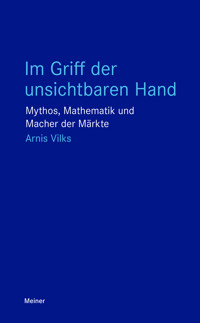
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Vor rund 250 Jahren erschien Adam Smith' »Wealth of Nations«. Eine seiner prägnantesten Thesen ist der Slogan von der »unsichtbaren Hand des Marktes«. Damit gemeint ist die Überzeugung, dass Wettbewerb und Märkte die Tendenz haben, die unzähligen individuellen wirtschaftlichen Entscheidungen, die täglich auf der Welt getroffen werden, in ein gesellschaftlich optimales Gleichgewicht zu bringen. Der Ökonom Arnis Vilks zeigt in seiner übersichtlichen Studie, wie Smith' These zum »harten Kern« eines Forschungsprogramms und etwa seit den 1970er Jahren zum herrschenden Paradigma der Volkswirtschaftslehre wurde, obwohl es immer auch andere, wohlbegründete konkurrierende Auffassungen gab. Nicht zuletzt die Vergabe von Nobelpreisen an prominente Propagandisten des neoliberalen Weltbilds sorgte dafür, dass die damit verbundenen ökonomischen Ideen in die Köpfe von Politikern einsickerten. Durch Deregulierung, Privatisierung und Steuersenkungen, von denen naturgemäß die bereits Vermögenden profitierten, wurden infolgedessen auch die Rolle und das wirtschaftliche Vermögen der staatlichen Institutionen zugunsten der Akkumulation und Konzentration privaten Vermögens reduziert. Der Neoliberalismus, dessen Genese im volkswirtschaftlichen Denken Vilks nachzeichnet, wirkte weit über »Thatcherismus« und »Reaganomics« hinaus – die Politik etwa eines Donald Trump oder eines Javier Milei zeigt, dass er bis heute zu radikalen Maßnahmen zu führen vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnis Vilks
Im Griff derunsichtbaren Hand
Mythos, Mathematik undMacher der Märkte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 〈https://portal.dnb.de〉 abrufbar.
ISBN 978-3-7873-5008-7
eBook (PDF) 978-3-7873-5009-4
eISBN 978-3-7873-5010-0
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Felix Meiner Verlag GmbH, Richardstraße 47, 22081 Hamburg
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2025. Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
Vorwort
1.Einleitung: Die allmähliche Verbreitung von Überzeugungen
2.Adam Smith: Der schottische Philosoph und seine Metapher
3.Ökonomie als Wissenschaft: Cournot und Walras
4.Vilfredo Pareto: Effizienz als gesellschaftliches Optimum
5.Die Chicago School: Knight, Stigler und Friedman
6.Ein alternatives Forschungsprogramm? Keynes und der Keynesianismus
7.Axiomatisierung eines Modells: Arrow und Debreu
8.Marktkräfte im Zeitablauf: Hahn, Hurwicz und Scarf
9.Gleichgewicht im Zeitablauf: Samuelson, Shell und Gale
10.Ein konkurrierendes Forschungsprogramm: von Neumann, Morgenstern und Nash
11.Liberalismus versus Pareto: Amartya Sen
12.Monopole, Wettbewerb, Staat und Macht
13.Academic Scribblers: Hayek und die Mont Pèlerin Society
14.Mad(wo)men in Authority: Von Thatcher und Reagan bis Trump und Milei
15.Im Griff der unsichtbaren Hand
16.Das Kapital im 21. Jahrhundert
17.Vermögenskonzentration: Zufall und Zwangsläufigkeit
18.Epilog
Anmerkungen
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Sach- und Personenregister
It is often difficult enough for the expert,and certainly in many instances impossible for the layman,to distinguish between legitimate and illegitimate claimsadvanced in the name of science.
Friedrich Hayek, Nobel Lecture 1974
… the reason that the hand may be invisibleis that it is simply not there – or at least thatif it is there, it is palsied.
Joseph Stiglitz, Nobel Lecture 2001
Vorwort
Als ich in den 1970er Jahren mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre begann, war die Auseinandersetzung zwischen Keynesianern und Monetaristen in vollem Gange. Die politische Färbung der wissenschaftlichen Positionen war unverkennbar und trübte allzu oft die Überzeugungskraft der Argumente, deren Logik ohnehin oft für den kritischen Studenten erkennbare Lücken aufwies. Gerard Debreus axiomatische Gleichgewichtstheorie kennenzulernen, kam für mich dann einer Offenbarung gleich – hier gab es kaum Lücken in der Logik, und wo es sie gab, wurde man auf sie hingewiesen. Debreu war freilich anspruchsvoll, man musste eine ordentliche Dosis Mathematik lernen, um seine Theorie gut verstehen zu können. Nicht alle Ökonomie-Professoren waren damals mit der nötigen Mathematik vertraut, aber oberflächliche Bezüge zur mathematischen Wirtschaftstheorie wurden dennoch häufig gern hergestellt.
Dass in den 1980er Jahren die »Effizienz der Marktwirtschaft« beschworen wurde, um Reformen à la Thatcher und Reagan zu motivieren, war offenkundig mehr als eine Oberflächlichkeit, aber die Erfolge der Privatwirtschaft in China und dann der Niedergang und die Auflösung des Sozialismus sowjetischen Stils in den 1990ern schien zu bestätigen, dass Wohlstand und Demokratie mit Freiheit und Wettbewerb eine Einheit bilden.
Seit den 2000ern jedoch wurde zunehmend offenkundig, dass zwei globale Probleme durch die sich selbst überlassenen Märkte nicht gelöst, sondern im Gegenteil verschärft werden: Zum einen der Klimawandel, der im Wesentlichen aus den Treibhausgasen resultiert, und zum anderen die zunehmende Konzentration von Vermögen und damit einhergehender Macht in den Händen weniger.
Da beide Probleme Wohlstand und Demokratie bedrohen, Wirtschaftstheorie seit langem aufzuklären vermag, dass beide durch »mehr Markt« nicht zu lösen sind, und dennoch die »neoliberale« Ideologie nach wie vor mehr Markt und weniger Staat predigt, entstand der Plan zu vorliegendem Büchlein. Er wäre aber vermutlich kaum rechtzeitig zum 250. Jahrestag von Adam Smiths Formel von der »unsichtbaren Hand« des Marktes realisiert worden, hätte ich nicht von Wolfgang Detel, bei dem ich vor vielen Jahren Wissenschaftstheorie studiert hatte, erfahren, dass er an einem ganz ähnlichen Essay arbeitet. Eine Zeit lang hegten wir die Absicht, unsere Pläne in einem gemeinsam verfassten Buch umzusetzen, aber Wissenschaftler stoßen allzu oft auf Meinungsverschiedenheiten, die sich allenfalls durch viel Zeit raubende Diskussionen ausräumen lassen, und so erscheinen jetzt fast zeitgleich im Meiner-Verlag das vorliegende Buch und ein in vielerlei Hinsicht dazu komplementäres von Wolfgang Detel, das weniger »theoretisch«, dafür aber stärker »politisch« ausgerichtet ist.1 Es sei dem Leser – je nach Neigung – als Ergänzung oder Alternative zum vorliegenden Text wärmstens empfohlen.
1.Einleitung
Die allmähliche Verbreitung von Überzeugungen
Vor 250 Jahren erschien Adam Smith’ Wealth of Nations, ein Buch, das als »der erste große Klassiker der Wirtschaftstheorie« bezeichnet worden ist.2 Während Schumpeter in seiner monumentalen History of Economic Analysis kritisch feststellt, dass
… the Wealth of Nations contained no really novel ideas and … cannot rank with Newton’s Principia or Darwin’s Origin of Species as an intellectual achievement,3
kann doch kein Zweifel an der historischen Bedeutung des Werkes bestehen. Wie im Falle Newtons und Darwins reicht sie weit über die Fachwissenschaft hinaus. Denn seit dem Erscheinen von Smith’ Hauptwerk im Jahr 1776 entstand nicht nur – allmählich – die akademische Disziplin der Volkswirtschaftslehre, sondern mit ihr verbreitete sich die Überzeugung, dass Wettbewerb und Märkte die Tendenz haben, die unzähligen individuellen wirtschaftlichen Entscheidungen, die täglich von Männern und Frauen auf der Welt getroffen werden, in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen, das die individuell getroffenen Entscheidungen miteinander verträglich macht und für die gesellschaftlich vernünftigste Allokation der Ressourcen sorgt. Es gibt heute kaum ein einführendes Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre, das nicht Smith’ Formel von der »unsichtbaren Hand« des Marktes erläutern würde, die zum Ausdruck bringen soll, dass individuelle Entscheidungen, die nur durch das Eigeninteresse der jeweiligen Individuen motiviert sind, sich letztlich als förderlich für die Gesellschaft erweisen. Nicht wenige Lehrbücher erläutern diese Formel nicht nur, sondern stellen sie dem Studenten der Wirtschaftswissenschaft als grundlegende Einsicht in die Funktionsweise einer Marktwirtschaft und in die gesellschaftlich segensreichen Auswirkungen individuellen Nutzen- und Gewinnstrebens dar. Nur exemplarisch sei hier aus der 10. Auflage eines Lehrbuchs für »Management Economics and Business Strategy« zitiert:
Smith is saying that by pursuing its self-interest – the goal of maximizing profits – a firm ultimately meets the needs of society … By moving scarce resources toward the production of goods most valued by society, the total welfare of society is improved. As Adam Smith first noted, this phenomenon is due not to benevolence on the part of the firms’ managers but to the self-interested goal of maximizing the firms’ profits.4
Ob nun Einsicht oder nicht, die Überzeugung, dass Wettbewerb auf freien Märkten individuelles Gewinnstreben und eigennützig verfolgte Ziele der Unternehmen und Haushalte in eine gesellschaftlich wünschenswerte Allokation der vorhandenen und produzierten Ressourcen überführt, ist hinreichend wirkmächtig geworden, so dass es sich lohnt, ihre Entstehungs- und Wirkungsgeschichte einer einigermaßen detaillierten Analyse zu unterziehen.
In gewisser Weise werden wir dabei eine ganz andersartige Überzeugung eines anderen bedeutenden Ökonomen bestätigt finden. John Maynard Keynes, zweifellos einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, schrieb am Ende seiner General Theory of Employment, Interest and Money die folgenden, höchst bemerkenswerten Sätze:
… the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Not, indeed, immediately, but after a certain interval; for in the field of economic and political philosophy there are not many who are influenced by new theories after they are twenty-five or thirty years of age, so that the ideas which civil servants and politicians and even agitators apply to current events are not likely to be the newest.5
Bezieht man Keynes’ Darstellung auf die Idee der »unsichtbaren Hand«, wird man allerdings feststellen müssen, dass Keynes die Zusammenhänge jedenfalls verkürzt: Ökonomen, die richtige Überzeugungen verbreiten, wird man kaum als »academic scribbler« bezeichnen wollen, und ebenso wenig Politiker, die sich von richtigen ökonomischen Überzeugungen leiten lassen, als »madmen«. Verkürzt ist Keynes’ Darstellung aber auch in einer anderen Hinsicht. Sind »academic scribbler« diejenigen Ökonomen, die wirtschaftswissenschaftliche Überzeugungen vereinfachend für ein breites, wissenschaftlich nicht sehr geschultes Publikum darstellen, so werden sie gewöhnlich auf Resultate gewissenhafter und umsichtiger Forschung zurückgreifen, die mit all ihren Voraussetzungen, Methoden und methodischen Limitationen nicht leicht zu verstehen sind. Die vereinfachende Darstellung komplizierter Zusammenhänge, die das Geschäft von Beratern und Wissenschaftspublizisten, aber auch von Lehrbuchautoren ist, steht naturgemäß vor der schwierigen Aufgabe, Dinge einfach zu erklären, ohne sie zu einfach erscheinen zu lassen. Heutige Politiker und Beamte, die häufig vor ihrem Berufseinstieg ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben, ohne sich allzu sehr der Wissenschaft zu widmen, die sich auch später von Beratern und Wissenschaftsjournalisten leiten lassen, werden in der Regel ihrerseits Zusammenhänge vereinfachen oder mitunter auch schlicht missverstehen. Und oft genug sind die Überzeugungen von Wissenschaftlern, und erst recht die von Beratern, Publizisten, Politikern und Beamten, ein Amalgam von aus der Wissenschaft stammenden Aussagen einerseits und aus anderen Quellen gewonnenen Ansichten andererseits.
Hinzu kommt, dass sich selbst innerhalb der akademischen Wirtschaftswissenschaft Spezialgebiete herausgebildet haben, deren Ergebnisse von den Experten auf anderen Spezialgebieten zur Kenntnis genommen und in der eigenen Forschung verwendet werden, ohne in jedem Falle – mit all ihren Voraussetzungen, Methoden und methodischen Limitationen – voll verstanden zu werden. Ebenso wie die heutige Physik einerseits hoch abstrakte, mathematisch anspruchsvolle und teils spekulative Spezialgebiete – etwa in der Teilchenphysik oder der Kosmologie – umfasst und andererseits sehr anwendungsnahe Bereiche, die man ebenso gut den Ingenieurswissenschaften zurechnen könnte, so gibt es auch in der heutigen Wirtschaftswissenschaft nicht sehr leicht zugängliche Spezialgebiete wie die mathematische Wirtschaftstheorie, Spieltheorie oder Ökonometrie einerseits und sehr anwendungsnahe wirtschaftspolitische Analysen andererseits. Die allmähliche Verbreitung ökonomischer Ideen, die Diffusion dessen, was in der mathematischen Wirtschaftstheorie erforscht worden ist, in die Köpfe und Handlungen von Politikern hinein, ist daher ein vielstufiger Prozess, um dessen Erhellung wir uns im Folgenden bemühen wollen.
Dabei wird sich herausstellen, dass die These von der unsichtbaren Hand des Marktes zum »harten Kern« eines ganzen Forschungsprogramms wurde, das die Volkswirtschaftslehre über lange Zeit beschäftigte und etwa seit den 1970er Jahren wieder so etwas wie das »herrschende Paradigma« wurde. Thomas Kuhn6 und Imre Lakatos7 haben mit den Begriffen »Paradigma« bzw. »hard core« Aussagen einer Wissenschaft bezeichnet, die über mitunter lange Zeiträume hinweg von den Angehörigen der jeweiligen »scientific community« als mehr oder weniger stillschweigend akzeptierte Grundannahmen behandelt werden, im Lichte derer empirische Befunde systematisiert und Forschungsfragen entwickelt werden, die aber selbst keiner ernsthaften Überprüfung unterworfen werden. Solche Grundannahmen werden den Studierenden durch Lehrbücher oder vorbildliche wissenschaftliche Leistungen schon während des Studiums nahegebracht und ihnen widersprechende Empirie wird als »nur scheinbar« widersprechend in das Weltbild der Wissenschaft eingebaut oder als weniger wichtiger Sonderfall bzw. »Anomalie« – zumindest vorläufig – beiseitegeschoben. Für die Wirtschaftswissenschaft werden wir sehen, dass sich durchaus mit der »unsichtbaren Hand« konkurrierende Forschungsprogramme identifizieren lassen, die nicht nur von kleinen Zirkeln »heterodoxer« Wissenschaftler vertreten werden, dass aber – nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen Verzögerung, mit der wissenschaftliche Einsichten außerhalb der Fachwissenschaft zur Kenntnis genommen werden – weite Teile der wirtschaftlichen Welt nach wie vor »im Griff der unsichtbaren Hand« sind.
Es wird sich herausstellen, dass man einerseits eine relativ schlichte Einsicht als »wahren Kern« der Smith’schen These ansehen kann, dass aber andererseits eine überspitzte Lesart, die eigentlich schon seit geraumer Zeit nicht mehr als wissenschaftlich haltbar gelten kann, politisch höchst wirkungsmächtig wurde. Die politische Strömung, von der hier die Rede ist, wird häufig als »Neoliberalismus« bezeichnet und namentlich mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan verbunden, aber sie wirkte weit über »Thatcherismus« und »Reaganomics« hinaus, und die Politik etwa eines Donald Trump oder eines Javier Milei zeigt, dass sie bis heute zu radikalen Maßnahmen zu führen vermag.
2.Adam Smith
Der schottische Philosoph und seine Metapher
Adam Smith (1723–1790) wurde 1751 zum Professor für Logik und Rhetorik an der Universität von Glasgow berufen und wenig später zum Professor für Moralphilosophie. Als solcher genoss er unter seinen Zeitgenossen hohes Ansehen, veröffentliche aber erst 1759, also im Alter von 36, sein erstes Buch, The Theory of Moral Sentiments, das von seinen damaligen Lesern gut aufgenommen wurde. Im Lichte der Wealth of Nations gelesen, wird es von seinen Bewunderern auch heute noch als bedeutendes Werk der Moralphilosophie angesehen, aber es ist schwer zu beurteilen, ob es außerhalb der Philosophiegeschichte noch Beachtung finden würde, hätte Smith nicht 18 Jahre später die Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations veröffentlicht, wie er sein Hauptwerk mit vollem Titel nannte.
Ob nun bedeutende Moralphilosophie oder nicht, bereits in seinem ersten Buch findet sich die Wendung von der »unsichtbaren Hand«. Smith verwendet sie, um darzulegen, dass der selbstsüchtige Grundbesitzer, der keinen Gedanken an das Wohlergehen seiner Landarbeiter verschwendet, doch, indem er sie beschäftigt und entlohnt, das Produkt seines Grundbesitzes mit seinen Arbeitern teilt.
The produce of the soil maintains at all times nearly that number of inhabitants which it is capable of maintaining. The rich only select from the heap what is most precious and agreeable. They consume little more than the poor; and in spite of their natural selfishness and rapacity, … , though the sole end which they propose from the labours of all the thousands whom they employ be the gratification of their own vain and insatiable desires, they divide with the poor the produce of all their improvements. They are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life which would have been made had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants; and thus, without intending it, without knowing it, advance the interest of the society … When providence divided the earth among a few lordly masters, it neither forgot nor abandoned those who seemed to have been left out in the partition. These last, too, enjoy their share of all that it produces.8
Nicht von ungefähr ist hier von der Vorsehung die Rede, die auch für diejenigen gesorgt habe, die nicht zu den wenigen begüterten »lordly masters« gehören. Wenngleich man in der Literatur unterschiedliche Auffassungen über die Religiosität von Adam Smith findet,9 so kann doch kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Smith die von ihm in Natur und Gesellschaft gesehene Harmonie letztlich auf einen – wie auch immer konzipierten – Schöpfer zurückgeführt hat. Jedenfalls findet sich in seinem Werk immer wieder eine Argumentationsfigur, die darauf abstellt, dass sich das Ergebnis der menschlichen Handlungen als im »Interesse der Gesellschaft« herausstellt, obwohl die Handelnden keineswegs in einem solchen gesellschaftliche Interesse zu handeln beabsichtigen.
So liest sich auch die Stelle in Smith’ Wealth of Nations, an der sich seine berühmt gewordene Metapher wiederfindet, folgendermaßen:
As every individual … endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can, he generally … neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.10
Das Argument ist hier offenbar sehr schlicht: Indem jedes Individuum den Wert seines Produkts zu steigern versucht, versucht es auch, den Wert des Sozialprodukts zu steigern – ohne freilich am Sozialprodukt als solchem interessiert zu sein. Die – für den Mathematiker naheliegende – Frage, ob nicht das Bemühen des einen Individuums die Erfolgsaussichten anderer beeinträchtigen könnte, wird von Smith freilich nicht gestellt.
Auch wenn sich der Ausdruck »invisible hand« nur dies eine Mal in Smith’ Hauptwerk findet, zieht sich seine Überzeugung, dass Eigennutz die Individuen zu Verhalten motiviert, das nützlich für »die Gesellschaft« ist – gemeint ist dabei stets die Gesellschaft der Nation – durch das gesamte Werk. Ein anderes, dafür häufig als Beleg angeführtes Zitat ist das folgende:
… man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and show them that it is to their own advantage to do for him what he requires of them. Whoever offers a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer. … It is not out of the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.11
Hier wird in der Tat eine Einsicht formuliert, die der liberalen Forderung nach Vertragsfreiheit zugrunde liegt: Beiderseits freiwilliger Tausch von Leistung und Gegenleistung ist – jedenfalls kurzfristig und aus der Sicht beider Vertragsparteien – von Vorteil für beide. Freilich ist die Einschränkung nicht ganz unwesentlich: Mitunter stellt sich nach der Transaktion heraus, dass die Leistung nicht die Qualität aufweist, die sie zum Zeitpunkt der Transaktion zu haben schien, und mitunter erweist sie sich langfristig sogar als schädlich.
Für das Zustandekommen eines Tauschgeschäfts weniger entscheidend als der beiderseitige Vorteil ist die Motivation der Beteiligten, für die Smith Eigennutz annimmt. Man kann durchaus argumentieren, dass derjenige, der nicht aus Eigennutz Bäcker wird, sondern Brot backt, damit seine Mitmenschen etwas zu essen bekommen, in der Regel von seinen Kunden dafür entlohnt werden wird. »Customer orientation« ist eine in der Management-Literatur wohlbekannte Maxime, die nicht den »Eigennutz« des Unternehmens, sondern die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt der Unternehmensführung rückt.12 Selbst wenn der Bäcker und Fleischer vorrangig am eigenen Einkommen interessiert ist, wird er gut daran tun, auch die Bedürfnisse seiner Kunden zu berücksichtigen.13
Der von Smith formulierten Einsicht, dass freiwilliger Tausch prima facie zum beiderseitigen Vorteil sein muss, steht zunächst gar nicht entgegen, dass ein solcher Tausch von Ware gegen Geld nicht unbedingt als fair empfunden werden muss. Wer dem Verdurstenden Wasser anbietet, kann dafür unter Umständen einen Wucherpreis verlangen. Nicht von Ungefähr kann – jedenfalls nach deutschem Recht – ein scheinbar beiderseits »freiwilliges« Rechtsgeschäft nichtig sein, wenn es unter Ausnutzung einer Zwangslage zustande kommt.
Wann eine Zwangslage vorliegt, wird in weniger extremen Fällen, in denen es nicht gerade um Leben und Tod geht, nicht immer leicht zu entscheiden sein. Allerdings ist nicht jeder Preis eines Monopolunternehmens auch schon ein Wucherpreis. Adam Smith, für den Monopole stets auf einem Privileg beruhen, das durch den Souverän gewährt wird, bemerkt, dass der Preis eines Monopolunternehmens stets höher sein wird als der »natürliche« Preis, gegen den der sich bei freiem Wettbewerb ergebende Marktpreis tendieren würde,14 und spricht sich für eine Beseitigung aller »Begünstigungen und Einschränkungen« durch den Staat aus, da sich so ein System natürlicher Freiheit ergeben würde:
All systems either of preference or of restraint … being … completely taken away, the obvious and simple system of natural liberty establishes itself of its own accord. Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly free to pursue his own interest his own way, and to bring both his industry and capital into competition with those of any other man …15
Der Souverän – im Großbritannien des 18. Jahrhunderts der Monarch in Verbindung mit dem Parlament – sollte also einen möglichst ungehinderten Wettbewerb garantieren, indem er seinen Bürgern möglichst weitgehende Freiheiten lässt. Wenngleich sich die Wendung »laissez faire«16 bei Smith nicht findet, sind doch seine Vorstellungen von »natural liberty« nicht ganz zu Unrecht damit verbunden worden. Allerdings war Smith weit davon entfernt, einem »Anarcho-Kapitalismus« das Wort zu reden. Die Aufgaben, die der Staat zu erfüllen habe, werden von ihm aufgelistet:
According to the system of natural liberty, the sovereign has only three duties to attend to; … first, the duty of protecting the society from the violence and invasion of other independent societies; secondly, the duty of protecting, as far as possible, every member of the society from the injustice or oppression of every other member of it, or the duty of establishing an exact administration of justice; and, thirdly, the duty of erecting and maintaining certain public works and certain public institutions, which it can never be for the interest of any individual, or small number of individuals, to erect and maintain; because the profit could never repay the expence to any individual or small number of individuals, though it may frequently do much more than repay it to a great society.17
Ebenso wie dann im 20. Jahrhundert bei den »Neoliberalen« Milton Friedman und Friedrich Hayek sind für Smith also Landesverteidigung, Polizei und Rechtswesen sowie die Bereitstellung öffentlicher Güter durchaus legitime Aufgaben des Staates – aber es sind auch die einzigen Aufgaben, die der Staat zu erfüllen hat. Die Finanzierung dieser Staatsaufgaben ist nach Smith durch eine proportionale Einkommensteuer sicherzustellen.
Im Lichte der Wirtschaftstheorie von anderthalb Jahrhunderten auf die Wealth of Nations zurückblickend, empfand Schumpeter das Werk als nicht sonderlich tief. In seiner History of Economic Analysis schreibt er über Smith:
… he disliked whatever went beyond plain common sense. He never moved above the heads of even the dullest readers. He led them on gently, encouraging them by trivialities and homely observations, making them feel comfortable all along.18
Schumpeter würdigt freilich das von Smith geleistete Zusammentragen und Systematisieren des zu seiner Zeit vorhandenen Materials und führt seinen unbestreitbaren Erfolg gerade auf die Leichtgängigkeit seiner Argumentation zurück. Wie auch immer man Originalität und Tiefe der Wealth of Nations beurteilen mag – keinem Zweifel kann unterliegen, dass Smiths Werk enormen Einfluss auf die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre gehabt hat. Und obwohl es gänzlich unmathematisch ist und ein halbes Jahrhundert vergehen musste, bis die Mathematik in die Wirtschaftstheorie Einzug hielt, werden wir sehen, dass es einen eigentümlichen Einfluss auch auf die mathematische Wirtschaftstheorie entfaltete.
3.Ökonomie als Wissenschaft
Cournot und Walras
Es war vermutlich der französische Mathematiker Antoine Augustin Cournot (1801–1877), der als Erster die Annahme verwendete, dass sich die Nachfrage nach einem Gut als Funktion seines Preises darstellen lässt. Von dieser Annahme ausgehend, formulierte er in seinen 1838 erschienenen Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses das Modell eines Monopolmarktes und der Preisbildung im Monopol, das bis heute als grundlegend für die Analyse derartiger Märkte gilt. Ebenso formulierte er das erste, später dann nach ihm benannte Modell eines Oligopolmarktes, dessen Lösung das erst 1950 von John Nash definierte Gleichgewichtskonzept vorwegnimmt.
In beiden Modellen wird die mengenmäßige Nachfrage N nach einem Gut als Funktion seines Preises p ausgedrückt: N=F(p). Die Annahme, dass die Nachfrage mit steigendem Preis abnimmt, lautet dann, dass die Ableitung der Funktion F kleiner als 0 ist: F′





























