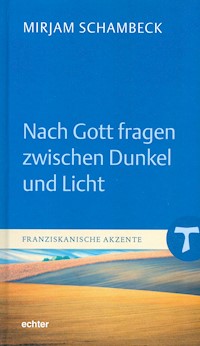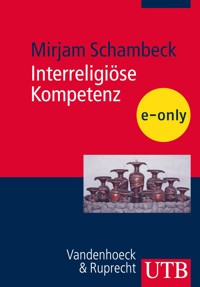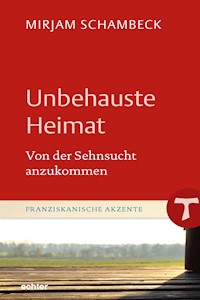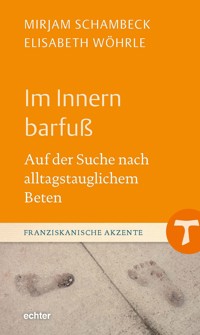
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Franziskanische Akzente
- Sprache: Deutsch
Beten kann man nur "barfüßig" – also ohne etwas, was man sonst gerne zwischen sich, die anderen und Gott schiebt. Beten ist der tägliche und andauernde Versuch, immer durchlässiger zu werden für das Eigentliche, die Menschen und Gott. Wie aber geht das? Was ist überhaupt Beten? Erschöpft es sich im Reden mit etwas Größerem, mit Gott? Was hat Beten mit mir zu tun und meinem Alltag? Inspiriert durch Gedichte und Texte von (Gott-)Sucherinnen und -Suchern geht das Buch diesen Fragen nach und lädt dazu ein, entlang der franziskanischen Spiritualität alltagstauglich beten zu lernen, "barfüßig" eben, oder mit den Worten von Joachim Ringelnatz: "die Schuhe, die blind machen, auszuziehen und den Weg mit den Zehen zu sehen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mirjam Schambeck / Elisabeth Wöhrle
Im Innern barfuß
Auf der Suche nach alltagstauglichem Beten
Franziskanische Akzente
herausgegeben von Mirjam Schambeck sf und Helmut Schlegel ofm
Band 25
MIRJAM SCHAMBECK/ ELISABETH WÖHRLE
Im Innern barfuß
AUF DER SUCHE NACH ALLTAGSTAUGLICHEM BETEN
echter
Herzlicher Dank geht an Eva Kasper für die sorgfältige Zuarbeit bei den Korrekturen sowie an die Provinz Sankt Elisabeth der Franziskaner-Minoriten, OFM Conv. in Deutschland für die finanzielle Unterstützung.
Wir widmen dieses Buch allen, die immer wieder dienstags mit uns meditieren, die die Gottesfrage nicht beruhigen wollen und aufstehen für eine bessere Welt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abruf bar.
1. Auflage 2020
© 2020 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: wunderlichundweigand.de
Satz: Crossmediabureau, Gerolzhofen
Umschlagfoto sowie Fotos zu den Kapiteln: © Elisabeth Wöhrle sf
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN
978-3-429-05483-0
Inhalt
1. Im Innern barfuß
2. Beten – ein Panorama von Fragen, Hoffnungen und Ermutigungen zum Leben
„Hier bin ich mit meiner Sprachlosigkeit“ – Beten ist mehr als Reden
„Niemals können wir sagen: dort nicht!“ – Beten ist mehr als Liturgie
Vom Stille-Werden in Gott – Beten ist Lauschen
Mitten in meinem Gedankenwirrwarr – Beten mit allen Sinnen und in allen Situationen
Basisweisen des Betens – Intellekt, Bauchgefühl und Körperlichkeit
Genügt dir ein Röcheln? – In Glück und Gebrochenheiten nach Gott tasten
„Nun sind wir vollgebetet“ – Vom Klagen, Danken, Bitten und Jubeln
„Die Hände sind zu kurz, um dein Herz zu fassen“ – Von der Not und dem Segen des (Bitt-)Gebets
Geschmacklose Zeiten – Von der Leere im Gebet
Das Vielerlei macht leer
Die Langeweile – eine Markierung für Übergänge und Neuanfänge
Geschmacklosigkeit – Anzeichen für einbetonierte Gespenster
Beten muss mitwachsen – biographische Phasen beim Beten
Alltagstaugliches Beten
Mitten in den Banalitäten des Lebens
Beten muss zum Alltag passen
Beten macht den Alltag tauglich
Um sich verständlich zu machen, lernt Gott Ägyptisch
3. Biblische Splitter, franziskanisch gespiegelt: Gott sucht den Menschen
Gib mir ein hörendes Herz (1 Kön 3,9) – Von der Unruhe und der Sehnsucht des Herzens
Wo du stehst, ist heiliger Boden (Ex 3,1–17) – Die Schuhe des „Daran-gewöhnt-Habens“ ausziehen
Zwischen Zeigen und Verbergen (Ex 33) – Den Rücken darfst du sehen
Actio oder Contemplatio (Lk 10,38–42)? – Von falschen Alternativen und der Tür zum Du
Der heruntergekommene Gott – Deus semper minor
Die Liebe ist alles – das große „Du-Gebet“ des Franziskus
4. Alltagstaugliches Beten – Gebet praktisch
Atmen ist mein Beten – auch für Religionsdistanzierte gedacht
Den Alltag beten – Strukturen, Orte, Zeiten
Aufrecht beten – Aufrichtig leben
Jetzt, jetzt, jetzt – Das Herzensgebet
Die Welt von innen her hören – Meditieren
Gebet der liebenden Aufmerksamkeit auf Franziskanisch
Gehen – Von Übungsformaten für das Aufbrechen
Anstelle eines Schlusses: Ungebet
Anmerkungen
Zum Weiterlesen
Abkürzungsverzeichnis
1. Im Innern barfuß
Das Coverbild verwundert. Wie kann es sein, dass im harten Betonboden Fußspuren zu finden sind, noch dazu barfüßige? Ist es überhaupt möglich, dass so weiche Formen einen so harten Untergrund verändern? Natürlich ist jedem, der schon einmal Beton gegossen oder dabei zugesehen hat, klar, dass hier Menschen über den Beton gelaufen sind, noch bevor er trocken war. Die Fußabdrücke sind geblieben, der Boden in den Augen von Bauarbeitern vielleicht nicht perfekt, aber eben einzigartig geworden.
Uns schien dieses Foto der barfüßigen Füße im Beton ein gutes Bild zu sein, ein Buch über das Gebet einzuleiten. Im Gebet wird man offen, auch verwundbar, lässt sich prägen. Das Gebet macht aufmerksam für das, was sich in mir tut, um mich herum, meine Welt und Gott. Beten kann man eigentlich nur „barfüßig“ – also ohne Schuhe und Mauern, die man sonst vielleicht dazwischengeschoben hat: zwischen sich und die anderen, zwischen sich und Gott, zwischen die, die ich im Innersten bin, und die Funktionsweisen, in denen mich andere kennen und die mich trotzdem nicht ganz ausmachen. Im Grunde könnte man das Beten auch als täglichen und andauernden Versuch beschreiben, immer durchlässiger zu werden auf das Eigentliche und den Eigentlichen, auf das Wirkliche und den Wirklichen, auf die Menschen und Gott hin. Von daher wundert es nicht, dass die Sehnsucht nach religiösen Erfahrungen umtreibt und wir Menschen in unserem Innersten danach tasten, von Gott gefunden zu werden.
Dass dieser barfüßige Boden in Tabgha zu finden ist, war für uns ein zusätzliches Motiv. Tabgha liegt am See Gennesaret und ist der Ort, an dem die biblische Brotvermehrung verortet wird. Schon im 5. Jahrhundert wurde dort eine Kirche errichtet, die durch ihre einzigartigen Fußbodenmosaike noch heute Besucher*innen fasziniert – ergänzt nun eben durch diese, von barfüßigen Füßen signierte Bodenplatte. Der Ort der Brotvermehrung (vgl. Mk 6,35–44 par.) passt gut zu dem, was Gebet sein kann. Die Brotvermehrungserzählung beginnt mit dem Hunger der Leute. Es ist Abend, ein langer Tag liegt hinter allen und es ist Zeit zu essen. Aber da gibt es nichts. Jesus ist mit den Jüngern an einen abgelegenen Ort gefahren, die Menschen sind ihm nachgelaufen, und zwar zu Tausenden, wie es bei Markus heißt, aber was nun? Hier gibt es nichts zu kaufen und der Hunger drängt. Die Jünger wollen die Leute wegschicken. Die Strategie, Probleme loszuwerden, indem man die Dinge nicht an sich heranlässt, ist also keine bloß heutige. Jesus aber gibt sich nicht damit zufrieden. „Gebt ihr ihnen zu essen“, fordert er sie auf (Mk 6,37), und als die Jünger abwehren, weil sie dafür ein Jahresgehalt ausgeben müssten (200 Denare eben), lässt Jesus dennoch nicht locker und fordert sie auf nachzusehen, was sie selbst haben. Es ist nicht viel – fünf Brote und zwei Fische –, und dennoch passiert das Unfassbare: Jesus spricht das Dankgebet, und alle teilen, werden satt, und es ist so viel übrig geblieben, dass zwölf Körbe voll geworden sind (Mk 6,43).
Uns rührt dieses Bild der Brotvermehrung an: Den Hunger nach dem, was das Gebet meint, kennen wir auch. Auch für viele junge Menschen gehört das Gebet zum Alltag. Eine der jüngsten Jugendstudien hält fest, dass drei Viertel der befragten Jugendlichen das Gebet zumindest manchmal, oftmals auch regelmäßig praktizieren und das Gebet selbstverständlich zu ihrem Leben gehört.1 Vielfach sind es Krisen, die zu beten geben und nach jemandem fragen lassen, der größer ist als ich selbst. Aber auch sich zu freuen und für Geglücktes und Schönes Danke zu sagen sind laut besagter Jugendstudie Anlass für junge Menschen zu beten.
Und dann kommt die große Frage: Wo kann ich meinen Hunger stillen – oder gewendet auf das Gebet: Wie geht Beten? Was ist es überhaupt? Erschöpft es sich im Reden mit etwas Größerem, mit Gott? Ist Beten identisch mit Liturgie, also damit, rituelle Gebete zu vollziehen, an der Eucharistiefeier teilzunehmen oder an gemeinsamen Gebetszeiten? Ist Beten etwas, das man in der Kirche macht – also einem eigens dafür vorgesehenen Ort und einer speziell reservierten Zeit? Was hat Beten mit mir zu tun? Ist es alltagstauglich – also so, dass es in meinem Alltag wurzelt, meine erlebten Banalitäten Thema des Gebets sind und meinen Alltag in Gott hineinhebt? Macht Beten Gott auffindbar auch in den Unwichtigkeiten meines Lebens?
Die Brotvermehrungserzählung war uns Anstoß, die Menschen, die mit uns meditieren, jede Woche neu, mit diesen Fragen nicht einfach wegzuschicken. Seht ihr doch nach, was ihr habt. Zugegeben, auch die folgende Erfahrung teilen wir mit den Jünger*innen der Brotvermehrungserzählung: Es ist viel zu wenig, was wir zu bieten haben, es reicht nicht, deshalb ist es wohl besser, die Leute zu beredteren Meister*innen zu schicken, so dachten wir. Nun aber haben wir es gewagt, ein Buch zu schreiben, wie Beten aus unserer Sicht gehen kann: barfüßig nur – und damit sehr unmittelbar mit dem Boden verbunden, also der Welt, die unseren Alltag ausmacht. Barfüßig, das heißt für uns auch: durchlässig für den Boden, auf dem wir stehen, die Welt, die uns umgibt, vielleicht so, wie Hilde Domin (1909–2006) dies auf ihre feinsinnige Art formuliert:
Wir müssen dünne Sohlen tragen
oder barfuß gehen.
Was wir berühren,
mit leichtem Finger berühren,
mit wachen Fingerspitzen.
Nichts achtlos.2
Und schließlich ist für uns das Bild, „im Innern barfüßig“ zu werden, auch eine Einladung, gerade angesichts der erschreckenden Erkenntnisse über den Klimawandel und der erforderlichen Schritte für eine gesunde Schöpfung, anzufangen, Gewohntes abzulegen und einfacher zu leben – barfüßig eben. Das ist sicher ein Risiko und in politischen Debatten eher belanglos oder gefürchtet. Für uns ist das barfüßige Herz aber ein starkes Bild, Sicherheiten abzulegen, der Verletzlichkeit zu trauen, mit dem Teilen zu beginnen und gerade darin offen zu werden für Gott, der alles Leben hält und erhält.
Dass unsere Erfahrungen mit dem Beten auch andere sattmachen, haben nicht wir zu entscheiden. Aber es sei diesem Buch als Wunsch mitgegeben, dem eigenen Hunger nach Glück und nach Leben viel zuzutrauen. Er ist eine gute Spur, Gott mitten in unseren meist unwichtigen Alltäglichkeiten zu entdecken, die aber doch unser Leben ausmachen. Immer durchlässiger auf Gott hin, im Innern eben barfüßig zu werden, ist für uns insofern eine Grundbeschreibung des Gebets, die wir im folgenden Buch entfalten wollen.
Angeregt durch die franziskanische Spiritualität, inspiriert durch Texte und Gedichte von Gottsucher*innen, die sich so verstehen, und Dichter*innen, die sich selbst wohl kaum als religiös bezeichnen würden, aber Texte geschrieben haben, die oft besser als herkömmliche Gebetstexte unsere tiefen Fragen ausloten, geht der Band der Frage nach, was Beten ist und wie Beten alltagstauglich geht. Dazu spannen wir im zweiten Kapitel ein Panorama auf, das den weiten Horizont des Gebets skizziert. Sosehr das Gebet nämlich gesucht, praktiziert, beiseitegelassen wird oder leer bleibt, so sehr erinnert es an die Grundfragen, die uns Menschen umtreiben: Woher komme ich? Was gibt meinem Leben Sinn? Wo finde ich Glück? Wohin gehe ich?
Im dritten Kapitel werden entlang von biblischen Erfahrungen, die auch Franziskus (1182–1226) und Klara (1193–1253) wichtig waren, Verdichtungen aufgespürt, was Beten ist und wozu, biblisch gesehen, das Gebet anstiftet. Das vierte Kapitel stellt ganz praktisch Gebetsweisen vor, die wir als alltagstauglich empfinden und von denen wir hoffen, dass sie Menschen in ihrem Alltag bewegen, auf ganz persönliche, je ihre Weise nach Gott zu fragen und von ihm gefunden zu werden.
2. Beten – ein Panorama von Fragen, Hoffnungen und Ermutigungen zum Leben
Beten wirft ein ganzes Panorama von Fragen, Hoffnungen und von Ermutigungen zum Leben auf. Beten reicht tief in unser Menschsein hinein und ist gerade deshalb so unbeschreiblich und doch so naheliegend. Es fordert uns heraus, weil es uns vor Augen führt, dass wir nicht in dem aufgehen, was wir in Händen halten. Beten ist wie ein Brennglas, in dem die Frage nach dem Menschen und nach Gott ineinandergehen. Wer vom Beten spricht, redet deshalb vom Menschen und von Gott und davon, wie geglücktes Menschsein möglich und erlittenes Leben bewältigbar ist. Einige Aspekte dieses weiten Panoramas wollen wir im Folgenden beleuchten.
„Hier bin ich mit meiner Sprachlosigkeit“ – Beten ist mehr als Reden
Für nicht wenige Menschen bedeutet beten, Texte zu sprechen – alte oder neue, vorformulierte oder eigene. Beten wird gleichgesetzt mit dem Reden mit Gott. Das stimmt, ist aber zu wenig. Beten ist nämlich mehr als Reden. Auch wenn Beten – wie das Reden – Ausdruck ist, nicht nur bei mir zu bleiben, sondern mich dem anderen zuzuwenden, ist das Reden nur eine von vielen unterschiedlichen Weisen, mit dem anderen und auch mit Gott in Beziehung zu treten. Manchmal zeigt die Erfahrung sogar, dass Worte eher den Weg zu dem verstellen, was ich sagen will, oder dem anderen so unverständlich und fremd bleiben, dass er nichts versteht. Ein berechtigter Vorwurf gegen tradierte Gebete lautet deshalb, dass sie in einer Sprache daherkommen, die hohl und leer ist und kaum mehr zu transportieren vermag, dass es um mich, wie ich hier bin, meine Welt und Gott geht.
Gerade liturgisches Beten dreht sich zu oft um die Vorstellung, „Gott die Ehre“ zu geben, ihm „makellose Opfergaben“ zu bringen oder aus der Errettung „vom ewigen Verderben“ zu bitten (Erstes Hochgebet). Sosehr dieses Sprechen in einem bestimmten Kontext Menschen geholfen hat, ihre Situation vor Gott zu bringen, und paradoxerweise in bestimmten sog. Neuen geistlichen Bewegungen gerade wieder re-aktiviert wird, so wirken diese Worte heute dennoch wie aus der Zeit gefallen. Wer spricht in seinem Alltag von Ehre, und ist Ehre eine gute Terminologie, um die Beziehung von Gott und Mensch auszudrücken? Wird damit nicht einer Gottesvorstellung zugearbeitet, die Gott in weite und unerreichbare Himmel rückt und ihn zum Unnahbaren degradiert? Sind die herrscherlichen Bilder des Königs, Triumphators und Weltenherrn für Menschen, die in Demokratien groß geworden sind, gute Formulierungen, um Gott anzureden? Wird das Verhältnis von Gott und Menschen in einer solchen Rede nicht zu sehr wie ein mittelalterliches Lehensverhältnis bestimmt, in dem der Mensch Gott einen genau definierten Anteil zuzuteilen hat, um den geschlossenen Vertrag aufrechtzuerhalten?
Studiert man die biblischen Texte, wird schnell deutlich, dass es bei Gott nicht um Ehre und ihr Gegenspiel die Scham, sondern um Würde geht. Würde aber kommt jedem Menschen zu und kann nicht erwirtschaftet, zugeteilt oder vorenthalten werden. Gebete aber, die sich immer noch dieser überkommenen Denkweisen bedienen, setzen damit auch falsche Spuren. Kein Wunder, dass so gefeierte Liturgien wie museale Inszenierungen aus einer fremden Welt anmuten, nicht aber als lebendiger und lebensstiftender Ort.
Um wie viel besser tun da Gebete, denen selbst die Steine und der Wind gut genug sind, um Gott zu suchen, und die uns begreifen machen, dass es letztlich Gott ist, der schon lange nach uns fragt:
Wer Gott sucht
dem wird alles
zur Suche:
die Steine
der Wind
die Schatten
die Tiere
Manche sagen
sie hätten IHN
schon gefunden
aber meist ist ER
dann eine Erfindung
ein leeres Versprechen
Es bleibt uns zu warten
bis wir den Ruf hören
Mensch
wo bist du?
(Wilhelm Bruners)3