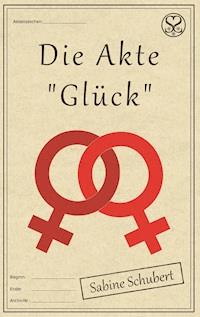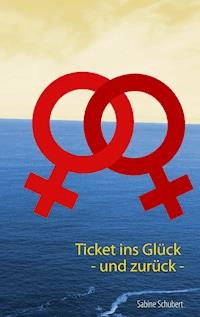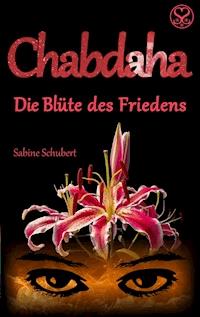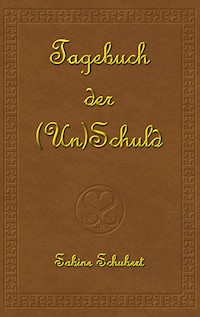Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Starrköpfig nennen einige die 16-jährige Lilian Anderson. Ihr freier Wille war ihr schon immer sehr wichtig. Sie entscheidet selbst, mit wem sie reden möchte, wen sie mag und wem sie vertraut. Aber wem soll sie noch vertrauen, wenn sie selbst von ihren Eltern belogen wird? Als dann auch noch eine geheimnisvolle Schatzkarte und ein sich selbstfüllendes Buch hinzukommen, muss sie einsehen, dass der Unterricht im Fach „Alternative Geschichte“ keine Märchenstunde ist. Ihr starker Wille und die Freundschaft im Kreis der 20 ist das einzige, das die Welt des Übernatürlichen vom feindseligen Regime des Rates befreien kann. An der Seite ihres Bruders muss sie die Schwesternschaft der Hexen und die Bruderschaft der Vampire davon abhalten, sich in edlen Motiven gegenseitig abzuschlachten. Wird sie den Sieg für die Freiheit und die Liebe finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abschied
Der Störenfried
Der Feind
Die Kontrolle zurück
Mabon
Familiengeschichten
Die Mission
Angriff
Es brodelt!
Kasimir
Überraschungen
Der Rat der Sieben
Impressum
Abschied
Mit Sechzehn war mein Leben noch völlig normal. Ich wohnte mit meinen Eltern und meinem großen Bruder in einem eigenen Häuschen, unser Garten wurde von einem weißen Gartenzaun umrandet und ich zoffte mich ständig mit meinen Eltern wegen Taschengeld, Schule, Ausgehzeiten und Klamotten. Ich ging gerade mit Marc, einem Jungen aus der Klassenstufe über mir. Seit einer Woche waren wir über das Stadium Händchenhalten hinaus und knutschten in jeder freien Minute. Meine Eltern hatten das spitzgekriegt und wollten mich aufklären. Bisher war ich ihnen entkommen, doch irgendwann würden sie es schaffen. Mir graute jetzt schon davor.
Meine beste Freundin hieß Caroline, ging mit einem Teamkollegen von Marc und traf sich ständig mit mir und Marc am Strand. Alles ganz normal für Sechzehnjährige, oder?
Das Schuljahr ging langsam zu Ende. Der Sommer war schon eingezogen und verlängerte gefühlsmäßig jede einzelne Unterrichtsstunde. Es war heiß und trocken und wir wollten alle an den Strand und nicht in diesem mit typischem Teenagergeruch gefüllten Raum hocken und irgendwas über den Aufbau von Pflanzenzellen hören. Ich wusste nicht mal, um welche Pflanze es ging. Am Ende war es auch nicht wichtig. Polly schrieb das Geschwafel mit und ich würde abschreiben, was ich verpasst hatte. Gedeckt durch meine Stiftemappe schrieb ich SMS mit Marc und ließ Caro neben mir mitlesen, die wiederum mit Steve schrieb, der drei Räume weiter neben Marc saß.
Vor uns saß Miranda. Sie war in drei Worten zu beschreiben: Minirock, Schminke, blond. Das war eine Umschreibung ihres Äußeren und ihres Inneren. Man könnte es auch auf zwei Worte reduzieren: hirnlose Schlampe. Ich kannte nicht einen bestätigten Fall eines Jungen unserer Schule, mit dem sie noch nicht in die Kiste springen wollte. Das hatte ihr einen gewissen Ruf verschafft.
Sie reckte den Arm in die Höhe und beugte sich dabei so weit vor, dass ihre Brüste auf der Bank lagen. Das war gewollt. Der Ausschnitt war so tief, dass unser Lehrer puterrot anlief.
„Ja, Miranda?“ stotterte er und sah besonders schnell wieder weg. Er blätterte in seinen Aufzeichnungen, nur um sie nicht direkt ansehen zu müssen. Es war einfach peinlich. Die normale, weitverbreitete Moralvorstellung lautet doch, dass man niemanden nackt ansieht, mit dem man nicht zufällig verwandt oder liiert ist. Ich wollte Mister Cosloff auch nicht nackt sehen. Wenn man Miranda ansah, kam immer dieses Schamgefühl auf, man hätte jemanden beim Umziehen erwischt. Mister Cosloff gehörte zu denen, die rot wurden, anfingen zu schwitzen und zu stottern. Witzig genug, um die Schüler zum lachen zu bringen.
„Mister Cosloff.“ sagte Miranda mit eindeutig unpassendem Blick. „Wie heißt das unter Drittens?“
Er drehte sich um zur Tafel und sah noch mal nach. Es war einwandfrei zu lesen. „Chloroplast.“
Extra für Miranda schrieb er es noch mal ordentlicher und vor allem größer, bevor er mit seinem Vortrag fortfuhr. Miranda schrieb es ab. Ich war inzwischen schon lange mit der nummerierten Beschriftung fertig, aber sie hing noch bei drittens. Und jetzt schrieb sie dieses Wort Buchstabe für Buchstabe ab. Sie sah immer wieder auf, schrieb einen Buchstaben und sah wieder zur Tafel. Sie war der Klassiker einer blöden Schönheit. So was gehört wohl an jede Schule.
Bio war die letzte Stunde des Tages. Endlich frei! Und es war auch noch Freitag! Zwei freie Tage in Sonnenschein und Sand und kühlem Wasser. Perfekt!
Das Wochenende wollte ich bei Caro verbringen, daher ging ich nach der Schule direkt nach Hause. Wenn ich Glück hätte, könnte ich packen und verschwinden, bevor meine Eltern von der Arbeit kämen. Sie wussten natürlich Bescheid, aber wenn ich konnte, entging ich dem Aufklärungsgespräch.
„Bis nachher!“ rief ich Caro zu. Sie hatte nicht das Glück, einen älteren Bruder mit Auto in der gleichen Schule zu haben. Sie musste mit dem Bus fahren, ich konnte bei Ricky einsteigen.
„Na?“ fragte er mit einem Grinsen bis zu den Ohren. „Heute vielleicht?“
Ich hatte ihm erzählt, was unsere Eltern vorhatten. Seither fragte er mich auf jedem Heimweg, ob es heute vielleicht soweit wäre. Und jeden Morgen, auf dem Weg zu Schule, fragte er, ob ich es hinter mich gebracht hätte.
„Nö.“ grinste ich zurück. „Ich muss ja zu Caro und hab keine Zeit.“
Er hatte mir von seinem Gespräch mit unseren Eltern erzählt. Total peinlich! Auch nach mehreren Tagen dieser Vorahnung in mir hatten wir noch nicht genug, darüber zu lachen. Ich bekam mich gar nicht mehr ein, wenn er unseren Vater imitierte.
Mit Bauchmuskelkater kam ich ins Haus und wurde enttäuscht. Die beiden waren schon da, saßen im Wohnzimmer und schienen nur auf uns zu warten. Oder auf mich.
„Hey.“ sagte Mama. „Wie war die Schule?“
„Okay.“ sagte ich schnell und gab meiner Stimme besonders viel Stress. „Ich muss mich beeilen.“
„Setzt euch doch mal.“ bat unsere Mama und ihr Ton machte mich hellhörig. Sie war nervös. Das hätte ja auf dieses berüchtigte Gespräch deuten können, aber sie würde Ricky ja wohl nicht zur Unterstützung mit da haben wollen.
„Kann das nicht warten?“ jammerte ich. „Ich muss mich beeilen.“
„Setzt euch bitte.“ wiederholte unser Vater und auch er wirkte zu ernst, um es zu ignorieren.
Ricky und ich warfen uns einen misstrauischen Blick zu und setzten uns auf unsere angestammten Plätze. Unsere Eltern auf der Couch und wir auf den Sesseln links und rechts. Diese Ordnung wurde nur für Horrorfilme gebrochen. Die sah ich wirklich gern, aber dann wollte ich nicht allein auf dem Sessel sitzen. So einsam und schutzlos. Ricky sah sie sich immer mit mir an und saß neben mir auf dem Sofa. Dann fühlte ich mich stark.
Jetzt gerade fühlte ich mich furchtbar. „Was ist los?“ fragte ich, weil ich die spannungsgeladene Stille nicht ertragen konnte. Sie sahen uns auch nicht an. Papa hatte die Hände gefaltet, sich nach vorn auf seine Knie gestützt und musterte unseren überaus interessanten Teppichboden. Und Mama beobachtete ihn dabei.
Papa hob plötzlich den Blick, sah erst zu Ricky, dann zu mir und dann zu Mama. „In meiner Firma werden Einsparungen gemacht.“
Ich musste schwer schlucken. „Soll das heißen, sie haben dich rausgeschmissen?“ Er war ein Ass, wenn es um Computer ging. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie ihn einfach auf die Straße gesetzt hätten.
„Nicht ganz. Unser Standort wird geschrumpft und meine Abteilung komplett nach London verlegt.“
„London?!“ schrien Ricky und ich wie aus einem Mund. Wir sprachen hier nicht von einigen Kilometern, sondern einigen Tausend Kilometern. Von Miami nach London! Hallo?! Was sollte das denn?! Ich bekam eine ausgewachsene Panikattacke!
„Wir werden in einer Woche umziehen.“ verkündete unsere Mutter leise, der ich für diesen einen kurzen Satz am liebsten den Kopf abgerissen hätte.
„Nein!“ Ich sprang auf. „Das ist nicht euer Ernst! Ihr wollt uns auswandern?! Uns alles nehmen, das uns etwas bedeutet?! Unser zu Hause, unsere Freunde, unsere Schule - unser ganzes Leben?!“
Papa war aufgestanden. „Lilly, ich muss da hin.“
„Dann geh.“ schoss ich eiskalt zurück. „Ohne mich. Das könnt ihr vergessen!“
Ich ignorierte die Rufe, die mir aus dem Wohnzimmer folgten. Ohne meinen gepackten Rucksack rannte ich aus dem Haus, die Straße hinunter, bog um eine Ecke und ließ mich mit Seitenstechen auf den Bordstein fallen. London! Die wollten doch nicht wirklich nach London! Wen kannten wir denn in London? Was sollten wir dort? Wir waren Miami gewöhnt. Gab es neben der Antarktis einen größeren Gegensatz zu Miami als London?
Ricky war mir gefolgt und setzte sich neben mich auf den Bordstein. „Lilly...“
„Willst du mir sagen, du willst nach London?“ schluchzte ich verzweifelt.
„Ich kann nicht behaupten, dass ich Freudentänze aufführe. Aber Lil, Papa bedeutet das sehr viel, das weißt du.“
„Ja, und darüber hinaus vergisst er uns ganz und gar oder wie?“
„Nein, sonst wäre er wohl fröhlicher mit der Nachricht herausgeplatzt.“
Da war was dran. Ich wollte das trotzdem nicht. „Auf keinen Fall. Ich will nicht nach London.“
Ich hatte da nur nichts zu sagen. Unsere Eltern hatten es bereits entschieden und wir Kinder hatten zu folgen. Ricky hätte mit seinen achtzehn Jahren vielleicht bleiben können, doch er war noch nicht fertig mit der Schule und war abhängig von den beiden Menschen, die ich anfing zu hassen.
Die letzte Woche in der Schule war grauenhaft. Am Wochenende bei Caro hatte ich mich ausgeschimpft und ausgeweint und mit ihr alle möglichen Pläne geschmiedet. Ihre Eltern sollten mich adoptieren, wir wollten abhauen, ich zog es sogar in Erwägung, zu heiraten, nur um diesem Irrsinn zu entgehen. Es half nichts. Der Entschluss stand und als ich am Sonntag Abend nach Hause kam, standen schon die ersten Kartons im Haus herum. Ein Stapel leerer Kartons stand vor meiner Zimmertür und wartete auf Füllung.
Ich begrüßte niemanden, warf die Kartons den Flur hinab, ging in mein Zimmer und schloss ab. Zum Glück hatte ich mein eigenes Badezimmer und musste für den Rest der Nacht niemanden meiner Familie mehr sehen. Am Montag schlich ich mich schon zeitig aus dem Haus und fuhr mit dem Fahrrad zur Schule.
Meine Eltern hatten mich von der Schule abgemeldet und irgendwie hatte es sich herumgesprochen. Zumindest unter denen, die es direkt betraf. Marc zum Beispiel. In der ersten Pause sprach er mich darauf an und machte mangels Zukunftsaussichten Schluss. Zum Mittag sah ich ihn dann schon mit einer anderen. Meine Freunde - oder was ich für Freunde gehalten hatte - wurden weniger. Ich wurde angesehen wie eine Aussätzige, obwohl ich doch noch gar nicht in der neuen Schule war. Caro war mir dafür näher als alle anderen. Sie wich nicht von meiner Seite, wie auch sonst nie. Wir hatten nur nicht so viel Spaß wie sonst.
Im Unterricht bekam ich nun noch weniger mit. Und als ich am Donnerstag mit dem Fahrrad nach Hause kam, war von meinem Zimmer nicht viel übrig. Ich hatte mich geweigert, mein ganzes Zeug einzupacken. Irgendwer hatte es jetzt trotzdem getan. An einer Wand neben dem Fenster stand ein Stapel Kisten, beschriftet mit meinem Namen und dem Inhalt. Daran hing ein handschriftlicher Zettel meiner Mama. „Bitte“ - mehr stand nicht darauf.
Ich warf mich aufs Bett, weinte in mein Kissen und wünschte mir, irgendwas tun zu können. Wie bei den Horrorfilmen fühlte ich mich einsam, verlassen und machtlos. Ausgeliefert den Geschehnissen, die ich nicht beeinflussen konnte, aber auch nicht zu verantworten hatte. Wieso konnte mein Vater nicht einfach einen anderen Job annehmen? Wieso musste er uns quer durch die ganze Welt verfrachten wie ein Sofa? Ich war vielleicht sein Kind, aber doch nicht sein Eigentum. Er hatte mich gezeugt, okay. Im Gegensatz zu seinen Computerprogrammen ging ich damit aber nicht in seinen Besitz über. Ich war ein selbst denkender und fühlender Mensch. War dem das alles egal?
Offensichtlich. Am Freitag Morgen wurde unser ganzes Hab und Gut in einen LKW geladen. Wie die Umzugskisten wurde ich genau vierundzwanzig Stunden später mit einem Koffer und einer Handtasche in ein Auto verfrachtet. Caro war da. Wir lagen uns weinend in den Armen und mochten uns eigentlich nicht loslassen. Wir wurden aber nicht gefragt und ich musste zusehen, wie meine beste Freundin im Heckfenster immer kleiner wurde und schließlich ganz verschwand. Erst da drehte ich mich nach vorn, sah aber nicht aus dem Fenster zu meiner geliebten Heimat, sondern auf meine Knie.
„Lilian...“ fing mein Vater an, doch ich unterbrach ihn gleich.
„Sprich mich nicht an.“ zischte ich zornig, obwohl die Trauer überwog. In Bezug auf meine Eltern konnte ich Trauer aber nur noch in Wut ausdrücken. Es ging nicht anders.
Ricky nahm meine Hand auch gegen meinen Widerstand. Er hielt sie fest mit seiner großen Pranke umschlungen, sagte aber nichts. Wir sprachen gar nicht während der Fahrt. Ich hatte meinen iPod geladen und mit meinen Lieblingsliedern gefüllt, so musste ich auch während des ganzen Fluges nicht ein einziges Wort sagen.
Es war Nacht, als wir in London landeten. Wir wurden von einem Wagen der Firma abgeholt. Mit Chauffeur. Sollte mich das jetzt beeindrucken? Mir fiel nur auf, dass es kalt war. Ich vermisste meine heiße Sonne jetzt schon.
Von London sah ich noch nicht viel. Wir fuhren außen um die große Stadt herum und es war dunkel. Ein Meer von Lichtern in der Ferne konnte ich erkennen, mehr nicht. Tolle Voraussetzungen für meine neue Heimat.
Die Lichter wurden weniger. Nicht nur, weil wir uns von London entfernten, auch weil es immer weniger beleuchtete Straßen oder Häuser gab. Schließlich hielten wir vor einem recht großen dreistöckigen Haus. Es lag in einen Wald eingebettet, wie es in der Dunkelheit schien. Ein anderes Haus konnte ich nicht ausmachen. Wir waren anscheinend nicht nur so weit weg von zu Hause, es hatte uns auch noch in die Einöde verschlagen. Großartig.
Der Chauffeur trug unsere Koffer noch mit ins Haus. Meinen nicht. Ich krallte mich in den Henkel, bevor der Mann ihn anheben konnte, und stapfte wütend zum Haus hin. Meine Mutter verfiel schon in Lobeshymnen auf das Haus und das Grundstück. Einen weißen Gartenzaun gab es hier übrigens nicht. Meterhohe Hecken schnitten das Grundstück vom Rest der Welt ab. Ricky stieg dumpf mit ein, mehr drang nicht in meine Ohren. Ich wollte es nicht hören. Ich verabscheute diesen Ort, dieses Haus, dieses Land und meine Familie. Ich wollte zurück nach Hause. Das hier würde nie mein zu Hause sein.
Das Haus war ziemlich alt, aber renoviert. Neben der Garderobe blieb ich stehen und wartete mit dem Rücken zur Tür, bis die anderen nachgekommen waren.
„Wo ist mein Zimmer?“ fragte ich tonlos, sah mich aber nicht um. Ich wollte diese Verräterbande nicht sehen.
Mein Vater stellte sich neben mich und betrachtete meine Silhouette. „Wir dachten, euch würde das Dachgeschoss gefallen.“
Ich hatte, was ich wissen musste, und lief mit meinem Koffer los, ohne mich umzusehen. Bis zu diesem Vorkommnis hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Okay, wir hatten uns auch mal in den Haaren, weil ich mehr Taschengeld oder Freiraum wollte oder weil ihrer Meinung nach mein Kleid für die Party zu kurz war. Diese Aktion würde ich ihnen allerdings niemals vergeben können. Ich konnte sie nicht mal ansehen, ohne dass Wut, Enttäuschung und Abscheu in mir aufgekommen wäre. Ich spürte es jedes Mal, wenn mein Blick über sie huschte. Langsam kroch diese kribbelnde Wärme meine Kehle hinauf und wollte ausgeschrien werden.
Ich ließ es bleiben und stieg die vielen Stufen zu meinem neuen Zimmer hinauf. Wenn ich den Weg öfter gehen würde, hätte ich bald Beinmuskeln wie ein professioneller Läufer oder Radfahrer. Zum Glück grenzte ein Badezimmer an mein Zimmer, so musste ich nicht wegen jedem Toilettengang die Treppe runter.
Ich hatte keinen Blick für das Bad übrig. Ich sah mich nicht mal in dem Zimmer um. Es war sehr groß - wesentlich größer als mein altes. Der Giebel hatte eine gigantische Fensterfront. An der Wand rechts der Tür gab es einen Einbauschrank, der wohl viel Platz für Klamotten bot. Klar, bei den Temperaturen brauchte man auch mehr Kleider mit dickerem Stoff. Da musste der Kleiderschrank schon entsprechend wachsen.
Es war mir alles egal. Ich ließ meinen Koffer direkt hinter der Tür stehen, schloss ab und legte mich in das fremde Bett. Aus den Satzfetzen, die ich während der Reise mitgehört hatte, wusste ich, unsere Möbel würden am folgenden Tag ankommen. Dann würden wir entscheiden, welche der bereits hier vorhandenen Möbel wir nicht mehr bräuchten. Ich hätte am liebsten alles weggeschmissen. Das Bett, die Kommoden, die Nachtschränkchen, den Einbauschrank, die Holzdielen, die Wandvertäfelungen im untersten Drittel des Zimmers, die große hölzerne Fensterbank, auf der eine Decke und Kissen lagen, die langen Gardinen mit samt der Stange, das Bild einer grünen Blumenwiese über meinem Bett - alles. Ich hätte gern alles von diesem verfluchten Ort zertrümmert und mein zu Hause wieder gehabt. Ich wollte nichts von diesem neuen Ort haben.
Ich ließ mich in das fremde Bett fallen, zog die Kopfhörer von meinem iPod und ließ mein Lieblingslied leise neben meinem Kopf dudeln. Es dauerte nicht lange, bis ich mich in den Schlaf geweint hatte. Ich träumte von weißen Sandstränden, hellblauem Himmel und gleißendem Sonnenlicht. Ein kalter Eistee zur Abkühlung an unserem Lieblingskiosk und dann mit den Füßen durchs Wasser und quatschen. So hatten Caro und ich die Tage am liebsten verbracht. Es verpuffte mit einer schwarzen Wolke aus Betonklötzen, die sich zu Bergen zu beiden Seiten der schmalen Straße auftürmten. Der Himmel war grau und es nieselte. Der Wind brachte keine angenehme, leichte Abkühlung. Er war eisig und brachte Gänsehaut. Ich zitterte wie Espenlaub, obwohl ich so viele Kleider trug, dass ich mich kaum bewegen konnte.
Geweckt wurde ich von der Sonne wie zu Hause. Deshalb dachte ich auch als erstes, ich würde mit Caro an der Strandpromenade vielleicht Inlineskaten können. Bei dem Gedanken lächelte ich. Und als ich die Augen aufschlug, weinte ich. Vor mir sah ich nicht den vertrauten Anblick meiner beigen Gardinen, die das helle Sonnenlicht nur ein wenig dämpften, um nicht geblendet zu werden. Nein, ich sah ein völlig fremdes Zimmer. Da änderte es auch nichts, dass es nach Süden ausgerichtet war und vor meinem Giebel die Sonne strahlte. Zugegeben, der Himmel war blau, aber es war ein anderes Blau. Ein kühleres Blau. Und die Sonne schien weiter von der Erde entfernt zu sein als in Miami.
Im Laufe des Tages bewegte ich mich nur zweimal. Einmal um aufs Klo zu gehen und mich frisch zu machen, und einmal um meinen iPod ans Stromnetz anzuschließen. Ansonsten lag ich im Bett, starrte zum Fenster hinaus und rührte mich nicht.
Irgendwann klopfte es leise. „Lilly?“
Meine Mutter! Die wollte ich genauso wenig sehen wie irgendjemanden anders, daher antwortete ich nicht. Als sie die Tür öffnete und hereinkam, schloss ich die Augen und tat, als würde ich schlafen.
Es half nicht. Sie kam zu mir und berührte mich an der Schulter. Instinktiv wich ich zurück. Ich musste nicht mal darüber nachdenken. Dass sie mich von meinem ganzen Leben gerissen hatten, warf ich ihnen so sehr vor, dass ich eine Berührung von ihr nicht ertragen konnte.
„Lil.“ seufzte sie und setzte sich auf meine Bettkante.
„Lass mich in Ruhe.“
„Lilly, bitte. In einer Stunde kommen unsere Möbel. Dann kannst du dich einrichten und wenn du noch was brauchst, dann fahren wir einkaufen.“
„Alles, was ich brauche, habt ihr mir genommen. Also geh und lass mich in Ruhe.“
Demonstrativ schloss ich wieder die Augen und schwieg. Sie saß noch einige endlose Sekunden dort, sah mich an und ging dann mit einem tiefen Seufzer. Ruhe suchte ich vergeblich. Meine Mutter war kaum weg, da kam Ricky zu mir. Und zwar so, wie ich ihn kannte. Witzig und laut.
„Hey du Schlafmütze!“ lachte er von der Tür aus und kam näher. „Komm schon, raus aus den Federn! Wenn du noch länger dort liegenbleibst, bestehst du bald nur noch aus Fett.“ Ich bewegte mich immer noch nicht. „Weißt du was?“ flüsterte er verschwörerisch. „Mama und Papa kaufen uns alles, was wir wollen, um unsere Zimmer zu gestalten. Aber du musst mitkommen.“ Er setzte sich neben mich. „Komm schon.“ bettelte er. „Ich will einen eigenen Fernseher. Das ist meine Chance. Die krieg ich nie wieder. Aber ohne dich gehen sie nirgends hin. Bitte bitte bitte. Dafür helfe ich dir auch, was du dir wünschst.“
Alles, was ich mir wünschte, würden sie mir nicht geben. Alles, was ich wollte, war wieder nach Hause zu fahren. Das wusste auch Ricky und seufzte.
„Lil, bitte. Ich möchte meine kleine Schwester nicht mehr so sehen. Bitte. Steh auf, richte dich mit mir ein und gib London und seinen Menschen eine Chance.“
„Ich will nach Hause.“ wimmerte ich schon wieder den Tränen nahe. Es gab nicht viele Leute, vor denen ich mich so zeigte. Ricky gehörte dazu. Er nahm mich in seine Arme, wo ich nun richtig anfing zu weinen.
„Lilly.“ flüsterte er liebevoll. „Quäle dich doch nicht selbst. Ich würde auch lieber am Strand liegen und mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, als in einem völlig fremden Land einkaufen zu gehen. Das können wir allerdings nicht beeinflussen. Wir können nur beeinflussen, was wir daraus machen. Wir können hier sitzenbleiben und verrotten oder wir geben London eine Chance und haben ein bisschen Freude. Diese Entscheidung liegt allein in unserer Gewalt. Und sieh es doch mal positiv. Mama und Papa werden dich nicht so schnell aufklären wollen.“
Das genügte. Ich musste tatsächlich schwach lachen. Unterm Strich hatte er ja auch Recht. Ich konnte nicht ändern, was andere für mich entschieden hatten. Ich konnte nur ändern, was ich beeinflussen konnte. Entweder ich würde hier ohne Lachen versauern oder ich würde es anpacken. Diese Entscheidung lag allein in meiner Hand.
„Meinst du, sie kaufen mir einen neuen Computer?“
„Zumindest stehen unsere Chancen nicht schlecht.“ sagte Ricky gelassen. „Vorausgesetzt natürlich, du stehst heute noch auf.“
Und ich tat ihm den Gefallen. Mehr war es auch nicht. Meinem Bruder tat ich den Gefallen, weil ich wusste, er liebte mich, er verstand mich und er litt mit mir. Ging es mir schlecht, ging es ihm auch nicht gut. Letztes Jahr hatte ich heftigen Liebeskummer gehabt und Ricky hatte Tag und Nacht bei mir verbracht. Ich hatte geweint und er hatte gelitten. Das wollte ich nicht. Er konnte genauso wenig dafür, dass wir jetzt in London festsaßen wie ich. Dafür wollte ich ihn nicht bestrafen und stand endlich auf.
Ich ging duschen, zog mir frische Kleider an und schaffte es gerade noch rechtzeitig, bis die Möbel kamen. Als erstes warf ich dieses grässliche alte Himmelbett raus. Es sah nicht nur aus wie das Bett einer Mumie, es roch auch so. Im Großen und ganzen schmiss ich alles aus dem Dachzimmer, das schon da gewesen war. Bis auf den Wandschrank natürlich. Ich stellte meine eigenen Möbel auf, öffnete das Fenster und ließ frische Luft herein. Das war besser.
„Sieht gemütlich aus.“ sagte auf einmal meine Mutter. Sie stand in der Tür. „Was hältst du von einem runden Teppich hier?“ Sie deutete auf den großen freien Platz zwischen Bett und Schreibtisch an den gegenüberliegenden Wänden.
Meine Antwort sah so aus, dass ich zu ihr ging, der Tür einen Stoß gab und meine Mutter damit aussperrte. Da sie sie nicht wieder öffnete, nicht klopfte und nichts sagte, ging ich davon aus, die Botschaft war angekommen.
Ohne weitere Unterbrechung richtete ich mich ein. Ich hängte viele Fotos an die Wände, die mir meine Heimat ein bisschen näher brachten. Caro war auf den meisten mit drauf. Und die Sonne. Es war jetzt wärmer als in der Nacht zuvor, aber immer noch kalt für mich. Mitten im Sommer und ich brauchte eine Strickjacke in meinem eigenen Zimmer. Irgendwas lief hier völlig schief.
Als ich meinen Computer angeschlossen hatte, rief ich meine Mails ab. Eine war von Caro: Hey Lil! Du fehlst mir jetzt schon, dabei bist du grad erst weg. Ich geh jetzt an unsere Stelle und werde unser Buch lesen. Hoffe, du kommst gut an. Meld dich und erzähl mir, wie es so ist. Bis bald. Caro.
Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Brust. Unsere Stelle war eine kleine Bucht, die niemand kannte. Wir hatten dort noch keine Menschenseele getroffen. Mehr als zwei Leute passten eh nicht hin. Wir hatten nie irgendjemanden dort hingenommen. Wenn wir dort gewesen waren, dann als Freundinnen.
Manchmal hatten wir Hausaufgaben gemacht oder einfach nur gequatscht, aber meistens hatten wir in unserem Buch gelesen oder es fortgeführt. Es war ein großes, dickes und schweres Buch, in dem wir alles festgehalten hatten, das uns Spaß machte. Fotos, getrocknete Blumen vom Schulball, die Servietten von unseren ersten Dates und so weiter. Alles, was uns irgendwie verband und an etwas erinnerte, war in diesem Buch gelandet.
Auf der ersten Seite hatten wir gemeinsam geschrieben, dass wir es komplett füllen würden und wenn wir zusammen in einem Zimmer im Altersheim leben würden, würden wir es immer noch lesen und uns gegenseitig daran erinnern, damit nie in Vergessenheit geraten würde, dass wir die besten Freundinnen waren. Und jetzt? Jetzt saß Caro allein an unserer Stelle und blätterte in dem Buch herum, weil ich nach London abgeschoben worden war.
Ich nahm mir vor, ihr zu schreiben. Nicht die kurze Antwort per Mail, die ich gleich abschickte. Ich wollte ihr einen Brief mit einem neuen Eintrag für unser Buch schicken. Dafür musste ich mein Zimmer verlassen. Hinterm Haus lag ein großer Garten. Er war ziemlich wild und ungepflegt. Unkraut wucherte in allen Ecken und die Büsche und Hecken sahen aus wie geplatzte Polsterstühle. Das war aber nicht mein Problem und ging mich auch nichts an.
Ich pflückte ein Gänseblümchen von der Wiese und machte noch ein Foto des Gartens und eines vom Haus. Die Blume würde ich pressen und dann zusammen mit den Fotos und ein paar Zeilen per Post an Caro schicken. Sie könnte es in unserem Buch fortführen.
Und in ein paar wenigen Jahren, wenn ich volljährig wäre, könnte ich einfach in ein Flugzeug steigen und zurück nach Hause fliegen, ohne dass meine Eltern irgendwas dagegen sagen könnten. Sie könnten sowieso sagen, was sie wollten, ich würde nicht antworten. Nach meinem Geburtstag würde ich nie wieder ein Wort mit ihnen wechseln und sie nie wieder sehen. Ich würde ihnen nie erzählen, wie ich mein Leben lebte. Sie hatten sich entschieden, ihr Leben in England zu leben, da gehörte ich aber nicht dazu. Ende der Diskussion.
Zurück in meinem Zimmer steckte ich das Gänseblümchen in ein dickes Lexikon zum Pressen, dann zählte ich die Tage bis zu meinem achtzehnten Geburtstag. Vierhundertsiebenundachtzig Tage noch. In meinen Wandkalender trug ich diese Zahl in den heutigen Tag ein und würde ab jetzt immer rückwärts zählen, bis ich endlich abhauen könnte. Das klang gar nicht so viel, aber realistisch betrachtet waren es noch fast anderthalb Jahre.
Den Einkauf schafften wir an dem Tag nicht mehr. Ich war ja auch erst nach dem Mittag aufgestanden. Als ich Hunger bekam, ging ich in die Küche, belegte mir ein Brot und ging wieder nach oben. Meine Eltern waren beide in der Küche gewesen. Sie hatten gekocht und auch etwas zu mir gesagt. Ich hatte es nicht mal registriert, geschweige denn, dass ich geantwortet hätte. Ich ging wieder nach oben und blieb in meinem Zimmer für den Rest des Abends und die ganze Nacht.
Am nächsten Morgen weckte mich wieder die Sonne, dicht gefolgt von Ricky, der mich bewegen wollte, mit zum Einkaufen zu gehen. Begeisterung sah anders aus. Ich hatte einfach keinen Bock, den ganzen Tag mit meinen Eltern durch die Gegend zu ziehen und so zu tun, als wäre alles toll.
Ich ging trotzdem mit. Als erstes fuhren wir in ein Möbelhaus. Unterwegs gab es schon die ersten Probleme, weil nämlich keiner von uns links fahren konnte. Das war nicht so einfach, wie es sich anhört. Der Schalthebel und so weiter sind ja alle auf der anderen Seite. Papa fuhr besonders langsam und vorsichtig. Er war vermutlich ein Verkehrshindernis, aber dafür kamen wir lebend im Möbelhaus an.
Das Haus war etwa doppelt so groß wie unser Altes. Diese zweite Hälfte musste mit Möbeln gefüllt werden, die zu uns passten. Himmelbetten gehörten ebenso wenig dazu wie alte, dreckige Teppiche mit goldenen Fransen an den Seiten. Ich fragte mich ernsthaft, woher die das Geld für das ganze Zeug nahmen. Wir waren ja nicht arm, aber so was sollte unser Konto nicht hergeben. Ich fragte auch nicht danach, denn dafür hätte ich das mir selbst auferlegte Schweigegelübde brechen müssen.
Wünsche äußerte ich auch keine. Das war allerdings auch nicht nötig. Während Ricky sich für einen neuen Schreibtisch entscheiden musste, begutachtete ich einen Schminktisch. Ich war eigentlich nicht der Typ, der einen extra Schminktisch brauchte, aber der hier gefiel mir. Der am hinteren Rand befestigte Spiegel war sehr groß und die ovale Fassung mit reichen Schnörkeln verziert, die ihm einen altmodischen, aber nicht modrigen Charme verliehen. Es gab viele kleine und größere Fächer zum Herausziehen, aber auch Türen, an denen Haken für Halsketten befestigt waren. In die Tischplatte eingelassen war ein Fach für Uhren. Den Deckel konnte man hochklappen. Weshalb mir das so gefiel war nicht, weil ich so viele Uhren besaß. Der Deckel war aus Glas und ich hatte mir einige Muscheln vom Strand mitgebracht. Die könnte ich dort reintun und ein Foto von Caro und mir dazu. Zusammen mit dem Sand, den ich in einem Gläschen mitgenommen hatte. Ein Teil meiner Heimat. Ich stand vor diesem Schminktisch und sah vor mir, wie ich dort einen kleinen Altar von Miami einrichtete.
Meine Mutter sah mir zu, wie ich die Finger über die Glasplatte des Fachs streifen ließ, und entschied. „Wir nehmen den für Lilly mit.“ legte sie unserem Vater zugewandt einfach fest. Ihr Ton machte klar, dass sie keine Diskussion zulassen würde. Das Teil war nicht billig und normalerweise hätte ich mir so was nie gewünscht. Ich hätte es unverschämt gefunden. Umso erstaunter war ich, dass mein Vater mit einem Lächeln zustimmte und dem Verkäufer Bescheid gab.
Ich war machtlos. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass sich meine Mundwinkel hoben. Der Tisch war toll und ich freute mich ehrlich darüber. Meine Mutter stand inzwischen mit einigem Abstand neben mir. Ich öffnete den Mund, um mich zu bedanken. Trotz aller Wut wusste ich immer noch, wie man sich benimmt. Mein Dank blieb mir jedoch im Halse stecken. Ich brachte es einfach nicht fertig, dieses Wort auszusprechen.
„Schon gut.“ wehrte meine Mutter leise ab und beließ es dabei.
In einem Elektrogeschäft bekam Ricky tatsächlich seinen eigenen Fernseher. Ihm ging es dabei weniger um Filme, das war klar. Er war es nur leid, seine Spielekonsole über den kleinen Bildschirm von seinem Computer zu nutzen.
Ich hatte keine Ahnung, wieso, aber ich bekam einen neuen Computer. Ricky schien geplaudert zu haben, ohne dass ich etwas mitbekommen hatte. Und dann auch noch einen, der genau das konnte, was ich brauchte. Irgendwelche hochauflösenden Spiele hatte ich nicht und die interessierten mich nicht. Ich surfte viel im Internet, sah Filme über meinen Rechner und wollte mit Caro per Videocall in Verbindung bleiben. Genau dafür war der Computer ausgelegt. Bildbearbeitung und Musik und Filme. Dazu einen ziemlich großen Bildschirm, damit ich mir den Fernseher sparte. Ich zeigte es nicht, aber ich war begeistert.
Am gleichen Nachmittag noch wurden die ganzen Sachen geliefert. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Altar für Miami und dem Einrichten des Computers, um Caro anzurufen. Dann fiel mir die Zeitverschiebung wieder ein. Bei ihr war es für Ferien noch viel zu zeitig, als dass sie wach gewesen wäre. Ich konnte sie jetzt nicht gleich anrufen und richtete als erstes den Schminktisch ein.
Die samtenen Einlagen für die Uhren nahm ich heraus, füllte den Sand vom Strand hinein, richtete die Muscheln, die ich mit Caro an unserer Stelle gesammelt hatte, genau aus und legte unser Foto dazwischen. Dann saß ich minutenlang da, starrte die vertrauten Dinge an und konnte das salzige Meeresrauschen hören, riechen und schmecken. Ich hörte Caros Lachen in meinem Kopf und wollte es richtig hören.
Den Computer anzuschließen, war keine Kunst. Ihn einzurichten eigentlich auch nicht, aber es war zeitaufwendig. Das Gute daran war nur, dass ich lange genug brauchte, um den Tag dem Ende zu neigen. Bis ich alles soweit fertig hatte und Caro anrief, konnte ich rechtfertigen, ins Bett zu gehen.
Der Störenfried
Die restlichen Sommerferien verliefen bis auf meine Begegnung mit Moe eher unspektakulär. Ich verbrachte viel Zeit im Freien, weil mich das große Haus schon nach zwei Tagen einengte. Ich lief durch Wälder, über Wiesen und Felder. Manchmal war ich auch mit dem Fahrrad unterwegs. Und manchmal lag ich auch einfach irgendwo unter der Sonne und wartete, dass es Abend wurde, damit ich am Morgen wieder aufstehen und endlich einen weiteren Tag rückwärts zählen konnte. So hatte ich mir meine Sommerferien nicht vorgestellt.
Eine Wendung gab es etwa zwei Wochen vor dem Schulbeginn. Nach dem Frühstück setzte ich mich auf mein Rad, fuhr die Einfahrt hinab und dann traf ich Moe. Er kam den Weg vor unserem Tor entlanggelaufen. Es war ein bisschen abschüssig für mich und ich sah ihn zu spät. Ich zog die Bremsen voll an, um ihn nicht zu überfahren, flog mit dem Kopf voran schreiend über den Lenker und blieb liegen. Autsch! Das hatte wirklich wehgetan.
Dafür war Moe unverletzt geblieben. Er sprang gleich zu mir und leckte mir fröhlich mit wedelndem Schwanz das ganze Gesicht ab. Es schien wirklich, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Seine Zunge leckte überall den Schmutz von meiner Haut. Mit dem Blut von den Schürfwunden versuchte er es auch, doch das wusste ich zu verhindern.
Ich richtete mich halb auf und stützte mich auf den Ellenbogen, um ihn richtig streicheln zu können. „Hey Kleiner. Wo kommst du denn her?“
Der musste irgendwem weggelaufen sein. Weit und breit war keine Menschenseele auszumachen. Bis auf meine Familie, die vermutlich meinen Aufschrei gehört hatten. Sie stürzten aus dem Haus, als stünden wir kurz vor einem Weltuntergang und sie wollten mich noch mal sehen.
„Lilly!“ rief meine Mutter schon fast weinend.
„Was ist passiert?“ wollte Ricky aufgeregt wissen und musterte mich mit unseren Eltern ganz akribisch.
„Er kam vorbeispaziert.“ erzählte ich völlig in Gedanken versunken. Ich war immer noch damit beschäftigt, dem Kleinen mit Streicheln zu verdeutlichen, dass ich ihm nicht böse war.
„Wo kommt der denn her?“ fragte mein Vater und spähte um unser Gartentor herum nach einem Herrchen. Ein Halsband trug der Kleine auch nicht. „Mh … Niemand zu sehen.“
„Komm rein.“ bat meine Mutter. „Das sollte sich nicht entzünden.“
Der kleine Hund hatte mehr geschafft, als er vermutlich vorhergesehen hatte. Ich sprach wieder mit meinen Eltern, auch wenn ich es in dem Moment gar nicht wahrnahm. Ich war noch viel zu überrascht von diesen Ereignissen. Ich ließ mich zur Behandlung der Wunden auch wieder berühren. Meine Mutter reinigte sie und musste einige sogar verbinden, weil es nicht aufhören wollte zu bluten. Ich selbst bekam davon nicht viel mit. Mein neuer Freund saß auf meinen Schoß, beobachtete neugierig, was meine Mutter tat, und ließ sich liebend gern hinterm Ohr kraulen.
„Wie finden wir denn jetzt heraus, wo er hingehört?“ warf Ricky in die Runde und gab ihm erst mal was zu trinken.
„Er hat kein Halsband.“ sagte ich. „Vielleicht so einen Chip unter der Haut.“
„Wo kann man die denn auslesen lassen?“ murmelte meine Mama.
„Beim Tierarzt, denke ich.“
„Dann fahren wir zum Tierarzt.“ grinste Ricky und hielt bei Papa die Hand nach dem Wagenschlüssel auf. „Und ihr könnt die Nachbarn fragen.“
Welche Nachbarn, dachte ich leicht angenervt von diesem Gedanken. Hier war ewig weit kein anderes Haus zu sehen. Wie nahe muss das nächstgelegene Haus an unserem stehen, um noch Nachbarn zu sein? Das letzte Haus einer Stadt sagt doch auch nicht Nachbarn zu denen, die in der nächsten Stadt als erstes wohnen, oder?
Unter innerem Protest stimmten unsere Eltern zu und überließen uns den Wagen. Moe, wie ich ihn beim Hinausgehen taufte, kam natürlich mit uns. Logisch. Wie sollte der Tierarzt den Chip auslesen, wenn der Hund nicht da war?
Ricky hatte im Internet noch schnell nach der Adresse und den Öffnungszeiten gesucht, während ich mich umgezogen und etwas gewaschen hatte. Mit Navigationssystem ging dieser Teil recht leicht, nur eben der Linksverkehr … Ich würde hier nicht so schnell mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Viel zu gefährlich.
Im Sprechzimmer mussten wir nur einige wenige Minuten warten, bis die Tierärztin hereinkam. Sie sah eigentlich echt freundlich aus. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte, aber ihre liebenswerte Ausstrahlung wunderte und beruhigte mich.
„Hallo.“ lächelte sie, gönnte uns aber nur einen flüchtigen Blick, dann lag all ihre Aufmerksamkeit auf Moe. „Na wer bist du denn? Du bist ja niedlich.“
Da sagte sie was … Ich mochte ihn schon jetzt nicht mehr hergeben. Diese niedlichen Schlappohren und die großen, dunklen Kulleraugen … Ich hatte mich verliebt.
„Können sie den Chip auslesen?“ bat ich. „Wir haben ihn gefunden.“
„Gefunden?“ staunte sie entsetzt.
„Ja. Wieso?“ fragte Ricky, weil es mir die Sprache bei ihrer Reaktion verschlagen hatte.
„Das ist ein reinrassiger Beagle, maximal drei Monate alt. Solche Hunde findet man doch nicht einfach auf der Straße. Wo bist du weggelaufen?“ fragte sie Moe, der natürlich keine Antwort gab, außer einem großen Schleck quer über ihr ganzes Gesicht.
Sie lachte auf. „Gott, bist du süß. Wenn wir dein Herrchen nicht finden, behalte ich dich.“
„Nein!“ rutschte mir viel zu laut und viel zu empört heraus. Ich konnte es nicht aufhalten, ich klang wie ein bockiges Kind.
„Schon gut.“ zwinkerte sie. „Was sagen eure Eltern dazu?“
Daran wollte ich gar nicht denken. Aber ich würde den Schminktisch und den neuen Computer wieder hergeben, wenn ich dafür Moe behalten könnte.
So weit waren wir aber noch nicht. Die Tierärztin nahm ein merkwürdig aussehendes Gerät, das Moe erst mal inspizieren musste. Sie ließ es ihn beschnuppern und redete auf ihn ein, dass ihm das nicht wehtun würde. Dann hielt sie es neben seinen Kopf und wartete. Noch auf die andere Seite und wieder warten. Sie führte es an seinem ganzen Körper entlang und sah auf das Display.
Dann war es amtlich: „Kein Chip. Er trug kein Halsband?“
„Nein. Gar nichts.“ seufzte ich. „Wie kriegen wir denn jetzt raus, wem er gehört?“
„Flugzettel vielleicht. Oder sie fragen ihre Nachbarn.“
„Schon in Arbeit.“ seufzte ich erneut. „Ist er denn gesund?“
„Soweit ist er wohlauf. Gut genährt und völlig gesund auf den ersten Blick. Ich geb ihm noch die allgemein übliche Impfung, um sicherzugehen.“
Und nett wie diese Ärztin war, mussten wir nicht einen Penny bezahlen. Weder für die Untersuchung mit dem Gerät noch für die Impfung. Das fand ich sehr nett und musste gestehen, das hatte ich den Briten nicht zugetraut.
Ohne Ergebnisse und trotzdem zufrieden fuhren wieder nach Hause. Unterwegs kauften wir wenigstens noch eine kleine Packung Hundefutter. Solange wir nicht wussten, wo Moe wohnte, musste er ja wenigstens was fressen. Mir behagte der Gedanke nicht, dass ich ihn in ein Tierheim bringen sollte. Wer wusste schon, wie es ihm dort gehen würde? Und wer ihn mitnehmen würde? Dann doch eher zu der Tierärztin, auf die ich dafür jetzt schon neidisch war.
Unsere Eltern hatten auch keine neuen Erkenntnisse, so blieb Moe für diesen Tag und auch für die Nacht noch bei uns. Den Tag verbrachte ich mit ihm im mittlerweile ordentlichen Garten mit gemähter Rasenfläche. Wir tollten ausgelassen über den Rasen. Ricky hatte einen alten Tennisball geopfert. Mit Hundespielsachen konnten wir nämlich nicht dienen.
Bis zu diesem Tag. In der Nacht schlief Moe in meinem Bett, nachdem ich lange genug gebettelt hatte. Am nächsten Tag klebten wir Flugzettel an Bäume und Laternen, legten sie in Geschäften aus und fragten weitere Anwohner. Niemand hatte diesen süßen Fratz je zuvor gesehen.
Drei Tage später fuhren wir mit ihm in die Stadt und kauften Hundefutter, Fressnapf, Spielzeug, Leine, Halsband und so weiter. Am Abend zuvor hatte ich gebettelt, was das Zeug hielt, und hatte gewonnen. Moe blieb bei uns. Wir meldeten ihn offiziell an, ließen ihn beim Tierarzt noch mal gründlich durchchecken und er bekam einen Chip, auf dem mein Name und meine Adresse gespeichert wurden. Letzteres leider immer noch in London.
Damit hatte ich endlich eine Aufgabe in diesem verfluchten Land. Ich spielte weiterhin mit Moe im Garten, aber ich erzog ihn auch. Im Spiel versteckt lernte er die gängigsten Befehle und sehr schnell hatte er verstanden, worauf es ankam.
Egal wohin ich ging, Moe kam mit. Sogar mit aufs Klo. Dass er sein Geschäft nicht dort machen durfte, hatte er schnell verstanden und scharrte an der Tür, wenn er musste. Perfekt! Ich war zufrieden mit meiner Leistung. Und seiner natürlich.
Mit Moe verging die Zeit sehr schnell. Meine Eltern versuchte ich zu meiden, ließ sie aber nicht mehr so kalt abblitzen, nachdem sie zugestimmt hatten, dass Moe bleiben könnte.
Und dann stand auf einmal schon der Schuljahresbeginn vor der Tür. Der Sommer war vorbei. Jetzt würde mein neuer Alltag losgehen, vor dem ich doch die ganze Zeit hatte fliehen wollen. Jeden Tag hatte ich per Internet mit Caro telefoniert, um sie auch zu sehen. Sie hatte ihren Laptop meistens mit zum Strand genommen, damit wir dort quatschen konnten, als würde ich neben ihr sitzen. Moe saß immer auf meinem Schoß und schlief. Aber jetzt holte mich England wieder ein. Die Zeit der Träumerei von Sonne, Strand und Meer war vorbei.
Am Samstag vor dem schwarzen Montag hieß es Shopping für Ricky und mich. Diesmal keine Möbel, sondern Kleidung und Schulsachen. Ich brauchte neue Blöcke, Kugelschreiber, einen Terminplaner, diverse Bücher, Sportsachen und am allerschlimmsten: Die Schuluniform. Als ich das erfuhr, hätte ich gern das ganze Haus zertrümmert.
Das hätte mir auch nicht geholfen. Und das war auch der einzige Grund, warum ich unbedingt mitgehen musste. Sonst hätte ich Ricky und meine Eltern alles besorgen lassen. So ging ich mit und ließ mich einkleiden. Dass ich das mal noch erleben würde...
Es wurde sogar noch schlimmer. Die Uniform war in einem eigentlich recht angenehmen Dunkelblau gehalten. Die Nähte stachen mit rotem Garn hervor. Es sah zumindest nicht schlecht aus. Ricky bekam ein weißes Hemd dazu verpasst. So hatte ich ihn bisher nur zum Schulball gesehen.
Mir gab die Verkäuferin einen Bügel mit kompletter Uniform. Ein Rock! Ich dachte, ich dreh durch. Ein Altweiberrock, der noch ganz brav die Knie verdeckte, und in altmodischen Falten fiel. Dazu eine Bluse, die sich von Rickys Hemd nur durch den Spitzenbesatz und Rüschen unterschied.
Einige Sekunden starrte ich reglos auf den Bügel. „Auf keinen Fall.“ legte ich fest und drückte der Frau das Zeug wieder in die Hand. „Ich nehme den Hosenanzug.“
„Für Mädchen gibt es nur Röcke.“ sagte sie verwundert.
Ich drehte mich zu meinen Eltern. „Vergesst es. Dann meldet uns als Ricky und Rocky an, aber ich werde nicht in diesem Fummel auf die Straße gehen. Da seh ich aus wie Einundsechzig, nicht wie Sechzehn.“
„Schatz...“ fing meine Mutter an, doch das konnte sie sich sparen.
Ich verschränkte die Arme und funkelte sie an. „Herzlich Willkommen im Einundzwanzigsten Jahrhundert. Ich weigere mich, Röcke zu tragen, nur weil ich zufällig nichts zwischen den Beinen hängen habe.“
Oh je … Ich hätte es mir verkneifen sollen. Die Verkäuferin wurde kreidebleich und alle anderen Besucher des Ladens schnappten erschrocken nach Luft. Der einzige, der sich prächtig amüsierte, war Ricky. Er sah aus, als würde er ersticken, wenn er den Lachanfall nicht gleich herauslassen würde. In dem ganzen Laden herrschte auf einmal Totenstille, bis in der Kabine hinter mir jemand nicht mehr an sich halten konnte. Der Stimme nach zu urteilen, war es ein Mädchen, das sich die Seele aus dem Leib lachte.
„Abby!“ rief wohl ihre Mutter empört.
Die Tür der Kabine ging auf und ein echtblondes Mädchen in der Schuluniform kam heraus. Sie grinste mich bis zu den Ohren an. „Gut gebrüllt, Löwe!“ gluckste sie und wandte sich ihrer Mutter zu. „Ich trage diese Fetzen auch nicht mehr. Ich fordere die Gleichberechtigung. Was unterscheidet mich von den Kerlen?“
Immerhin eine Verbündete hatte ich, wenn ich schon den ganzen Betrieb hier lahmlegte. Ich hatte auch nicht vor, davon abzuweichen. Eher würde ich im Bikini zur Schule gehen, als mich zu kleiden wie einem Altersheim entkommen. Na gut, ich bekam den leichten Anflug eines schlechten Gewissens, als sich drei weitere Mädchen weigerten, die Röcke zu tragen, und auf Hosen bestanden. Das war doch nicht etwa meine Schuld, oder? Meine Eltern waren zu Salzsäulen erstarrt, aber Ricky hob hinter ihrem Rücken den Daumen.
Über meinen Vater musste man eines wissen: Für ihn gab es nichts Schlimmeres, als negativ im Zentrum des Geschehens zu stehen. So war es aber in diesem Fall und er lief knallrot an. Kein gutes Vorzeichen. Dann wurde er nämlich wirklich wütend.
„Lilan, du wirst das anziehen, wie es die Schulvorschriften verlangen!“ donnerte er streng.
Ich schüttelte rigoros den Kopf. „Schick mich auf eine andere Schule und nicht auf eine steinzeitliche. Ich hab mich ja mit der Uniform abgegeben, aber das geht gar nicht. Ruf von mir aus den Direktor an und sag ihm, in welchem Jahrhundert wir leben. Ist mir völlig egal, aber das wird nicht an meinem Körper hängen. Basta.“
Das fremde Mädchen baute sich mit gleicher Gestik neben mir auf. Verschränkte Arme und stahlharter Blick auf ihre Mutter. Sie trug den Fummel zwar schon, aber ich war mir sicher, sie würde damit nicht in der Schule erscheinen.
Meine Mutter war in solchen Situationen eher nah am Wasser gebaut. Sie fing vor Scham immer an zu weinen und auch hier war es fast so weit. Sie schämte sich in Grund und Boden für mich. Fragte sich einer der Erwachsenen mal, dass ich mich ein ganzes Jahr lang in Grund und Boden schämen müsste, wenn ich damit auf die Straße gehen würde?
„Sie hat doch Recht.“ meldete sich Ricky schnell zu Wort, ehe mein Vater vor Wut platzen konnte. Dafür erntete er die bösen Blicke. „Ist doch so. Die Zeiten der Klassen-, Rassen- und Geschlechtertrennung sind vorbei. Wo ist das Problem, ihr eine Hose zu geben?“
Die letzte Frage richtete er an die Verkäuferin, die damit völlig überfordert war. Ich fürchtete, wir würden hier nie wieder einkaufen dürfen.
„Aber...“ japste sie. „Die passen doch gar nicht.“
„Geben sie mir eine der Kleineren.“ bat ich ganz freundlich. „Alles andere ändere ich mir selbst.“
Sie sah hilfesuchend zu meinen Eltern, die nur nickten. Allerdings nicht, weil sie mir zustimmten, sondern weil sie ganz schnell die Aufmerksamkeit von sich ablenken wollten.
„Du wirst die Konsequenzen allein tragen.“ sagte mein Vater kalt zu mir und wandte sich ab. Er blieb in einer Ecke nahe des Ausgangs stehen.
Das andere Mädchen kriegte ihre Mutter auch noch rum. „Abby.“ grinste sie mich zufrieden an und reichte mir die Hand.
„Lilly. Freut mich.“
„Und mich erst. Ich freue mich schon auf Montag. Wird bestimmt witzig.“
Ich kam zu keiner Antwort mehr. Ihre Mutter strafte mich mit einem bösen Blick, packte ihre Tochter am Oberarm und schleifte sie weg von mir - weg von dem Störenfried. Mein Ruf würde wohl schneller in der Schule kursieren, als ich ankommen würde. Störte mich das? Nicht im geringsten. Innerlich triumphierte ich. Und dass sich Ricky mit Argumenten auf meine Seite geschlagen hatte, toppte alles.
Nur das Wochenende verlief wieder sehr kühl. Im Großen und ganzen sprachen wir gar nicht miteinander. Außer Ricky und ich. Am Abend dieses bedeutsamen Samstags ging ich zu ihm und dankte ihm. Er versicherte mir, dass er aus Überzeugung gesprochen hatte und mich verstehen konnte. Ob mir das in der Schule helfen würde, war eine andere Frage.
Am Montag war es dann so weit. Meinen Wecker hätte ich gern in irgendeine Ecke geworfen. Am liebsten an Papas Kopf. Ich ließ es bleiben und schlüpfte in meine neue Schuluniform. Viel hatte ich an der Hose nicht ändern müssen. Sie saß gut so. Die spitzenbesetzte Bluse hatte ich auch abgelehnt und lieber eines der Jungenhemden genommen. Das Wochenende hatte ich genutzt, um es ein bisschen aufzupeppen. So prangte Miamis Wappen auf meiner Brust, neben dem Schulwappen. Wenn schon untergehen, dachte ich, dann richtig. Ich hatte auch einigen Stoff entfernt, um das Hemd auf Taille zu formen. Es war nicht ganz mein Stil, aber besser als das alte Zeug. Ich passte mich der Schuluniform an, verriet mich selbst aber nicht ganz, also konnte sich doch keiner beschweren.
Als ich mit Ricky vor der Schule hielt, bekam ich Muffensausen. Das Miamiwappen konnte man wegen der Jacke nicht sehen, aber ich war weit und breit das einzige Mädchen mit Hose.
„Steh zu dir.“ lächelte Ricky, bevor wir ausstiegen.
„Du sagst das so leicht.“ antwortete ich, als wir unsere Taschen aus dem Kofferraum nahmen.
„Meinst du, die Gleichberechtigung wäre durchgesetzt worden, wenn alle Frauen sich dafür geschämt hätten?“
Da war was Wahres dran. Deshalb straffte ich mich auch. „Du hast Recht. Danke.“
„Nicht dafür. Ich bin dein Fürsprecher. Sag Bescheid, wenn du Ärger hast.“
„Das wird wohl nicht lange dauern.“ sagte ich und schielte aus dem Augenwinkel zur Seite. Wir waren jetzt schon das Gesprächsthema Nummer eins. Alle sahen uns an, steckten die Köpfe zusammen und zerrissen sich die Mäuler über die Neuen. Und dann musste ich auch noch so herausstechen.
Ricky legte lachend seinen Arm auf meine Schulter. „Seit wann lässt du dich von solchen Affen kleinkriegen?“
„Seit Caro nicht mehr da ist.“
„Ich bin vielleicht nicht Caro, aber ich stehe immer zu dir. Vergiss das nicht.“
„Danke.“ lächelte ich aufrichtig. Mit diesen Worten im Hinterkopf würde ich das doch wohl durchstehen. Ich hoffte es wenigstens.
Unser erster Weg führte uns ins Sekretariat. Die Stundenpläne hatten wir zwar schon bekommen, uns fehlten aber noch die Schülerausweise und die Zimmernummern. Es war ja gut zu wissen, dass ich mit Mathe anfangen musste, aber wo?
So schnell wurde die Frage nicht beantwortet. Die Sekretärin schien mit der Verkäuferin der Uniformen verwandt zu sein. Ihr Mund stand leicht offen und sie starrte ungeniert meine Beine an, die von chicem blauem Stoff umhüllt wurden. Umso mehr die sich davon angegriffen fühlten, desto besser gefiel es mir.
Ricky blieb lässig wie immer. „Guten Morgen. Sie haben die Schülerausweise für uns?“
Aus einer offenen Tür neben dem Tresen der Sekretärin kam der Direktor der Schule. Anfangs lächelte er freundlich und fing mit „Herzlich Willk...“ an, bevor er mich sah und verstummte. Auch sein Blick huschte von meinem Gesicht bis zu meinen Füßen hinab.
„Willkommen?“ beendete ich unschuldig.
„Äh … Die Schuluniform ist Pflicht an dieser Schule.“
„Und ich trage sie.“
„Aber nicht die Richtige.“
„Wieso nicht?“ fragte ich weiterhin vollkommen unschuldig und blickte an mir hinab. „Was hab ich denn vergessen?“ Ich zog eines der Hosenbeine ein Stück hoch, um die weißen Strümpfe mit dem Schulwappen zu zeigen. „Sogar die hab ich.“
„Aber...“ Er fing an zu schwitzen und leckte sich nervös die Lippen. „Mädchen haben die Röcke zu tragen.“
„Ich hab keinen. Und ich sehe auch nicht ein, einen zu tragen, nur weil ich ein Mädchen bin. Entweder ich trage die Hose oder gar nichts.“
Ricky verkrampfte neben mir. Er stand so nah bei mir, dass ich das leichte Zittern spüren konnte. Auch mir fiel es bei dem Anblick nicht leicht, die Fassung zu behalten. Der Rektor hatte sie auf jeden Fall verloren.
Ricky räusperte sich und blieb halbwegs gefasst. „Meine Schwester möchte nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Ihr soll kein Stempel aufgedrückt werden.“
Oha! Diskriminierung ist ein heikles Thema. Darüber wurde so viel in den Medien und Gerichtssälen diskutiert, dass allein die Nennung dieses Wortes einer Drohung gleichkam. Eine Schule konnte sich wahrlich nicht leisten, in so einen Skandal verwickelt zu werden.
Das wusste auch der Rektor und gab sich alle Mühe, ruhig und entspannt zu wirken, als wäre alles in bester Ordnung. „Na schön. Dann herzlich Willkommen in London und unserer Schule.“
Die Stimme hatte er ja kontrolliert, aber als er wieder ins Büro ging, schwankte er ein wenig. Die Perlen auf seiner Stirn sprachen auch für sich. Vermutlich würde er jetzt im Internet recherchieren und die Gesetzgebung mit Gerichtsurteilen und seiner Schulordnung vergleichen.
Ricky und ich grinsten uns zufrieden an und wandten uns wieder der Sekretärin zu. Die hatte nicht so viel Erfolg damit, den Vorfall zu übergehen. Während des ganzen Gesprächs sah sie immer wieder zu meinen Beinen hinab. Das fand ich äußerst unhöflich. Das gehörte sich doch nicht. Ich lief doch auch nicht durch die Gegend und starrte jedermann unter die Gürtellinie.
Die erste Schlacht hatte ich gewonnen, doch der Krieg war gerade erst ausgebrochen. Wo ich auch hinkam, wurde ich begafft und ausgelacht. Bis ich endlich Abby traf.
„Lilly!“ strahlte sie mir entgegen. Sie trug tatsächlich Hosen. Ich war begeistert.
„Hey Abby.“ schnaufte ich erledigt, obwohl die erste Stunde noch nicht mal angefangen hatte.
„Haben deine Eltern dich auch noch zugetextet?“ fragte sie ernsthaft interessiert.
„Nö. Haben mich das ganze Wochenende angeschwiegen.“
„Hast du es gut. Ich durfte mir zwei Tage lang Vorträge anhören. Warst du schon beim Direx?“
„Sicher. Lass das Wort Diskriminierung fallen, dann wird das schon.“
Sie lachte lauthals den ganzen Korridor zusammen. Aufgrund der Uniformen konnte man die Persönlichkeiten hier nicht auf den ersten Blick erkennen. In meiner Heimat war das einfacherer gewesen. Die Streber, die Skater, die Sportler, die Künstler und so weiter. Und die Mittelklasse, zu der auch Caro und ich zählten. Wir hatten Freunde aus allen Bereichen und kleideten uns wie uns eben gerade war. Manchmal freizügig, manchmal eher verschlossen, bunt oder schlicht. Je nach Laune.
Die Uniformen machten dieses Erkennen schwierig. Ich wusste nicht, mit wem ich es zu tun hatte. Das konnte ein Vor-, aber auch ein Nachteil sein. Eine streng aussehende Lehrerin kam vorbei und blieb stehen.
„Abigale.“ sagte sie ebenso streng, wie es ihr Äußeres angekündigt hatte.
Abby konnte ihre Mundwinkel nicht halten. Ein ersticktes Glucksen drang aus ihrer Kehle, als sie krampfhaft versuchte, nicht wieder laut zu lachen. „Ja, Miss Stranger?“
„Abigale, das Schuljahr hat gerade erst begonnen und du machst genauso weiter? Wo ist eure Uniform.“
„Hier.“ sagte ich wieder unschuldig und sah an mir hinab. Wie oft ich die Frage wohl noch beantworten müsste?
„Seid ihr Jungen?“ fragte die Lehrerin, die ich jetzt schon nicht mochte.
Das würde gleich auf Gegenseitigkeit beruhen. „Sind sie ein Mann?“ schoss ich zurück.
Sie schnappte so erschrocken nach Luft, wie es wohl bisher noch nicht vorgekommen war. „Was erlaubst du dir eigentlich?!“ fauchte sie, während ich meine Argumentation sachlich und ruhig fortsetzte.
„Müssen wir uns äußerlich von Jungen unterscheiden? Haben nicht Frauen für Gleichberechtigung gekämpft? Sonst würden sie zu Hause am Herd stehen und nicht hier unterrichten.“
Ich konnte meine Klappe manchmal einfach nicht halten. Diese kleinkarierte Haltung machte mich rasend! Ich kannte die Frau keine fünf Minuten, aber allein ihr Anblick trieb mir blanke Wut durch die Knochen. Wo lebten die denn hier?
Die restliche Schülerschaft bestaunte uns wie die Tiere im Zoo. In Abby schien ich einen typischen Störenfried gefunden zu haben. Das untermauerte meinen Standpunkt nicht gerade, aber sie stand zu mir, zu ihren Hosen und zu ihren Rechten. Die konnten uns ja tatsächlich nicht zwingen, die Hosen auszuziehen. Sollten wir in Unterwäsche in den Unterricht gehen?
Von der Unruhe angelockt kamen weitere Lehrer, bis auch der Rektor noch bei uns stand. „Was ist los?“ wollte er von seiner Lehrerin wissen.
„Sie tragen Hosen.“ stellte sie entsetzt fest und zeigte auch noch mit dem Finger auf Abby und mich. Unhöflich - es fiel mir immer wieder ein.
Ricky tauchte im Rücken des Rektors auf und ich gab ihm stumm zu verstehen, er solle sich raushalten. Das war mein Kampf. Solange es nicht nötig war, wollte ich den ohne ihn ausfechten.
Ich reckte mein Kinn etwas vor. „Wir sind vielleicht Mädchen, aber wir sind nicht das Eigentum der Lehrerschaft. Und wenn sie uns schon Röcke andrehen wollen, dann gehen sie mit der Zeit. Zeitlos chice Anzüge für die Jungen, aber altmodische Röcke für die Mädchen, in denen sie genau dieses alte Klischee zur Schau stellen wollen, gegen das hunderte Frauen sich erhoben haben? Das müssen sie mir erklären.“
Das war schon die zweite Schlacht in diesem Krieg, die für mich entschieden wurde. Nicht nur, weil der Direktor mir zustimmte und seine Lehrerin anwies, das hinzunehmen. Mein größter Sieg war, dass die anderen Mädchen verhalten anfingen zu klatschen. Ich war mit Abby hier eine absolute Außenseiterin, aber in dem Moment sprachen wir für alle Mädchen und sie zeigten uns, dass sie zumindest in diesem Punkt hinter uns standen. Dem hatte dann auch die strenge Miss Stranger nichts mehr hinzuzufügen und ging ihrer Wege. Hoffentlich hatte ich die nicht allzu oft pro Woche. Einmal im Monat wäre mehr als genug.
Die Schulglocke kündigte den Beginn des Unterrichts an und ich wusste immer noch nicht, wo ich hin musste. Die Schülertrauben lösten sich hektisch auf und verschwanden in den Räumen.
Abby nahm meinen Zettel mit dem Stundenplan, den ich die ganze Zeit in der Hand hielt. „Hey, wir haben zusammen.“ freute sie sich und lief los. „Übrigens starker Auftritt.“
„Danke.“ freute ich mich stolz und winkte Ricky noch schnell zum Abschied.
„Dein Bruder?“ fragte Abby.
„Ja. Und er sieht das genauso wie wir.“
„Bestens.“ kicherte Abby und öffnete eine Tür, zu der sie mich geführt hatte.
Noch bevor ihre Hand die Klinke berührte, fing ich an zu beten, dass es nicht Miss Stranger war, die uns erwartete. Bitte nicht die! Jeder, aber nicht diese!
Die Erleichterung folgte auf den Fuß. Ein Mann stand vor dem Lehrertisch. „Schon zur ersten Stunde zu spät.“ seufzte er kopfschüttelnd. Das war der erste, der sich nicht an unseren Kleidern störte.
„Miss Stranger und der Rektor haben uns aufgehalten.“ erklärte Abby hoch erhobenen Hauptes.
„Hast du jetzt schon was angestellt?“