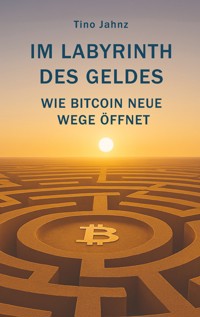
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Inflation raubt dir leise die Früchte deiner Arbeit. Gibt es dafür einen Ausweg? Dieses Buch nimmt dich mit auf eine Reise und zeigt, warum Bitcoin weit mehr ist als ein Spekulationsobjekt. Bitcoin ist ein Werkzeug der Freiheit, ein Schutz für den Wert deiner Arbeitszeit und eine Chance auf finanzielle Teilhabe für Menschen weltweit. Erfahre, warum Bitcoin oft missverstanden wird, welche Chancen es öffnet und wie es den Weg zu einem faireren und stabileren Finanz- und Energiesystem bahnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
Dieses Buch ist kein technisches Handbuch, kein Börsenratgeber und auch kein Manifest. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, sich auf eine Reise zu begeben, die mit einer einfachen Frage beginnt: Was ist Geld und warum beschäftigen sich plötzlich Millionen Menschen mit einer Handvoll digitaler Zahlen, genannt Bitcoin?
Ich bin selbst irgendwann in dieses Thema hineingerutscht, ohne zu wissen, wie tief der sprichwörtliche Kaninchenbau tatsächlich ist. Was als Neugier begann, wurde schnell zu einer Faszination. Denn hinter Bitcoin steckt weit mehr als ein „neues Internetgeld“ oder eine Möglichkeit, reich zu werden. Wer sich auf dieses Thema einlässt, landet unweigerlich bei Fragen über unser Wirtschaftssystem, über Energie, über Freiheit, Vertrauen und über uns selbst.
Dieses Buch soll einen ersten Überblick geben und Lust auf mehr machen. Es soll helfen, sich im Dickicht der Begriffe, Meinungen und Vorurteile zurechtzufinden, ohne zu überfordern. Ich möchte zeigen, wie viele Türen Bitcoin öffnet: zur Geschichte des Geldes, zu ökonomischem Denken, zu philosophischen Grundfragen und zu technologischen Innovationen. Vielleicht ist es nicht für jede dieser Türen an der Zeit, sie ganz zu durchschreiten. Aber dieses Buch hält eine Taschenlampe bereit.
Mir geht es nicht darum, jemanden zu überzeugen. Ich will keine Predigt halten und schon gar keine Versprechen geben. Mein Ziel ist es, Denkimpulse zu geben und einen schönen Einstieg in dieses vielschichtige Thema zu geben.
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Dieses Buch ist keine Anlageberatung. Ich bin kein Finanz- oder Steuerberater. Alles, was du hier liest, spiegelt meine persönliche Sichtweise wider und soll dich vor allem dazu ermutigen, selbst weiterzudenken. Denn wer sich mit Bitcoin beschäftigt, lernt eines ziemlich schnell:
„Selbstverantwortung ist kein Ballast, sondern der Anfang von Freiheit.“
Inhaltsverzeichnis
Was ist Geld
Die Vorgeschichte von Kryptowährungen und der Anfang von Bitcoin
Bitcoin verstehen - Die neue Architektur des Geldes
Bitcoin-Mining und seine Rolle in der Energiewende
Bitcoin & Wirtschaft: Arbeitszeitspeicher, Opportunitätskosten, Zeitpräferenz
Freiheit Selbstverwahrung, Zensurschutz und Finanzinklusion
Bitcoin als Innovationstreiber
Warum Bitcoin nicht durch Altcoins ersetzt werden kann
Zu schön, um wahr zu sein? Die psychologischen Hürden gegenüber Bitcoin
Kritikpunkte und Herausforderungen
Weg in die Zukunft
Schlusswort
Buch und Podcast Empfehlungen
Kapitel 1: Was ist Geld?
Kaum etwas prägt das tägliche Leben so sehr wie Geld, und doch machen sich die wenigsten Menschen Gedanken darüber, was es eigentlich ist. Es wird verdient, ausgegeben, gespart und manchmal scheint es einfach zu verschwinden. Aber was macht etwas zu Geld? Warum akzeptieren Menschen Geld als Zahlungsmittel und weshalb kann dieses Vertrauen in seinen Wert ins Wanken geraten?
Um diese Fragen zu verstehen, hilft ein Blick zurück. Denn Geld ist kein Naturgesetz. Es ist eine menschliche Erfindung, ein Konzept, das sich über Jahrtausende hinweg verändert und weiterentwickelt hat. Und jede Etappe dieser Entwicklung erzählt uns etwas darüber, wie Gesellschaften funktionieren, worauf Menschen Vertrauen setzen und was wir unter „Wert“ verstehen.
Vom Tauschhandel zur symbolischen Vereinbarung
Am Anfang stand der direkte Tausch: ein Korb Datteln gegen ein Fell, ein Fisch gegen eine Handvoll Getreide. Dieses System funktionierte nur, solange beide Seiten zufällig genau das besaßen, was die andere brauchte. Fehlt diese Übereinstimmung, wurde der Handel schnell kompliziert.
So entstand die Frage, ob es nicht Dinge gibt, die grundsätzlich jeder gern annimmt, nicht zum unmittelbaren Verbrauch, sondern als Zwischenschritt beim Tausch. Die Antwort fiel in vielen Kulturen gleich aus: ja. Rund um den Globus begannen Menschen, bestimmte Güter als allgemein anerkanntes Zahlungsmittel zu verwenden, etwa seltene Muscheln, Salz, Perlen, Vieh oder auffällige Steine. Damit begann die Geschichte des symbolischen Tauschmittels, der seinen Wert nicht allein im praktischen Nutzen eines Gegenstands hatte, sondern in der gemeinsamen Übereinkunft, dass er etwas wert ist.
Edelmetalle als universelle Vertrauensanker
Mit der Zeit setzten sich Edelmetalle wie Gold und Silber durch. Sie hatten mehrere Eigenschaften, die sie als Geld besonders geeignet machten: Sie waren relativ begrenzt, leicht teilbar, nahezu unverwüstlich und kulturell hoch angesehen. Vor allem aber waren sie schwer zu fälschen. Ein Stück Gold konnte überall auf der Welt gegen Waren eingetauscht werden, ein wahres Weltgeld, lange bevor der Begriff existierte.
Silber war dabei oft das Geld des Alltags, während Gold den großen Transaktionen oder Staatsgeschäften vorbehalten blieb. Der römische Denar, die spanische Silbermünze „Pieces of Eight“ oder der frühe US-Dollar, sie alle basierten auf dem Vertrauen in die dauerhafte Werthaltigkeit des Silbers. Doch selbst Edelmetalle hatten ihre Nachteile. Wer größere Mengen transportieren wollte, war schnell auf Wagen und bewaffnete Begleiter angewiesen.
Vom Metall zur Idee: Der Aufstieg des Papiergeldes
Um dieses Problem zu lösen, begannen Händler und später Banken damit, Einlagen in Edelmetallen zu verwahren und dafür Quittungen auszustellen. Diese Quittungen waren leicht zu transportieren und zu handeln, sie entwickelten sich zum Papiergeld und man vertraute darauf, dass man jederzeit das dahinterliegende Gold oder Silber einlösen konnte.
Doch dieses System öffnete auch die Tür für neue Formen wirtschaftlicher Macht. Denn Banken merkten bald, dass nicht jeder seine Quittungen gleichzeitig einlöste. Also begannen sie, mehr Quittungen auszugeben, als sie an Metallreserven hielten. Ein Prinzip, das wir heute als Teilreserve-Bankwesen kennen. So entstand die Geldschöpfung durch Kreditvergabe. Das ermöglichte mehr wirtschaftliche Dynamik, machte das System aber auch anfälliger für Krisen und Missbrauch.
Der Versuch der Kontrolle: Der Goldstandard
Um der zunehmenden Unsicherheit entgegenzuwirken, versuchten viele Staaten ab dem 19. Jahrhundert, das Geldsystem zu stabilisieren, durch den sogenannten Goldstandard. Die Idee war einfach: Jede ausgegebene Banknote musste durch eine bestimmte Menge Gold gedeckt sein. Das begrenzte die Geldmenge und verhinderte inflationäre Auswüchse. Solange der Goldstandard funktionierte, war Geld an einen realen, begrenzten Rohstoff gebunden. Vertrauen war keine bloße Idee mehr, sondern hatte eine physische Grundlage.
Doch auch dieses System geriet unter Druck, besonders während der beiden Weltkriege, in denen enorme Summen zur Finanzierung mobilisiert wurden. Regierungen mussten mehr Geld ausgeben, als ihre Goldreserven hergaben. Immer wieder kam es zu sogenannten „Bank Runs“, bei denen Menschen versuchten, ihr Papiergeld gegen Gold einzutauschen, oft vergeblich.
Die Welt von Bretton Woods: Ein Kompromiss
Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte man, dass eine neue globale Finanzordnung notwendig war. 1944 versammelten sich Delegierte aus 44 Ländern im amerikanischen Kurort Bretton Woods, um ein solches System zu schaffen. Das Ziel: stabile Wechselkurse, wirtschaftliches Wachstum und ein Wiederaufbau der kriegszerstörten Weltwirtschaft.





























