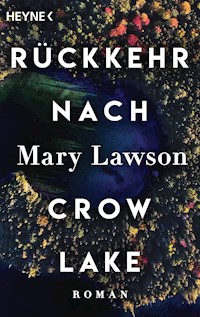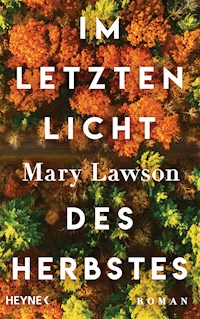
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die kanadische Bestsellerautorin verknüpft drei Schicksale zu einem hoffnungsvollen und zutiefst menschlichen Roman
In der idyllischen Kleinstadt Solace ist ein Teenager spurlos verschwunden. Die siebenjährige Clara ist untröstlich und wartet seit Tagen am Fenster auf die Rückkehr ihrer Schwester. Zu allem Unglück liegt auch noch ihre geliebte Nachbarin, die alte Mrs. Orchard, im Krankenhaus. Eines Abends zieht nebenan ein Fremder ein. Liam Kane wurde das Haus von Mrs. Orchard geschenkt, obwohl er kaum Erinnerungen an sie hat. Ist hier, im Norden Ontarios, ein Neuanfang für ihn möglich? Nach und nach erinnert sich Liam an seine eigene, von Verlust geprägte Kindheit. Und auch Mrs. Orchard stellt sich ihrer Vergangenheit. Denn vor dreißig Jahren gab es einen Vorfall, der für zwei Familien tragische Folgen hatte.
»Es ist eine Freude, Lawsons Bücher zu lesen … sie sind menschlich, weise und voller Empathie.« The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
In der idyllischen Kleinstadt Solace ist ein Teenager spurlos verschwunden. Die siebenjährige Clara ist untröstlich. Seit Tagen wartet sie am Fenster auf die Rückkehr ihrer Schwester. Zu allem Unglück liegt auch noch ihre geliebte Nachbarin, die alte Mrs. Orchard, im Krankenhaus. Eines Abends zieht nebenan ein Fremder ein. Liam Kane wurde das Haus von Mrs. Orchard geschenkt, obwohl er kaum Erinnerungen an sie hat. Ist hier, im Norden Ontarios, ein Neuanfang für ihn möglich? Nach und nach erinnert sich Liam an seine eigene, von Verlust geprägte Kindheit. Und auch Mrs. Orchard stellt sich ihrer Vergangenheit. Denn vor dreißig Jahren gab es einen Vorfall, der für zwei Familien tragische Folgen hatte.
Mary Lawson
IM LETZTEN LICHT DES HERBSTES
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Lohmann
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel A Town Called Solace bei Chatto & Windus / Vintage, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Mary Lawson
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Redaktion: Angelika Lieke
Herstellung: Mariam En Nazer
Covergestaltung © Uno Werbeagentur GmbH unter Verwendung eines Motivs von Stocksy / Jen Grantham
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27865-6V003
www.heyne.de
1 CLARA
Es gab vier Kartons. Große. Mit einer Menge Sachen drin, denn sie waren schwer, das konnte man daran sehen, wie der Mann sie reinschleppte, nach vorn gebeugt, in den Knien ein bisschen eingeknickt. Er brachte sie in Mrs. Orchards Haus, stellte sie im Wohnzimmer ab und ließ sie einfach dort stehen. Also war wohl nichts Wichtiges in den Kartons, nichts, was er gleich brauchen würde, wie Pyjamas, sonst hätte er sie ausgepackt.
Die Kartons standen mitten im Zimmer herum, was Clara nervös machte. Jedes Mal, wenn der Mann reinkam, musste er einen Bogen darum machen. Wenn er sie an die Wand gerückt hätte, wären sie ihm nicht im Weg gewesen, und es hätte auch viel ordentlicher ausgesehen. Und weshalb trug er sie überhaupt aus dem Auto ins Haus, wenn er sie dann nicht auspackte? Zuerst dachte Clara, er hätte sie nur für Mrs. Orchard abgeliefert und sie würde sie selbst auspacken, wenn sie wieder nach Hause kam. Aber sie war nicht wieder nach Hause gekommen, und die Kartons waren immer noch da, genau wie der Mann, der dort nicht hingehörte.
Gegen Abend war er in einem großen blauen Auto angefahren gekommen, genau zwölf Tage, nachdem Rose weggelaufen war. Zwölf Tage, das war eine Woche und fünf Tage. Clara hatte an ihrem üblichen Platz am Wohnzimmerfenster gestanden und versucht, nicht zu horchen, während ihre Mutter mit Sergeant Barnes telefonierte. Der Apparat stand im Flur, sodass man immer mitbekam, was jemand am Telefon sagte, egal in welchem Zimmer man sich aufhielt.
Claras Mutter schrie den Polizisten an. »Sechzehn! Rose ist sechzehn, falls Sie das vergessen haben sollten! Sie ist noch ein Kind!« Ihre Stimme brach. Clara presste die Hände auf die Ohren und summte laut vor sich hin, drückte das Gesicht ans Fenster, bis ihre Nase platt gequetscht war. Ihr Summen klang etwas abgehackt, weil es ihr schwerfiel zu atmen, wenn ihre Mutter sich so aufregte; sie musste immer wieder innehalten und Luft holen. Aber das Summen half. Wenn man summte, konnte man es innendrin spüren, nicht bloß hören. Es fühlte sich an wie eine Hummel. Wenn man sich auf das Gefühl und den Klang konzentrierte, schaffte man es, an nichts anderes zu denken.
Dann war da plötzlich ein knirschendes Geräusch, das ihr Summen übertönte, Autoreifen auf Kies, und das große blaue Auto kam in Mrs. Orchards Einfahrt gerollt. Clara hatte den Wagen noch nie zuvor gesehen. Es war ein schnittiger Straßenkreuzer, mit Heckflossen, himmelblau. Zu anderen Zeiten, normalen Zeiten, hätte er Clara vielleicht ganz gut gefallen, aber jetzt war nichts mehr normal, und sie wollte, dass alles so blieb, wie es immer gewesen war. Ohne fremde Autos in der Einfahrt.
Der Motor wurde ausgeschaltet, und ein unbekannter Mann stieg aus dem Wagen. Er schloss die Autotür, stand da und blickte auf Mrs. Orchards Haus. Es sah aus wie immer; dunkelgrün mit weißen Tür- und Fensterrahmen und einer breiten Veranda mit grau gestrichenem Bretterboden und weißem Geländer. Bisher hatte Clara nie darauf geachtet, wie das Nachbarhaus aussah, aber jetzt fiel ihr auf, dass es genau zu Mrs. Orchard passte. Alt, aber nett.
Der Mann ging auf die Veranda zu, stieg die Stufen hoch, zog einen Schlüsselbund aus der Hosentasche, schloss die Tür auf und ging hinein.
Clara war entsetzt. Wo hatte er die Schlüssel her? Der hatte da doch gar nichts zu suchen. Mrs. Orchard hatte ihr gesagt, dass es drei Schlüsselbunde gab (je einer für die Vorder- und Hintertür). Mrs. Orchard hatte einen, Mrs. Joyce (die einmal die Woche zum Putzen kam) hatte einen, und Clara hatte den dritten. Clara wollte es ihrer Mutter sagen, die nicht mehr am Telefon war, aber ihre Mutter weinte manchmal, wenn sie mit dem Polizisten gesprochen hatte; ihr Gesicht wurde dann ganz rot und fleckig, und das machte Clara Angst. Außerdem konnte sie ihren Platz am Fenster nicht verlassen. Wenn sie nicht nach ihr Ausschau hielt, würde Rose vielleicht nie zurückkommen.
In Mrs. Orchards Flur wurde eine Lampe angeschaltet – der Lichtschein fiel kurz auf die Veranda, bevor der Mann die Tür schloss. Mrs. Orchards Wohnzimmer befand sich direkt neben dem Wohnzimmer von Claras Haus, die Seitenfenster lagen sich gegenüber, und beide hatten auch noch Fenster zur Straße raus. Clara lief hinüber zum Seitenfenster (solange sie an einem der Fenster blieb, würde Rose nichts dagegen haben), und prompt ging in Mrs. Orchards Wohnzimmer das Licht an, und der Mann kam herein. Clara konnte alles gut sehen: Moses, der sich unter dem Sofa versteckt hatte (er verschwand immer unterm Sofa, wenn irgendwer außer Mrs. Orchard oder Clara ins Haus kam), schoss so schnell zur Tür hinaus, dass er schon weg war, bevor der Mann einen Fuß ins Zimmer gesetzt hatte. Er hatte sich in die Waschküche verzogen, wie Clara wusste, und von dort aus in den Garten. Die Waschküche hatte drei Türen, eine zum Wohnzimmer, eine zur Küche und eine zum Garten, und die Gartentür hatte eine Katzenklappe. »Er ist getürmt«, hätte Mrs. Orchard gesagt. Sie war die Einzige, von der Clara je das Wort »türmen« gehört hatte.
Eine Stunde zuvor war Clara noch in der Waschküche gewesen, um Moses zu füttern. Morgens und abends erlaubte sie es sich, ihren Platz am Fenster kurz zu verlassen, weil sie Mrs. Orchard versprochen hatte, sich um Moses zu kümmern, während sie im Krankenhaus war. Rose würde das verstehen.
»Er wird froh sein, wenn du rüberkommst«, hatte Mrs. Orchard gesagt. »Er vertraut dir. Stimmt’s, Moses?« Sie hatte Clara in die Geheimnisse des neuen Dosenöffners eingeweiht. Er war elektrisch. Man musste die Dose auf bestimmte Weise daranhalten, aber alles andere machte er allein, sogar die Dose drehen, während er den Deckel abschnitt.
»Eigentlich bin ich ja nicht für so einen Schnickschnack zu haben«, hatte Mrs. Orchard gesagt, »aber der alte Dosenöffner funktioniert nicht gut, und ich möchte nicht, dass du dich verletzt.« Moses war ihnen um die Beine gestrichen, ungeduldig nach seinem Abendessen miauend.
»Man könnte meinen, wir lassen ihn hungern«, sagte Mrs. Orchard schmunzelnd. »Hier, siehst du, der Deckel bleibt am Dosenöffner hängen – da ist ein Magnet dran. Pass auf, dass du nicht an die Kante kommst, wenn du ihn abnimmst. Du musst ziemlich fest ziehen, und die Kante ist sehr scharf. Bewahr die Dose im Kühlschrank auf, bis sie leer ist, dann spül sie aus und wirf sie draußen in die Tonne, nicht hier in den Eimer, sonst stinkt es. Mrs. Joyce kümmert sich um den Müll, wenn sie zum Putzen kommt. Ich hab mit deiner Mutter gesprochen, und sie ist damit einverstanden, dass du Moses zweimal am Tag füttern kommst. Ich bleib ja auch nicht lange weg.«
Aber sie war lange weggeblieben, wochenlang. Das Katzenfutter war Clara mehrmals ausgegangen, und sie hatte ihre Mutter um Geld bitten müssen, um neues nachzukaufen. (Das war, bevor Rose verschwand, als alles noch normal war und Clara sich frei bewegen konnte.) Sie hatte Mrs. Orchard für zuverlässiger gehalten und war enttäuscht von ihr. Die Erwachsenen waren meistens weniger zuverlässig, als sie sein sollten, aber sie hatte gedacht, Mrs. Orchard sei eine Ausnahme.
Sie konnte ihre Mutter in der Küche hören. Vielleicht ging es ihr jetzt wieder besser.
»Mummy?«, rief Clara.
»Ja?«, sagte ihre Mutter nach einer Weile mit erstickter Stimme.
»Ach nichts«, rief Clara schnell. »Schon gut.«
Der Mann ging durchs Haus, knipste Lichter an – Clara sah ihren fahlen Widerschein draußen auf dem Rasen. Er knipste sie nicht wieder aus, wenn er ein Zimmer verließ. Wenn Clara oder Rose das getan hätten, hätte ihr Vater »Licht aus!« gerufen. Aber jetzt war Rose nicht mehr da. Keiner wusste, wo sie war. Claras Mutter behauptete immer wieder, Rose sei in Sudbury oder North Bay und es gehe ihr gut, sie hätten sie nur lieber wieder zu Hause, oder wenigstens mal eine Postkarte von ihr, denn es wäre schön zu wissen, dass alles in Ordnung sei. Was eigentlich nur hieß, dass ihre Mutter keine Ahnung hatte, was mit Rose los war. Weshalb sie den Polizisten anschrie, weil er Rose noch immer nicht gefunden hatte.
Nachdem in Mrs. Orchards Haus so viele Lampen an waren, konnte man draußen fast nichts mehr erkennen. In Claras Wohnzimmer auch nicht, aber sie machte kein Licht, weil der Mann sie dann hätte sehen können. Im Hellen sieht man die Leute im Dunkeln nicht, doch wenn man im Dunkeln ist, sieht man die Leute im Hellen. Das wusste sie von Rose. »Stehst du nur einen Schritt weg vom Fenster«, hatte Rose gesagt, »dann können sie dich nicht sehen. Ich hab neulich Mrs. Adams zugeschaut, wie sie sich ausgezogen hat. Ganz nackt! BH und Schlüpfer, alles! Sie hat dicke Fettwülste am ganzen Körper, und ihr Busen erst! Wie zwei riesige schlabberige Ballons. Grässlich!«
Der Mann war jetzt wieder im Wohnzimmer und sah sich die Fotos auf Mrs. Orchards Anrichte an. Es waren sehr viele, alle gerahmt. Manche Rahmen aus Silber, manche aus Holz. Zwei der Fotos waren von Mrs. Orchard und ihrem Mann, als er noch gelebt hatte. Auf dem einen saßen sie nebeneinander auf dem Sofa, auf dem anderen standen sie auf irgendwelchen Türstufen, und auf beiden hatte Mr. Orchard seiner Frau den Arm um die Schultern gelegt. Es gab auch Fotos von ihm allein, am Türrahmen eines anderen Hauses lehnend, die Hände in den Hosentaschen, lächelte er in die Kamera. Es musste ein schönes Haus gewesen sein, denn an der Mauer neben ihm rankten Blumen. Mrs. Orchard sprach mit dem Foto, als sei es Mr. Orchard selbst, leibhaftig bei ihr im Zimmer, Clara hatte es oft gehört. Sie klang dabei nicht traurig, eigentlich genau wie immer.
Auf einem der Fotos war Mr. Orchard mit einem kleinen Jungen zu sehen. Der Junge saß am Frühstückstisch, was man daran sah, dass ein Glas Orangenmarmelade vor ihm stand – Clara konnte gerade noch das Etikett erkennen. Mr. Orchard trug ein ordentlich gefaltetes Geschirrtuch über dem Arm und darauf einen vollgeladenen Teller (Clara hatte ihn sich genau angesehen und war zu dem Schluss gekommen, dass es sich um gebratenen Speck und Würstchen handelte). Mr. Orchard stand kerzengerade da und blickte auf den Jungen hinab, der zu ihm aufsah und übers ganze Gesicht strahlte. Clara hatte Mrs. Orchard gefragt, ob das ihr Sohn sei, und Mrs. Orchard hatte gesagt, nein, sie hätten keine Kinder, es sei ein Nachbarskind, aber sie und Mr. Orchard hätten den Jungen sehr gern gehabt. Ist es Ihr Lieblingsfoto?, hatte Clara wissen wollen, und Mrs. Orchard hatte sie angelächelt und gesagt, es seien alle ihre Lieblingsfotos. Aber Clara glaubte ihr das nicht, denn Mrs. Orchard hatte nur dieses Foto und das von Mr. Orchard im blumenumrankten Türrahmen ins Krankenhaus mitgenommen. Clara hatte gleich gemerkt, dass sie fehlten. Wenn man nur zwei Fotos mitnahm, dann waren das doch wohl die Lieblingsfotos.
Der fremde Mann hatte sich vorgebeugt und musterte die Fotos. »Fass sie ja nicht an«, flüsterte Clara ärgerlich, aber als ob er sie gehört hätte und absichtlich nicht gehorchte, hob er sofort eins hoch. Clara ballte die Fäuste. »Das gehört dir nicht!«, sagte sie laut. Er sah sich eins im Holzrahmen an. Dem Platz in der Reihe nach hätte es eins von Mr. und Mrs. Orchard sein können, aber sie war sich nicht sicher – vielleicht war es auch das von Mrs. Orchards Schwester, Miss Godwin, die allein in dem Haus gewohnt hatte, bevor Mrs. Orchard zu ihr zog, und die vor ein paar Jahren gestorben war.
Der Mann stellte das Foto wieder zu den anderen. Er stand noch eine Weile da und schaute sie an, dann drehte er sich um und ging hinaus.
Clara lief zurück zum Vorderfenster – von dort aus konnte man Mrs. Orchards Einfahrt besser sehen. Erst dachte sie, er wollte wieder wegfahren, aber dann ging er ums Auto herum, öffnete den Kofferraum und hob einen der Kartons heraus, und noch einen, und noch zwei von der Rückbank, um sie in Mrs. Orchards Wohnzimmer zu tragen. Anfangs hatte Clara noch den tröstlichen Gedanken, dass die Kartons voller Sachen für Mrs. Orchard waren (aber was würde sie denn haben wollen, das so schwer und sperrig war?) und dass er ins Auto steigen und wegfahren würde, nachdem er die Kartons abgeliefert hatte. Stattdessen tat er etwas, das alles andere als ermutigend war: Er holte einen Koffer heraus.
Sie nahm ihr Abendessen am Fenster ein. Sie hoffte, ihr Vater würde nach Hause kommen, bevor sie ins Bett musste, damit sie ihm von dem Mann im Nachbarhaus erzählen konnte, aber dann fiel ihr ein, er war bei einer Lehrerkonferenz und würde erst spät zurück sein. Also aß sie schnell auf, wünschte Rose stumm eine gute Nacht, wo immer sie sein mochte, sagte ihrer Mutter Gute Nacht und ging hinauf. Lieber wäre sie die ganze Nacht auf ihrem Posten geblieben, aber zu Bett gehen gehörte zu der Abmachung, die sie mit ihrem Vater getroffen hatte, als Clara eine Woche nach Roses Verschwinden mit ihrer Fensterwache begonnen hatte.
In jener zweiten Woche begann Clara, den kalten Schatten der Angst zu spüren. Angst, dass ihrer Schwester etwas passiert sein könnte. »Ich kann auf mich selbst aufpassen«, hatte Rose in ihrem Zimmer zu ihr gesagt, bevor sie auf und davon gegangen war. »Das weißt du doch, nicht?« Clara hatte betrübt genickt und zugesehen, wie Rose herumwirbelte, Kleidungsstücke vom Boden aufsammelte, andere aus dem Schrank riss und alles in ihre Schultasche stopfte. Es stimmte ja: Rose war klug und stark. Außerdem schön und witzig und andauernd im Clinch mit den Eltern und Lehrern (sehr zum Verdruss ihres Vaters, denn er war der Geschichtslehrer an ihrer Schule). Rose hasste es, gesagt zu bekommen, was sie tun sollte. Wenn Rose wütend auf ihre Mutter war, sagte sie Dinge, die sie nicht so meinte, wie zum Beispiel, dass sie abhauen und nie mehr wiederkommen würde. Sie war schon zweimal von zu Hause weggelaufen und nach ein paar Tagen wiedergekommen, wenn sie fand, dass sie ihrer Mutter genug Angst eingejagt hatte. Das war immer ihre Absicht gewesen, wusste Clara. Rose lief weg, um ihre Mutter zu bestrafen.
Aber diesmal fühlte es sich anders an; bisher hatte Rose noch nie zu ihrer Mutter gesagt: »Du siehst mich nie mehr wieder. Niemals. Versprochen.« Rose nahm Versprechen ernst. Und bisher hatte sie ihre Drohungen immer herausgeschrien, doch diesmal hatte sie leise gesprochen, fast sanft, was Clara noch mehr ängstigte als das Schreien. Die Küche hatte förmlich geraucht vor verhaltener Wut.
Dabei hatte es gar nicht wie ein besonders großer Krach begonnen – Rose war nur mal wieder zu spät heimgekommen –, aber daraus wurde dann ein hitziger Streit, ob ihre Mutter Rose vorschreiben könne, was sie zu tun und zu lassen habe. Immer aufgebrachter hatten ihre Stimmen geklungen, bis ihre Mutter schließlich sagte: »Solange du in diesem Haus lebst, mein Fräulein, wirst du tun, was man dir sagt.« Was in dem Fall genau das Falsche war.
»Mach dir keine Sorgen um mich«, hatte Rose oben in ihrem Zimmer zu Clara gesagt, während sie ein paar T-Shirts aus dem Schrank zerrte. »Versprich es mir«, sagte sie streng. Ihre Augen waren dick mit schwarzem Eyeliner umrahmt. Rose trug immer jede Menge Make-up – die blasseste Grundierung, die sie finden konnte, fast weiß, einen dicken schwarzen Lidstrich, schwarze Wimperntusche, grünen oder blauen Lidschatten (an dem Tag war er grün) und einen Lippenstift, der so blass war, dass er ihre Lippen beinahe verschwinden ließ. Einmal hatte sie sich eine schwarze Träne auf die Wange gemalt. Sie färbte ihre Haare schwarz, bleichte die Spitzen, bis sie wie gelbes Stroh aussahen, und türmte das Ganze zu einer riesigen Bienenstockfrisur auf. »Ich sehe aus wie der Tod«, hatte sie einmal zufrieden festgestellt, während sie sich im Badezimmerspiegel musterte. »Findest du nicht auch, dass ich wie der Tod aussehe?«
»Ich finde, du siehst schön aus«, hatte Clara gesagt, was die Wahrheit war. Rose war die Schönste auf der ganzen Welt.
»Aber wo willst du denn hin?«, fragte Clara, als sie ihrer Schwester beim Packen zusah. »Wo wirst du schlafen?« Die Kehle tat ihr weh vor lauter Anstrengung, nicht zu weinen. Rose hasste es, wenn sie weinte. »Wann werde ich dich wiedersehen? Wie kann ich wissen, ob es dir gut geht?«
Rose zögerte. »Das weiß ich noch nicht«, sagte sie schließlich. »Aber irgendwie werde ich mich bei dir melden. Ich weiß nicht, wie oder wann, aber ich werde es hinkriegen, also bleib wachsam, aber sag Mum und Dad nichts davon, okay?«
Einen Moment lang sah sie Clara eindringlich an, während sie an einem Fingernagel kaute – das Nägelkauen war etwas, das Rose an sich hasste. »Fang bloß nie damit an«, hatte sie mal zu Clara gesagt. »Wenn du anfängst, an den Nägeln zu kauen, bring ich dich um. Versprich mir, dass du es lässt.«
Dann nahm sie die Hand herunter und sagte sanft, was ungewöhnlich war, denn Rose war keine von der sanften Sorte: »Wenn ich eine eigene Bleibe gefunden hab, kannst du mich besuchen kommen. Wir werden solchen Spaß haben! Wir gehen jeden Abend aus, und ich werd dir alles zeigen!«
Sie lächelte, und Clara versuchte, das Lächeln zu erwidern, aber ihre Unterlippe zitterte zu sehr, und Rose wirkte plötzlich niedergeschlagen. Sie stopfte die T-Shirts in ihre Tasche, schmiss die Tasche aufs Bett, nahm Clara in die Arme und wiegte sie sanft hin und her. »Ich hab dich so wahnsinnig lieb«, murmelte sie, den Mund an Claras Kopf gedrückt. »Versprich mir, dass du das nie vergisst.«
»Versprochen«, sagte Clara, halb erstickt, weil sie den Kampf mit den Tränen verloren hatte. Aber Rose verlor nicht die Geduld mit ihr wie sonst, sondern drückte sie nur noch fester an sich. Und dann ging sie.
Es stimmte, dass Rose auf sich selbst aufpassen konnte. Ron Taylor war von hinten gekommen und hatte ihr seine fetten Pratzen auf die kleinen Brüste gelegt, und Rose hatte sich losgerissen und ihm so einen Schlag mit der Schultasche verpasst, dass er Nasenbluten bekam. Clara hatte es mit eigenen Augen gesehen. Wenn Rose sagte, sie würde klarkommen, dann konnte man ihr das glauben. Darum hatte Clara sich anfangs auch keine Sorgen um ihre Sicherheit gemacht, sondern nur darum, wann sie wieder heimkommen würde. Aber nach einer Woche hatte sie doch langsam Angst bekommen. Nicht nur, dass eine Woche mehr als doppelt so lang war wie Roses frühere Abwesenheiten; es waren auch die wachsende Verzweiflung ihrer Mutter und das schreckliche Verhalten ihres Vaters, der so tat, als ob alles in Ordnung wäre. Was, wenn es da draußen gefährliche Dinge gab, von denen Rose keine Ahnung hatte? Offenbar wussten ihre Eltern davon, sonst wären sie nicht so besorgt gewesen.
Clara bildete sich immer wieder ein, Rose zu sehen. Acht Tage nach ihrem Verschwinden, als Clara auf dem Heimweg von der Schule war und wie immer ihre Schritte zählte (sie musste auf dem Hin- und Rückweg, so lange sie konnte, jeweils hundert am Stück zählen, oder Rose würde womöglich nicht zurückkommen), meinte sie beim Einbiegen in ihre Einfahrt, ihre Schwester im Wald jenseits der Straße zu sehen. Das Gebiet dort war nie gerodet worden, es war nichts als struppiger Wildwuchs, über Hunderte von Meilen hinweg. Manchmal tauchten Rehe auf, grasten direkt am Straßenrand, und von Zeit zu Zeit tappte ein Bär neugierig durch die Gärten, sodass die Leute Angst hatten, hinauszugehen. Aber an diesem Tag schien es Clara, nur für eine Sekunde, sie habe im Dunkel der Bäume etwas Rotes aufblitzen sehen – genau das Rot von Roses Jacke.
Sergeant Barnes und die Leute aus der Stadt hatten den Wald natürlich längst abgesucht; meilenweit hatten sie alles durchkämmt. Aber Rose hätte ihnen ein Schnippchen schlagen können; sie hätte am Anfang erst einmal weit weggehen können, um dann, wenn alle aufgegeben hatten und heimgegangen waren, wieder zurückzukommen.
Mit angehaltenem Atem spähte Clara zu den Bäumen hin. Nichts rührte sich. Ganz behutsam, als ob Rose ein Reh sei und aufgescheucht werden könnte, huschte Clara über die Straße, bis an den Waldsaum. »Rose?«, rief sie leise. Es war nichts zu hören. Keine Bewegung. »Rosie?«, rief sie wieder und ging langsam, vorsichtig in den Wald hinein. Plötzlich blitzte wieder etwas auf, und eine rot geflügelte Amsel flatterte aus einem Baum auf.
Es war also gar nicht Rose gewesen. Aber Clara wurde das Gefühl nicht los, dass es etwas mit ihr zu tun hatte. Vielleicht war es irgendeine geheimnisvolle Botschaft.
Das war der Abend, an dem sie ihre Wache am Fenster begann. Als ihre Mutter ins Wohnzimmer kam, um sie zum Abendessen zu rufen, sagte Clara, sie würde sich von nun an nicht mehr an den Esstisch setzen. Und auch nicht zur Schule gehen. Bis Rose wieder nach Hause kam.
Ihre Mutter begriff es nicht.
»Wieso kannst du vom Fenster weggehen, um die Katze zu füttern, aber nicht dein Abendbrot essen oder zur Schule gehen?«, hatte sie gefragt, die Hände an den Wangen, als hielte sie mit Müh und Not ihren Kopf zusammen.
Sie klang ganz verzweifelt, was wiederum Clara zur Verzweiflung brachte, weil sie nicht wusste, wie sie es erklären sollte. Sie musste Moses füttern und ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, weil sie es Mrs. Orchard versprochen hatte; und sie musste den Rest der Zeit am Fenster stehen bleiben, weil sie Rose sonst verpassen könnte, oder eine Botschaft von Rose. Wer wusste denn, in welcher Form die Botschaft kommen würde? Erst hatte Clara einen Brief erwartet, oder wenigstens eine Postkarte, die so aussah, als sei sie von jemand anders abgeschickt worden, und nur Clara würde merken, von wem sie stammte. Es konnte aber auch etwas ganz anderes sein. Wenn Rose wirklich zurückgekommen war und sich in der Nähe versteckte, würde sie vielleicht mit Clara reden wollen, um herauszufinden, ob es ein günstiger Moment war, sich wieder blicken zu lassen. Und wenn Clara dann nicht auf ihrem Posten war, könnte sie sie verpassen. Aber wie konnte sie ihrer Mutter das erklären, ohne Rose zu verraten? Ihre Mutter würde Sergeant Barnes anrufen, und alle würden noch mal den Wald durchkämmen, und Rose würde endgültig weglaufen und nie mehr wiederkommen.
»Ich muss hier auf Rose warten«, sagte sie schließlich, ohne ihre Mutter anzusehen.
»Liebes«, sagte ihre Mutter, »ich weiß, dass sie dir fehlt, Daddy und mir geht es genauso, aber am Fenster stehen bringt sie uns nicht zurück. Bitte komm und iss ordentlich zu Abend. Ich kann mich jetzt nicht auch noch damit …« Sie stockte, drauf und dran, in Tränen auszubrechen. Clara vergaß zu atmen. Ihr war auf einmal so schwindlig, dass sie umgekippt wäre, wäre ihr Vater nicht hereingekommen.
»Was ist denn hier los?«, fragte er in dem künstlichen Tonfall, den er sich angewöhnt hatte, seit Rose verschwunden war. Clara konnte ihn nicht ansehen, weil sein Gesicht ihr ebenso Angst machte wie das ihrer Mutter. Es war nicht vom Weinen verquollen; stattdessen trug es eine heitere Miene, wie eine Maske, die nicht richtig saß.
Ihr Vater hasste Auseinandersetzungen. Wenn Leute sich stritten, musste er vermitteln, er konnte gar nicht anders. Dann ruderte er beschwörend mit den Armen und sagte so etwas wie: »Momentchen, jetzt beruhigen wir uns erst mal alle wieder. Sehen wir doch mal, ob wir einen Kompromiss finden können.« Oder: »Versuchen wir doch, zu einer Einigung zu kommen. Wer will hier was, fangen wir mal damit an.« Damit trieb er Rose und ihre Mutter regelmäßig zur Weißglut (Rose meinte, total von ihm genervt zu sein, sei das Einzige, was sie und ihre Mutter gemeinsam hätten). In der Schule mischte er sich genauso in jeden Streit ein, sagte Rose, und die Leute wollten ihn am liebsten umbringen. Aber eigentlich war er ziemlich gut im Streitschlichten, fand Clara. Für alle Probleme gebe es eine Lösung, sagte er, es gehe nur darum, sie zu finden, und das schien ihm am Ende auch meistens zu gelingen.
Die Kräche in der Familie fanden immer zwischen Rose und ihrer Mutter statt. Clara hasste Streit ebenso wie ihr Vater; außerdem hatte sie bisher auch noch keinen zum Streiten gefunden. Rose war sowieso nie fies zu ihr, und Clara war so sehr darauf bedacht, ihre Mutter nicht zu ärgern, dass sie nie etwas falsch machte. Daher war es jetzt das erste Mal, dass sie ihrem Vater Grund zum Einschreiten gab. Und sie war ihm dankbar, dass er einschritt.
Ihre Mutter weniger. »Mach, dass du rauskommst!«, fauchte sie ihn an. »Kannst du dich nicht ein einziges Mal raushalten!«
Aber das konnte er nicht. Und er fand eine Lösung, auch wenn es eine Weile dauerte. Sie einigten sich schließlich darauf, dass Clara weiterhin zur Schule und zur üblichen Zeit ins Bett gehen sollte, aber dafür durfte sie ihre Mahlzeiten am Wohnzimmerfenster einnehmen oder wo sonst es ihr beliebte.
»Wie soll sie denn da essen?«, hatte ihre Mutter mit schriller Stimme eingewandt. »Da ist kein Platz für einen Tisch.«
»Wir stellen den Teller einfach aufs Fensterbrett«, sagte ihr Vater ruhig.
»Da fällt er runter! Sieh doch, wie schmal es ist! Die Teller sind zu groß dafür! Das Essen wird über den Boden verstreut sein, soll sie vielleicht vom Boden essen? Wie kannst du nur so lächerliche Vorschläge machen?«
»Wir tun das Essen einfach in eine kleine Schüssel«, entgegnete ihr Vater noch ruhiger. »Probieren wir’s doch wenigstens mal aus, Di, dann sehen wir ja, ob’s geht.«
»Würdest du bitte aufhören, mich so von oben herab zu behandeln? Ich bin deine Frau, nicht dein Kind! Und hör auch endlich auf, so zu tun, als ob …« Claras Mutter brach mitten im Satz ab und verließ den Raum.
Aber die Sache mit dem Essen in der Schüssel klappte bestens, und von da an stand Clara den ganzen Tag – mit Ausnahme der Schlafenszeit, der Schulzeit und der Moses-Fütterzeit – am Fenster und hielt Ausschau nach Rose.
Clara hatte ein eigenes Zimmer, aber dort bewahrte sie nur ihre Sachen auf. Von klein auf hatte sie bei Rose im Zimmer schlafen wollen, dort gab es zwei Betten, und Rose hatte sie gelassen. Manchmal ließ Rose sie sogar bei sich im Bett schlafen, obwohl Clara nun schon fast acht war und es ein bisschen eng wurde. Das war das Allerschönste für sie. Clara versuchte dann wach zu bleiben, um das Gefühl von Rose so dicht neben ihr zu genießen, Roses warmen Atem im Nacken zu spüren, aber sie schlief immer viel zu schnell ein.
Nachdem sie sich die Zähne geputzt, den Pyjama angezogen und ihre Sachen ordentlich auf dem Stuhl in ihrem Zimmer zusammengelegt hatte, ging Clara an dem Abend, als der Mann im Nebenhaus aufgetaucht war, zurück in das Zimmer, das sie sich mit Rose teilte, hob die herumliegenden Klamotten auf und hängte sie in den Schrank, wo sie hingehörten. Dann zog sie ein paar andere wieder heraus, ließ sie neben Roses Bett auf den Boden fallen und rührte sie gewissenhaft mit dem Fuß durcheinander.
Der Kontrast zwischen ihren beiden Seiten des Zimmers war immer ein Witz für sie gewesen: Rose war eine »geborene Schlampe«, wie sie selbst sagte, während Clara eine geborene Ordnungsfanatikerin war. »Geradezu widernatürlich«, pflegte Rose sie aufzuziehen. Roses Seite des Zimmers sah immer aus wie eine Müllhalde. Ihre Mutter hatte es aufgegeben, ihr deswegen Vorhaltungen zu machen. Wenn sie in einem Schweinestall leben wollte, dann war das ihre Sache, sagte ihre Mutter, und sie würde sicher nicht hinter ihr herräumen. Rose hatte das als einen eindeutigen Sieg betrachtet.
An dem Abend, als Rose fortgegangen war, hatte Clara die Sachen ihrer Schwester aufgeräumt, denn es würde ihr doch sicher gefallen, in ein ordentliches Zimmer zurückzukommen, das sie dann wieder verwüsten konnte. Es war ein Fehler gewesen. Das Zimmer hatte so verkehrt ausgesehen, dass Clara nicht schlafen konnte, also stand sie nach einer Weile wieder auf, nahm ein paar von Roses Sachen aus dem Schrank und verstreute sie über den Boden. Von da an veränderte sie das Durcheinander jeden Abend, sodass Rose alles genau so vorfände, wie sie es mochte, wenn sie sich unter dem Schutz der Dunkelheit ins Haus zurückstehlen würde.
Clara stieg ins Bett und kuschelte sich auf ihrer Seite zusammen, dachte an Rose und wünschte, sie käme wieder heim, dachte an den Mann im Nachbarhaus und wünschte, er ginge wieder weg, bis die beiden Dinge irgendwie miteinander verschmolzen und sie einschlief.
Im Schlaf sah sie Rose durch die Dunkelheit wandern. Sie ging sehr langsam, mit nackten Füßen. Erst wandte sie Clara den Rücken zu, aber dann drehte sie sich um, sah sie an und lächelte. Es war aber nicht ihr normales Lächeln. Es war das Lächeln eines Mädchens, das versuchte, so auszusehen, als ob es sich nicht fürchtete.
2 ELIZABETH
Martha macht wieder mal Theater. Ich kann nicht genau verstehen, was sie sagt, aber sie scheint sich über irgendetwas zu beschweren. Heute Morgen hat sie sich schon aufgeregt, als Schwester Roberts zum Fiebermessen kam. Schwester Roberts sagte (und zwinkerte mir dabei zu): »Ganz recht. Es ist eine Schande. So was sollte nicht erlaubt sein. Hier, stecken Sie das mal unter die Zunge, okay?«
Sie hat eine Engelsgeduld mit uns – wie die meisten Schwestern, aber Schwester Roberts ganz besonders. Ein wunderbarer Mensch.
»Nimm doch Vernunft an!«, schimpfte Martha mit der Person in ihrem Kopf, und das Thermometer flog ihr aus dem Mund und landete auf der Decke. Schwester Roberts hob es auf, wischte es mit einem Papiertuch ab und sagte: »Ich will’s versuchen. Wissen Sie was? Sie behalten das hier jetzt zwei Minuten unter der Zunge, und ich versuche, Vernunft anzunehmen. Einverstanden?«
Du hättest dich sofort in sie verliebt, mein Schatz. (Schwester Roberts, meine ich, nicht Martha. Ganz bestimmt nicht Martha!) Du hast dich immer in hübsche junge Frauen verliebt, besonders, wenn sie Grips hatten. Es hat mir nicht das Mindeste ausgemacht.
Übrigens macht mir Marthas Gezeter auch nicht mehr so viel aus wie am Anfang. Die ersten Tage hier ging es mir entsetzlich auf die Nerven, aber man gewöhnt sich an alles. Inzwischen finde ich es ganz unterhaltsam. Ich versuche immer herauszuhören, wann sie komplett abdreht. Manchmal ist sie auch ganz klar im Kopf.
Sie bekommt nie Besuch. Ich allerdings auch nicht. Meine wenigen noch lebenden Freundinnen fahren nicht mehr Auto. Als Diane hörte, dass ich ins Krankenhaus musste, wollte sie mich mit der kleinen Clara besuchen kommen, doch ich habe dankend abgelehnt. Es ist eine furchtbar lange Fahrt, und die Straßen sind in miserablem Zustand. Ich wollte nicht, dass sie sich verpflichtet fühlt. Obwohl ich es jetzt schon ein bisschen bedaure. Ich hatte nicht angenommen, dass sie mich so lange hierbehalten würden, und ich war nicht darauf gefasst, wie endlos sich die Tage im Krankenhaus dehnen.
Aber ich habe ja dich, mein Liebster, also beklage ich mich nicht. Dich und Moses.
Ein Besuch von Moses, das wäre was. Alle hier würden aus ihren Betten hüpfen und versuchen, ihn zu streicheln.
Ich mache mir Sorgen um ihn. Das Katzenfutter muss ja längst verfüttert sein. Diane wird wohl Nachschub besorgt haben, wenn Clara sie darum gebeten hat, aber was soll aus Moses werden, wenn es ganz schlimm kommt und ich hier sterbe? Clara wird ihn adoptieren wollen, aber Diane hat eine Katzenallergie, darum geht es nicht. Ich liege die halbe Nacht wach und mache mir Sorgen. Albern.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich nach Hause sehne. Es sind die ganz alltäglichen Dinge, die ich am meisten vermisse. Wasser aufsetzen. Ein Schwätzchen mit Clara, wenn sie nach der Schule rüberkommt. Ich genieße unsere Unterhaltungen sehr, man weiß nie, wo sie hinführen. Sie lässt mein Herz nicht höherschlagen, wie Liam früher, aber das hat kein anderes Kind je getan.
Clara hat eine ältere Schwester, die in der rebellischen Phase ist und ihren Eltern die Hölle heiß macht, aber Clara ist ein braves Mädchen. Nein, brav ist nicht das richtige Wort. Interessant, manchmal rührend, aber nicht brav. Zum Beispiel ist sie eine waschechte Skeptikerin. Ich kenne sie, seit sie auf der Welt ist, und kaum war sie alt genug, eine Frage zu stellen, hat sie an der Antwort gezweifelt. »Was ist das?«, fragte sie und zeigte auf den Toaster, und wenn man dann sagte, das sei ein Toaster, um das Brot knusprig zu machen, guckte sie einen so von der Seite an, als wollte sie sagen, erzähl mir keinen Quatsch. Für eine Dreijährige war das schon sehr komisch, aber inzwischen ist sie fast acht und eine ausgewachsene Zweiflerin. Als ich ihr sagte, ich müsse ins Krankenhaus, meinte sie: »Wieso das denn?«, als hätte sie mich im Verdacht zu simulieren. Ich sagte, mein Herz sei nicht ganz in Ordnung, doch es sei nichts Ernstes, und ich würde nicht lange wegbleiben. »Wie viele Tage?«, hakte sie nach, und ich sagte, vielleicht ein, zwei Wochen, worauf sie wissen wollte: »Wird Ihr Herz dann wieder in Ordnung sein?« Ich sagte, ich hoffte es. Das war natürlich keine befriedigende Antwort; sie wollte ja oder nein hören, keine Ausflüchte. Ich wechselte schnell das Thema, um Fragen über den Tod zu vermeiden. Ich fragte sie, ob sie Moses füttern und jeden Tag ein bisschen bei ihm bleiben wolle, damit er nicht so einsam wäre, und sie nickte entschlossen.
»Werden Sie einsam sein?«, fragte sie dann, was mich überraschte. So viel Empathie hatte ich ihr gar nicht zugetraut. Ich sagte, wahrscheinlich nicht, weil man im Krankenhaus immer von einer Menge Leuten umgeben sei. Sie dachte einen Moment über meine Antwort nach und beschloss offenbar, sie gelten zu lassen, aber ehrlich gesagt, mein Liebster, bekam ich es auf einmal mit der Angst zu tun. Eine Menge Leute um sich zu haben verhindert nicht, dass man sich einsam fühlt. Ich beschloss, das Bild von dir und Liam mitzunehmen, und dazu das von dir in Charleston – diese beiden Fotos heitern mich immer auf. Sie stehen Seite an Seite auf dem Nachtkästchen neben meinem Bett. Ich brauche nur den Arm danach auszustrecken.
Schwester Roberts findet dich gut aussehend. Ich sagte ihr, sie habe einen guten Geschmack.
Aber zurück zu Clara: Ich bin natürlich nicht der Grund dafür, dass sie so viel Zeit bei mir verbringt. Da mache ich mir nichts vor. Es ist Moses, den sie besuchen kommt. Er mag sie (was ungewöhnlich ist, er ist sonst sehr misstrauisch) und lässt sich sogar manchmal von ihr streicheln. Sie versucht nicht, ihn auf den Arm zu nehmen, was weise ist, es würde ihm nicht gefallen. Meist hockt sie nur da und sieht ihm zu, während er regungslos das Loch in der Fußleiste belauert, hinter dem die Maus wohnt. Moses hat eine lange Fehde mit der Maus laufen. Stundenlang kann er vor dem Mauseloch sitzen, als ginge es ihn gar nichts an, wobei nur sein Schwanzzucken die innere Anspannung verrät. Hin und wieder gibt es eine winzige Bewegung hinter dem Loch, das Aufblitzen eines Schnurrhaars. Ich habe mich gefragt, ob es eine absichtliche Provokation vonseiten der Maus ist – vielleicht hat sie die natürliche Ordnung der Dinge verkehrt und spielt Maus und Katz. Moses erstarrt dann hoffnungsvoll, duckt sich, macht sich ganz flach, sprungbereit. Clara duckt sich ebenfalls, streckt den Kopf vor, entschlossen, keine Sekunde des Dramas zu verpassen. Ich weiß nicht, welchen Ausgang sie sich erhofft. Ich wage nicht zu fragen.
Ich vermisse sie. Wenn ich mir einen Besucher auswählen dürfte, würde ich sie wählen.
Leber zum Mittagessen. Ich hasse Leber. Nicht sehr taktvoll, Leuten, deren eigene Innereien ihnen zu schaffen machen, Innereien zu servieren. Immerhin gab es Apfelkuchen mit Eis zum Nachtisch. Zu wenig Äpfel zwar, aber die Kruste tadellos, und schön süß. Es heißt ja, im Alter entwickele man einen süßen Zahn, und siehe da, es stimmt.
Die Mahlzeiten sind das Einzige, auf das man sich hier freuen kann. Das muss ihnen doch klar sein, warum geben sie sich dann nicht ein bisschen mehr Mühe?
Nach dem Mittagessen habe ich ein Nickerchen gemacht und bin mit dem Gedanken aufgewacht, dass ich nicht Clara wählen würde, wenn ich nur einen Besucher haben könnte, sondern natürlich Liam. Und du wärst schon hier, also wären wir wieder zu dritt, wie damals.
Ein neuer Tag. Dienstag, glaube ich, auch wenn das keinen Unterschied macht. Heute Morgen bin ich hingefallen. Geschieht mir recht, würdest du bestimmt sagen. Sie hatten mich ermahnt, nicht alleine aufzustehen, sondern eine Schwester zu rufen, aber ich musste auf die Toilette, und es war keiner da, also beschloss ich, es zu versuchen. Prompt gaben die Beine unter mir nach, und ich lag am Boden. Martha hatte wohl gerade einen klaren Moment, denn sie sagte: »Ach, du liebe Zeit!«, schlug die Decke zurück und fing selber an, aus dem Bett zu klettern. Ich nehme an, sie wollte mir zu Hilfe eilen, was nett von ihr war, aber albern, sie ist ja in einem viel schlechteren Zustand als ich. Im Handumdrehen landete sie ebenfalls auf dem Boden. Dann fing jemand im Krankensaal an zu schreien, und die Schwestern kamen hereingestürzt, es gab einen Riesenwirbel, bis wir irgendwann wieder in unseren Betten lagen. Ich wisperte Schwester Roberts zu, dass ich immer noch aufs Klo musste, und sie wisperte zurück, sie würde mir eine Bettpfanne bringen. Ich sagte ärgerlich, ohne zu wispern, dass ich Bettpfannen hasste und aufs Klo gehen wollte wie ein zivilisierter Mensch. Sie setzte sich auf die Bettkante, nahm meine Hand und sagte sanft: »Heute nicht, Mrs. Orchard, wo Sie doch gerade hingefallen sind. Warten wir noch ein Weilchen, bis Sie wieder sicherer auf den Beinen sind.«
Es ist schwer, wütend auf jemand zu sein, der so nett ist – aber ich war es.
Ich bin eine alte Kuh. Es ist scheußlich. Das Leben hat keinen Sinn mehr, wenn man den Leuten nur noch zur Last fällt.
Martha war heute Nacht wieder unruhig. Sie schimpfte, vielleicht mit derselben Person wie letztes Mal, er oder sie solle endlich erwachsen werden. Wer das wohl sein mochte? Heute Morgen beschloss ich, sie zu fragen. Geht mich nichts an, ich weiß, aber die Tage sind hier so eintönig, dass man jede Chance auf Ablenkung ergreifen muss. Sonst stirbt man, egal woran man erkrankt ist, am Ende noch vor Langeweile.
Es war beim Frühstück, als wir alle in die Kissen gelehnt saßen. Martha aß Shredded Wheat, du weißt schon, diese kleinen Getreidekissen. Die Schwestern schneiden es ihr klein, aber nicht klein genug, es ragt ihr immer was davon aus dem Mund, wie bei einem Pferd, das Heu frisst, außer dass Pferden keine Milch übers Kinn läuft. Zugegeben, es ist schwer, nicht zu kleckern, wenn man im Bett isst. Man kann sich nicht richtig aufsetzen, weil man die Beine ausgestreckt hat. Außerdem sitzt Marthas Gebiss locker, was nicht gerade hilfreich ist. Die Schwestern legen ihr ein Handtuch um, wie ein Lätzchen, und es ist immer patschnass.
»Auf wen sind Sie denn so zornig?«, fragte ich.
Sie wandte den Kopf und sah mich an. »Wa?«, fragte sie mit vollem Mund. Die Art, wie sie essen, sagt eine Menge über Leute aus, und Marthas Mutter legte offenbar keinen Wert auf Tischmanieren. Meine Manieren sind tadellos, wohlgemerkt. Genau wie deine; deine waren immer absolut perfekt. Du hast selten von dir gesprochen, mein Liebster – genau genommen nie, es sei denn, man drängte dich dazu –, weshalb ich sehr wenig von deiner Jugend weiß, aber ich weiß, dass du überaus gut erzogen wurdest. (Gilt das eigentlich generell für die Briten, oder ist es eine Frage der »Klasse«? Ich habe nie begriffen, wie euer Klassensystem funktioniert oder wie du da reingehörst. Immerhin warst du auf dem Internat, also wohl recht gut betucht. Meiner Meinung nach ist es barbarisch, Kinder ins Internat zu stecken, aber lassen wir das.)
»Sie haben im Schlaf mit jemandem geschimpft«, sagte ich zu Martha. »Ich hab mich nur gefragt, wer das sein mag.«
Sie kaute weiter. Schien darüber nachzudenken. Schluckte ein paarmal, ihr magerer alter Hals arbeitete krampfhaft, wie eine Schlange, die einen Golfball hinunterwürgt.
»Janet«, sagte sie schließlich.
»Wer ist Janet?«
»Meine Schwester.«
»Was hat sie getan, das Sie so wütend macht?«
»Hat sich den Männern an den Hals geworfen, einem nach dem anderen. Schließlich ist sie an einen richtig fiesen, verlogenen Dreckskerl geraten …«
Als sie nichts weiter hinzufügte, fragte ich behutsam: »Und hat sie da wieder rausgefunden? Gab es ein Happy End?«
»Nein«, sagte sie. »Gab es nicht.«
Unehelicher Nachwuchs – das wird es gewesen sein, was Janet passiert war. Ein Schandfleck für die Familie. Ein Bastard. Ein ungewolltes Kind.
Ein »ungewolltes Kind« – allein schon der Gedanke kommt mir vor wie Blasphemie.
Schlafenszeit. Die Nachtschwestern haben ihren Dienst angetreten. Bei Nacht sind sie nur zu zweit. Sie sitzen mitten im Saal an einem Schreibtisch, die Leselampe mit einem Handtuch umwickelt, damit das Licht uns nicht stört. Dem Schnarchen nach zu urteilen, scheinen manche der Patienten tatsächlich die ganze Nacht durchzuschlafen, was ich erstaunlich finde. Ich schaffe selten mehr als zwei, drei Stunden am Stück.