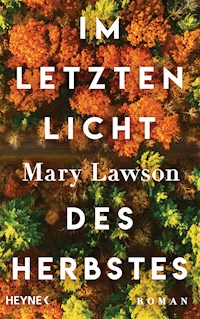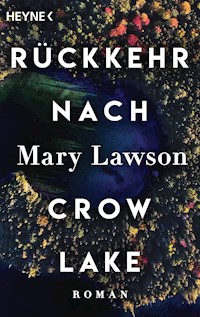
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kates Kindheit im Norden Ontarios endet jäh, als ihre Eltern tödlich verunglücken. Ihre beiden Brüder Luke und Matt beschließen, sie und die kleine Schwester Bo alleine großzuziehen. Halt findet die verschlossene und bildungshungrige Kate vor allem bei Matt, dessen Liebe zur Tier- und Pflanzenwelt auf sie überspringt. Jahre später arbeitet Kate erfolgreich als Biologin an der Universität von Toronto, weit weg von ihrer Heimat. Doch die Geschehnisse von damals schweben immer noch wie ein Schatten über ihr. Als sie für ein Familienfest nach Crow Lake zurückkehrt, gerät ihre Welt erneut aus den Fugen.
»Ein höchst beeindruckendes Debüt. Lassen Sie es sich nicht entgehen.« The New York Times Book Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch:
Crow Lake heißt das kleine Dorf im äußersten Norden von Ontario, wo Kate mit ihren Geschwistern Luke, Matt und Bo inmitten von weiten Feldern und karger Landschaft aufwächst. Das Leben ist nicht leicht, aber erfüllt von familiärer Wärme und Liebe. Eines Tages findet die Idylle ein jähes Ende, als Kates Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen. Die vier Geschwister sind plötzlich auf sich alleine gestellt. Als Kate viele Jahre später eine Einladung zum Geburtstagsfest von Matts Sohn erhält, leben die Ereignisse ihrer Kindheit mit unvermittelter Heftigkeit wieder auf. Mit einem Mal scheint sich zu rächen, dass sie ihre Vergangenheit jahrelang still mit sich herumgetragen hat – nicht einmal ihr Freund Daniel weiß, was Kate im Innersten bewegt. Um mit sich selbst ins Reine zu kommen und die Liebe zu Daniel nicht aufs Spiel zu setzen, ist es für Kate an der Zeit, sich den lang unterdrückten Erinnerungen und Gefühlen zu stellen.
Die Autorin:
Mary Lawson, aufgewachsen in Ontario, lebt seit 1968 in Surrey, England. Mindestens einmal im Jahr reist sie in ihre Heimat Kanada. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Ihr Debüt »Rückkehr nach Crow Lake« war ein internationaler Erfolg und wurde in 20 Länder verkauft. 2006 wurde sie für den Booker Prize nominiert. Ihr neuester Roman, »Im letzten Licht des Herbstes«, ist in Kanada ein Bestseller.
MARY LAWSON
Rückkehr nach Crow Lake
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Lohmann und Andreas Gressmann
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe CROW LAKE erschien erstmals 2002 bei CHATTO & WINDUS / Random House, London. Copyright © 2021 by Mary Lawson Copyright © by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Printed in Germany Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, unter Verwendung von Stocksy / Jill Chen Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-453-28258-5V001www.heyne.de
Für Eleanor, für Nick und Nathaniel, vor allem aber für Richard
ERSTER TEIL
PROLOG
MEINE URGROSSMUTTER Morrison hatte ein kleines Lesepult an ihrem Spinnrad befestigt, damit sie beim Spinnen lesen konnte, so wurde uns erzählt. Und eines Samstagabends war sie so sehr in ihr Buch vertieft, dass sie erst nach Mitternacht wieder aufblickte und feststellen musste, dass sie eine halbe Stunde lang am Tag des Herrn gesponnen hatte. Damals galt das als schwere Sünde.
Diese kleine Familienanekdote erwähne ich nicht bloß um ihrer selbst willen; in letzter Zeit ist mir aufgegangen, dass meine Urgroßmutter und ihr Lesepult eine ganze Menge zu verantworten haben. Sie war schon seit Jahrzehnten unter der Erde, als die Ereignisse über uns hereinbrachen, die unsere Familie zerrissen und unseren Träumen ein Ende setzten, aber das heißt nicht, dass sie keinen Einfluss auf den Ausgang des Geschehens hatte. Was sich zwischen Matt und mir abspielte, lässt sich ohne den Hinweis auf unsere Urgroßmutter kaum erklären. So ist es nur recht und billig, ihr auch einen Teil der Schuld zuzuweisen.
Im Zimmer meiner Eltern hing ein Bild von ihr. Als Kind stand ich oft davor. Ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen, um ihr in die Augen zu sehen. Sie war klein, schmallippig, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem weißen Spitzenkragen (der zweifellos jeden Abend kräftig geschrubbt und dann in aller Herrgottsfrühe gebügelt wurde), und hielt sich stocksteif. Streng sah sie aus, argwöhnisch und vollkommen humorlos. Nun, kein Wunder – sie hatte vierzehn Kinder in dreizehn Jahren bekommen und fünfhundert Hektar dürren Ackerbodens auf der Halbinsel Gaspé zu bewirtschaften. Wie sie da noch die Zeit zum Spinnen fand, geschweige denn zum Lesen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben.
Von uns vieren, Luke, Matt, Bo und mir, war Matt der Einzige, der ihr in irgendeiner Weise ähnlich sah. Wenn auch von seinem Wesen her alles andere als griesgrämig, hatte er doch die gleichen schmalen Lippen und hellgrauen Augen. Wenn ich in der Kirche nicht still saß und einen zurechtweisenden Blick von meiner Mutter erntete, blinzelte ich aus dem Augenwinkel zu Matt hoch, um zu sehen, ob er es mitbekommen hatte. Und jedes Mal machte er dann ein strenges Gesicht, aber im letzten Moment, wenn ich schon anfing zu verzweifeln, zwinkerte er mir doch noch schnell zu.
Matt war zehn Jahre älter als ich, sehr groß und ernst und klug. Seine Leidenschaft waren die Teiche, die sich ein, zwei Meilen hinter den Bahngleisen befanden. Es waren ehemalige Kiesgruben, längst verlassen, seit die Straße fertig ausgebaut war, und von der Natur mit allen möglichen glitschigen Wunderwesen bevölkert. Als Matt begann, mich zu den Teichen mitzunehmen, war ich noch so klein, dass er mich auf den Schultern tragen musste – durch den Wald mit seinem wuchernden Efeu, die Gleise entlang, vorbei an den staubigen Güterwagen, die in langer Reihe auf ihre Ladung Zuckerrüben warteten, und schließlich den steilen Pfad hinab zum Ufer. Dort lagen wir dann auf dem Bauch, während die Sonne uns auf den Rücken brannte, und blickten gespannt in das dunkle Wasser.
Kein Bild aus meiner Kindheit ist mir deutlicher in Erinnerung geblieben; ein Junge um die fünfzehn, neben ihm ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen und braun gebrannten Beinen. Sie liegen beide ganz still, das Kinn auf den Handrücken gestützt. Er zeigt ihr seltsame Dinge. Oder vielmehr, seltsame Dinge zeigen sich ihnen, tauchen aus dem Schatten, unter Steinen auf, und er erzählt ihr mit leiser Stimme von dieser kleinen Wunderwelt.
»Beweg nur ein bisschen den Finger im Wasser, Kate. Dann kommt sie schon her. Sie kann gar nicht anders.«
Vorsichtig wackelt das kleine Mädchen mit dem Finger; vorsichtig gleitet eine kleine Schnappschildkröte herbei, um zu schauen, ob es da was zu holen gibt.
»Siehst du? Sie sind schrecklich neugierig, wenn sie jung sind. Erst die älteren werden misstrauisch und angriffslustig.«
»Warum?« Die alte Wasserschildkröte, die sie einmal an Land festgehalten hatten, wirkte eher schläfrig als misstrauisch. Das faltige, ledrige Köpfchen lud zum Streicheln ein. Matt hielt ihr einen Zweig hin, so dick wie sein Daumen, und sie biss ihn glatt entzwei.
»Diese Sorte Schildkröten hat einen ziemlich kleinen Panzer, der viel von ihrer Haut ungeschützt lässt, und das macht sie nervös.«
Das kleine Mädchen nickt, ihre Zöpfe berühren das Wasser, und winzige Wellen zittern über den Teich. Sie ist völlig vertieft.
Über die Jahre haben wir wohl hunderte von Stunden so verbracht. Ich lernte die Kaulquappen der Leopardenfrösche von den fetten grauen der Ochsenfrösche und den kleinen schwarzen der Kröten zu unterscheiden. Ich kannte die Schildkröten und die Welse, die Wasserläufer und die Molche und die Taumelkäfer, die wie verrückt über der Wasseroberfläche wirbelten. Hunderte von Stunden, während im Wechsel der Jahreszeiten das Leben im Teich viele Male erstarb und sich erneuerte und ich langsam zu groß wurde, um auf Matts Schultern zu reiten, und stattdessen hinter ihm her durch den Wald stapfte. Natürlich nahm ich den Wechsel gar nicht bewusst wahr – er vollzog sich ganz allmählich, und Kinder haben ja keine Vorstellung von Zeit. Bis morgen ist es ewig lang hin, und Jahre vergehen wie im Flug.
1
ALS DAS ENDE KAM, kam es scheinbar völlig unvorbereitet, und erst sehr viel später erkannte ich, dass ihm eine ganze Reihe von Ereignissen vorausgegangen waren. Einige der Ereignisse hatten gar nichts mit uns, den Morrisons, zu tun, sondern einzig und allein mit den Pyes, die gut eine Meile entfernt von uns wohnten und unsere nächsten Nachbarn waren. Die Pyes hatten schon immer so ihre Probleme, vorsichtig gesagt; aber in jenem Jahr eskalierten die Probleme in dem großen alten, grau gestrichenen Holzhaus derart, dass sie zu einem Albtraum wurden. Nur schwante uns damals noch nichts davon, wie schicksalhaft sich der Traum der Morrisons mit dem Albtraum der Pyes verflechten würde. Nein, das hätte wahrhaftig niemand vorhersehen können.
Natürlich kann die Suche nach dem Anfang einer Geschichte unendlich weit in die Vergangenheit zurückführen, bis zu Adam und Eva, und noch weiter. Aber in unserer Familie ereignete sich in jenem Sommer eine Katastrophe, die als Beginn von allem Folgenden anzusehen ist. Es passierte an einem heißen, ruhigen Sommertag im Juli, als ich sieben Jahre alt war, und setzte dem normalen Familienleben ein jähes Ende; auch heute noch, neunzehn Jahre später, will es mir nicht gelingen, irgendeinen tieferen Sinn dahinter zu erkennen.
Als einzig Positives ließe sich vielleicht sagen, dass alles wenigstens in gehobener Stimmung zu Ende ging, denn am Tag zuvor – dem letzten, den wir gemeinsam verbrachten – hatten meine Eltern erfahren, dass Luke, mein ältester Bruder, sein Examen bestanden und einen Ausbildungsplatz am Lehrerseminar erhalten hatte. Lukes Erfolg kam einigermaßen überraschend, da er so gar nichts von einem Musterschüler hatte. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass jedes Familienmitglied eine ganz bestimmte Rolle zugewiesen bekommt – »der Kluge«, »die Niedliche«, »der Eigenbrötler« –, und wenn man die Rolle eine Zeit lang gespielt hat, wird man sie nicht wieder los, ganz egal, wie man sich entwickelt; nur im Anfangsstadium habe man die Möglichkeit, Einfluss auf die Wahl der Rolle zu nehmen. Wenn die Theorie zutrifft, dann muss Luke sich schon frühzeitig dafür entschieden haben, »das Problemkind« sein zu wollen. Ich weiß nicht, was ihn zu dieser Wahl bewogen hat, aber vielleicht hat er sich die Geschichte von der Urgroßmutter und ihrem berühmten Lesepult zu sehr zu Herzen genommen. Diese Geschichte muss der Fluch seines Lebens gewesen sein – oder einer der Flüche –, der andere war dann wohl, jemanden wie Matt als Bruder zu haben. Matt war so offensichtlich der geistige Erbe unserer Urgroßmutter, dass es für Luke gar keinen Sinn mehr hatte, sich überhaupt noch groß anzustrengen. Dann also lieber herausfinden, worin seine eigene Stärke lag – unsere Eltern zur Weißglut zu bringen, beispielsweise – und immer schön in dieser Richtung weiterüben.
Trotzdem hatte er nun aber mit neunzehn sein Examen bestanden. Nach drei Generationen eifrigen Bemühens war ein Mitglied der Familie Morrison drauf und dran, den höheren Bildungsweg einzuschlagen.
Was nicht nur für die Familie etwas Neues war, sondern wohl auch für ganz Crow Lake, das kleine Bauerndorf im nördlichen Ontario, wo wir vier geboren und aufgewachsen sind. Damals war Crow Lake bloß durch eine ungeteerte Straße und ein Bahngleis mit der Außenwelt verbunden. Die Züge hielten auf Winkzeichen, und die Straße führte nur nach Süden, da es keinen Grund gab, noch weiter nach Norden zu fahren. Abgesehen von etwa einem Dutzend Farmen, einem Gemischtwarenladen und ein paar bescheidenen Häusern am See, gab es dort nichts außer der Kirche und der Schule. Im Lauf seiner Geschichte hatte der Ort, wie gesagt, nicht eben viele Gelehrte hervorgebracht, und Lukes Leistung hätte in der Kirchenpostille am nächsten Sonntag bestimmt Schlagzeilen gemacht, wäre nicht vorher die Katastrophe passiert, die unsere Familie zerstörte.
Luke muss die Nachricht von seiner Zulassung zum Lehrerstudium am Freitagmorgen erhalten haben, worauf er es unserer Mutter erzählte, die dann sofort unseren Vater in der Bank anrief, wo er arbeitete, in Struan, zwanzig Meilen weit entfernt. Das allein war schon unerhört; unter keinen Umständen hatte eine Hausfrau ihren Mann bei der Arbeit zu stören, wenn es sich um Schreibtischarbeit handelte. Aber sie rief ihn an, und die beiden beschlossen dann wohl, uns anderen die große Neuigkeit beim Abendessen zu verkünden.
Oft habe ich seitdem an jene Mahlzeit zurückgedacht, nicht so sehr wegen Lukes überraschender Erfolgsmeldung, sondern weil es unser letztes gemeinsames Familienmahl sein sollte. Ich weiß, Erinnerungen sind trügerisch, und eingebildete Ereignisse können einem so echt vorkommen wie wirkliche, aber ich könnte schwören, dass ich jedes Detail dieses Essens im Gedächtnis behalten habe. Im Rückblick bestürzt mich am meisten, wie gewöhnlich alles war. Nur nichts hochspielen, war das Motto bei uns. Gefühlsregungen, auch positive, wurden strikt im Zaum gehalten. Es war das elfte Gebot, auf eine eigene Gesetzestafel gemeißelt, speziell für Presbyterianer: Du sollst nicht deine Gefühle zeigen.
So verlief dieses Abendessen genau wie jedes andere auch, ziemlich förmlich und langweilig, nur ab und zu aufgelockert durch Bo. Es gibt ein paar Fotos von Bo aus dieser Zeit. Sie war klein und rund und hatte hellblondes Flaumhaar, das ihr senkrecht vom Kopf abstand, als hätte sie der Blitz getroffen. Auf den Fotos sieht sie lieb und friedlich aus, was nur beweist, wie sehr Kameras lügen können.
Wir saßen alle auf unseren angestammten Plätzen, Luke und Matt, neunzehn und siebzehn Jahre alt, an der einen Tischseite, ich, sieben Jahre, und Bo, eineinhalb, an der anderen. Ich weiß noch, wie mein Vater mit dem Tischgebet begann und prompt von Bo unterbrochen wurde, die ihren Saft verlangte, und wie meine Mutter sagte: »Gleich, Bo. Jetzt mach die Augen zu.« Mein Vater setzte erneut an, und Bo krähte wieder dazwischen, und meine Mutter sagte: »Noch ein Mucks, und du kommst sofort ins Bett« – worauf Bo den Daumen in den Mund steckte und trotzig vor sich hin schmatzte wie eine tickende Zeitbombe.
»Wir wollen es noch mal versuchen, Herr«, sagte mein Vater. »Wir danken dir für dieses Mahl, das du uns heute Abend beschert hast, und wir danken dir besonders für die gute Neuigkeit, die wir heute erhalten haben. Hilf uns, dass wir unser großes Glück immer zu schätzen wissen. Hilf uns, das Beste aus unseren Gaben zu machen und die kleinen Talente, die wir haben mögen, stets zu deinem Dienst zu verwenden. Amen.«
Luke und Matt und ich reckten uns. Meine Mutter reichte Bo den Saft.
»Was für eine gute Neuigkeit?«, fragte Matt. Er saß mir direkt gegenüber. Wenn ich auf die Stuhlkante rutschte und das Bein ausstreckte, konnte ich mit meinem Zeh an sein Knie tippen.
»Dein Bruder« – mein Vater nickte zu Luke hin – »ist am Lehrerseminar angenommen worden. Heute kam die Zusage.«
»Echt, kein Witz?« Matt sah Luke an.
Ich tat es ihm nach. Ich weiß nicht, ob ich Luke vorher je richtig angesehen hatte, ihn überhaupt je richtig beachtet hatte, meine ich. Irgendwie hatten wir nicht viel miteinander zu tun. Unser Altersunterschied war größer als der zwischen mir und Matt, aber ich glaube nicht, dass es nur daran lag. Wir hatten einfach wenig Gemeinsamkeiten.
Aber jetzt beachtete ich ihn, wie er da neben Matt saß, wie vermutlich jeden Tag in den letzten siebzehn Jahren. In gewisser Weise waren sie sich sehr ähnlich – es war nicht zu übersehen, dass sie Brüder waren: beide hoch aufgeschossen und blond, mit der typischen langen Morrison-Nase und den grauen Augen. Aber in der Statur unterschieden sie sich deutlich. Luke war breitschultrig und stämmig und wog gut dreißig Pfund mehr als Matt. Er war eher bedächtig und kraftvoll, Matt agil und flink.
»Kein Witz?«, wiederholte Matt mit absichtlich übertriebener Verwunderung. Luke warf ihm einen schrägen Blick zu. Matt grinste. »Ist ja fabelhaft! Gratuliere!«
Luke zuckte die Schultern. Ich fragte: »Wirst du jetzt Lehrer?« Ich konnte es mir nicht vorstellen. Lehrer waren Respektspersonen. Luke war einfach nur Luke.
»Sieht ganz so aus«, sagte Luke.
Er lümmelte mit dem Ellbogen auf dem Tisch, aber heute wies mein Vater ihn nicht zurecht. Matt saß auch krumm, hatte sich aber doch nicht ganz so breit hingefleezt, weshalb er im Vergleich zu Luke immer noch relativ aufrecht wirkte.
»Er kann wirklich von Glück sagen«, bemerkte meine Mutter. Sie gab sich solche Mühe, allen unschicklichen Stolz auf ihren Sohn zu verbergen, dass sie fast mürrisch klang. Sie teilte das Essen aus – Koteletts von den Tadworth-Schweinen, Kartoffeln, Karotten und Buschbohnen von der Pye-Farm, Apfelmus von Mr. Jamies knorrigen alten Spalierbäumen. »Nicht jeder bekommt so eine Chance geboten, wirklich nicht. Hier, Bo, das ist für dich. Und iss ordentlich, hörst du? Nicht mit dem Essen spielen.«
»Wann soll’s denn losgehen?«, fragte Matt. »Und wohin? Toronto?«
»Mhm. Ende September.«
Bo angelte sich eine Hand voll Bohnen von ihrem Teller und presste sie sich quietschvergnügt an die Brust.
»Wir werden dir wohl einen Anzug kaufen müssen«, sagte meine Mutter zu Luke. Sie sah meinen Vater an. »Er braucht doch einen Anzug, oder?«
»Ich weiß nicht«, sagte mein Vater.
»Aber natürlich braucht er einen«, mischte sich Matt ein. »Er wird ganz allerliebst aussehen im Anzug.«
Luke schnaubte bloß. Trotz ihrer Verschiedenheit, trotz der Tatsache, dass Luke ständig in Schwierigkeiten geriet und Matt nie, gab es selten Streit zwischen ihnen. Sie neigten beide nicht zu Wutausbrüchen, und jeder von ihnen lebte mehr oder minder in seiner eigenen Welt, sodass es wenig Reibungspunkte gab. Wenn es dennoch mal zu einer Auseinandersetzung kam, gingen die sorgsam gezügelten Gefühle schlagartig mit ihnen durch und überrannten das elfte Gebot. Aus irgendeinem Grund aber schien das Raufen gar nicht gegen die Regeln zu verstoßen – vielleicht hielten meine Eltern es für normales Benehmen unter Halbstarken, vielleicht sagten sie sich, wenn der Herrgott nicht gewollt hätte, dass sie sich prügeln, hätte er ihnen keine Fäuste gegeben. Doch einmal, als er in der Hitze des Gefechts gegen den Türrahmen geknallt war, sagte Luke: »Verdammter Scheißkerl!«, und musste dann zur Strafe eine Woche lang in der Küche im Stehen essen.
Ich war die Einzige, die es bei ihren Rangeleien mit der Angst zu tun bekam. Matt war der Schnellere, aber Luke war viel stärker, und ich befürchtete immer, dass einer seiner gewaltigen Faustschläge eines Tages zu gut treffen und Matt umbringen könnte. Ich fing dann stets an zu kreischen, sie sollten aufhören, und mein Geschrei ging meinen Eltern so auf die Nerven, dass zumeist ich es war, die auf ihr Zimmer geschickt wurde.
»Was er auf jeden Fall brauchen wird«, überlegte mein Vater, »ist ein Koffer.«
»Oh«, sagte meine Mutter und hielt im Kartoffelaufgeben inne. »Ein Koffer. Jaja, natürlich.«
Ich sah, wie ihr Gesicht auf einmal traurig wurde. Ich hörte auf, an meinem Kotelett herumzusäbeln, und beäugte sie ängstlich. Wahrscheinlich hatte sie bis zu diesem Moment gar nicht recht begriffen, dass Luke fortgehen würde.
Bo summte vor sich hin und wiegte ihre Brechbohnen zärtlich im Arm. »Baby, Baby«, sang sie leise. »Baby Baby Baby Bohnen.«
»Tu sie auf den Teller zurück«, sagte meine Mutter mit abwesender Miene, und der Löffel schwebte immer noch über der Schüssel. »Die Bohnen sind zum Essen da. Leg sie hin, dann schneid ich sie dir klein.«
Bo machte ein missbilligendes Gesicht, schrie auf und drückte die Bohnen leidenschaftlich an ihre Brust.
»Herrje!«, sagte meine Mutter. »Jetzt aber Schluss. Ich hab genug von deinem Theater.«
Was immer sich in ihrer Miene gespiegelt hatte, jetzt war es verflogen, und alles war wieder wie sonst. »Wir müssen in die Stadt fahren«, sagte sie zu meinem Vater. »Einen Koffer kaufen. Am besten gleich morgen.«
Also machten sie sich am Samstag auf den Weg nach Struan. Eigentlich hätten sie nicht unbedingt zusammen hinfahren müssen. Jeder von ihnen hätte genauso gut allein einen Koffer aussuchen können. Und sie hätten auch nicht gleich an jenem Wochenende fahren müssen – Lukes Seminar begann erst in sechs Wochen.
Aber ich nehme an, sie wollten einfach gerne in die Stadt fahren. So seltsam das bei derart vernunftbetonten Leuten scheinen mag, sie waren wohl doch ganz schön aufgeregt. Immerhin war es ihr Sohn, ein Morrison, der sich nun anschickte, Lehrer zu werden.
Sie wollten Bo und mich nicht mitnehmen, und natürlich waren wir noch zu klein, um allein zu Hause zu bleiben, also warteten sie, bis Luke und Matt von Calvin Pyes Farm zurückkehrten. Die beiden halfen dort immer am Wochenende und in den Ferien aus. Mr. und Mrs. Pye hatten selbst drei Kinder, aber zwei davon waren Mädchen, und Laurie, der Sohn, war erst vierzehn und zu jung für schwere Arbeit, sodass Mr. Pye gezwungen war, zusätzliche Hilfskräfte aus der Nachbarschaft anzuheuern.
Matt und Luke kamen gegen vier nach Hause. Meine Eltern fragten Luke, ob er mitkommen wollte, um sich seinen Koffer selbst auszusuchen, aber er sagte Nein, ihm sei heiß und er wolle lieber schwimmen gehen.
Ich glaube, ich war die Einzige, die ihnen nachwinkte. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, später, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, mich nicht mal von ihnen verabschiedet zu haben – aber es kommt mir doch wie eine echte Erinnerung vor. Die anderen drei winkten nicht, denn Bo war außer sich vor Wut, nicht mitzudürfen, und Matt und Luke starrten Bo finster an und überlegten, wer von ihnen sie für den Rest des Tages auf dem Hals haben würde.
Der Wagen rollte auf die Straße und verschwand aus unserem Blickfeld. Bo ließ sich auf den Kies der Auffahrt fallen und plärrte nach Leibeskräften.
»Also, ich geh jedenfalls schwimmen«, sagte Luke laut, um Bo zu übertönen. »Mir ist heiß, und ich hab den ganzen verdammten Tag lang geschuftet.«
»Ich auch«, sagte Matt.
»Ich auch«, sekundierte ich.
Matt stupste Bos Windelpo mit dem Zeh an. »Und du, Bo? Hast du auch den ganzen verdammten Tag lang geschuftet?«
Bo brüllte.
Luke sagte: »Warum muss sie bloß dauernd so einen Terror machen?«
»Sie weiß halt, wie man dich glücklich macht«, grinste Matt. Er bückte sich, zog ihr den Daumen aus der geballten Faust und stopfte ihr damit den Mund. »Na, wie wär’s, Bo? Möchtest du mit zum Baden kommen?«
Sie nickte und wimmerte hinter ihrem Fäustchen.
Es muss das erste Mal gewesen sein, dass wir zusammen baden gingen, alle vier. Der See lag keine zwanzig Meter vom Haus entfernt, also sprang man einfach rein, wenn einem gerade danach war, und das war bisher anscheinend nie bei uns allen zur gleichen Zeit vorgekommen. Auf jeden Fall war es sonst immer meine Mutter, die Bo auf dem Arm trug. Jetzt wechselten wir uns ab, warfen sie uns gegenseitig zu wie einen Wasserball, und es machte uns allen Spaß, daran erinnere ich mich noch gut.
Ich erinnere mich auch, dass Sally McLean sich zu uns gesellte, als wir aus dem Wasser kamen. Mr. und Mrs. McLean besaßen den einzigen Laden in Crow Lake, und Sally war ihre Tochter. In den letzten Wochen hatte sie sich häufig bei uns blicken lassen, aber immer so, als wäre sie auf dem Weg irgendwohin und nur zufällig in der Nähe. Das war seltsam, da es nichts gab, wohin sie hätte unterwegs sein können.
Unser Haus war das letzte am Ort und schon ein ganzes Stück abgelegen; dahinter kam nichts mehr als dreitausend Meilen Einöde bis zum Nordpol.
Luke und Matt hatten Kiesel übers Wasser springen lassen, doch als Sally erschien, hörte Matt auf, setzte sich neben mich und sah mir zu, wie ich Bo eingrub. Bo war noch nie eingegraben worden und ganz entzückt. Ich hatte ihr eine Kuhle im warmen Sand gebuddelt, und da saß sie nun drin, rund und braun und nackt wie ein Ei, und beobachtete glückstrahlend, wie ich den Sand um sie herum aufhäufte.
Sally McLean war immer langsamer gegangen, je mehr sie sich Luke näherte, um schließlich ein paar Meter vor ihm stehen zu bleiben; die eine Hüfte herausgestemmt, stand sie da und zog mit dem Zeh Striche in den Sand. Sie und Luke unterhielten sich leise und stockend, ohne sich anzusehen. Ich achtete nicht weiter auf sie. Ich hatte Bo bis an die Achseln vergraben und dekorierte nun den glatt geklopften Sandhaufen ringsum mit Kieselsteinen, die Bo immer wieder herausklaubte und an die falschen Stellen zurücksteckte.
»Lass das, Bo«, sagte ich. »Ich mach doch ein Muster.«
»Erbsen«, sagte Bo.
»Nein, das sind keine Erbsen. Das sind Kiesel. Die kann man nicht essen.«
Sie steckte einen in den Mund.
»Pfui bäh!«, sagte ich. »Spuck ihn aus!«
»Dummes Ding«, sagte Matt. Er beugte sich herüber, drückte Bos Pausbacken zusammen, bis ihr der Schnabel aufklappte, und fischte das Steinchen heraus. Sie grinste, schob den Daumen in den Mund, zog ihn wieder vor und schaute ihn an. Er war ganz glibberig vor Spucke und Sand. »Bohnen«, sagte sie zufrieden und schob ihn wieder hinein.
»So, jetzt hat sie Sand im Mund«, sagte ich.
»Daran stirbt sie nicht.«
Er beobachtete Luke und Sally. Luke ließ immer noch Steine übers Wasser springen, gab sich jetzt aber mehr Mühe damit, wählte sorgfältig die flachsten aus. Sally strich sich ständig die Haare zurück. Lang und dick und kupferrot war ihre Mähne, und die Seebrise lupfte immer wieder kleine Strähnen daraus und blies sie ihr übers Gesicht.
Ich fand die beiden reichlich langweilig, aber Matt musterte sie mit der gleichen Aufmerksamkeit, mit der er sonst die Lebewesen in den Teichen beobachtete.
Sein Interesse weckte meine Neugier. »Was macht die hier überhaupt? Wo will die denn hin?«
Er antwortete nicht gleich. »Ich vermute mal, es hat was mit Luke zu tun«, sagte er schließlich.
»Was? Wieso denn mit Luke?«
Er kniff die Augen zusammen. »Weiß nicht genau. Soll ich mal raten?«
»Ja!«
»Es ist nur so eine Idee, aber überall, wo Luke hingeht, taucht Sally auf. Also nehme ich an, sie ist in ihn verliebt.«
»In Luke verliebt?«
»Kaum zu glauben, was? Aber Frauen sind da halt komisch, Katie.«
»Aber ist Luke denn in sie verliebt?«
»Keine Ahnung. Kann sein.«
Nach einer Weile zog Sally dann wieder ab, und Luke kam vom Ufer herauf, stirnrunzelnd, mit gesenktem Blick. Matt sah mich an und hob warnend die Brauen, was wohl heißen sollte, dass ich gut daran täte, das Thema Sally McLean nicht anzusprechen.
Wir buddelten Bo aus ihrem Grabhügel aus, klopften ihr den Sand ab und trugen sie zum Anziehen zurück ins Haus. Dann ging ich noch mal nach draußen, um meinen Badeanzug auf die Leine zu hängen, sodass ich es war, die das Polizeiauto in die Einfahrt einbiegen sah.
Ich lief ihm neugierig entgegen, denn Polizeiautos bekam man in Crow Lake höchst selten zu sehen. Der Polizist stieg aus, und zu meiner Überraschung dann auch noch Reverend Mitchell und Dr. Christopherson. Reverend Mitchell war unser Pfarrer, und seine Tochter Janie war meine beste Freundin. Dr. Christopherson wohnte in Struan, aber er war unser Hausarzt – ohnehin der einzige Arzt im Umkreis von hundert Meilen. Ich mochte sie beide gern. Der Doktor hatte einen irischen Setter namens Molly, der Blaubeeren mit den Zähnen pflücken konnte und Dr. Christopherson stets auf seinen Runden begleitete. Ich hopste auf sie zu und sagte: »Mum und Dad sind nicht da. Sie sind einkaufen gefahren, einen Koffer für Luke, der wird jetzt nämlich Lehrer.«
Der Polizist stand neben seinem Auto und starrte auf einen kleinen Kratzer am Kotflügel. Reverend Mitchell blickte Dr. Christopherson an, dann wieder mich und fragte: »Ist Luke da, Katherine? Oder Matt?«
»Sie sind beide da«, nickte ich eifrig. »Sie ziehen sich gerade um. Wir sind baden gewesen.«
»Wir müssten mal mit ihnen reden. Kannst du ihnen sagen, dass wir hier sind?«
»Na klar!« Dann besann ich mich auf meine Manieren. »Möchten Sie nicht hereinkommen? Mum und Dad sind gegen halb sieben wieder zurück.« Mir fiel noch etwas ein. »Ich könnte Ihnen eine Tasse Tee machen.«
»Dank dir«, sagte Reverend Mitchell. »Wir kommen gern rein, aber ich glaube, Tee … nein, danke, im Moment lieber nicht.«
Ich führte sie ins Haus und entschuldigte mich für den Krach, den Bo mal wieder veranstaltete – sie hatte alle Töpfe und Pfannen aus dem unteren Schrankfach gezogen und schepperte damit auf dem Küchenboden herum. Aber das mache doch nichts, sagten sie, also ließ ich sie im Esszimmer stehen und holte Luke und Matt. Die beiden blickten die zwei Männer verwundert an – der Polizist war draußen beim Wagen geblieben – und sagten hallo. Und plötzlich veränderte sich Matts Gesichtsausdruck. Auf einmal schaute er nicht mehr nur höflich fragend, sondern furchtbar erschrocken.
»Was ist los?«, sagte er.
Dr. Christopherson wandte sich zu mir. »Kate, könntest du vielleicht mal nach Bo sehen? Vielleicht mal ein bisschen, ähm …?«
Ich ging in die Küche. Bo tat nichts Unrechtes, doch ich nahm sie auf den Arm und schleppte sie nach draußen. Allmählich wurde sie ziemlich schwer, und ich konnte sie nur noch mit Mühe tragen. Ich nahm sie wieder mit zum Strand. Die Stechmücken wurden langsam lästig, aber ich blieb trotzdem dort hocken, selbst als Bo zu knatschen anfing, weil Matts Miene mir Angst gemacht hatte und ich nicht wissen wollte, was der Grund dafür war.
Nach langer Zeit, mindestens eine halbe Stunde später, kamen Matt und Luke zu uns an den Strand. Ich sah sie nicht an. Luke hob Bo auf die Schultern und ging langsam mit ihr die weite Bucht entlang. Matt setzte sich neben mich, und als Luke und Bo ein gutes Stück entfernt waren, sagte er mir, dass unsere Eltern tödlich verunglückt seien, beim Zusammenstoß mit einem voll beladenen Holzlaster, dessen Bremsen am Honister Hill versagt hatten.
Ich erinnere mich, dass ich entsetzliche Angst hatte, er könnte jeden Moment in Tränen ausbrechen. Seine Stimme zitterte, und er rang heftig um Fassung, und ich war ganz starr vor Angst, wagte nicht, zu ihm aufzublicken, wagte kaum zu atmen. Als ob das schlimmer als alles andere wäre, weit schlimmer als das Unfassbare, was er mir da erzählte. Als ob ein weinender Matt das einzig wirklich Unvorstellbare wäre.
2
Erinnerungen. Eigentlich brauche ich sie nicht. Nicht, dass es nicht auch ein paar nette gäbe, aber insgesamt würde ich sie lieber in eine Kiste stopfen, und Deckel zu. Und tatsächlich ist mir das bis vor zwei Monaten auch recht gut gelungen. Ich musste schließlich mit meinem eigenen Leben klarkommen. Ich hatte meine Arbeit, und ich hatte Daniel, und beides nahm viel Zeit und Energie in Anspruch. Zugegeben, in beiden Bereichen lief es seit einiger Zeit nicht mehr so gut, aber es kam mir nie in den Sinn, dies in Zusammenhang mit der »Vergangenheit« zu bringen. Bis vor zwei Monaten hatte ich wirklich das Gefühl, all das längst hinter mir gelassen zu haben. Ich fand mein Leben in Ordnung, so wie es war.
Aber dann, im letzten Februar, fand ich einen Brief von Matt vor, als ich eines Freitagabends von der Arbeit nach Hause kam. Ich sah die Handschrift, und augenblicklich sah ich Matt vor mir – man weiß ja, wie die Handschrift immer sogleich den Schreiber heraufbeschwört. Und ebenso prompt kam der alte Schmerz zurück, ein dumpfes Ziehen in der Brust, wie Trauer um etwas unwiederbringlich Verlorenes. In all den Jahren war der Schmerz kein bisschen schwächer geworden.
Ich klemmte meine mit Laborberichten voll gestopfte Tasche unter den Arm und öffnete den Brief, noch während ich die Treppe hinaufstieg. Es war dann aber gar kein richtiger Brief, sondern eine Karte von Simon, Matts Sohn, der mich zu seinem achtzehnten Geburtstag Ende April einlud. Beigefügt eine kleine, hastig hingekritzelte Notiz von Matt: »Du musst kommen, Kate!! Keine Ausreden!!!« Fünf Ausrufezeichen insgesamt. Und dann noch ein taktvolles PS: »Bring ruhig jemanden mit, wenn du möchtest.«
Hinter dem Zettel steckte ein Foto. Es war von Simon, aber zuerst dachte ich, es sei von Matt. Matt mit achtzehn. Sie sehen sich verblüffend ähnlich. Und natürlich schwemmte das den ganzen Bodensatz von Erinnerungen an jenes Jahr mit seinen unheilvollen Ereignissen hoch. Und das wiederum brachte mich auf die alte Geschichte von Urgroßmutter Morrison und ihrem Lesepult. Arme alte Urgroßmutter. Ihr Bild hängt jetzt in meinem Schlafzimmer. Ich hatte es mitgenommen, als ich von zu Hause fortging. Niemand schien es zu vermissen.
Ich stellte meine Tasche auf dem Tisch im Wohnzimmer ab und setzte mich, um die Einladung noch mal zu lesen. Natürlich würde ich hinfahren. Simon ist ein lieber Junge, und ich bin schließlich seine Tante. Luke und Bo würden auch dort sein – es würde ein Familientreffen werden, und ich habe nichts gegen Familientreffen. Keine Frage, ich würde hinfahren. An dem betreffenden Wochenende sollte zwar eine Konferenz in Montreal stattfinden, zu der ich mich schon angemeldet hatte, aber ich hatte dort keinen Vortrag zu halten, also konnte ich genauso gut wieder absagen. Und da ich am Freitagnachmittag keine Seminare hatte, konnte ich auch gleich nach dem Mittagessen los. Einfach auf den Highway 400 und ab in Richtung Norden. Es ist eine Strecke von vierhundert Meilen, immer noch eine lange Fahrt, obwohl die meisten Straßen mittlerweile asphaltiert sind. Nur auf den letzten Kilometern, wenn man von der Hauptstraße nach Westen abbiegt und die Teerstraße in Holperwege durch immer dichteren Wald mündet, hat man wirklich das Gefühl, in die Vergangenheit zurückzureisen.
Und was »jemanden mitbringen« anging – nein. Daniel würde nur zu gern mitkommen, Daniel verzehrte sich vor Neugier auf meine Familie und wäre bestimmt überglücklich, mitzukommen, aber sein naiver Enthusiasmus war einfach mehr, als ich verkraften konnte. Nein, ich würde Daniel nicht zu der Geburtstagsparty einladen.
Ich blickte auf das Foto, sah Simon, sah Matt, und ich wusste genau, wie es laufen würde. Sehr gut nämlich; alles würde glatt laufen. Die Party würde laut und fröhlich sein, das Essen fabelhaft, wir würden alle viel lachen und uns gegenseitig auf die Schippe nehmen. Luke und Matt und Bo und ich würden über die alten Zeiten reden, aber manche Dinge würden wir aussparen, manche Namen unerwähnt lassen. Calvin Pye zum Beispiel. Oder auch Laurie Pye.
Ich würde Simon ein teures Geschenk überreichen, als Zeichen meiner Zuneigung zu ihm, die echt war, und als Beweis meines unverbrüchlichen Familiensinns.
Am Sonntagnachmittag, wenn ich dann wieder aufbrechen musste, würde Matt mich nach draußen zu meinem Wagen begleiten. Er würde sagen: »Irgendwie finden wir nie Zeit zum Reden«, und ich würde sagen: »Ja, komisch, nicht?«
Ich würde ihn anschauen, und er würde aus Urgroßmutter Morrisons ruhigen grauen Augen zurückschauen, und ich würde wegschauen müssen. Und auf halbem Weg nach Hause würde ich merken, dass ich weinte, und die nächsten Wochen unentwegt darüber nachgrübeln, warum.
* * *
Es führt alles immer wieder zurück zur Urgroßmutter.
Mühelos kann ich sie mir in vertraulichem Zwiegespräch mit Matt vorstellen. Die Urgroßmutter sitzt stocksteif in einem Sessel mit hoher Lehne, und Matt sitzt ihr gegenüber. Er hört ihr aufmerksam zu, nickt, wenn er ihr zustimmt, wartet höflich darauf, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, wenn er ihre Meinung nicht teilt. Er ist respektvoll, aber nicht von ihr eingeschüchtert, und das gefällt ihr. Ich kann es in ihren Augen sehen.
Seltsam, nicht wahr? Denn natürlich haben sie sich im wirklichen Leben niemals getroffen. Obgleich unsere Urgroßmutter ein hohes Alter erreichte, war sie längst tot, als Matt auf die Welt kam. Sie hat uns nie besucht – hat die Ufer von Gaspé überhaupt nie verlassen –, und doch hatte ich als Kind oft das Gefühl, dass sie auf geheimnisvolle Weise bei uns war. Ihr Einfluss war allgegenwärtig; sie hätte sich ebenso gut im Zimmer nebenan aufhalten können. Und was sie und Matt betrifft – ich glaube, ich spürte schon in jungen Jahren, dass es eine tiefere Verbindung zwischen ihnen gab, auch wenn ich nicht hätte sagen können, worin genau sie bestand.
Mein Vater erzählte uns viel von ihr – weit mehr als von seiner eigenen Mutter. Leider war er kein sehr begabter Erzähler; bei den Geschichten ging es meistens darum, irgendein moralisches Prinzip zu veranschaulichen. Wie zum Beispiel bei der Geschichte über die Protestanten und die Katholiken, über die Reibereien zwischen den verschiedenen Konfessionen in der Gemeinde, die zu Prügeleien zwischen rivalisierenden Jungenbanden führten. Die beiden Seiten waren damals anscheinend ungleich stark – es gab mehr Protestanten als Katholiken –, also entschied die Urgroßmutter, dass ihre Söhne »auf der anderen Seite« kämpfen müssten, um ein bisschen für Ausgleich zu sorgen. Fairplay war in dem Fall die Lehre, die wir daraus zu ziehen hatten. Keine Prügelszenen, kein Blut, keine Heldentaten, nur diese eine dürre Lehre: Fairplay.
Und dann war da noch der berühmte Bildungshunger der Urgroßmutter. Alle ihre vierzehn Kinder hatten die Volksschule abgeschlossen, was in jenen Zeiten höchst ungewöhnlich war. Schularbeiten waren wichtiger als Feldarbeit – ungeachtet der Tatsache, dass alles, was es zu essen gab, dem Ackerboden abgerungen werden musste. Doch Bildung war nun einmal ihr Lebenstraum, eine Leidenschaft, die fast schon krankhaft war, und sie steckte damit nicht nur ihre eigenen Kinder an, sondern ganze Generationen von noch ungeborenen Morrisons.
Wenn er von ihr sprach, stellte unser Vater sie immer als großes Vorbild hin, gerecht, gütig und weise wie Salomon – mir fiel es nur schwer, dieses Bild mit dem Foto von ihr in Einklang zu bringen. Auf dem Foto wirkt sie einfach nur wie ein Dragoner. Man sieht sofort, wieso es keine Geschichten über irgendwelche Streiche ihrer Kinder gibt.
Und wo war eigentlich ihr Mann, unser Urgroßvater, die ganze Zeit? Draußen auf dem Feld, nahm ich an. Irgendwer musste sich ja darum kümmern.
Aber wir wussten alle, dass sie eine bedeutende Frau war, nicht einmal das mangelhafte Erzähltalent unseres Vaters konnte das verbergen. Matt fragte einmal, was für Bücher sie denn so auf ihr Lesepult gestellt hatte, abgesehen von der Bibel natürlich. Er wollte wissen, ob sie Romane las – Charles Dickens vielleicht, oder Jane Austen. Doch unser Vater sagte, Literatur interessierte sie nicht, nicht einmal Weltliteratur. Sie wollte nicht aus der Wirklichkeit »flüchten«, sie wollte sich bilden. Sie las Bücher über Geologie, über das Leben der Pflanzen, über das Sonnensystem; eins dieser Werke hieß Die Spuren der Schöpfung, es handelte von der geologischen Entwicklung der Erde, und mein Vater erinnerte sich, wie sie darüber perplex den Kopf schüttelte. Es war nur ein Vorläufer von Darwin, aber wie dieser nicht ganz in Einklang mit den Lehren der Bibel. Man konnte daran sehen, sagte unser Vater, wie sehr sie das Wissen verehrte, denn obwohl es sie beunruhigte, verwehrte sie den Kindern und Enkeln nicht, es zu lesen.
Vieles von dem, was in den Büchern stand, ging sicher weit über ihren Horizont – sie hatte selber nie eine Schule besucht –, aber sie las trotzdem immer weiter, bemühte sich, alles zu verstehen. Selbst als Kind hat mich das beeindruckt. Jetzt finde ich es rührend, solch ein Wissensdurst, solch eine Beharrlichkeit neben all der Plackerei tagein, tagaus; bewundernswert und traurig. Die Urgroßmutter war eine geborene Wissenschaftlerin, zu einer Zeit und an einem Ort, wo der Begriff noch völlig unbekannt war.
Aber sie hatte auch Erfolg. Gewiss war unser Vater ihr Ein und Alles, denn durch ihn sah sie ihren Traum von Bildung und der Befreiung vom Bauerndasein allmählich Gestalt annehmen. Er war der jüngste Sohn ihres jüngsten Sohnes; seine Brüder übernahmen seinen Teil der Landarbeit, damit er die höhere Schule abschließen konnte, als Erster in der ganzen Familie. Er hatte in jedem Fach die besten Noten; ich kann mir gut vorstellen, wie die Urgroßmutter mit verbissenem Stolz am Kopf der Festtafel thronte! Nach der Examensfeier packten sie ihm einen Rucksack – ein Paar saubere Socken, ein Taschentuch, ein Stück Seife und sein Abschlusszeugnis – und schickten ihn hinaus in die Welt, um das Beste aus seinen Gaben zu machen.
Er schlug den Weg nach Süden ein, reiste von Stadt zu Stadt, nahm Arbeit an, wo er sie finden konnte, immer das breite blaue Band des St. Lawrence entlang. Als er Toronto erreichte, blieb er einige Zeit, aber nicht lange. Vielleicht war die Großstadt ihm unheimlich – die vielen Menschen, der Lärm –, obwohl ich ihn nicht als zart besaitet in Erinnerung habe. Wahrscheinlich fand er das Stadtleben einfach oberflächlich und frivol.
Wieder unterwegs, machte er sich gen Nordwesten auf, fort von der so genannten Zivilisation; gerade erst dreiundzwanzig, ließ er sich schließlich in Crow Lake nieder, einer kleinen Dorfgemeinde ähnlich der, die er tausend Meilen weit hinter sich gelassen hatte.
Als ich alt genug war, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, schien mir, die Familie meines Vaters müsste doch ziemlich enttäuscht darüber gewesen sein, dass er in einem solchen Nest hängen blieb, bis mir irgendwann klar wurde, dass sie seine Wahl eigentlich nur billigen konnten, denn trotz des bescheidenen Ortes unterschied sein neues Leben sich ganz beträchtlich von dem früheren. Er hatte einen Job bei einer Bank in Struan, trug einen Anzug bei der Arbeit, besaß ein Auto und baute sich ein schlichtes, kühles, von Bäumen beschattetes Haus am See, weit weg vom Schmutz und den Fliegen der Bauernhöfe. Im Wohnzimmer seines Hauses hatte er ein Regal voller Bücher, und was noch ungewöhnlicher war, er hatte auch die Muße, sie zu lesen. Wenn er sich in einem Bauerndorf angesiedelt hatte, dann deshalb, weil er sich in den Wertvorstellungen aufgehoben fühlte, die er dort vorfand. Das Entscheidende war, dass er überhaupt eine Wahl hatte. Das war es, was sie für ihn erkämpft hatten.
Die Bank gestand meinem Vater zwei Wochen Jahresurlaub zu (den ersten Urlaub, den jemals jemand in der Familie bekommen hatte), und ein Jahr, nachdem er sich in Crow Lake niedergelassen hatte, nutzte er diesen Urlaub, um nach Gaspé zurückzukehren und seiner Jugendliebe einen Antrag zu machen. Sie stammte von einem Nachbarhof und, genau wie er, aus einer soliden schottischen Sippschaft. Sie muss wohl auch den gleichen Sinn fürs Abenteuer besessen haben, denn sie nahm seinen Antrag an und kam als seine Braut mit nach Crow Lake. Es gibt ein Foto von ihnen an ihrem Hochzeitstag. Sie stehen im Portal der kleinen Kirche am Ufer von Gaspé; zwei hoch gewachsene, kräftige, blonde, ernsthafte Menschen, die ebenso gut Geschwister hätten sein können. Ihre Ernsthaftigkeit offenbart sich in ihrem Lächeln. Aufrichtig, direkt, aber von Grund auf ernst. Sie bilden sich nicht ein, ihr Leben würde leicht sein – sie sind nicht dazu erzogen worden, so etwas zu erwarten –, aber sie trauen sich zu, es anzugehen. Sie werden ihr Bestes geben.
So reisten sie denn miteinander nach Crow Lake und gründeten ihren Hausstand und setzten im Lauf der Zeit vier Kinder in die Welt: zwei Jungen, Luke und Matt, und dann nach zehn Jahren und sicher reiflicher Überlegung noch zwei Mädchen: mich (Katherine, Kate genannt) und Elizabeth, die wir Bo riefen.
Liebten sie uns? Selbstverständlich. Sagten sie uns das auch? Selbstverständlich nicht. Obwohl, so ganz stimmt das nicht – meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass sie mich liebte. Ich hatte irgendwas verbrochen – es war so eine Phase, in der ich ständig etwas anstellte –, und sie war böse auf mich und redete tagelang nicht mehr mit mir (so empfand ich es jedenfalls, vermutlich waren es bloß ein paar Stunden). Und schließlich fragte ich sie ängstlich: »Mummy, hast du mich noch lieb?« Sie sah mich überrascht an und sagte nur: »Über die Maßen.« Ich wusste nicht, was »über die Maßen« hieß, aber instinktiv begriff ich es doch und war beruhigt. Ich bin heute noch beruhigt.
Irgendwann, wahrscheinlich bereits ganz zu Anfang, schlug mein Vater einen Nagel in die Wand des Elternschlafzimmers und hängte das Bild von Urgroßmutter Morrison daran, und wir alle wuchsen unter der Schirmherrschaft ihres strengen Blicks und ihrer hochfliegenden Träume auf. Was aus meiner Sicht nicht unbedingt zur Gemütlichkeit beitrug. Ich war immer überzeugt, dass sie uns alle skeptisch beäugte, mit einer Ausnahme. An ihrer Miene konnte ich sehen, dass sie Luke für einen Faulpelz hielt, mich für eine Träumerin und Bo für einen unverbesserlichen Sturkopf. Ihre harten alten Augen, so schien es mir, zeigten nur dann einen Anflug von Sanftheit, wenn Matt das Zimmer betrat. Dann änderte sich ihr Gesichtsausdruck, und man konnte ihr ansehen, was sie dachte. Der hier, dachte sie, der ist goldrichtig.
* * *
Es fällt mir schwer, mich an die Tage zu erinnern, die unmittelbar auf den Unfall folgten. Meist tauchen nur einzelne Bilder vor meinem inneren Auge auf, erstarrt in der Zeit, wie auf Fotografien. Das Wohnzimmer zum Beispiel – ich erinnere mich, was für ein Durcheinander es war. In der ersten Nacht schliefen wir dort alle vier; Bo wollte sich wahrscheinlich nicht ins Bett bringen lassen, also schleppten Luke und Matt dann Bos Kinderbett und drei Matratzen ins Wohnzimmer.
Ich sehe mich noch wach liegen und ins Dunkel starren. Ich versuchte einzuschlafen, doch es gelang nicht, und die Zeit wollte nicht vergehen. Ich wusste, dass Luke und Matt ebenfalls wach lagen, aber aus irgendeinem Grund traute ich mich nicht, mit ihnen zu sprechen, und so zog die Nacht sich endlos hin.
Andere Dinge schienen sich dauernd zu wiederholen, aber im Rückblick bin ich mir nicht sicher, ob es mir nur so vorkam. Wie Luke zum Beispiel in der Haustür stand, mit Bo auf dem Arm, und mit der freien Hand eine große, zugedeckte Schüssel von irgendwem entgegennimmt. Ich weiß, dass es passiert ist, aber in meiner Erinnerung verbrachte er praktisch die ganzen ersten Tage in dieser Haltung. Obwohl das auch durchaus möglich wäre – jede Hausfrau in der Gemeinde wird die Ärmel aufgekrempelt und zu kochen angefangen haben, als sie die Nachricht hörte. Kartoffelsalat wurde in Mengen abgeliefert, und ganze Schinkenkeulen und nahrhafte Eintöpfe, obwohl es viel zu heiß für solches Essen war. Jedes Mal, wenn man aus der Tür trat, stolperte man über einen Korb Erbsen oder einen Bottich Rhabarberkompott.
Und Luke mit Bo auf dem Arm. Trug er sie in jenen ersten Tagen wirklich ununterbrochen herum? So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ich nehme an, die Stimmung im Haus hatte sich auf sie übertragen, und sie vermisste unsere Mutter und weinte, wenn er sie absetzte.
Ich selbst wich Matt nicht von der Seite. Ich klammerte mich an seine Hand oder seinen Ärmel oder seine Jeans, was immer ich zu fassen bekam. Ich war sieben. Eigentlich zu alt für solches Benehmen, aber ich konnte es nicht lassen. Ich erinnere mich, wie er sich sanft aus meinem Griff löste, wenn er zur Toilette musste, und sagte: »Warte mal, Katie, ich bin gleich wieder da.« Ich stand dann an der verschlossenen Badezimmertür und fragte mit bebender Stimme: »Bist du fertig?«
Ich kann mir nicht vorstellen, wie jene ersten Tage für Luke und Matt gewesen sein müssen; die Vorbereitungen für die Beerdigung, die vielen Anrufe, die Beileidsbesuche von Nachbarn, die gut gemeinten Hilfsangebote, das Problem, Bo und mich zu versorgen. Die Verwirrung und Beklommenheit, ganz zu schweigen von der Trauer. Und natürlich wurde die Trauer verschwiegen. Wir waren ja schließlich die Kinder unserer Eltern.
Es kamen auch ein paar Anrufe aus der Gaspé-Gegend oder aus Labrador, von den verschiedenen Linien der Familie. Diejenigen ohne eigenes Telefon riefen von öffentlichen Fernsprechern aus an, und man konnte die Münzen durchrasseln hören und schnaufenden Atem, während der unbeholfene Anrufer, der keine Übung im Telefonieren hatte, krampfhaft nach den richtigen Worten suchte.
»Hier ist Onkel Jamie.« Ein hohles Bellen aus dem wilden, fernen Labrador.
»Ach ja, hallo«, von Luke.
»Ich rufe an wegen deinen Eltern.« Er hatte eine mächtige Lunge. Onkel Jamie. Luke musste den Hörer auf Armeslänge vom Ohr weg halten, und Matt konnte am anderen Ende des Zimmers jedes Wort verstehen.
»Ja. Danke.«
Peinliches, rauschendes Schweigen.
»Spreche ich mit Luke? Dem Ältesten?«
»Ja. Luke.«
Weiteres Schweigen.
Luke, weniger verlegen als einfach nur müde: »Nett von dir, dass du anrufst, Onkel Jamie.«
»Nun ja, ja. Schreckliche Sache, mein Junge, schreckliche Sache.«
Im Wesentlichen schien es bei all diesen Anrufen darum zu gehen, dass wir uns keine Sorgen um die Zukunft machen sollten. Die Familie würde sich um alles kümmern. Nur keine Bange. Tante Annie, eine von den drei Schwestern meines Vaters, würde so bald wie möglich zu uns kommen, obwohl sie es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zur Beerdigung schaffen würde. Ob wir Kinder noch ein paar Tage allein durchhalten könnten?
Ich hatte Glück, dass ich noch zu jung war, um zu verstehen, was in diesen Anrufen mitschwang. Ich wusste nur, dass sie Luke und Matt beunruhigten, denn hinterher, sobald sie den Hörer aufgelegt hatten, standen sie noch eine Weile wie angewurzelt da und starrten grübelnd aufs Telefon. Luke hatte die Angewohnheit, sich mit den Händen durchs Haar zu fahren, wenn er aufgewühlt war, und in den Tagen und Wochen nach dem Unfall sahen seine Haare aus wie ein gut gepflügtes Kornfeld.
Ich erinnere mich, wie mir schlagartig aufging, als ich ihn im Kinderzimmer nach sauberen Sachen für Bo durch die Schubladen wühlen sah, dass ich Luke nicht mehr kannte. Er war nicht mehr der Gleiche wie noch vor ein paar Tagen – der halb trotzige, halb verlegene Junge, der es mit Ach und Krach ins Lehrerseminar geschafft hatte –, und ich wusste nicht mehr, wer er war. Ich wusste nicht, dass Menschen sich ändern konnten. Aber ich hatte ja auch nicht gewusst, dass Menschen sterben konnten. Zumindest nicht die Menschen, die man liebte und brauchte. Theoretisch wusste ich, was der Tod war, aber in der Praxis – nein. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass so etwas wirklich passieren konnte.