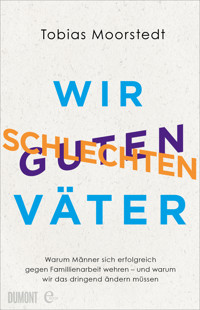8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Erdbeben, H1N1-Virus, Piraten, die Kriminalitätsrate in Kapstadt, die Kampfhundplage in Hoyerswerda – der Mensch im 21. Jahrhundert schwebt offenbar ständig in Lebensgefahr. Doch nicht jede Katastrophe, vor der uns die Medien aufgeregt warnen, sollte man auch zu 100 Prozent ernst nehmen. Eine gesunde Portion Skepsis und Ironie könne nicht schaden, meinen Tobias Moorstedt und Jakob Schrenk und raten: Im Notfall Buch aufschlagen. Denn dort ist nicht nur zu lesen, wie man einen potenziellen Selbstmordattentäter erkennt, sondern auch, wie unbegründet unsere Angst vor ebendiesen Terroristen doch ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Tobias Moorstedt • Jakob Schrenk
Im Notfall Buch aufschlagen
Tipps für alle möglichen Katastrophen
Über dieses Buch
Erdbeben, H1N1-Virus, Piraten, die Kriminalitätsrate in Kapstadt, die Kampfhundplage in Hoyerswerda – der Mensch im 21. Jahrhundert schwebt offenbar ständig in Lebensgefahr. Doch nicht jede Katastrophe, vor der uns die Medien aufgeregt warnen, sollte man auch zu 100 Prozent ernst nehmen. Eine gesunde Portion Skepsis und Ironie könne nicht schaden, meinen Tobias Moorstedt und Jakob Schrenk und raten: Im Notfall Buch aufschlagen. Denn dort ist nicht nur zu lesen, wie man einen potenziellen Selbstmordattentäter erkennt, sondern auch, wie unbegründet unsere Angst vor ebendiesen Terroristen doch ist.
Vita
Tobias Moorstedt, Jahrgang 1977, arbeitet als freier Journalist, u. a. für die «Süddeutsche Zeitung», «spiegel.de», die «taz» und ARD. Bei Suhrkamp erschien sein Buch «Jeffersons Erben. Wie die digitalen Medien die Politik verändern» (2008).
Jakob Schrenk, Jahrgang 1977, ist Redakteur bei «NEON». 2007 erschien bei DuMont sein Buch «Die Kunst der Selbstausbeutung».
Im Rowohlt Taschenbuch Verlag haben sie 2009 gemeinsam «Das Jetzikon» veröffentlicht.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Umschlagabbildung: © FinePic®, München)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62730-9 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-44251-1
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
EINLEITUNG
01. Einbrecher MY HOME IS MY CASTLE
02. Fliegen SICHER IN DER STRATOSPHÄRE
03. Geiselnahme EMOTIONALES KIDNAPPING
04. Sintflut NOAHS ERBEN
05. Jugendgewalt DAS EISENKINN
06. Katastrophenfilm (I) LEKTIONEN DER LEINWAND (I)
07. Sicherheitswahn KATASTROPHENPÄDAGOGIK
08. Piraten FREIGEISTER UND FREIBEUTER
09. Sturz SCHULE DES SCHEITERNS
10. Grubenunglück DER MUT DER MINEURE
11. Historisches Unglück (I) VOLKSHOCHSCHULE DER VERGANGENHEIT I
12. Viren KENNE DIE KEIME
13. Briefbombe NACHRICHT AUS DER HÖLLE
14. Sport 1. FC BLUTGRÄTSCHE
15. Lebensmittelvergiftung DIE GEFAHR IM KÜHLREGAL
16. Meteoriten KRIEG DEN STERNEN
17. Krisenkommunikation GRAMMATIK DER NOT
18. Überlebenskünstler (I) HANDREICHUNGEN DER HELDEN (I)
19. Atomkrieg A WIE ANGST
20. Zivilisationszusammenbruch DAS LEBEN OHNE STADTWERKE
21. Bienen MAJAS BÖSE SCHWESTERN
22. Krankenhauskeime DO-IT-YOURSELF-OP
23. Sicherheitskontrolle ANTI-TERROR-TERROR
24. Katastrophenfilm (II) LEKTIONEN DER LEINWAND (II)
25. Wirtschaftskrise FINANZIELLE SELBSTVERTEIDIGUNG
26. Rocker DIE WIKINGER DER A8
27. Haushalt DIE WOHNUNG ALS SARG
28. Zombies Z-Day
29. Historisches Unglück (II) VOLKSHOCHSCHULE DER VERGANGENHEIT II
30. Polizeigewalt WIR SIND DAS VOLK
31. Schweinegrippe INFEKTIONEN UND IMAGE
32. Aliens KOSMISCHES KAUDERWELSCH
33. Hai VOLL AUF DIE FRESSE
34. Männer IM BETT MIT DEM MONSTER
35. Handys Die Echte Sicherheits-Software
36. Überlebenskünstler (II) HANDREICHUNGEN DER HELDEN (II)
37. Massenpanik DER MENSCH ALS ELEMENTARTEILCHEN
38. Straßenverkehr HELM AUF IM AUTO
39. Panikattacken NUR DIE RUHE
40. Roboter MASCHINENFRÜHLING
41. Gerüchte MYTHOS UND WAHRHEIT
42. Versicherungsvertreter TOTALE SICHERHEIT
43. Historisches Unglück (III) VOLKSHOCHSCHULE DER VERGANGENHEIT (III)
44. Hungersnot AM BUSEN DER NATUR
45. Fehlentscheidungen DER FRÜHE TOD DES SINGLES
46. Eiswasser DER RETTENDE BART
47. Hakenwürmer MISSBRAUCH DER GASTFREUNDSCHAFT
48. Klimawandel ROLLENDE MANGELLANDSCHAFT
49. Wirbelsturm WIDER DIE WETTERFEE
50. Überlebenskünstler (III) HANDREICHUNGEN DER HELDEN (III)
51. Stillstand und Stau ADAC UND APOKALYPSE
52. Esoterik DER TAG DANACH
53. Lawinen DER WEISSE TOD
54. Videospiele MENSCH-ENTSPANN-DICH-DOCH
55. Kampfhunde DER BISS DES BESTEN FREUNDES
56. Al-Qaida DER BLICK DES BODYGUARD
57. Mitmenschen SCHLAGENDES ARGUMENT
58. Raubtiere DER VORGARTEN ALS WILDPARK
59. Katastrophenfilm (III) LEKTIONEN DER LEINWAND (III)
60. Lohnarbeit DER KILLER IM BÜRO
61. Superhelden ANSCHLUSS UNTER DIESER NUMMER
62. Freier Fall DEEP IMPACT
63. Apokalypse THE DAY AFTER
EINLEITUNG
Im Herbst 2009 leuchtete die Weltkarte tiefrot. Die rasche Ausbreitung des H1N1-Virus von Mexiko über die USA und Kanada bis nach Mitteleuropa schürte die Angst vor einer neuen Supergrippe und einer tödlichen Pandemie. Die Fernsehsender und Internetzeitungen präsentierten den Siegeszug der neuen Grippe auf einem digitalen Globus, nannten Zahlen über Infektionen und Todesfälle und färbten jedes Land, in dem die Grippe bestätigt worden war, blutrot ein. Dem Zuschauer vor dem Bildschirm musste angst und bange werden, denn noch nie konnte er eine potenzielle Bedrohung derart vom globalen Horizont auf sich zu rollen sehen. Die steigende Zahl der Infizierten, die Pandemiestufen der Weltgesundheitsorganisation (1 bis 6), der Bodycount (schon 4 deutsche Opfer, schon 7, 11, 15, 23) – Panik schien die angemessene Reaktion zu sein.
Im Winter und Frühjahr 2010 wiederholte sich das Spektakel noch einmal. Und der Medienkonsument weiß: Neuartige Viren sind nicht die einzige Gefahr. Eine Boeing 747 stürzt über dem Atlantik ab. Ganze Landstriche werden von Erdbeben verwüstet. Es gibt Terroralarm und Tsunami-Warnungen, Piraten am Horn von Afrika und Amok laufende Teenager in S-Bahnen. Zu allem Überfluss verrät eine TV-Dokumentation mit dem schönen Titel Todesfalle Haushalt, dass die «meisten Unfälle in den eigenen vier Wänden passieren»: ein Fehltritt in der Dusche, ein tödlicher Stromschlag aus dem Toaster oder ein Handy-Akku, der fünf Zentimeter neben dem Ohr explodiert. Game over.
Der Mensch schwebt im 21. Jahrhundert offenbar in jeder Lebenslage in Gefahr, ist umstellt von Warnschildern und Gefahrenmeldern, deren Neonfarben grell und bedrohlich leuchten wie die Augen des Säbelzahntigers vor der Höhle des Steinzeitmenschen.
Eigentlich haben wir es im Vergleich zu unseren Vorfahren ja ganz gut, bekommen bereits vom Kinderarzt eine Spritze gegen diverse Krankheiten (und einen Lutscher!), können uns gegen Unfälle und Unglücke versichern lassen, und die Säbelzahntiger sind auch längst ausgestorben. Weil wir aber nicht nur mit Augen, Ohren und dem sechsten Sinn unsere unmittelbare Umgebung nach potenziellen Bedrohungen abtasten, sondern dank Satellitentechnik über Zwischenfälle auf der ganzen Welt informiert werden, ist das Gefühl der Gefährdung stärker denn je. Wissen ist Kontrolle, sagen manche Philosophen und Security-Dienstleister, aber in Wahrheit ist wohl das Gegenteil der Fall: Informationen sind Irritationen. Das Wissen über Naturkatastrophen in der Karibik, die Kriminalitätsrate in Kapstadt oder die Kampfhundplage in Hoyerswerda steigert nicht unsere tatsächliche Sicherheit, sondern führt uns vor allem vor Augen, was theoretisch alles schiefgehen und passieren kann und dass auf die Zukunft kein Verlass ist. Durch die Maschen unserer Sicherheitsnetze blicken wir in den dunklen Abgrund und fürchten uns sehr.
In diesem Buch berichten wir von Zombies, Piraten, Schlägern und dem gefährlichsten Tier der Welt (Löwe? Kobra? Nilpferd? Alles falsch!). Aber wir wollen Ihnen keine Angst machen. Im Gegenteil. Das Buch ist als unterhaltsame Konfrontationstherapie konzipiert, bei der man nicht nur lernt, wie man einen potenziellen Selbstmordattentäter erkennt, sondern auch, wie unbegründet unsere Angst vor ebendiesen Terroristen doch ist. Interessanter als Statistiken über neue Todesviren und die Terrorwarnstufe ist die Angst selbst. So gibt es zum Beispiel regelrechte Konjunkturen und Moden der Angst: Die Wikinger hatten Angst, dass sie am Ende der scheibenförmigen Welt mit ihren Schiffen ins Nichts stürzen, im Mittelalter fürchtete man Dämonen und Hexen. Im 21. Jahrhundert ist der böse Blick unsere kleinste Sorge, stattdessen zittern wir vor dem unsichtbaren Systemfehler, dem Virus, Kurzschluss oder einer Terrorzelle.
Aber sind unsere Horror- und Worst-Case-Szenarien wirklich rationaler und aufgeklärter als die Ängste und der Aberglauben des Mittelalters? Vielleicht liegen wir ja schon wieder falsch und erschaffen moderne Mythen-Monster. Wir fürchten uns vor Pestiziden, Zusatzstoffen und anderen Horrorchemikalien in Lebensmitteln. Für wesentlich gefährlicher halten Lebensmittelexperten jedoch zum Beispiel Campylobacter-Infektionen. Das weitgehend unbekannte Bakterium lebt und vermehrt sich in Geflügel, Milch oder Hackfleisch und verursacht jährlich bei zehntausenden Deutschen Darmentzündungen und manchmal auch Lähmungen. Ist «die Natur» mit ihren flauschigen Kleinstlebewesen und Erregern vielleicht viel bedrohlicher als «die Chemie» (→ Lebensmittelvergiftung, S. 72)? Die ziemlich öde Feld-Wald-und-Wiesen-Grippe sorgt in Deutschland für 10 000 Tote pro Jahr, trotzdem hat das H1N1-Virus mit maximal 300 Opfern ein Schlagzeilen-Abonnement (→ Viren, S. 58). Und wer weiß schon, dass der gefährlichste Teil einer Flugreise die Autofahrt zum Airport ist (→ Fliegen, S. 20)?
Es ist noch gar nicht so lange her, da glaubte der Mensch, dass die großen Entscheidungen über Leben, Tod, Ausstattung der Vorratskammer und Höhe des Kontostands allein in der Hand Gottes lagen. Das war naiv, aber auch ganz bequem. Wenn die Blockhütte an einem verregneten Herbsttag mal wieder von einem manisch-depressiven Fluss mitgerissen wurde, war das eben Schicksal, nicht zu ändern und niemand musste sich deshalb Vorwürfe machen (→ Sintflut, S. 28). So einfach haben wir es heute nicht mehr. Ein Mensch, der einen Hai-Angriff knapp überlebt hat, wird sich gleich nach der rettenden OP die Frage gefallen lassen müssen, wieso er die Warnungen der Rettungsschwimmer nicht beachtet hat – und warum es ihm eigentlich nicht gelungen ist, das ziemlich wehleidige Tier durch ein paar gezielte Hiebe aufs Auge zu vertreiben (→ Hai, S. 150).
Menschen versuchen sich mit Alarmanlagen, Schutzimpfungen und Versicherungen vor den Gefahren der Gegenwart zu schützen. Aber egal, wie viel Geld oder Energie man in die Risikovorsorge investiert, es gibt immer etwas, an das man nicht gedacht hat, etwas, das schiefläuft. Auch ein Leser, der alle Tipps in diesem Buch auswendig gelernt hat, wird nicht ewig leben. Und nicht jedes Problem lässt sich mit den fünf Spiegelstrichen einer Powerpoint-Präsentation lösen.
Der moderne Individualist versteht sich als Drehbuchschreiber seines eigenen Lebens, will jede Entscheidung selbst treffen, hält schon den Tag-Nacht-Wechsel für eine krasse Zumutung (weil er ihn nicht beeinflussen kann) und erträgt nur schwer die Vorstellung, dass ein PKW-Unfall oder Meteoriteneinschlag sein ganz persönliches Biopic sehr plötzlich beenden kann. Wir wollen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft kontrollieren, aber der gefällt es nun einmal, uns zu überraschen. Niemand, der sich in den fünfziger Jahren einen Kühlschrank kaufte oder sich wenig später die Haare mit Spray zu einer Elvis-Tolle auftoupierte, ahnte, dass er mit dieser Entscheidung die Ozonschicht unserer Atmosphäre zerstörte. Das Waldsterben, vor dem sich in den achtziger Jahren jeder vernünftige Mensch fürchtete, ist dagegen ausgeblieben.
Es ist eben kompliziert. Manchmal entsteht aus der präventiven Maßnahme zur Gefahrenvermeidung sogar eine neue Gefahr. Weil nach dem 11. September in Amerika niemand mehr in ein Flugzeug steigen wollte und alle Auto fuhren, stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle drastisch an (→ Sicherheitswahn, S. 40).
Dieses Buch ist für Abenteurer und Angsthasen gedacht, für Heimwerker und Hausmenschen, harte Kerle und Menschen mit weichen Knien. Es ist ein Sicherheitshinweis für das Leben in der Risikogesellschaft. Wir zeigen, wie man einen Panic Room im Eigenheim installiert (→ Einbrecher, S. 15) und eine Begegnung mit einem Hund heil übersteht (→ Kampfhunde, S. 234), warnen aber trotzdem davor, einen Schutzschild aus Dienstleistungen, Vorkehrungen und Notfallplänen zu basteln. Wer sich in Schaumstoff einwickelt, verliert den Kontakt zum Leben.
Nicht das Wissen über Gefahren schafft Kontrolle, sondern die Fähigkeit, die Informationen in einen Kontext stellen, einordnen und bewerten zu können. Nicht jede Gefahr, vor der uns Frau Mama, die Bild-Zeitung (oder dieses Buch) aufgeregt warnen, sollte man auch zu 100 Prozent ernst nehmen. Skepsis und Ironie können nicht schaden. Und manchmal ist ein Schulterzucken schon die beste Prävention. (Nehmen Sie dafür eine lockere, entspannte Haltung ein, die Beine stehen hüftbreit auseinander. Halten Sie die Ellbogen eng am Körper und heben Sie jetzt beide Schultern so hoch es geht an. Führen Sie dabei Unterarm und Hände seitlich vom Körper weg. Die Handinnenflächen zeigen nach oben.)
Auf den folgenden Seiten werden Sie unter anderem die besten Selbstverteidigungstricks der Welt erlernen und erfahren, was Sie gegen einen Roboterangriff tun können. Unser bester Ratschlag aber heißt: Keine Panik!
01. Einbrecher MY HOME IS MY CASTLE
Schutz vor ungebetenen (und gegebenenfalls auch gebetenen) Gästen: Der Panic Room ist das neueste Interieur-Statussymbol.
In Städten wie New York, São Paulo oder Moskau werden Luxusapartments nicht mehr mit der «guten Lage» und dem «edlen Stuck» beworben, oder mit Features wie Pool, Personal und Panoramafenster, sondern mit dem Zusatz: «Safe Room installed». Der Panic Room, eine kleine Zelle, in der sich Bewohner vor Einbrechern und Entführern verstecken können, ist das neue Statussymbol. Nachrichten von Terroranschlägen und Geiselnahmen sind ein idealer Werbespot für Firmen, die verstärkte Türen und Bunker-Komplettpakete anbieten und die heute das beste Geschäft seit der Kubakrise machen. Ende 2009 wurde zum Beispiel der dänische Künstler Kurt Westergaard, der eine Karikatur des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte und deshalb auf der schwarzen Liste islamischer Extremisten gelandet war, in seinem Eigenheim von einem mit einer Axt bewaffneten Somalier angegriffen. Kurt Westergaard rettete sich in seinen Safe Room und alarmierte mit dem Handy die Polizei. Der Angreiferwurde verhaftet, während er vergebens versuchte, die Tür aufzubrechen.
Das alte Sprichwort «My home is my castle» wird zunehmend wörtlich genommen. Genau wie mittelalterliche Burgherren, die sich nicht nur auf die hohen Burgmauern verließen, sondern im Inneren der Burg eine uneinnehmbare Zitadelle mit Quelle, Vorräten und geheimen Fluchtwegen anlegten, leisten sich immer mehr Hauseigentümer einen Schutzraum im Eigenheim. Dabei handelt es sich nicht um einen großräumigen Bunker, wie ihn im 20. Jahrhundert viele Menschen im Keller eingerichtet hatten, um sich vor Atomkrieg und nuklearem Winter flüchten zu können. Der Safe bzw. Panic Room ist eher für moderne Bedrohungen wie Gewaltverbrechen, Kidnapping oder Terroranschläge konzipiert und soll dem Bewohner nur wenige Stunden Schutz bieten. Zur Zielgruppe der Panic-Room-Hersteller gehören natürlich vor allem Staatsmänner, Geschäftsleute und andere VIPs. Aber auch Durchschnittsbürger investieren zwischen 10 000 und 300 000 Euro für einen sicheren Ort in den eigenen vier Wänden. Eine Bastelanleitung für die Worst-Case-Architektur:
1. Standortsuche: Nicht jedes Zimmer im Haus eignet sich als Safe Room. Der Raum sollte kompakt und fensterlos sein und Platz für alle Bewohner bieten. Achten Sie auch darauf, dass der Raum gut und schnell zu erreichen ist – der Heizungskeller oder der Speicher im zweiten Stock sind eher nicht geeignet. Im Idealfall sollte man den Safe Room sogar über mehrere Routen erreichen können. Nicht jeder Hausbesitzer verfügt über ausreichend Wohnfläche, um einen Raum dem Sicherheitsbedürfnis zu opfern, oft werden deshalb Badezimmer oder begehbare Kleiderschränke zu einem Safe Room upgegradet.
2. Türen und Schlösser: Die Tür ist das wichtigste Bauteil eines Safe Rooms. Experten empfehlen ein kugelsicheres Produkt mit integriertem Stahlrahmen. Der Nachteil einer solchen Konstruktion ist, dass eine derart verstärkte Tür oft mehrere hundert Kilo wiegt. Moderne Materialien wie Kevlar oder Fiberglas werden deshalb immer beliebter. Die Tür sollte sich mit einem Handgriff schließen und ohne Schlüssel absperren lassen. Absolutes Premiumprodukt ist ein elektrisches Magnetschloss, das weder mit Brecheisen noch mit Dietrichen geknackt werden kann. Eine Tür ohne Türgriff ist eine Wand.
3. Dreidimensionaler Schutz: Ein Safe Room ist ein Tresor für Menschen. Deshalb ist es wichtig, alle Berührungsflächen mit der Außenwelt zu verstärken. Verfügt Ihr Haus über Böden und Decken aus Beton: Prima! Falls nicht, sollten Sie auch hier Stahlnetze oder Kevlarplatten einfügen. Die Wände sollten mit kugelsicheren Stahlplatten verstärkt werden. Stellen Sie sicher, dass die Verstärkungen nicht die Statik des Gebäudes überlasten.
4. Über-Lebensmittel: Ein Safe Room ist nur für eine Aufenthaltsdauer von wenigen Stunden konzipiert. Große Vorräte, wie sie in den alten Atombunkern üblich waren, sind deshalb nicht vonnöten. Trotzdem sollten Sie darauf achten, im Innenraum einige überlebenswichtige Dinge zu lagern. Das Katastrophenhandbuch des US-Justizministeriums listet Wasser, haltbares Essen, Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie Taschenlampen mit frischen Batterien auf. Verteidigungsmittel wie Pfefferspray, Elektroschocker oder gar eine Feuerwaffe könnten, so Experten, dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl zu verstärken. Manche raten gar dazu, eine Toilette mit eigenem Wasserkreislauf zu installieren.
5. Kommunikation: Ein Safe Room sollte unbedingt einen Kommunikationskanal zur Außenwelt aufweisen. Verlassen Sie sich dabei nicht auf Ihr Telefon-Netzwerk, das womöglich von Eindringlingen außer Kraft gesetzt wird. Auch der Empfang von Mobiltelefonen (immer aufgeladenen Akku vorrätig halten!) könnte durch die Stahlkonstruktion des Raumes gestört sein. Die sicherste Option ist es, ein kleines Funkgerät im Mini-Bunker zu deponieren. Halten Sie eine Liste der wichtigsten Nummern und Frequenzen griffbereit. Elaborierte Konstruktionen verfügen oft über Monitore, die mit Überwachungskameras im Haus verbunden sind. Der Vorteil: Sie können die Situation besser beurteilen. Der Nachteil: Womöglich müssen Sie hilflos dabei zusehen, wie die Einbrecher Ihre Wohnung und Ihre materielle Existenz vernichten.
6. Ego-Schutzhaft: Ein Schutzraum sollte im Idealfall schalldicht sein. Das stellt sicher, dass die Eindringlinge Ihre Kommunikation mit den Sicherheitsbehörden nicht verfolgen können. Außerdem, betonen Experten, sei es immens wichtig, dass die Angreifer die Menschen im Safe Room nicht psychisch unter Druck setzen können, wie man es zum Beispiel in dem Hollywoodfilm Panic Room mit Jodie Foster sehen konnte. Lassen Sie sich nicht auf psychologische Spielchen mit den Angreifern ein.
7. Extras: Die besten Safe Rooms sind luftdichte Kammern mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle. Experten raten dazu, den Schutzraum als geschlossenes System zu konstruieren, mit eigener Strom-, Wasser- und Luftversorgung. Das stellt sicher, dass Angreifer Sie nicht mit Tränengas oder anderen Substanzen ausräuchern können. Einige empfehlen auch, einen Fernseher und DVD-Player einzubauen. Manchmal braucht die Polizei eben länger. Und entspannte Menschen handeln überlegter und abgeklärter als Safe-Room-Insassen mit Lagerkoller.
8. Dekoration: Als letzten Schritt sollten Sie sich darüber Gedanken machen, wie man den Safe Room so gestaltet, dass er nicht wie ein militärisches Sperrgebiet im Wohnbereich wirkt. Verkleiden Sie die Stahlelemente zum Beispiel mit Ziegeln oder Holzpaneelen. Hängen Sie Bilder auf, und vielleicht macht sich ja auch eine Designerlampe gut in dem Raum. Das alles stellt nicht nur sicher, dass der Safe Room schwerer zu orten ist, sondern erhöht auch den Wohnkomfort. Und darauf will man nicht verzichten. Auch nicht in diesen Zeiten.
02. Fliegen SICHER IN DER STRATOSPHÄRE
Ein Flugzeugabsturz muss keine Katastrophe sein – vorausgesetzt man beachtet die wichtigsten Sicherheitsregeln.
Die Turbinen fallen aus, die Sauerstoffmasken fallen von der Decke, und die dicke Dame auf Platz 17A beginnt, die Arie der Panik zu kreischen. Vor keiner Katastrophe fürchtet sich der Mensch mehr als vor einem Flugzeugabsturz. Weit über fünfzig Hollywood-Filme haben sich bisher mit Flugkatastrophen beschäftigt und tragen Titel wie Falcon Down – Todesflug ins Eismeer. Und Tageszeitungen berichten 1500-mal häufiger über Flugzeugabstürze als über Autounfälle. Dabei ist der gefährlichste Teil einer Flugreise die Fahrt zum Flughafen. Von den insgesamt rund 2,3 Milliarden Passagieren, die im Jahr 2009 weltweit auf 35 Millionen Flügen befördert wurden, starben nur 685. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen, ist bis zu einhundertmal höher als der Tod in der Stratosphäre. Die International Air Transport Association (IATA) kommt zu dem Ergebnis, dass ein Mensch schon 4807 Jahre lang jeden Tag ins Flugzeug steigen müsste, um statistisch in einen Flugunfall verwickelt zu werden – auf so ein Meilenkonto kommen nicht mal die aktivsten Vielflieger. Auch im – wie es die Stewardessen immer nennen – «unwahrscheinlichen Fall einer Notlage», tut man als Passagier gut daran, eine Panikattacke (→ Panikattacken, S. 171) zu vermeiden und stattdessen kühl und überlegt zu handeln. Selbst bei schweren Flugzeugabstürzen überleben 56 Prozent aller Passagiere. Mit diesen acht Tipps zählen Sie zur glücklichen Mehrheit:
1. Seien Sie wählerisch: Fluglinien lassen sich nicht nur nach Ticketpreis und der Garderobe der Flugbegleiterinnen unterscheiden, auch die statistische Sicherheit sollte ein zentrales Auswahlkriterium sein. Als sicherste Fluglinien der Welt gelten Emirates, Virgin Atlantic, El Al und Finnair. Besonders gefährlich sind THY Turkish Airlines, China Airlines und die brasilianische TAM Linhas Aéreas. 70 Prozent aller sogenannten Totalverluste von Maschinen entfallen auf Airlines aus Entwicklungsländern, obwohl diese nur 15 Prozent des weltweiten Flugverkehrs abwickeln.
2. Fliegen Sie nie erster Klasse: Die alte Schulbusweisheit «Die hinteren Plätze sind die besten» gilt auch im Flugzeug. Eine Auswertung aller Bruchlandungen und Abstürze kommerzieller Flüge seit 1971 ergab, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit auf einem Sitzplatz im Heck um etwa 40 Prozent höher ist, als wenn man auf einem der Luxus-Klappbetten in den vorderen Reihen logiert. Denn Flugzeuge krachen bei Bruchlandungen oft zuerst mit der Nase in den Boden. In die First Class kommt auch der Tod als Erster. Der Service ist makellos.
3. Wählen Sie einen Sitz in der Nähe des Notausgangs: Ed Galea von der Greenwich University in London hat 105 Flugzeugabstürze samt Sitzplänen und den Berichten von 1917 Überlebenden und 155 Flugbegleitern sorgfältig studiert. Er stellte fest, dass die Überlebenden in einem brennenden Flugzeug durchschnittlich fünf Sitzreihen bis zum nächsten Notausgang zurücklegten. Aus dieser Erkenntnis heraus formulierte Galea die 5-Reihen-Regel: Am wahrscheinlichsten überleben Passagiere, die direkt am Notausgang oder eine Reihe davor oder dahinter sitzen. Wenn der Sitzplatz mehr als fünf Reihen vom Notausgang entfernt ist, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit zu überleben. Es lohnt sich also, vor dem Check-in den Sitzplan des eingesetzten Flugzeuges zu studieren.
4. Bestehen Sie auf einem Gangplatz: Der Blick auf Wolkengebilde und Sonnenaufgänge ist natürlich eine schöne Erfahrung, aber wiegt das wirklich Ihr Leben auf? Passagiere, die am Gang sitzen, haben bei Bruchlandungen eine Überlebenschance von 64 Prozent, auf einem Fensterplatz sind es nur 58 Prozent. Der Gangsitzer ist im Fall einer Bruchlandung besser geschützt, außerdem kann er sich nach der unsanften Landung einfacher befreien und hat einen kürzeren Weg zum Notausgang.
5. Bleiben Sie nüchtern: Es mag schon sein, dass die Enge, das Schnarchen und die Essgeräusche der anderen Mitreisenden eigentlich nur im betrunkenen Zustand zu ertragen sind, und ein Bloody Mary schmeckt ja auch wirklich gut. Andererseits: Da betrunkene Menschen dazu neigen, sich nicht nur im Alltag, sondern auch in extremen Gefahrenzuständen unvernünftig zu verhalten, kann absolute Nüchternheit die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Menschen um bis zu 50 Prozent erhöhen.
6. Bewahren Sie Ruhe: Beim Absturz eines Flugzeugs, nach der Bruchlandung oder wenn der Flieger schon brennt, verlieren die Insassen in der Regel nicht die Kontrolle, schreien oder irren kopflos umher. Sie verfallen vielmehr in eine Art Schockstarre, Experten sprechen von «negativer Panik», sie machen einfach gar nichts. Und reduzieren so ihre Überlebenschancen auf null.
7. Achten Sie auf Ihren Body-Mass-Index: Ist die Maschine schon im Sturzflug, mag es für Ernährungstipps vielleicht etwas zu spät sein. Aber laut Untersuchungen der amerikanischen Federal Aviation Administration haben schlanke Menschen die besten Chancen, sich aus einem Wrack zu befreien oder durch einen engen Notausgang zu zwängen. Doch nicht nur Übergewicht, sondern auch Alter, Körperbau und Geschlecht haben Einfluss auf die Überlebenschancen. Junge Männer, die in ihrem übrigen Leben auf Grund der verstärkten Neigung zu Alkoholkonsum, Vollkontaktsport und frisierten Sportwagen eher gefährlich leben, können sich im Flugzeug sicherer fühlen als die alte Dame oder die junge Mutter auf dem Nebensitz.
8. Hören Sie auf die Stewardess: Natürlich wirken Sie wie ein souveräner und erfahrener Vielflieger, wenn Sie gelassen in der Tageszeitung oder dem Duty-free-Katalog blättern, während die Flugbegleiter im Gang von Notwasserung und Sauerstoffnot sprechen und kleine Turnübungen mit Sauerstoffmaske und Schwimmweste vollführen. 60 Prozent aller Flugreisenden geben zu, dass sie sich nicht die Mühe machen, die Sicherheitshinweise der Airlines zu studieren. Kein Wunder, dass das Bildungsniveau der Passagiere erbärmlich ist: Die meisten Befragten gehen davon aus, dass sie bei einem Abfall des Kabinendrucks bis zu eine Stunde ohne Sauerstoff überleben könnten (es sind nur wenige Sekunden). Eine Mehrheit denkt auch, dass sie dreißig Minuten Zeit haben, um ein brennendes Flugzeug zu verlassen. Tatsächlich beträgt die Frist nur 90 Sekunden. Im Fall einer Notlandung entscheidet vor allem das überlegte und korrekte Verhalten der einzelnen Passagieren über Leben und Tod: Über 40 Prozent aller Todesfälle bei Flugzeugabstürzen wären vermeidbar gewesen, wenn sich die Betroffenen klüger und souveräner verhalten hätten. Das bedeutet: Die sogenannte «Brace»-Position bei der Notlandung einnehmen (Anlehnen an den Vordersitz), schnell genug nach der Sauerstoffmaske greifen, das Handgepäck bei der Evakuierung zurücklassen und sich vor dem Start niemals die Schuhe ausziehen (manchmal kann einem Stilempfinden auch das Leben retten)!
03. Geiselnahme EMOTIONALES KIDNAPPING
Eine Entführung ist unangenehm. Umso wichtiger ist die richtige Kommunikation mit dem Geiselnehmer.
Am 15. April 1974 stürmten vier schwer bewaffnete Mitglieder der amerikanischen Stadtguerilla Symbionese Liberation Army (SLA) eine Filiale der Hibernia National Bank in San Francisco. Wie bei einem Rockkonzert rief der Anführer: «Wir sind die SLA!», dann deutete er auf eine Frau, die sich mit Maschinenpistole im Anschlag in der Schalterhalle postiert hatte, und setzte hinzu: «Und das ist Tania Hearst.» Die junge Frau war zu dieser Zeit ein Weltstar wie Liz Taylor oder Janis Joplin, jeder kannte ihr Gesicht von den Titelseiten der Zeitungen und aus den TV-Nachrichten. Die 20-jährige Erbin des Milliardenvermögens von Zeitschriftenmogul William Randolph Hearst, dem der Regisseur Orson Welles mit Citizen Kane ein Denkmal aus Zelluloid gesetzt hat, war zwei Monate zuvor von der SLA aus ihrer Penthouse-Wohnung in Südkalifornien entführt worden. Während der Gefangenschaft wurde Patty vom Opfer zum Mitglied der Gruppe, wandelte sich vom unpolitischen Tiffany-Fan zur militanten, linksradikalen Kämpferin und taufte sich «Tania» – zu Ehren von Tania la Guerrillera, der ostdeutschen Geliebten von Che Guevara.
Ein ähnlicher Fall ereignete sich ein Jahr zuvor in Stockholm. Zwei Kidnapper hatten am 23. August 1973 eine Bank überfallen, vier Angestellte in ihre Gewalt gebracht und sich mit ihnen im schwer gesicherten Tresorraum verschanzt. Im Laufe der mehrtägigen Geiselnahme zeigte sich, dass die Entführten mit den Entführern mehr und mehr sympathisierten und sich am Ende weigerten, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. In einem Telefongespräch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Olof Palme sagte eine der Geiseln: «Mich bedrückt, dass die Polizei uns angreifen wird … aber Jan (Anmerkung: einer der beiden Täter) sitzt hier und beschützt uns vor der Polizei.»
Seit der spektakulären Geiselnahme in Südschweden sprechen Soziologen vom Stockholm-Syndrom, wenn sie versuchen, die verzerrte Wahrnehmung von Kidnapping-Opfern zu verstehen. Sollten Sie eines Tages also entführt werden und feststellen, dass Sie plötzlich positive Gefühle für Ihre Peiniger empfinden, dann zweifeln Sie nicht an Ihrem Verstand. Das Stockholm-Syndrom ist eine nachvollziehbare Reaktion von Entführungsopfern auf den Ausnahmezustand. Um das Syndrom zu bekämpfen, müssen Sie es aber erst verstehen.
Das kuriose Verhalten von Patty Hearst und den schwedischen Bankangestellten hat durchaus rationale Gründe. Geiselnehmer und Geiseln befinden sich in einer ähnlichen Lage, teilen sich nicht nur den begrenzten Raum und die begrenzten Notrationen, sondern müssen auch darauf hoffen, dass die Lösegeldforderungen möglichst schnell erfüllt werden und die Polizei keinen gewaltsamen Befreiungsversuch startet. Diese paradoxe Verbundenheit wird durch Gespräche und die allgemeine Stresssituation noch verstärkt. Eine der Stockholmer Geiseln, die unter schwerer Platzangst litt, empfand zum Beispiel enorme Dankbarkeit für ihre Kidnapper, als die ihr erlaubten, den Tresorraum an eine Leine gefesselt für wenige Minuten zu verlassen.
Das Stockholm-Syndrom wirkt wie eine potente Psychodroge, die den Geist verwirrt und den Lauf der Dinge umpolt – aus der Demütigung, wie ein Hund an der Leine gehen zu müssen, wird ein Akt der Gnade.
Es ist nicht ratsam, aus Angst vor dem Stockholm-Syndrom jegliche Kommunikation mit den Geiselnehmern zu vermeiden. Smalltalk mit den Kidnappern bietet sich aus nachrichtendienstlichen Gründen an, da Sie so eventuell entscheidende Informationen erhalten, die bei einem Fluchtversuch nützlich sein könnten, sowie andere Hinweise, die bei der späteren Ergreifung der Täter helfen könnten. Empfindet der Täter ein wenig Sympathie oder Mitgefühl für die Geisel, wird er sie vermutlich besser behandeln; außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er sie im Affekt tötet oder sie ums Leben bringt, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen und die Polizei zu beeindrucken. Tatsächlich fürchten sich auch die Kidnapper vor dem Stockholm-Syndrom. Der ehemalige RAF-Terrorist Peter-Jürgen Boock erzählt gerne, wie er in den siebziger Jahren von jemenitischen und palästinensischen Ausbildern in Rollenspielen auf Entführungen vorbereitet wurde: «Es ging im Wesentlichen darum, wie man im Falle eines Kidnappings einerseits die Geiseln durch einen ständig wechselnden Mix aus Einschüchterung, Terror und selektiver Freundlichkeit in Angst und Abhängigkeit hält, andererseits aber das sogenannte Stockholm-Syndrom vermeidet.»
Psychoanalytiker sprechen von einer «Identifikation mit dem Aggressor». Das Leben der Geisel liegt vollkommen in der Hand des Geiselnehmers, er bestimmt, wann seine Opfer essen, trinken, schlafen und frei atmen dürfen. Dieser extreme Kontrollverlust ist für die Geiseln nur zu ertragen, indem sie sich selbst hinters Licht führen und sich einreden, der Geiselnehmer sei gar nicht böse, sondern werde im Gegenteil alles dafür tun, das Leben der Geiseln zu schützen. Diesem mentalen Mechanismus kann man entgehen, wenn man die eigenen Gedanken und Emotionen immer wieder auf ihre Gründe hinterfragt. Im Idealfall gelingt es Ihnen sogar, Sympathien für den Geiselnehmer nur vorzutäuschen und ihn dadurch emotional zu manipulieren. Genau das schaffte der amerikanische Botschafter Diego Ascensio während einer Geiselnahme in Bogotá im Jahr 1980. Ascensio diskutierte intensiv mit den Kidnappern der Terrororganisation M-19 über amerikanische Außenpolitik, beriet als erfahrener Diplomat seine Peiniger bei den Verhandlungen mit der US-Regierung und versuchte durch sein besonnenes Auftreten, die Rebellen zu beruhigen und Zuversicht zu verbreiten. Mit Erfolg. Die Geiselnehmer gaben sich damit zufrieden, dass die amerikanische und die kolumbianische Regierung nur einen Teil ihrer Forderungen erfüllten, und zogen ab. Die Geiselnahme ging unblutig zu Ende.
Patty «Tania» Hearst gelang es erst mit der Hilfe von Polizei und Staatsanwaltschaft, sich von ihren Peinigern loszusagen. Nach mehreren Banküberfällen wurde Hearst im Jahr 1975 gefasst. Im Prozess gab sie an, durch Misshandlungen und Gehirnwäsche gezwungen worden zu sein, sich der SLA anzuschließen. Hearst bekam 35 Jahre Haft, von denen sie jedoch nur 22 Monate absitzen musste. Für zukünftige Entführungen beugte sie vor. 1979 heiratete Hearst ihren Bodyguard Bernard Shaw, der heute als Sicherheitschef der Hearst Corporation arbeitet.
04. Sintflut NOAHS ERBEN
Tipps bei Hochwasser, Flutkatastrophen und emotionalen Dammbrüchen.
Ein bekannter Action-Bestseller, Die Bibel, beschreibt Noah als einen hilfsbereiten, entscheidungsfreudigen und handwerklich begabten Mann mit langem, weißen Rauschebart, der 950 Jahre alt wurde, im Alter von 500 Jahren die Söhne Sem, Ham und Jafet zeugte und auch gerne mal einen über den Durst trank – ein echter Kerl also, nicht unähnlich Bruce Willis und Chuck Norris. Allerdings muss man sagen, dass der ewige Ruhm, der dem Arche-Architekten zuteil wird, ein wenig unverdient ist: Noah hatte schließlich nicht mit Problemen wie Klimawandel, Flussbegradigungen und Flächenversiegelungen zu tun und erlebte in seinem knapp tausendjährigen Leben nur eine Flut – jeder Bewohner einer durchschnittlichen ostdeutschen Kleinstadt muss alle zwei bis drei Jahre mit einer Flutkatastrophe rechnen. An Elbe und Oder gab es innerhalb von zehn Jahren gleich drei sogenannte «Jahrhunderthochwasser». Im 21. Jahrhundert sind Grundkenntnisse in Dammbau und Arche-Konstruktion also erste Bürgerpflicht.
Prävention I: Bevor das Wasser über die Ufer trat, gab Gott seinem Diener Noah einen kleinen Hinweis, damit dieser mit dem Bau seiner Arche beginnen konnte. Rechnen Sie nicht mit derartiger Gnade. Die Flutwelle erreicht die ersten Häuser oft nur drei Stunden nach der Warnung des Katastrophenschutzes. Es ist deshalb ratsam, einen permanenten Ringdeich um das Haus zu bauen, wie ihn auch viele Bauernhöfe und Landgüter in Schleswig-Holstein errichtet haben (ja, auch wenn man im bayerischen Oberland wohnt). Der Drei-Zonen-Deich ist das Premiumprodukt dieser Strukturgattung. Der sogenannte Stützkörper besteht aus einem Sandkern, der mit Erde und Schutt bedeckt wird. Auf der Binnenseite, also der Seite, die trocken bleiben soll, sollte man grobkörnigen Kies auftragen, da das Material eine Art Filter bildet und Wasser, das doch durch den Deich dringt, auf kontrollierte Art und Weise ablässt. Zur Wasserseite hin sollte ein wasserabweisendes Material wie Beton oder Lehm den Deich abschließen (im Notfall tut es aber auch eine Folie).
Prävention II: Falls Ihnen der Platz oder die Baugenehmigung zur Errichtung eines Ringdeichs fehlt, sollten Sie sich wenigstens vorsorglich ein Sandsacklager anlegen. Fünfzig Stück passen auf eine Euro-Palette und sind das absolute Minimum. Während in Normalzeiten ein Sandsack etwa fünfzig Cent kostet, erhöht sich der Preis im Katastrophenfall oft um 1500 Prozent. Sandsäcke sind also eine interessante Anlagemöglichkeit.
Der Ernstfall: Wenn das Wasser kommt, sollten Sie nicht zu lange vor dem Fernseher hängen bleiben und sich zusammen mit den TV-Journalisten davon berauschen lassen, wie der Fluss von der Linie zur Fläche übergeht. Ein Hochwasser schafft eine neue Realität und ist eine besonders fotogene Katastrophe, von der die Medien gar nicht genug bekommen können. Sie aber sollten nun den Fernseher abschalten und sich um den Keller kümmern. Dichten Sie die Kellerfenster mit Folie (Plastiktüten, Bettlaken) ab und schichten Sie Sandsäcke vor den Fenstern auf. Die Sandsäcke sollten auch ein paar Zentimeter der Hauswand bedecken, damit sich das Wasser nicht zwischen Mauerwerk und Sandsack hindurchdrücken kann. Leider kann eine perfekte Abdichtung des Kellers auch eine unangenehme Konsequenz haben: In Überflutungsgebieten steigt der Grundwasserspiegel. Der Pegel kann Gebäude, deren Keller nicht geflutet sind und die deshalb verhältnismäßig leicht sind, anheben und die Bausubstanz beschädigen.
Personenschutz: