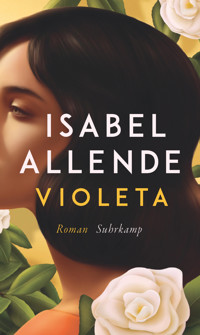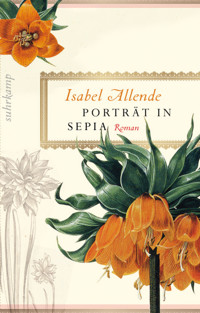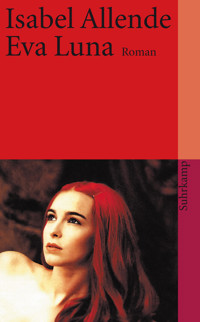4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Abenteuer von Aguila und Jaguar
- Sprache: Deutsch
Ein Yeti im Himalaya und die Kraft einer Freundschaft
Eigentlich wollten Nadia und Alex nur dessen schreibende Großmutter Kate auf eine Forschungsreise in den Himalaya begleiten. Wer hätte schon erwartet, dass sich im friedlichen Reich des Goldenen Drachen die Ereignisse auf einmal überstürzen? Dunkle Gestalten kommen über die Berge, sie haben es auf die goldene Statue abgesehen, die dem Königreich den Namen gibt und der Legende nach die Zukunft vorhersagen kann. Als das Wahrzeichen verschwindet und wenig später der König und Nadia von den Verbrechern entführt werden, beginnt für die Abenteurer ein Kampf gegen eine Macht, die unheimlich und unsichtbar hinter den Drachenräubern steht.
Isabel Allende lässt keine Leserwünsche offen: Nadia und Alex alias Aguila und Jaguar entdecken das Dach der Welt, und ein fantastisches Abenteuer mit Skorpionkriegern, buddhistischen Mönchen und den letzten Yetis kann beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Isabel Allende, 1942 geboren, hat ab ihrem achtzehnten Lebensjahr als Journalistin in Chile gearbeitet. Nach Pinochets Militärputsch am 11. September 1973 ging sie ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
Isabel Allende
Im Reich des Goldenen Drachen
Aus dem Spanischen vonSvenja Becker
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel El Reino del Dragón de Oro bei Plaza & Janés, Barcelona. © Isabel Allende, 2003.
Umschlagfoto: Holger Scheibe/zefa
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 3. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4082.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2003
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73783-5
www.suhrkamp.de
INHALT
ERSTES KAPITEL Das Tal der Yetis
ZWEITES KAPITEL Drei ganz erstaunliche Eier
DRITTES KAPITEL Der Sammler
VIERTES KAPITEL Adler und Jaguar
FÜNFTES KAPITEL Die Kobras
SECHSTES KAPITEL Die Skorpionsekte
SIEBTES KAPITEL Im Verbotenen Reich
ACHTES KAPITEL Mädchenraub
NEUNTES KAPITEL Borobá
ZEHNTES KAPITEL Der weiße Adler
ELFTES KAPITEL Ein Jaguar als Totemtier
ZWÖLFTES KAPITEL Gedanken als Medizin
DREIZEHNTES KAPITEL Der Goldene Drache
VIERZEHNTES KAPITEL Die Banditenhöhle
FÜNFZEHNTES KAPITEL Die Steilwand
SECHZEHNTES KAPITEL Kämpfende Yetis
SIEBZEHNTES KAPITEL Zur Klosterburg
ACHTZEHNTES KAPITEL Die Schlacht
NEUNZEHNTES KAPITEL Der Prinz
ZWANZIGSTES KAPITEL Der Abschied
Meiner Freundin Tabra Tunoa, der unermüdlichen Reisenden, die mich in den Himalaja mitnahm und mir vom goldenen Drachen erzählte.
ERSTES KAPITELDas Tal der Yetis
Tensing, der buddhistische Lama, und sein Schüler, Prinz Dil Bahadur, wanderten seit Tagen hinauf in die Berge des nördlichen Himalaja, immer weiter in eisige Höhen, wo der Frost niemals nachlässt und wo außer einigen wenigen Mönchen noch nie ein Mensch gewesen ist. Keiner der beiden zählte die Stunden, denn Zeit kümmerte sie nicht. Sie ist eine Erfindung des Menschen, für das spirituelle Dasein ohne Bedeutung, hatte der Meister seinen Schüler gelehrt.
Wichtig war für sie der Weg, den der junge Prinz zum ersten Mal ging. Der Lehrer wusste, dass er selbst ihn in einem früheren Leben schon einmal zurückgelegt hatte, aber die Erinnerung daran war bruchstückhaft. Die beiden folgten der Wegbeschreibung auf einem alten Pergament und richteten sich nach den Sternen, um sich in dieser schroffen Gebirgslandschaft zurechtzufinden. Die Temperatur lag hier selbst im Sommer meist etliche Grad unter Null, und nur während einiger Monate im Jahr, wenn keine schlimmen Schneestürme wüteten, konnte man es wagen, eine solche Wanderung zu unternehmen.
Aber selbst bei Sonnenschein war es bitterkalt. Die beiden Wanderer trugen wollene Mönchsumhänge und darüber grobe Yakfelle. Auch ihre Stiefel waren aus Yakfell, der Pelz nach innen gewendet, die lederne Außenseite gegen die Nässe eingefettet. Sie achteten auf jeden Schritt, denn wer auf dem Eis den Halt verlor, stürzte womöglich viele hundert Meter tief in eine der Felsspalten, die wie Axthiebe Gottes in den Berghängen klafften.
Gegen den tiefblauen Himmel hoben sich strahlend die verschneiten Gipfel ab, und die Wanderer erklommen sie langsam, denn in diesen Höhen wurde der Sauerstoff knapp. Oft hielten sie an, um sich an die dünne Luft zu gewöhnen. Sie spürten den Druck auf der Brust, die Ohren und der Kopf schmerzten, Schwindel überkam sie, und sie fühlten sich erschöpft, verloren jedoch kein Wort darüber; all ihre Sinne waren darauf gerichtet, gleichmäßig zu atmen und jedes Luftholen so gut es ging auszunutzen.
Sie waren aufgebrochen, um im verborgenen Tal der Yetis nach jenen seltenen Pflanzen zu suchen, die nur dort wachsen und mit denen sich viele Tinkturen und Heilsalben zubereiten lassen. Wer die Gefahren dieser Wanderung überstand, war dem Ziel, ein hoher Lama zu werden, ein Stück näher gekommen, denn auf diesem Weg wurden sein Wille und sein Mut viele Male auf die Probe gestellt. Beides, Wille und Mut, würde der Prinz brauchen, wollte er die Aufgabe erfüllen, die ihn in seinem Leben erwartete. Deshalb war sein Name Dil Bahadur, was in der Sprache des Verbotenen Reiches »tapferes Herz« bedeutet. Die Reise ins Tal der Yetis war eine der letzten Stufen der harten Unterweisung, die der Prinz seit zwölf Jahren erhielt.
Vom wahren Grund dieser Reise ahnte Dil Bahadur allerdings nichts, denn es ging um weit mehr als nur darum, nach den Heilpflanzen zu suchen oder aus ihm einen hohen Lama zu machen. Aber das gehörte zu den vielen Dingen, die der Meister seinem Schüler nicht einfach enthüllen durfte. Seine Rolle als Lehrer war eine andere: Er musste den Prinzen auf jeder Stufe dieser langen Lehrzeit begleiten, seine Körperbeherrschung fördern und seine Persönlichkeit stärken, ihn bei der Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten unterstützen und die Reinheit seines Bewusstseins ein ums andere Mal auf die Probe stellen. Eines Tages würde Dil Bahadur den Grund für seine Reise ins Tal der Yetis selbst erkennen, wenn er der prächtigen Statue des Goldenen Drachen gegenübertrat.
Tensing und Dil Bahadur trugen Bündel mit ihren Decken und einem lebensnotwendigen Vorrat an Getreide und Yakbutter auf dem Rücken. Um die Hüften hatten sie Seile aus Yakhaar geschlungen, die ihnen das Klettern erleichterten, und beim Gehen stützten sie sich auf einen langen, festen Stock, einen Wanderstab, mit dem sie sich auch gegen wilde Tiere verteidigen konnten und mit dessen Hilfe sich ein notdürftiges Zelt für die Nacht errichten ließ. Auch prüften sie damit die Tiefe und Festigkeit des Untergrunds, wenn ihnen die Erfahrung sagte, dass der Neuschnee an einer Stelle womöglich eine tiefe Mulde verbarg. Oft taten sich Spalten im Eis oder im Fels auf und zwangen sie zu weiten Umwegen, wenn es ihnen nicht gelang, darüber zu springen. Um sich diese stundenlangen Märsche zu ersparen, legten sie manchmal einen der Stäbe über die Kluft, vergewisserten sich, dass er auf beiden Seiten sicher auflag, und wagten es schließlich, einen Fuß darauf zu setzen und sich auf die andere Seite zu werfen, aber es durfte nur ein Schritt sein, denn zu groß war die Gefahr, in die Tiefe zu stürzen. Im Sprung dachten sie an nichts mehr, war ihr Kopf leergefegt, und sie vertrauten ganz auf ihre Geschicklichkeit, auf ihren Instinkt und ihr Glück, denn hätten sie hin und her überlegt, wie sie das anstellen sollten, sie hätten es niemals heil auf die andere Seite geschafft. Waren die Stäbe zu kurz, fand sich vielleicht ein höher gelegener Felsen, um den sie ein Seil schlingen konnten, dann banden sie sich das andere Ende um die Hüfte, nahmen Anlauf, sprangen ab und schwangen wie ein Pendel hinüber. Obwohl der junge Schüler Gefahren meist ungerührt und mutig ins Auge sah, zögerte er doch immer, wenn es darum ging, eine Kluft auf die eine oder andere Weise zu überqueren.
Jetzt standen sie wieder vor einem solchen Abgrund, und der Lama suchte die günstigste Stelle, um hinüberzukommen. Dil Bahadur schloss kurz die Augen zu einem Gebet.
»Hast du Angst zu sterben, Dil Bahadur?« Tensing lächelte.
»Nein, ehrwürdiger Meister. Der Zeitpunkt meines Todes ist mir vom Schicksal schon vor meiner Geburt bestimmt. Ich werde sterben, wenn die Aufgabe, für die ich wiedergeboren wurde, erfüllt und mein Geist bereit ist, sich von allem zu lösen; aber ich habe Angst, mir sämtliche Knochen zu brechen und lebend da unten zu liegen.« Er deutete auf die beeindruckende Leere vor seinen Füßen.
»Das wäre möglicherweise unangenehm …«, sagte der Lama gut gelaunt. »Wenn du jedoch deinen Geist und dein Herz öffnest, wird es dir nicht mehr so bedrohlich erscheinen.«
»Was würdet Ihr tun, wenn ich abstürze?«
»Falls es dazu kommt, muss ich vielleicht darüber nachdenken. Im Moment bin ich mit den Gedanken bei anderen Dingen.«
»Darf ich fragen, wo, Meister?«
»Bei der schönen Aussicht.« Er zeigte auf die endlose Kette der Berge, auf das makellose Weiß des Schnees, auf den strahlenden Himmel.
»Sieht aus wie eine Mondlandschaft«, sagte der Prinz.
»Vielleicht … Wo auf dem Mond bist du denn gewesen, Dil Bahadur?« Tensing versuchte, ein ernstes Gesicht zu machen.
»So weit bin ich noch nicht gekommen, Meister. Aber ich stelle es mir so vor.«
»Auf dem Mond ist der Himmel schwarz, und es gibt nicht solche Berge wie hier. Schnee gibt es dort auch keinen, nur Steine und aschgrauen Staub.«
»Vielleicht kann ich eines Tages solche weiten Reisen in Trance unternehmen wie mein ehrwürdiger Meister«, sagte der Schüler.
»Vielleicht …«
Nachdem der Lama geprüft hatte, dass der Stab auf beiden Seiten sicher auflag, streiften die beiden ihre Felle und Umhänge ab, weil sie sich darin nicht frei bewegen konnten, und banden alles zu vier Bündeln zusammen. Der Lama hatte die Statur eines Zehnkämpfers. Sein Rücken und seine Arme waren Muskelpakete, sein Hals so dick wie bei anderen Leuten die Oberschenkel, und seine Beine sahen aus wie Baumstämme. Diese kriegerische Erscheinung bildete einen bemerkenswerten Kontrast zu dem heiteren Gesicht, den sanften Augen und dem zarten, fast weiblichen Schwung der immer lächelnden Lippen. Tensing hob die Bündel eines nach dem anderen auf, ließ den Arm wie einen Windmühlenflügel kreisen und schleuderte sie auf die andere Seite des Abgrunds.
»Angst gibt es eigentlich nicht, Dil Bahadur«, sagte er, »wie alles andere entsteht auch sie nur in deinem Kopf. Unsere Gedanken erschaffen das, was wir Wirklichkeit nennen.«
»Gerade eben erschaffen meine Gedanken ein ziemlich tiefes Loch, Meister«, nuschelte der Prinz.
»Und meine erschaffen eine sehr sichere Brücke«, antwortete der Lama.
Mit einem kurzen Wink verabschiedete er sich von seinem Schüler, der reglos im Schnee stand, tat einen Schritt über den Abgrund, erreichte mit dem rechten Fuß die Mitte des Holzstocks, warf sich im Bruchteil einer Sekunde nach vorne und landete mit dem linken Fuß auf der anderen Seite. Dil Bahadur kam hinter ihm her, weniger geschmeidig und langsamer zwar, aber nichts an seiner Bewegung verriet, wie aufgeregt er war. Der Meister bemerkte nur, dass seine Haut vom Schweiß glänzte. Schnell zogen sie sich wieder an und setzten ihren Marsch fort.
»Ist es noch weit?«, wollte Dil Bahadur wissen.
»Vielleicht.«
»Würdet Ihr es unverschämt finden, wenn ich Euch bitte, mir nicht immer mit vielleicht zu antworten, Meister?«
»Vielleicht würde ich das.« Tensing grinste, schwieg einen Moment und sagte dann, dem Pergament zufolge müssten sie sich immer weiter nach Norden halten. Der schlimmste Teil der Wanderung stand ihnen noch bevor.
»Habt Ihr die Yetis schon einmal gesehen, Meister?«
»Sie sind wie Drachen, aus ihren Ohren quillt Feuer, und sie haben auf jeder Seite vier Arme.«
»Du Schreck!«, entfuhr es dem Prinzen.
»Habe ich dir nicht viele Male gesagt, du sollst nicht alles glauben, was du hörst? Such deine eigene Wahrheit.« Der Lama lachte.
»Aber Meister, das hier ist doch keine Lektion über die Lehren des Buddha, sondern bloß eine Unterhaltung …«
»Ich bin den Yetis in diesem Leben nicht begegnet, aber ich erinnere mich aus einem früheren Leben an sie. Sie haben den gleichen Ursprung wie die Menschen, und vor einigen tausend Jahren besaßen sie auch eine Kultur, die fast so entwickelt war wie unsere, aber heute sind sie ziemlich unbehauen und von recht beschränktem Denkvermögen.«
»Wieso das denn?«
»Sie sind sehr streitsüchtig. Sie haben sich gegenseitig umgebracht und alles zerstört, was sie hatten, selbst ihr Land. Die Überlebenden haben sich in die Berge zurückgezogen, und dort sind sie immer mehr verwildert. Jetzt sind sie wie Tiere«, erzählte der Lama.
»Gibt es noch viele?«
»Wie man’s nimmt. Falls sie uns angreifen, werden wir denken, es sind viele, und falls sie uns freundlich aufnehmen, denken wir, es sind wenige. Auf jeden Fall wurden sie früher nicht sehr alt, hatten allerdings immer viel Nachwuchs, deshalb wird es wohl einige geben im Tal. Der Ort ist sehr unzugänglich, und bisher wurden sie dort noch nicht aufgespürt, aber manchmal geht einer auf Nahrungssuche zu weit weg und findet nicht wieder zurück. Möglicherweise stammen daher die Spuren dieser so genannten Schneemenschen.«
»Diese Fußabdrücke sind riesig. Die Yetis müssen sehr groß sein. Ob sie noch immer so streitsüchtig sind?«
»Du stellst viele Fragen, auf die ich keine Antwort weiß, Dil Bahadur.«
~
Tensing führte seinen Schüler weiter und weiter hinein die Berge, sie sprangen über Klüfte, erklommen steile Felswände, folgten schmalen, in den Fels gehauenen Pfaden. Wenn Wind aufkam oder Hagel fiel, suchten sie eine geschützte Stelle und warteten. Einmal am Tag aßen sie Tsampa, eine Mischung aus geröstetem Gerstenmehl, getrockneten Kräutern, Yakbutter und Salz. Wasser gab es in Hülle und Fülle unter der Eisschicht der Bachläufe. Dil Bahadur kam es zuweilen so vor, als würden sie im Kreis gehen, denn die Landschaft sah für ihn überall gleich aus, aber das sagte er nicht: Es wäre seinem Meister gegenüber unhöflich gewesen.
Wenn es Abend wurde, suchten sie einen Unterschlupf für die Nacht. Mal fanden sie eine Höhle oder wenigstens eine windgeschützte Spalte zwischen den Felsen, aber hin und wieder blieben ihnen nur die Yakfelle als notdürftiger Schutz gegen die eisige Nacht. War ihr karges Lager bereitet, setzten sie sich mit überkreuzten Beinen auf die Erde, blickten in die Richtung der untergehenden Sonne und stimmten das heilige Mantra an, sprachen wieder und wieder das Om mani padme hum, O, du Juwel im Lotos. Vom Echo zu einem vielstimmigen Chor verstärkt, hallte der Singsang endlos zwischen den hohen Bergen des Himalaja wider.
Mit den Zweigen und trockenen Gräsern, die sie tagsüber in ihren Bündeln gesammelt hatten, entfachten sie ein Feuer, über dem sie ihr Essen zubereiteten. Wenn die Mahlzeit beendet war, meditierten sie lange. Da war es für gewöhnlich bereits so kalt, dass die beiden starr wie Eisstatuen wurden, aber sie spürten das kaum. Die Reglosigkeit war ihnen vertraut und verhalf ihnen zu innerer Ruhe. In ihrer buddhistischen Übung saßen Meister und Schüler ganz gelöst, aber aufmerksam da. Sie ließen sich durch keinen Gedanken ablenken und bildeten sich keine Urteile über die Welt, vergaßen jedoch niemals die Leiden der Menschen.
~
Nachdem sie so viele Tage gewandert und in eisige Höhen vorgedrungen waren, näherten sie sich dem Chenthan Dzong, einer Klosterburg, in der die Lamas vor langer Zeit die Kampfkunst Tao-Shu entwickelt hatten. Im neunzehnten Jahrhundert hatte ein Erdbeben das Kloster zerstört, und man hatte es aufgeben müssen. Das Gebäude bestand aus Granitquadern, Ziegelsteinen und Holzbalken, hatte mehr als hundert Zimmer und sah aus, als hätte man es mit Klebstoff am Rand einer mächtigen Felswand befestigt. Einige hundert Jahre lang hatten die Mönche hier ihr Leben der Suche nach Erleuchtung und der Vervollkommnung ihrer Kampfkunst gewidmet.
Ursprünglich waren die Mönche des Tao-Shu Ärzte gewesen, die außergewöhnlich viel über den Körperbau des Menschen wussten. Bei der Ausübung ihrer Heilkunst hatten sie entdeckt, dass es bestimmte Punkte am menschlichen Körper gibt, die man nur zu drücken braucht, um jemanden gefühllos zu machen oder zu lähmen, und dieses Wissen kombinierten sie mit den überlieferten asiatischen Kampftechniken. Sie wollten geistige Vollkommenheit erlangen, indem sie ihren Körper und ihre Empfindungen ganz beherrschten. Durch das Tao-Shu wurden sie im Zweikampf praktisch unbesiegbar, aber sie setzten es nicht für gewalttätige Zwecke ein, sondern nur als körperliche und geistige Übung; auch hüteten sie ihr Wissen und gaben es nur an ausgewählte Männer und Frauen weiter. Tensing hatte das Tao-Shu von ihnen gelernt und seinen Schüler Dil Bahadur darin unterrichtet.
Durch das Erdbeben, durch Schnee und Eis und den Lauf der Jahre war ein großer Teil des Gebäudes zerfallen, aber zwei Seitenflügel standen noch, wenn auch nur als Ruinen. Um dort hinaufzugelangen, musste man einem kaum noch erkennbaren, halsbrecherischen Treppenweg folgen, der sich an der Felswand entlangschlängelte und schon seit einem halben Jahrhundert von niemandem mehr benutzt worden war. An einigen Stellen führten Hängebrücken über tiefe Einschnitte im Fels, aber sie waren in einem miserablen Zustand und nur mit größter Vorsicht zu überqueren.
»Bald wird man das Kloster aus der Luft erreichen.« Tensing sah zum Himmel.
»Glaubt Ihr, Meister, man kann von einem Flugzeug aus auch das Tal der Yetis entdecken?«
»Möglicherweise.«
»Stellt Euch nur vor, wir bräuchten uns nicht mehr durch die Berge zu quälen, könnten ins Flugzeug steigen und wären im Handumdrehen da.«
»Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Falls die Yetis gefunden werden, enden sie als Zirkusattraktionen oder als Arbeitssklaven«, sagte der Lama.
Endlich waren sie oben im Chenthan Dzong, wo sie rasten und die Nacht im Schutz der Mauern verbringen wollten. An den zerfallenen Wänden des Klosters hingen noch Reste von Teppichen mit religiösen Bildern, auch Töpfe und Waffen fanden sich hier, nach dem Erdbeben von den Mönchen zurückgelassen. Überall konnte man Darstellungen des Buddha finden, mal saß er im Lotossitz, mal kniete oder stand er, und es gab sogar eine riesige Holzstatue, die den Erleuchteten auf der Seite liegend zeigte. Die goldene Farbe war abgeblättert, aber ansonsten war sie unbeschädigt. Fast alles war mit einer Schicht aus Eis und pulvrigem Schnee überzogen, was dem Ort eine besondere Schönheit verlieh, als wäre es ein Kristallpalast. Hinter dem Gebäude hatte eine Lawine eine ebene Fläche geschaffen, die einzige weit und breit, eine Art Hof so groß wie ein Basketballfeld.
»Könnte hier ein Flugzeug landen, Meister?« Dil Bahadurs Begeisterung für die wenigen modernen Gerätschaften, die er kannte, war nicht zu überhören.
»Von solchen Sachen verstehe ich nichts, Dil Bahadur, ich habe nie ein Flugzeug landen sehen, aber der Platz hier scheint mir doch etwas beengt, und außerdem bilden diese Berge einen Trichter, in dem der Wind von allen Seiten kreuz und quer pfeift …«
Dort, wo früher einmal die Küche gewesen war, fanden sie Töpfe und anderes Metallgeschirr, Kerzen, Holzkohle, Späne zum Feuermachen und Steingefäße mit etwas Getreide, das sich durch die Kälte gut gehalten hatte. Dort standen auch Krüge mit Öl und ein Töpfchen Honig, den der Prinz noch nie gegessen hatte. Tensing reichte ihm einen kleinen Löffel voll, und Dil Bahadur hatte zum ersten Mal in seinem Leben etwas derart Süßes auf der Zunge. Das war so umwerfend köstlich, fast hätte er sich tatsächlich auf den Hintern gesetzt. Für das Abendessen entfachten sie ein Feuer, und dann zündeten sie als Zeichen der Hochachtung vor allen Buddhas Kerzen an. Heute Abend würden sie üppiger speisen, und für die Nacht hatten sie ein Dach über dem Kopf: Das verdiente eine kleine Dankzeremonie.
Sie saßen schweigend und meditierten, als ein gedehntes Brüllen die Klosterruine erbeben ließ. Sofort schlugen sie die Augen auf, und da sahen sie ihn in den Saal kommen: einen riesigen weißen Tiger, wie es ihn nur im Himalaja gibt, übermächtig und gefürchtet wie kein zweites Raubtier der Erde.
Der Prinz empfing einen stummen Befehl seines Meisters und versuchte auch, ihn zu befolgen, obwohl er instinktiv aufspringen und sich mit Hilfe des Tao-Shu verteidigen wollte. Wenn es ihm gelänge, eine Hand hinter die Ohren des Tigers zu legen, würde er ihn lähmen können, nun aber tat er gar nichts, blieb reglos sitzen und strengte sich an, gleichmäßig zu atmen, damit die Raubkatze seine Angst nicht witterte. Langsam kam der Tiger auf sie zu. Wie schön er ist, dachte Dil Bahadur und vergaß für einen Moment die drohende Gefahr. Das Fell schimmerte wie helles Elfenbein, die Streifen darin waren kastanienbraun und die Katzenaugen so wässrig blau wie manche Himalajagletscher. Es war ein ausgewachsenes Männchen, ein unbezwingbarer Koloss, ein vollkommenes Geschöpf.
Tensing und Dil Bahadur saßen da im Lotossitz, die geöffneten Hände auf den Knien, und sahen, wie der Tiger immer näher kam. Beide wussten, falls er hungrig war, würden sie kaum eine Chance haben. Aber vielleicht hatte er ja schon gefressen, obwohl er hier oben in dieser Einöde wahrscheinlich nicht sehr oft Beute machen konnte. Tensing besaß außerordentliche übersinnliche Macht, denn er war ein Tulku, die Wiedergeburt eines großen Lamas aus alten Zeiten. Jetzt konzentrierte er sich darauf, all seine Kraft wie in einem Blitz zu bündeln und in den Geist der Raubkatze vorzustoßen.
Aus den Lefzen des Tigers wehte ihnen sein heißer, stinkender Atem ins Gesicht. Noch einmal erbebte die Klosterruine unter dem fürchterlichen Brüllen. Der Tiger war jetzt nur noch wenige Zentimeter von ihnen entfernt, und seine harten Schnurrhaare stachen ihnen in die Haut. Es kam ihnen vor, als schliche er endlos lange um sie herum, er schnüffelte und schubste sie mit seinen riesigen Tatzen, aber er griff nicht an. Der Meister und sein Schüler verharrten vollkommen still, offen und achtsam. Der Tiger empfing keine Signale von Furcht oder Feindseligkeit, und als er seine Neugier schließlich befriedigt hatte, zog er sich mit der gleichen feierlichen Würde zurück, mit der er aufgetaucht war.
»Siehst du, Dil Bahadur, manchmal ist Ruhe doch zu etwas gut …«, war alles, was der Lama dazu sagte. Der Prinz brachte keine Antwort heraus, seine Stimme blieb ihm im Hals stecken.
Trotz dieses unvorhergesehenen Besuchs entschieden sie, die Nacht im Chenthan Dzong zu bleiben, ließen allerdings vorsichtshalber das Feuer brennen und suchten sich unter den zurückgelassenen Waffen einige Lanzen aus, die sie sich zur Verteidigung in Reichweite legten. Der Tiger kam nicht zurück, aber als sie am nächsten Morgen aufbrachen, sahen sie seine Spuren im glitzernden Schnee und hörten weit entfernt sein Brüllen, das an den Berghängen widerhallte.
~
Wenige Tage später stieß Tensing plötzlich einen Freudenschrei aus und deutete auf einen schmalen Einschnitt in der Bergwand vor ihnen. Schwarz ragte der Fels zu beiden Seiten in die Höhe, durch Jahrmillionen von Stürmen und Eis blank poliert. Ganz vorsichtig tasteten sie sich dort hinein, denn unter ihren Schritten löste sich Geröll, und hier und da klafften tiefe Löcher im Boden. Bevor sie irgendwo hintraten, mussten sie den Untergrund mit ihren Stäben prüfen.
Tensing warf einen Stein in eines der Löcher, und sie warteten lange, hörten ihn aber nicht aufschlagen. Der Himmel über ihnen war nur noch ein blaues Band zwischen den glänzenden Felsen. Ein grausiges, vielstimmiges Wimmern drang ihnen entgegen.
»Gut, dass wir nicht an Gespenster und Dämonen glauben, was?«, sagte der Lama augenzwinkernd.
»Wollt Ihr damit sagen, ich bilde mir dieses Stöhnen nur ein?« Dil Bahadur hatte Gänsehaut.
»Vielleicht ist es der Wind, der hier durchfegt, so ähnlich wie wenn man ein Langhorn bläst.«
Sie waren ein gutes Stück vorangekommen, da roch es mit einem Mal widerlich nach faulen Eiern.
»Schwefel«, sagte der Meister.
»Ich kriege keine Luft.« Dil Bahadur hielt sich die Nase zu.
»Vielleicht sollten wir uns vorstellen, es wäre Blumenduft.«
»Von allen Düften ist der Duft der Tugend der köstlichste«, gluckste der Prinz.
»Stell dir also vor, dies sei der köstliche Duft der Tugend.« Jetzt lachte auch der Lama.
Der Durchgang war nur etwa eine Meile lang, aber sie brauchten zwei Stunden, bis sie ihn hinter sich hatten. An manchen Stellen traten die Felswände so dicht zusammen, dass sie sich seitlich hindurchzwängen mussten, aber obwohl ihnen von der verpesteten Luft schwindlig war, dachten sie keinen Augenblick an Umkehr, denn das Pergament ließ keinen Zweifel daran, dass es einen Ausgang geben musste. Sie sahen Nischen in den Wänden, in denen riesige Schädel und Knochen aufgeschichtet waren, von denen manche aussahen, als stammten sie von Menschen.
»Der Friedhof der Yetis …«, flüsterte Dil Bahadur.
Unverhofft blies ihnen eine feuchtheiße Böe ins Gesicht und kündigte den Ausgang der Schlucht an.
Tensing ging voraus, dicht gefolgt von seinem Schüler. Als Dil Bahadur die Landschaft sah, die sich vor ihnen auftat, glaubte er sich auf einem anderen Planeten. Hätte er nicht so deutlich seine müden Glieder und seinen von dem Schwefelgestank durcheinander gebrachten Magen gespürt, er hätte geglaubt, auf einer Trancereise zu sein.
»Da ist es: das Tal der Yetis«, verkündete der Lama mit einer ausladenden Handbewegung.
Vor ihnen lag ein vulkanisches Hochtal. Zwischen den Schneefeldern wuchsen Büschel harter graugrüner Gräser, dichtes Gestrüpp und große Pilze in allen Formen und Farben. Hier gab es Bäche und Tümpel mit blubberndem Wasser, türmte sich Lavagestein zu merkwürdigen Gebilden, und in hohen Fontänen schoss weißer Dampf aus dem Boden. Über allem lag ein zarter Dunst, in dem die Konturen der Berge ringsum verschwammen und das weite Tal wie verzaubert wirkte. Die beiden Besucher fühlten sich, als hätten sie ihre Welt verlassen und wären in einer anderen Dimension wieder zu sich gekommen. So viele Tage hatten sie die schneidende Kälte in den Bergen ertragen müssen, jetzt empfanden sie die laue Luft hier als ein Geschenk für all ihre Sinne, vergaßen sogar den brechreizerregenden Gestank, der auch jetzt noch vorhanden war, allerdings nicht mehr so stark wie in der Schlucht.
»Früher haben bestimmte Lamas, die man sorgfältig auswählte, weil sie körperlichen Strapazen gewachsen und spirituell gefestigt sein mussten, diese Reise alle zwanzig Jahre gemacht, um Heilpflanzen zu sammeln, die es nur hier gibt«, erklärte Tensing.
So vieles war anders geworden, seit die Chinesen 1950 Tibet überfallen hatten. Sechstausend Klöster hatten sie zerstört, und die übrigen waren geschlossen worden. Die meisten Lamas waren in andere Länder ins Exil gegangen, viele nach Indien und Nepal oder ins Reich des Goldenen Drachen, wo sie weiter nach den Lehren Buddhas lebten. Die chinesischen Invasoren hatten also eher das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollten: Sie hatten den Buddhismus nicht ausgerottet, sondern dazu beigetragen, ihn in die ganze Welt zu tragen. Dennoch war seither viel vom medizinischen Wissen und den geistigen Fähigkeiten der Lamas in Vergessenheit geraten.
»Die Pflanzen wurden getrocknet, zerrieben und mit anderen Zutaten vermischt. Ein Gramm dieses Pulvers kann wertvoller sein als alles Gold der Welt«, sagte der Meister.
»Wir können nicht viel mitnehmen. Schade, dass wir kein Yak dabeihaben.«
»Ein Yak wäre vielleicht nicht freiwillig auf einer Holzstange über einen Abgrund balanciert. Wir nehmen mit, was wir tragen können.«
Sie gingen weiter hinein in das geheimnisvolle Tal und waren noch nicht weit gekommen, da stießen sie auf etwas, das aussah wie ein Gerippe. Der Lama erklärte seinem Schüler, es seien versteinerte Knochen von einem Tier, das vor der großen Sintflut gelebt habe. Auf allen vieren suchte er den Boden ab, bis er einen dunklen Stein mit roten Sprenkeln fand.
»Schau, Dil Bahadur, Drachenkot. Er hat magische Kräfte.«
»Ich soll nicht alles glauben, was ich höre, Meister, richtig?«
»Schon, aber vielleicht kannst du mir diesmal glauben.« Der Lama hielt ihm das Stück hin.
Der Prinz zögerte. Er fand es nicht eben verlockend, so etwas anzufassen.
»Er ist versteinert«, lachte Tensing. »Man kann damit gebrochene Knochen in wenigen Minuten heilen. Eine Prise davon, gemahlen und in Reisschnaps gelöst, kann wahre Wunder wirken.«
In dem Brocken, den Tensing gefunden hatte, war ein kleines Loch, und der Lama fädelte einen Lederriemen hindurch und band ihn Dil Bahadur um den Hals.
»Das ist so gut wie ein Kettenhemd, es hat nämlich auch die Fähigkeit, bestimmte Metalle abzuwehren. Pfeile, Messer und andere Waffen, die eine Schneide haben, werden dir nichts anhaben können.«
»Aber vielleicht genügt ein entzündeter Zahn oder einmal Stolpern auf dem Eis oder ein Steinschlag auf den Kopf, und ich falle tot um …« Der Prinz lachte.
»Wir sterben alle, nur das steht unabänderlich fest, Dil Bahadur.«
~
Der Lama und der Prinz ließen sich neben einer der Dampffontänen nieder und freuten sich auf die erste angenehme Nacht seit Tagen, denn die dicke Dampfsäule würde sie warm halten. Mit dem Wasser einer nahen heißen Quelle hatten sie Tee aufgebrüht. Das Wasser trat kochend aus dem Fels, und wenn sich das Geblubber legte, sah man, dass es blass lavendelfarben war. Die Quelle speiste einen dampfenden Bach, an dessen Ufern fleischige dunkelviolette Blumen wuchsen.
Tensing schlief fast nie. Stattdessen ruhte er sich mit halb geschlossenen Augen im Lotossitz aus. Während er vollkommen reglos dasaß, konnte er seine Atmung und den Herzschlag verlangsamen, seinen Blutdruck und die Körpertemperatur senken und erreichte damit eine Ruhe wie ein Tier im Winterschlaf. Genauso mühelos schüttelte er diesen Zustand wieder ab, konnte, wenn nötig, von einer Sekunde auf die andere wie ein Pfeil hochschnellen und war auf der Stelle hellwach. Jahrelang hatte Dil Bahadur vergeblich versucht, ihm das nachzumachen. Jetzt überließ er sich der Erschöpfung und schlief, kaum dass sein Kopf die Erde berührte.
Der Prinz schrak hoch, weil um ihn her plötzlich ein fürchterliches Grunzen war. Er schlug die Augen auf, sah, wer sie da umringte, und war im gleichen Augenblick mit abwehrbereit nach vorne gestreckten Armen in die Hocke gesprungen. Er wollte sich eben mit Hieben Platz verschaffen, da ließ ihn die ruhige Stimme seines Meisters mitten in der Bewegung erstarren:
»Ruhig. Das sind die Yetis. Sei offen und achtsam wie bei dem Tiger.«
Um sie her drängelte sich eine Horde abstoßender Kreaturen, ungefähr einsfünfzig groß und ganz von schmutzig weißen, verfilzten Zotteln bedeckt, mit Armen, die fast auf dem Boden schleiften, und kurzen, krummen Beinen, die in ausladenden Affenfüßen endeten. Von wegen Riesen, dachte Dil Bahadur. Aber wenn nur die Füße so groß waren, zu wem gehörten dann diese langen Knochen und mächtigen Schädel in der Schlucht?
Ihr kleiner Wuchs änderte auch nicht viel, sie sahen einfach zum Fürchten aus. Die behaarten, plattnasigen Gesichter hatten fast etwas Menschliches, aber der Ausdruck darin war der von wilden Tieren; die kleinen Augen waren gerötet, die Ohren gespitzt wie bei beißwütigen Hunden und die Zähne lang und messerscharf. Jedes Mal, wenn sie zu einem neuen Grunzen ansetzten, schnellten kurz ihre Zungen nach vorne, die an der Spitze eingerollt waren wie bei Echsen und dunkelviolett glänzten. Vor der Brust trugen sie einen Lederschurz, der im Nacken und um die Hüften von Riemen gehalten wurde und von getrockneten Blutflecken starrte. Sie drohten mit Keulen und Faustkeilen, blieben aber trotz dieser Waffen und ihrer deutlichen Überzahl argwöhnisch außer Reichweite. Es dämmerte, und im ersten Morgenlicht, das durch den zähen Nebel drang, wirkte die Szenerie noch gespenstischer.
Sehr bedächtig, um seine Gegner nicht zu reizen, richtete sich Tensing zu seiner vollen Größe auf. Neben diesem baumlangen Mönch sahen die Yetis recht verkümmert aus. Die Aura des Meisters funkelte unverändert weiß und golden, ein Zeichen vollkommener Gelassenheit, während sie bei den meisten dieser Geschöpfe glanzlos war, in Erdfarben flirrte, ein Hinweis auf Krankheit und Angst.
Der Prinz erriet, warum sie nicht angriffen: Sie warteten auf jemanden. Und tatsächlich sah er kurze Zeit später eine Gestalt auf die Gruppe zukommen, die zwar vom Alter gebeugt, jedoch deutlich größer war als die anderen. Obwohl auch sie ein Yeti war, hätte sie aufrecht die Übrigen um zwei Kopf überragt und wäre so groß wie Tensing gewesen. Aber ihr Alter und ein mächtiger Buckel zwangen sie, den Oberkörper waagerecht zu halten und sich auf einen knotigen Stock zu stützen. Während die anderen nur den Lederschurz über ihren schmutzigen Zotteln trugen, hingen dieser Kreatur Ketten aus Zähnen und Knochen um den Hals und ein abgeschabtes Tigerfell über den Schultern.
Keiner hätte sie eine Frau genannt, aber sie war eindeutig weiblich; sie war zwar kein Mensch, aber ein richtiges Tier war sie auch nicht. Ihr Pelz war räudig, an manchen Stellen fehlten ganze Büschel, und dort kam die blanke Haut zum Vorschein, so schuppig und rosa wie ein Rattenschwanz. Alles an ihr war von einer dicken Kruste aus Fett, geronnenem Blut, Schlamm und Grind überzogen, und sie stank erbärmlich. Ihre Fingernägel waren schwarze Klauen, und die wenigen Zähne hingen ihr lose im Maul und tanzten bei jedem Atemzug. Aus ihrer Nase troff ein grüner Rotzfaden. Schleimig schwammen die Augen zwischen den Borsten in ihrem Gesicht. Als sie zu der Gruppe trat, wichen die Yetis ehrerbietig zur Seite; es war nicht zu übersehen, dass sie hier das Kommando führte, sie musste so etwas wie die Königin oder die Hohepriesterin der Horde sein.
Mit großen Augen beobachtete Dil Bahadur, wie sein Meister vor dieser Schauergestalt auf die Knie ging, die Hände vor dem Gesicht faltete und sie mit der im Verbotenen Reich gebräuchlichen Formel begrüßte: Das Glück möge mit Euch sein.
»Tampo kachi«, sagte er.
»Grr-ympr«, knurrte sie und besprenkelte ihn dabei mit Spucke.
Kniend war Tensing mit der gebeugten Greisin auf einer Höhe, so dass sie einander in die Augen sehen konnten. Dil Bahadur folgte dem Beispiel des Lamas, obwohl er sich in dieser Haltung nicht gegen die weiter ihre Keulen schwingenden Yetis verteidigen konnte. Aus den Augenwinkeln schätzte er, dass es ungefähr zehn oder zwölf waren, aber es war unmöglich zu sagen, wie viele sich sonst noch in der Nähe aufhielten.
Die Anführerin der Horde stieß in schneller Folge kehlige und spitze Laute aus, offensichtlich versuchte sie, ihrer Horde etwas zu erklären. Dil Bahadur hatte das vage Gefühl, diese Sprache schon einmal gehört zu haben, wusste aber nicht, wo. Die Töne waren ihm vertraut, auch wenn er kein Wort verstand. Mit einem Mal knieten sich alle Yetis hin und berührten wieder und wieder mit der Stirn die Erde, umklammerten allerdings weiter ihre Waffen, als wüssten sie nicht so recht, ob sie die Besucher nun feierlich begrüßen oder doch ihrem Drang nachgeben und ihnen alle Knochen einzeln brechen sollten.
Die alte Yetifrau hielt sie mit Gebärden in Schach, während sie das Knurren wiederholte, das sich nach Grr-ympr anhörte. Das sollte wahrscheinlich ihr Name sein. Tensing hörte sehr aufmerksam zu, während Dil Bahadur sich damit abmühte, die Gedanken der anderen Yetis zu lesen, aber ihr Geist war ein einziges Gestrüpp aus unverständlichen Bildern. Er lenkte seine Aufmerksamkeit auf das, was die Alte ihnen mitzuteilen versuchte, die ihm nicht so stumpfsinnig vorkam wie die Übrigen. Etliche Bilder formten sich in seinem Kopf. Er sah kleine pelzige Tiere, wie weiße Kaninchen, die in Krämpfen zuckten und dann starr wurden. Er sah Leichen und Gerippe; er sah einige Yetis, wie sie einen der Ihren in eine kochende Dampffontäne trieben; er sah Blut, Tod, Grausamkeit und Terror.
»Vorsicht, Meister, sie sind sehr wild«, stammelte er.
»Möglicherweise sind sie verängstigter als wir, Dil Bahadur«, antwortete der Lama.
Grr-ympr gab den anderen Yetis ein Zeichen, und die hörten endlich mit ihren Drohgebärden auf, während sie selbst sich zum Gehen wandte und dem Prinzen und seinem Meister durch einen Wink zu verstehen gab, dass sie ihr folgen sollten. Flankiert von der Meute, gingen die beiden hinter ihr her, an den Fontänen und siedenden Tümpeln vorbei, bis sich vor ihnen einige Löcher in dem vulkanischen Boden auftaten. Unterwegs sahen sie noch mehr Yetis, die auf der Erde hockten oder lagen und keine Anstalten machten, sich zu nähern.
Vor langer Zeit musste sich hier ein Vulkanausbruch ereignet haben, und während die erste Lavaschicht bei ihrer Berührung mit Schnee und Eis schnell erkaltet war, hatten sich neue Gesteinsmassen darüber geschoben. So hatten sich Grotten und Tunnel gebildet, in denen die Yetis hausten. An manchen Stellen war die Lavakruste aufgerissen, und durch die Löcher konnte man nach innen sehen. Die meisten der Höhlen waren so niedrig und eng, dass Tensing nicht hineingepasst hätte, aber innen musste es angenehm warm sein, denn das Lavagestein speicherte die Hitze von dem heißen Wasser und dem Dampf, die sich unterirdisch einen Weg nach draußen bahnten. So mussten die Yetis den Winter nicht fürchten, den sie ohne diese Vulkanheizung sicher nicht überstanden hätten.
In den Höhlen war kein Werkzeug zu sehen, bloß stinkende Felle lagen herum, und an manchen klebte noch vertrocknetes Fleisch. Erschrocken sah Dil Bahadur, dass auch Yetifelle darunter waren. Die anderen stammten von Chegnos, die von den Yetis in Koppeln aus Felsbrocken und Schnee gehalten wurden. Sein Meister hatte ihm von dieser sonderbaren Mischung aus Rind und Schaf erzählt, die es nur hier gab: Die Chegnos waren kleiner als Yaks und hatten gebogene Hörner wie Widder. Die Yetis aßen ihr Fleisch, nutzten das Fett, die Felle und auch den getrockneten Kot, der ihnen als Brennstoff diente. Die Tiere waren genügsam, brauchten wenig Futter und konnten auch die schlimmsten Schneestürme überstehen. Ohne sie hätten die Yetis hier oben verhungern müssen.
~
»Wir bleiben ein paar Tage hier, Dil Bahadur. Versuch, die Sprache der Yetis zu lernen«, sagte der Lama.
»Wozu, Meister? Wir werden sie nie wieder brauchen.«
»Ich möglicherweise nicht, aber du vielleicht schon«, gab Tensing zur Antwort.
Nach und nach glaubten sie, etwas von dem zu verstehen, was die alte Yetifrau ihnen mit diesen knurrend glucksenden Wörtern begreiflich machen wollte. Auch Grr-ymprs Gedanken konnten sie leichter lesen und erfuhren so von der Tragödie, die sich bei den Yetis abspielte: Es kamen immer weniger Kinder zur Welt, und die wenigsten blieben lange am Leben. Auch die Erwachsenen ereilte ein grausiges Schicksal. Sie waren nicht mehr so groß wie früher und wurden immer schwächlicher, wie die Fliegen starben sie weg, und nur ein paar wenige waren überhaupt noch kräftig genug, die alltäglichen Arbeiten zu verrichten, sich um die Chegnos zu kümmern, Kräuter zu sammeln und auf die Jagd zu gehen. Es war eine Strafe der Berggötter oder Dämonen, da war sich Grr-ympr sicher. Die Yetis hatten versucht, den Zorn ihrer Götter durch Opfer zu besänftigen, hatten viele ihrer Horde in Stücke gerissen oder in die kochenden Quellen getrieben, aber ihr Tod hatte den Fluch nicht abwenden können.
Grr-ympr blickte auf ein langes Leben zurück. Ihre Herrschaft stützte sich auf ihre Erinnerungen, auf Erfahrungen, über die sonst niemand mehr verfügte. Die Horde war davon überzeugt, dass sie übernatürliche Kräfte besaß, und seit vielen Jahren hofften alle darauf, sie würde sich mit den Göttern verständigen, aber ihre Zauberkunst hatte nichts bewirkt, und bald würde keiner mehr am Leben sein. Wieder und wieder hatte Grr-ympr die guten Götter um Hilfe angerufen, und jetzt, endlich, waren sie gekommen: Sie hatte sie sofort erkannt. Deshalb hatte sie befohlen, den beiden nichts anzutun.
Der Prinz schielte zu seinem Meister hinüber:
»Ich glaube, wenn sie mitkriegen, dass wir keine Götter sind, werden sie nicht sehr erfreut sein.«
»Vielleicht … Aber im Vergleich zu ihnen sind wir Halbgötter, auch wenn unsere Schwächen ohne Zahl sind.« Der Lama zwinkerte ihm zu.
Grr-ympr erzählte davon, dass die Yetis einmal groß gewesen waren und massig, und ihr Pelz war so dicht gewesen, dass er sie auch in den kältesten Winterstürmen hoch oben in den Bergen geschützt hatte. Die Knochen in der Schlucht stammten von diesen Ahnen, den Riesenyetis. Sie wurden dort in Ehren gehalten, auch wenn sich außer ihr niemand mehr an sie erinnern konnte. Grr-ympr war noch sehr klein gewesen, als ihre Sippe das Tal mit den heißen Quellen entdeckt hatte, wo die Temperatur erträglicher und das Leben leichter war, weil hier Pflanzen wuchsen und es Tiere gab, die man jagen konnte, Mäuse etwa und Ziegen, zusätzlich zu den Chegnos.
Die Alte erinnerte sich auch daran, dass sie schon einmal in ihrem Leben Götter wie Tensing und Dil Bahadur gesehen hatte, die ins Tal gekommen waren, um nach Pflanzen zu suchen. Im Austausch gegen die Pflanzen hatten sie den Yetis wichtige Dinge beigebracht, die ihr Leben verbessert hatten. Sie hatten ihnen gezeigt, wie man die Chegnos zähmt und ihr Fleisch kocht, obwohl mittlerweile niemand mehr die Kraft aufbrachte, Steine gegeneinander zu schlagen und ein Feuer zu entfachen. Was die Yetis an Beute kriegen konnten, verschlangen sie roh, und wenn der Hunger zu groß wurde, schlachteten sie ihre Chegnos oder aßen die Leichen der eigenen Gefährten. Die Götter hatten ihnen auch beigebracht, einander Namen zu geben. Grr-ympr bedeutete in der Yetisprache »weise Frau«.
Es war lange her, dass der letzte Gott im Tal gewesen war, lasen sie in Grr-ymprs Gedanken. Nach Tensings Schätzung war seit mindestens fünfzig Jahren, seit die Chinesen in Tibet einmarschiert waren, niemand mehr auf der Suche nach Heilpflanzen hierher gekommen. Die Yetis wurden normalerweise nicht sehr alt, und außer dieser Greisin hatte keiner jemals einen Menschen gesehen, aber es gab Legenden bei ihnen von den weisen Lamas.
~
Tensing zwängte sich auf allen vieren in eine der Höhlen, die innen geräumiger war als die anderen und zweifellos von der Horde als Versammlungsort genutzt wurde, als eine Art Ratszimmer. Drinnen setzten sich Dil Bahadur und Grr-ympr neben ihn, und nach und nach kamen die übrigen Yetis herein, einige von ihnen so geschwächt, dass sie nur mühsam über den Boden krochen. Die Kämpfer dieser jämmerlichen Schar, von denen die Besucher so unfreundlich empfangen worden waren, blieben draußen und bewachten mit ihren Keulen und Faustkeilen den Höhleneingang.
Einer nach dem anderen gingen die Yetis zu den Sitzenden, insgesamt waren es etwa zwanzig, die zwölf Kämpfer nicht mitgezählt. Es waren fast ausnahmslos Yetifrauen, die ihrem Fell und den Zähnen nach zu urteilen jung waren, aber sterbenskrank aussahen. Sehr behutsam, um ihnen keine Angst einzujagen, untersuchte Tensing jede Einzelne. Die letzten fünf hatten ihre Säuglinge mitgebracht, die Einzigen, die noch am Leben waren. Sie sahen nicht so widerlich aus wie die Erwachsenen, ein bisschen wie ausgeleierte weiße Plüschäffchen. Sie hingen schlaff in den Armen ihrer Mütter, konnten die Köpfe nicht heben und Arme und Beine nicht bewegen, hielten die Augen geschlossen und atmeten kaum.
Dil Bahadur musste schlucken, als er sah, wie liebevoll diese schauerlichen Yetimütter mit ihren Kindern umgingen. Sie wiegten die Kleinen in den Armen, schnüffelten an ihnen und leckten ihnen das Fell, legten sie sich an die Brust, um sie zu stillen, und schrien ängstlich auf, wenn sie sich nicht rührten.
»Das ist so traurig, Meister. Sie sterben«, sagte der Prinz.
»Das Leben ist voller Leid. Unsere Aufgabe ist es, das Leid zu mindern, Dil Bahadur«, antwortete Tensing.
Hier drinnen war das Licht so trüb, und es stank so unerträglich, dass der Lama schließlich alle bat, wieder mit ihm ins Freie zu gehen. Vor dem Höhleneingang versammelte sich die Horde erneut. Grr-ympr tanzte eine Weile um die kranken Kinder herum, rasselte mit ihren Ketten aus Knochen und Zähnen und stieß dazu markerschütternde Schreie aus. Die anderen Yetis begleiteten ihr Gekreisch mit einem wimmernden Singsang.
Ohne auf dieses misstönende Wehklagen zu achten, beugte sich Tensing zu den Kleinen hinunter. Dil Bahadur sah an seinem Gesichtsausdruck, dass er sich auf seine Heilkräfte konzentrierte. Der Lama hob den kleinsten der Säuglinge hoch, der bequem auf seiner Handfläche Platz fand, und besah ihn sich aufmerksam. Dann wandte er sich unter beschwichtigenden Gebärden an die Mutter und untersuchte einige Tropfen ihrer Milch.
»Was ist mit dem Kleinen?«, fragte der Prinz.
»Möglicherweise verhungert es«, sagte Tensing.
»Es verhungert? Es hat doch die Milch!«
Tensing zeigte sie ihm: Sie war ganz dünnflüssig und gelb. Jetzt winkte der Lama die Kämpfer zu sich, die nicht kommen wollten, bis Grr-ympr einen Befehl knurrte, und auch die untersuchte er, wobei er sich besonders eingehend die violetten Zungen ansah. Er stellte fest, dass nur die Zunge der alten Grr-ympr nicht verfärbt war. Ihr Mund war ein stinkendes, schwarzes Loch, nicht sehr einladend, seine Nase dort hineinzustecken, aber Tensing war Kummer gewöhnt.
»Die Yetis sind allesamt unterernährt, außer Grr-ympr, der nur ihr Alter zu schaffen macht. Sie ist bestimmt an die hundert Jahre alt«, sagte der Lama, an seinen Schüler gewandt.
»Was kann sich im Tal denn verändert haben, dass sie nicht mehr genug zu essen finden?«
»Vielleicht gibt es ja Nahrung genug, und ihr Körper kann sie nur nicht richtig verwerten, weil sie so krank sind. Die Säuglinge haben nur die Muttermilch, aber die macht sie nicht satt, weil sie wie Wasser ist, deshalb sterben sie nach wenigen Wochen oder Monaten. Die Erwachsenen sind widerstandsfähiger, sie essen Fleisch und Pflanzen, aber etwas schwächt sie.«
»Und deshalb werden sie auch nicht mehr so groß wie früher und sterben eher«, spann Dil Bahadur den Gedanken weiter.
»Vielleicht.«
Der Prinz schielte gen Himmel. Dieses nebelhafte vielleicht seines Meisters machte ihn manchmal ganz kribbelig.
»Es kann erst vor ungefähr zwei Generationen angefangen haben«, versuchte er es noch einmal. »Grr-ympr erinnert sich doch noch daran, dass alle Yetis einmal so groß waren wie sie. Wenn das so weitergeht, sind sie möglicherweise in ein paar Jahren alle tot.«
»Vielleicht«, sagte der Lama zum hundertsten Mal, als hätte er überhaupt nicht zugehört, fügte aber gleich darauf hinzu, Grrympr erinnere sich ja auch noch, wie die Yetis das Tal entdeckt hatten. Das konnte nur heißen, dass etwas hier ihnen nicht bekam, etwas in diesem Tal die Yetis umbrachte.
»So muss es sein …! Könnt Ihr sie retten, Meister?«
»Vielleicht …«
Der Lama schloss für einen Moment die Augen und betete, hoffte auf eine Eingebung, um dieses Rätsel zu lösen, und bat um Demut, damit er einsehen konnte, dass nichts von dem, was vom Schicksal bestimmt war, in seiner Hand lag. Er würde tun, was er konnte, aber über Leben und Tod hatte er keine Macht.
Als diese kurze Meditation beendet war, rieb sich Tensing die Hände mit Schnee sauber und ging zu den Koppeln der Chegnos hinüber, wo er eines der Muttertiere auswählte und molk. Mit seinem Essnapf voller warmer, schaumiger Milch kehrte er zu den Kindern zurück. Er feuchtete einen Zipfel seines Umhangs in der Milch an und steckte ihn einem der Kinder in den Mund. Erst rührte sich das Kleine überhaupt nicht, aber mit einem Mal schien der Milchgeruch es aufzuwecken, seine Lippen bewegten sich, und es nuckelte ganz schwach an dem Stoff. Mit Gebärden forderte der Lama die Mütter auf, seinem Beispiel zu folgen.
Es dauerte lang und war ermüdend, den Yetis beizubringen, wie sie die Chegnos melken und den Säuglingen Tropfen für Tropfen die Milch einflößen sollten. Die Yetis waren kaum in der Lage, etwas mit dem Verstand zu erfassen, und begriffen es erst, wenn man es ihnen wieder und wieder vormachte. Den ganzen Tag mühten sich Meister und Schüler damit ab, und tatsächlich wurden sie noch am gleichen Abend belohnt, als sie drei der Kleinen zum ersten Mal weinen hörten. Am nächsten Morgen schrien alle fünf und wollten gefüttert werden, schlugen kurze Zeit später die Augen auf und strampelten zaghaft.
Dil Bahadur war so stolz, als wäre das alles seine Idee gewesen, aber Tensing hatte keine Ruhe. Es musste eine Erklärung geben für diese Krankheit. Er nahm alles in Augenschein, was sich die Yetis in den Mund stopften, fand aber keinen Hinweis, bis er selbst und sein Schüler Bauchschmerzen bekamen und Galle erbrachen. Die beiden aßen wie gewöhnlich ausschließlich Tsampa, den warmen Gerstenbrei mit Butter. Das Fleisch der Chegnos, das ihnen die Yetis anboten, rührten sie nicht an, denn sie waren Vegetarier.
»Was haben wir zu uns genommen, das anders ist als sonst, Dil Bahadur?«, fragte der Meister, während er für beide einen Tee aufbrühte, der gegen die Bauchschmerzen helfen sollte.
»Nichts, Meister.« Dil Bahadur war totenbleich.
»Es muss etwas geben«, ließ Tensing nicht locker.
»Wir haben bloß Tsampa gegessen, sonst nichts …«
Tensing reichte ihm den Napf mit dem Tee, und Dil Bahadur, der sich vor Schmerzen krümmte, hob ihn an die Lippen. Er kam nicht mehr dazu, die Flüssigkeit zu schlucken. Er spuckte sie in den Schnee.
»Das Wasser, Meister! Das heiße Wasser!«
Normalerweise kochten sie ihr Wasser für die Tsampa über einem Feuer, und wenn sie kein frisches Quellwasser finden konnten, nahmen sie Schnee, aber hier im Tal hatten sie das siedende Wasser aus einem der heißen Tümpel benutzt.
»Das ist es, was die Yetis vergiftet, Meister.« Der Prinz war sich sicher.
Sie hatten gesehen, dass die Yetis mit dem lavendelfarbenen Wasser derselben Quelle eine Suppe aus Pilzen, Kräutern und violetten Blüten anrührten, die sie fast täglich aßen. Grr-ympr hatte mit den Jahren den Appetit verloren, aß nur alle paar Tage etwas rohes Fleisch und stopfte sich händeweise Schnee in den Mund gegen den Durst. Dieses Quellwasser musste irgendwelche Giftstoffe enthalten. In den nächsten Stunden tranken sie keinen Tropfen mehr davon, und die Übelkeit verschwand und kam nicht wieder. Um sicher zu gehen, dass sie den Grund für die Krankheit gefunden hatten, brühte sich Dil Bahadur am folgenden Tag noch einmal einen Tee mit dem verdächtigen Wasser auf und trank ihn. Wenig später musste er sich übergeben, und freute sich richtig darüber: Seine Theorie hatte sich bestätigt.
Mit Engelsgeduld machten der Lama und sein Schüler Grrympr klar, dass sie auf gar keinen Fall das Wasser aus der lavendelfarbenen Quelle trinken oder die violetten Blumen essen durften, die das Ufer des Bachlaufs säumten. Das heiße Wasser war gut, um sich darin zu waschen, nicht zum Trinken, nicht zum Essenmachen, schärften sie ihr ein. Sie versuchten gar nicht erst, ihr etwas von mineralischer Verseuchung zu erzählen, das hätte die greise Yeti-Frau wohl doch nicht verstanden; es genügte, wenn sich die Yetis an die Anweisung hielten. Grr-ympr übernahm alles Übrige. Sie rief die Horde zusammen und verkündete das neue Gesetz: Wer dieses Wasser trinkt, wird in die kochenden Dämpfe geworfen, verstanden? Alle hatten verstanden.
Die Yetis halfen Tensing und Dil Bahadur beim Sammeln der Heilpflanzen. Die Wochen gingen ins Land, und die beiden Besucher im Tal der Yetis konnten sehen, wie es den Kindern von Tag zu Tag besser ging und wie auch die Erwachsenen langsam wieder zu Kräften kamen, während die violette Verfärbung ihrer Zungen verschwand.
Schließlich war es Zeit, Abschied zu nehmen, und Grr-ympr begleitete sie höchstpersönlich. Sie sah, wie die beiden auf die Schlucht zusteuerten, zögerte, weil sie selbst ihren guten Göttern das Geheimnis der Yetis nicht ohne weiteres verraten wollte, zog sie aber schließlich doch in die entgegengesetzte Richtung. Der Lama und der Prinz folgten ihr über eine Stunde lang auf einem schmalen Pfad, der sich zwischen den Dampfsäulen hindurch und an den siedenden Tümpeln vorbeischlängelte, bis die Höhlensiedlung der Yetis weit hinter ihnen lag und sie das gegenüberliegende Ende des Tals erreichten.
Dort deutete die Alte auf eine Öffnung im Berg und gab ihnen zu verstehen, dass die Yetis dort hinausgingen, wenn sie Nahrung suchten. Tensing verstand, was sie ihnen sagen wollte: Es war ein Tunnel, der als Abkürzung diente. Das mysteriöse Tal lag viel näher an den von Menschen bewohnten Gegenden, als irgendwer zu träumen gewagt hätte. Tensings Pergament beschrieb den einzigen Weg, den die Lamas kannten, aber daneben gab es noch diesen geheimen Durchgang, mit dem man sich einen großen Teil der Strecke und viele Hindernisse ersparen konnte. So wie der Tunnel gelegen war, nahm Tensing an, dass er direkt im Innern des Berges nach unten und vor der Klosterburg Chenthan Dzong wieder ins Freie führte. Damit sparten sie sich zwei Drittel des Weges.
Grr-ympr kannte nur eine Art, sich liebevoll von jemandem zu verabschieden, und das tat sie jetzt: Sie schleckte den beiden über Gesicht und Hände, bis sie vor Spucke und Rotz klebten.
Die grausige Alte hatte ihnen kaum den Rücken gekehrt, da wälzten sich Dil Bahadur und Tensing im Schnee und schrubbten alles wieder ab. Der Meister lachte herzhaft, aber seinen Schüler schüttelte es vor Ekel.
»Mein einziger Trost ist, dass wir die gute Frau niemals wiedersehen«, stöhnte er.
»Niemals ist eine lange Zeit, Dil Bahadur. Vielleicht hält das Leben noch eine Überraschung für uns bereit«, antwortete der Lama und machte einen entschlossenen Schritt hinein in den engen Tunnel.
ZWEITES KAPITELDrei ganz erstaunliche Eier
Etwa zur gleichen Zeit landeten auf der anderen Seite der Erde Alexander Cold und seine Großmutter Kate in New York. Alex hatte in der Amazonassonne eine Farbe bekommen wie ein Stück Tropenholz. Seine Haare waren zu einer Topffrisur geschnitten, wie sie die Indianer im Regenwald tragen, oben war eine kreisrunde Fläche ausrasiert, und dort prangte eine frische Narbe. Über seiner Schulter hing ein schmuddeliger Rucksack, und in der Hand hielt er eine Flasche mit einer milchigen Flüssigkeit. Kate Cold, die genauso braun gebrannt war wie er, hatte ihre khakifarbene Lieblingspumphose an und trug dazu klobige, schlammverschmierte Treter. Mit ihren selbstgestutzten grauen Haaren sah sie aus wie ein unlängst aus dem Schlaf gerissener Mohikaner. Sie war tatsächlich müde, nur ihre Augen blitzten lebhaft hinter den zerkratzten Brillengläsern in einem mit Klebeband zusammengehaltenen Gestell. Im Gepäck hatten die beiden ein ungefähr drei Meter langes, stabförmiges Etwas, das quer über einigen Kisten von ebenfalls wenig gebräuchlicher Größe und Form lag.
»Haben Sie etwas zu verzollen?« Der Beamte an der Passkontrolle warf einen missbilligenden Blick auf die Frisur des Jungen und den Aufzug der Alten.
Es war fünf Uhr morgens und der Mann genauso verschlafen wie die Passagiere des Flugzeugs, das soeben aus Brasilien eingetroffen war.
»Nichts. Wir sind Reporter des International Geographic. Alles, was wir dabeihaben, ist Ausrüstung für unsere Arbeit«, antwortete Kate Cold.
»Obst, Gemüse, sonstige Nahrungsmittel?«
»Nur das Wasser des Lebens für meine Mutter, die ist krank …« Alex zeigte ihm die Flasche, die er während der ganzen Reise in der Hand gehalten hatte.
»Einfach nicht hinhören«, sagte Kate schnell, »der Junge hat zu viel Phantasie.«
»Was ist da drin?« Der Beamte deutete auf das lange, mit Zeitungspapier umwickelte Ding.
»Ein Blasrohr.«
»Ein was?«
»So eine Art ausgehöhlte Holzstange, mit der die Indianer am Amazonas ihre Pfeile abschießen, meistens sind die vergiftet mit …« Alex hätte es dem Zollbeamten gerne erklärt, aber seine Großmutter trat ihm ans Schienbein.
Der Mann war nicht bei der Sache und fragte nicht weiter, also erfuhr er nichts von einem Köcher mit Pfeilen und nichts von einer Kalebasse voll mit dem tödlichen Gift Curare, die zusammen in einer der Kisten steckten.
»Sonst noch was?«
Alex kramte in den Taschen seines Anoraks und hielt ihm drei gläserne Eier unter die Nase.
»Was ist das?«
»Ich glaube, es sind Diamanten«, sagte Alex und bekam auch gleich den nächsten Tritt von seiner Großmutter.
»Diamanten! Scherzkeks! Was haben sie dir denn eingeflößt?« Der Beamte lachte gequält, stempelte die Pässe ab und winkte die beiden durch.
~
Als sie die Tür zu Kates New Yorker Wohnung öffneten, quoll ihnen ein strenger Geruch entgegen. Kate tippte sich an die Stirn. Schon wieder hatte sie vergessen, vor der Reise den Müll runter zu bringen. Tapfer hielten sie sich die Nase zu und stolperten vorwärts. Während Kate das Gepäck durch die Tür zerrte, riss ihr Enkel sämtliche Fenster auf und kümmerte sich dann um den Abfalleimer, in dem schon ein stattliches Dickicht mit allerlei Getier gewachsen war. Als sie endlich auch das Blasrohr in die winzige Wohnung gezwängt hatten, ließ sich Kate breitbeinig aufs Sofa plumpsen und schnaufte. Sie merkte langsam, dass sie nicht mehr die Jüngste war.
Alex zog die drei runden Dinger aus seinem Anorak und legte sie auf den Tisch. Kate warf einen unbeteiligten Blick darauf. Sie sahen aus wie diese Briefbeschwerer aus Glas, die sich die Touristen als Souvenir kaufen.
»Es sind Diamanten, Kate«, sagte ihr Enkel.
»Na klar! Und ich bin Marilyn Monroe.«
»Wer?«
»Was!« Sie starrte ihn entgeistert an.
»Sagt mir halt nichts, wohl eher jemand aus deiner Zeit.« Er hielt ihren Blick aus.
»Das hier ist meine Zeit! Jedenfalls mehr als deine. Wenigstens lebe ich nicht hinterm Mond«, schnaubte sie.
»Es sind wirklich Diamanten«, nahm er einen neuen Anlauf.
»Okay, Alexander, es sind Diamanten.«
»Du wolltest mich doch Jaguar nennen, oder? Ist immerhin mein Totemtier. Die Diamanten gehören eigentlich den Indianern, Kate, sie sind für die Nebelmenschen bestimmt. Ich habe Nadia versprochen, dass wir ihnen damit helfen.«
»Ja, ja.« Kate hörte überhaupt nicht zu.
»Mit den Steinen können wir die Stiftung finanzieren, die du zusammen mit Professor Leblanc gründen wolltest.«
»Ich glaube, bei dir sind ein paar Schrauben locker, seit sie dir mit dem Knüppel eins übergebraten haben, mein Lieber«, sagte sie und ließ die Kristalleier in ihrer Jackentasche verschwinden, damit er endlich Ruhe gab.
In den nächsten Wochen sollte sie Gelegenheit haben, ihr Urteil über ihren Enkel noch einmal zu überdenken. Kate besaß die Kristalleier nun schon seit zwei Wochen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, bis sie einmal ihre Jacke von einer Stuhllehne nahm und dabei eines aus der Tasche und ihr auf die Zehen fiel. Ihr Enkel war mittlerweile wieder zu Hause in Kalifornien bei seinen Eltern. Ein paar Tage lief sie mit einem wehen Fuß herum und spielte zerstreut mit den runden Dingern in ihrer Jackentasche. Als sie eines Morgens beim Italiener an der Ecke einen Kaffee trank, vergaß sie eins davon auf dem Tisch. An der nächsten Querstraße hörte sie den Cafébesitzer, den sie seit zwanzig Jahren kannte, hinter sich rufen:
»Kate! Dein Glasei, du hast es liegen lassen!« Er warf es ihr über die Köpfe der Passanten hinweg zu.