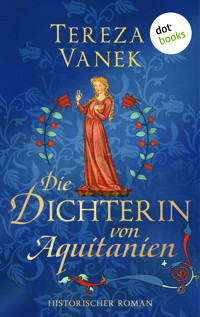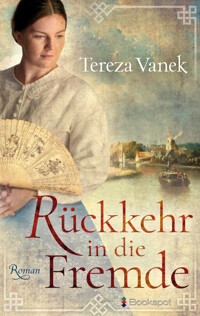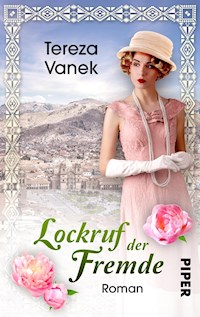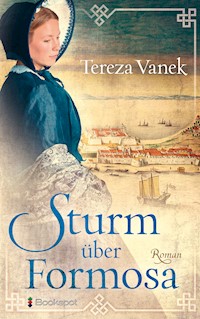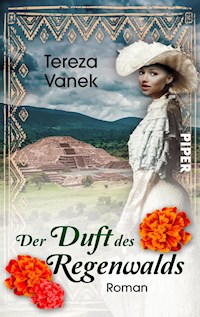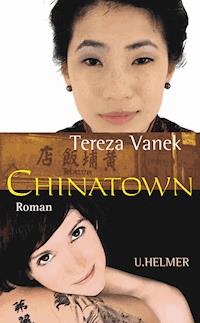Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er sollte ihr Feind sein – doch ihr Herz spricht eine andere Sprache … London, 1830. Nach dem Tod ihrer Eltern reist die junge Emily Lawson nach Jamaica, um ihren Mann zu finden, der den Menschen dort als Baptistenpfarrer den christlichen Glauben predigt. Doch als sie ankommt, muss sie feststellen, dass Jeremiah inzwischen sein Glück mit einer anderen Frau gefunden hat und nichts mehr von Emily wissen will. Dennoch ist sie fest entschlossen, sich ihr neues Leben auf der Insel aufzubauen, denn sie hat das Gefühl, hier eine Aufgabe zu haben: Schockiert von dem Leid der Menschen, die sich Tag für Tag auf den Zuckerrohrplantagen quälen müssen, setzt sie sich bald leidenschaftlich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Dabei begegnet sie auch Christopher Hindley, Sohn einer der reichsten Plantagenbesitzer Jamaicas. Obwohl die beiden auf unterschiedlichen Seiten stehen, spürt Emily schon bald eine rätselhafte Anziehung … aber kann sie diese Gefühle wirklich zulassen? Unter der glühenden Karibik-Sonne: Ein mitreißender historischer Roman für alle Fans von Tara Haigh und Linda Belago.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1830. Nach dem Tod ihrer Eltern reist die junge Emily Lawson nach Jamaica, um ihren Mann zu finden, der den Menschen dort als Baptistenpfarrer den christlichen Glauben predigt. Doch als sie ankommt, muss sie feststellen, dass Jeremiah inzwischen sein Glück mit einer anderen Frau gefunden hat und nichts mehr von Emily wissen will. Dennoch ist sie fest entschlossen, sich ihr neues Leben auf der Insel aufzubauen, denn sie hat das Gefühl, hier eine Aufgabe zu haben: Schockiert von dem Leid der Menschen, die sich Tag für Tag auf den Zuckerrohrplantagen quälen müssen, setzt sie sich bald leidenschaftlich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Dabei begegnet sie auch Christopher Hindley, Sohn einer der reichsten Plantagenbesitzer Jamaicas. Obwohl die beiden auf unterschiedlichen Seiten stehen, spürt Emily schon bald eine rätselhafte Anziehung … aber kann sie diese Gefühle wirklich zulassen?
eBook-Neuausgabe September 2025
Copyright © der Originalausgabe 2019 Tereza Vanek
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Mihai-Bogdan Lazar, Nature Peaful, RUNGSAN NANTAPHUM, Suthin_Saenontad, Dan Thornberg, Designer Saidur
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ah)
ISBN 978-3-98952-876-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tereza Vanek
Im Reich des Zuckerrohrs
Roman
dotbooks.
Me know no law, me know no sin,
Me just wat ebba them make me;
This ist he may dem bring me in;
So God nor devil take me.
Altes Lied einer Sklavin aus Jamaika
Kapitel 1
London,1830
»Ich bedauere Ihren Verlust«, sagte Dr. Jitter und hielt Emily die Hand hin. Der Druck seiner Finger fiel unnötig kräftig aus, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht das Gesicht zu verziehen. »Meine ... ähm ... Rechnung schicke ich Ihnen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Wir müssen alle leben.«
»Natürlich. Natürlich«, stammelte Emily und wickelte den Schal enger um ihre Schultern, weil der Wind durch die undichten Fenster ins Zimmer pfiff. Obwohl es bereits Mitte Juli war, fiel draußen seit Tagen nur Regen, und der Himmel war so dunkel, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor.
Ähnlich empfand Emily im Augenblick auch ihre Lage. Der Vater hatte die kleine Familie mit seinen Buchillustrationen mühsam über Wasser halten können. Nach seinem Tod hatte die Mutter Näharbeiten angenommen, bei denen Emily ihr fleißig geholfen hatte, obwohl sie mit der Nadel nie wirklich geschickt gewesen war. Wie würde sie nun die Miete für ihre winzige Wohnung im Eastend zahlen, wenn sie über keinerlei besonderen Fähigkeiten verfügte? Sie wusste es nicht, aber die gespenstische Leere in dem dunklen Zimmer machte ihr im Moment noch mehr Angst als alle Sorgen um ihre zukünftige Existenz. Der bettlägerigen Mutter ihre Medizin zu verabreichen, sich um das nächste Essen zu kümmern und die Wohnung sauber zu halten – all das hatte in den letzten Monaten ihren Alltag bestimmt. Aber die ganze Zeit war die Mutter noch bei ihr gewesen, hatte sie trotz Fieberschüben und schweren Hustenanfällen mit Ratschlägen unterstützt. Nun war Emily allein. Unter ihr hatte sich ein rabenschwarzer Abgrund aufgetan, sie fiel und fiel, ohne auch nur die Kraft zu haben, irgendwo nach Halt zu suchen.
»Brauchen Sie Hilfe bei der Organisation der Beerdigung?«
Dr. Jitter sah sie besorgt über die Ränder seiner Brille an.
Emily unterdrückte den Wunsch, sich an seinen großen, dünnen Körper zu lehnen, denn es tat so wohl, dass irgendjemand sie unterstützen wollte.
»Danke, aber ... meine Mutter wurde doch schon abgeholt.«
Dr. Jitter hatte dafür gesorgt, dass der Leichnam sogleich in die Leichenhalle gebracht worden war, während Emily noch weinend im Schaukelstuhl gesessen hatte. Es würde nur eine Bestattung im Armengrab geben, so wie vor zwei Jahren bei ihrem Vater. Die Vorstellung, dass sie nicht einmal einen Ort haben durfte, wo sie regelmäßig Blumen für ihre Eltern ablegen konnte, ließ eine neue Tränenflut aus ihren Augen strömen. Verlegen wandte sie sich ab. Warum ging der Arzt nicht einfach und schickte dann seine Rechnung? Todesfälle wegen Schwindsucht mussten für ihn zur Tagesordnung gehören.
»Miss Habermash ... gibt es, also ... haben Sie Verwandte oder sonst jemanden, der Ihnen nahesteht und sich nun um Sie kümmern könnte?«
Seine Stimme klang so rührend besorgt, dass Emily einen Schritt in seine Richtung wagte. Er streckte seine Hand aus, um ihre Schulter zu tätscheln.
»Falls Sie Hilfe brauchen, also ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Teller, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Diese Gegend ist kein Ort für eine junge, gottesfürchtige Frau ohne Beschützer.« Die Worte waren gütig, aber etwas an der Art, wie er nun ihren Arm zu streicheln begann, ließ Emily erschrocken zurückweichen. »Miss Habermash ...«, begann er mit einem Räuspern.
»Ich bin Mrs Lawson!«
Früher hatte sie das Drängen ihrer Mutter, dass jede Frau einen Ehemann haben sollte, nie wirklich verstanden. Nun ergab es Sinn, denn allein die Anrede als Mrs war wie ein Schutzschild, hinter dem sie sich verstecken konnte. Dr. Jitter räusperte sich verlegen.
»Ich verstehe. Sie sind also Witwe«, stellte er fest. Emily schüttelte entschlossen den Kopf.
»Mein Mann lebt.« Zumindest hatte sie bisher nichts Gegenteiliges gehört. ›Er ist in Jamaika und predigt den armen Wilden das Wort Gottes.«
Dies hatte sie allen Nachbarn und auch dem Pfarrer erzählt, wenn nach dem Verbleib ihres Ehemannes gefragt wurde. Jeder verstand, dass sie ihren tapferen Gemahl nicht in die Wildnis hatte begleiten wollen. Auch Dr. Jitter nahm diese Umstände kommentarlos hin.
»In diesem Fall sollten Sie Ihrem Gemahl mitteilen, dass Sie nun seine Unterstützung benötigen«, sagte er mit etwas kühlerer Stimme. ›Am besten noch heute, denn die Post nach Jamaika braucht mehrere Wochen. Falls Sie dennoch in Not geraten sollten, können Sie sich an mich wenden.«
»Vielen Dank, Sir«, murmelte Emily, denn sie war es gewohnt, Männern wie ihm Respekt zu zeigen. Vielleicht hatte sie sein Verhalten auch falsch interpretiert, und er hatte ihr wirklich nur helfen wollen.
»Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben alles Gute, Mrs Lawson.«
Er entfernte sich mit einem höflichen Neigen des Kopfes. Emily zuckte zusammen, als die Tür hinter ihm zufiel. Die Stille in den zwei Räumen, die sie seit frühester Kindheit bewohnt hatte, schien ihr plötzlich wie die Schreie der Händler und Huren am Hafen, so aufdringlich und voller Gewalt, dass es in den Ohren schmerzte. Wieder zerrte sie an den Rändern ihres Schals. Ihre Mutter hatte ihn für sie zu Weihnachten gestrickt, kurz nachdem Jeremiah nach Jamaika gesegelt war und sie sich geweigert hatte, ihn zu begleiten. Das Geschenk war wie ein Friedensangebot an die störrische Tochter gewesen, die sich nicht von ihren Eltern hatte trennen wollen. Emily konnte sich noch erinnern, wie sie dankbar über die roten und blauen Streifen gestrichen hatte. Niemand fertigte so akkurate, tadellose Handarbeiten wie ihre Mutter.
Sie ließ sich in den Schaukelstuhl fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. Joanna Habermash würde niemals wieder einen Schal stricken oder Unterröcke nähen, denn sie war für immer aus dieser Wohnung, dieser Stadt, ja von der Welt verschwunden. Sie würde weder Hebevolle noch ermahnende Worte an die Tochter richten können, auch nicht mehr husten, Blut spucken oder über Kopfschmerzen klagen. Die Mutter läge bald schon im Armengrab, während Emily sich in dieser Wohnung wie in einer Gruft fühlte. Es gab nichts außer Erinnerungen, um die winzigen Räume mit Leben zu füllen.
Wie betäubt schlich sie zu der Bank, auf der sie fast ihr ganzes Leben lang jede Nacht geschlafen hatte. Ihr Zusammenleben mit Jeremiah hatte sich auf etwa zwei Monate beschränkt, danach war sie zu ihren Eltern zurückgekehrt, ohne dass er sie aufgehalten hätte. Sie streckte sich aus und zog sich die zerschlissene Decke über den Kopf. Zwar würde sie nicht schlafen können, aber es tat wohl, eine Weile nichts weiter sehen zu müssen als Schwärze.
An Jeremiah schreiben, hatte Dr. Jitter gesagt. Sie hatte aber bereits geschrieben, als der Zustand ihrer Mutter sich drastisch verschlechtert hatte. Joanna Habermash hatte selbst dazu gedrängt. Ein guter Christ würde sich um seine Ehefrau kümmern, weil Gott der Herr es ihm aufgetragen hatte. Nur war auf ihr Schreiben bisher keine Antwort gekommen, obwohl es schon vor etwa einem halben Jahr abgeschickt worden war.
Jeremiah. Ihr Ehemann. Ihr wurde bewusst, dass sie sich nur noch undeutlich an sein Gesicht erinnern konnte. Er hatte schütteres, mittelbraunes Haar gehabt, kleine, aber freundliche Augen und dicke Backen, als sei er ständig am Kauen. In den wenigen Nächten, da er auf ihr gelegen hatte, waren ihr diese Backen besonders aufgefallen und sie hatte an einen Hamster denken müssen. Jedes Mal, wenn Jeremiah sich nach einem tiefen Stöhnen von ihr heruntergerollt hatte, hatte sie das Gefühl gehabt, von Schleim bedeckt zu sein, der aus dem Mund und anderen Körperöffnungen ihres Gemahls stammte.
Aber nun brauchte sie ihn, wie die Mutter ihr vor dem Tod klargemacht hatte. Als letzten Rettungsanker in einer Notlage. Dafür hatte Gott der Herr offenbar Ehemänner geschaffen.
Unter der Matratze, auf der Joanna Habermash sich das Leben aus der Lunge gehustet hatte, lag ein Umschlag mit Geld. In ihren letzten klaren Momenten hatte die Mutter ihn ihr gezeigt.
»Damit kommst du nach Jamaika, Kind. Wenn er dir nicht schreibt, dann musst du einfach zu ihm fahren.«
Das Fieber musste aus Joanna Habermash gesprochen haben. Bei der Vorstellung, dieser Weisung zu folgen, verspürte Emily eine Welle von Panik, die sie erzittern ließ. Was sollte sie allein unter Wilden, auf der Suche nach einem verschollenen Ehemann? Aber dazu würde es nicht kommen. Jeremiah würde ihr einfach Geld schicken, das sicher bald ankommen musste. Auf Jamaika gab es reiche Zuckerbarone, die es gewiss begrüßten, wenn ihre Arbeitskräfte zu frommen Christenmenschen geformt wurden. Sie bezahlten Jeremiah. Es war nur eine Frage der Zeit, dann kämen die Dinge wieder ins Lot.
»Alles wird gut«, sagte Emily mit lauter Stimme zu sich selbst. Trotzdem fror sie so erbärmlich, dass sie das Klappern ihrer eigenen Zähne hören konnte. Es hallte durch die menschenleeren Räume wie ein Dröhnen. Draußen schrie eine heisere Frauenstimme um Hilfe. Das kam öfter vor, es gab Prostituierte in der Nähe, und manche Ehemänner verprügelten regelmäßig ihre Frauen. Trotzdem schien es Emily nun, als wäre dieser Schrei unmittelbar aus ihrer eigenen Seele gekommen. Sie verbarg das Gesicht in ihrem Kissen. Wenigstens konnte sie nun ungehemmt weinen, ohne dass jemand sich ihretwegen Sorgen machte.
Ein hämmerndes Geräusch riss Emily aus dem Schlaf, der sie für eine Weile von ihren Sorgen erlöst hatte. Ohne weiter nachzudenken, schwankte sie ins Schlafzimmer, um nach ihrer Mutter zu sehen, die stets entschieden hatte, wann Besuch willkommen war. Der Anblick des leeren Bettes traf sie wie ein heftiger Schlag. Sie musste sich an der Wand abstützen, während sie zur Tür ging.
»Ich habe von Ihrem Verlust gehört«, sagte Mrs Graham, die Vermieterin, und stemmte die Hände in die Hüften. Mit einer unangenehmen Ahnung wich Emily zurück.
»Es tut mir wirklich sehr leid um Ihre Mutter, Miss Habermash. Sie war eine kluge, tüchtige Frau.«
Etwas an dem Blick, den Mrs Graham ihr zuwarf, machte Emily klar, dass sie selbst von ihr ganz anders eingeschätzt wurde.
»Ich brauche dennoch meine Miete, verstehen Sie? Wir müssen alle leben.«
Das hatte Dr. Jitter auch gesagt. Offensichtlich bestand die ganze Stadt aus Menschen, die um ihr Überleben fürchteten. So wie Emily selbst in diesem Moment.
»Wie viel sind wir Ihnen schuldig?«, fragte sie leise. Ihre Mutter hatte trotz wiederkehrender Fieberschübe bis kurz vor ihrem Tod noch genug Kraft gehabt, sich selbst um diese Dinge zu kümmern. Es war, als hätte Joanna Habermash alle Übel dieser Welt von ihrer Tochter fernhalten wollen. Aber nun stürzten sie auf Emily ein wie Trümmer eines baufälligen Gebäudes.
»Vier Pfund«, verkündete Mrs Graham mit grimmiger Miene. »Leider konnte Ihre Mutter seit längerer Zeit nicht mehr zahlen. Ich bin ja kein Unmensch, der eine Kranke hinauswirft. Aber nun ... also ich brauche mein Geld.«
Sie stand da wie ein Felsen, der nicht so leicht wegzurücken wäre. Emilys Kopf drehte sich. Sie hatte keine Ahnung, wie hoch die Monatsmiete hier gewesen war. Mrs Graham hätte jede Summe nennen können, die ihr gefiel. Eine leise Stimme in ihrem Kopf mahnte sie, misstrauisch zu sein. Aber welche Möglichkeiten hatte sie denn, die Forderung der Vermieterin zu überprüfen?
Sie musste Zeit gewinnen.
»Ich habe natürlich Verständnis und werde die Schulden baldmöglichst begleichen. Bitte geben Sie mir zwei Tage Zeit, um ein paar Wertgegenstände zu verkaufen.«
Mrs Graham sah nicht wirklich überzeugt aus.
»Gut. Wie Sie meinen. Aber ich habe gehört, dass Ihre Mutter noch bei anderen Leuten Schulden hatte.«
»Das weiß ich«, log Emily und überlegte angespannt, wer das alles sein konnte. Natürlich zuerst einmal Dr. Jitter. Dann der Apotheker, der ihnen das Opium gegeben hatte, um die Leiden der Todkranken zu lindern. Sie fürchtete, dass die Liste in Wahrheit noch viel länger wäre. Hatte ihre Mutter deshalb gemeint, sie müsse baldmöglichst nach Jamaika aufbrechen?
»Na gut. Ich komme übermorgen wieder«, murmelte Mrs Graham. »Und Sie sollten sich überlegen, wo Sie jetzt unterkommen. Ein Mädchen in Ihrem Alter sollte nicht allein leben. Außerdem brauchen Sie sicher keine zwei Zimmer.«
Die stämmige Frau wandte sich um, und die Stiegen ächzten unter ihrem Gewicht, als sie hinabstieg. Emily wurde schwindelig. Am liebsten hätte sie noch ein paar Tage auf ihrer Bank gelegen und um ihre Mutter geweint, doch immer neue Schwierigkeiten machten das unmöglich. Mit einem Seufzer schloss sie die Tür und ging ins Schlafzimmer zurück, wo sie den Umschlag mit dem Geld aus seinem Versteck holte. Angespannt begann sie zu zählen. Es waren genau fünf Pfund, sie würde also Mrs Graham bezahlen und vielleicht noch ein paar andere Rechnungen begleichen können, aber dann hätte sie nichts mehr und müsste diese Wohnung hier verlassen.
Kurz fiel ihr das Atmen schwer, dann riss sie sich zusammen. Bisher hatte es immer Menschen gegeben, die für sie gesorgt hatten. Nun galt es, jemanden zu finden, der diese Aufgabe übernahm. Jeremiah wäre als ihr Ehemann der Richtige gewesen, aber er war zu weit weg. Es musste auch hier in London Hilfe geben, und sie konnte das von der Mutter hinterlassene Geld verwenden, um eine Weile über die Runden zu kommen.
Dieser Gedanke beruhigte sie ein wenig. Sie setzte Wasser für Tee auf und aß ein paar Scheiben trockenen Zwiebacks. Danach fühlte sie sich kräftiger.
Ihre Eltern waren beide aus dem Norden Englands nach London gekommen und hatten ihre Familien hinter sich gelassen. Den Grund dafür kannte Emily nicht, im Augenblick schien er auch unwichtig. Verwandtschaft hatte sie hier nicht. Der Vater war mit dem Verleger, dessen Bücher er illustriert hatte, befreundet gewesen. Es hatte sich um religiöse Erbauungsliteratur gehandelt, und über diesen Kontakt war es auch zu ihrer Verlobung mit Jeremiah gekommen. Der junge Pfarrer hatte einige der Texte verfasst. Aber all das war lange her, der Verleger hatte sich nach dem Tod ihres Vaters nicht mehr bei ihnen blicken lassen. Die Mutter hatte unter den Nachbarinnen ein paar Freundinnen gehabt, doch die Vorstellung, bei ihnen mit bittender Miene aufzutauchen, schien Emily allzu beschämend. Am Ende würde man sie nur abwimmeln, da es bereits genug andere Mäuler zu stopfen gab.
Sie brauchte jemanden, der nicht jeden Pence dreimal umdrehen musste, bevor er ihn ausgab, und der ihr wohlgesinnt war. Wie Dr. Jitter. Seine unpassende Berührung gestern war nur dem Umstand geschuldet gewesen, dass er sie für unvermählt gehalten hatte. Ledige Frauen wurden oft als Freiwild betrachtet. Das hatte Joanna Habermash ihrer Tochter eingeschärft, um sie zur Heirat mit Jeremiah zu überreden. Nun, da der Arzt wusste, dass sie eine verheiratete Frau war, würde er sich besser benehmen.
Zur Sicherheit zog sie den schmalen Silberring an, den sie nach Jeremiahs Abreise in einer Schublade hatte verschwinden lassen. Mit dem Schal, den ihre Mutter für sie gestrickt hatte, und robusten Lederschuhen fühlte sie sich in der Lage, den Fußmarsch zu Dr. Jitter anzutreten.
Zum Glück hatte der Regen nachgelassen, und ein paar Sonnenstrahlen ließen die Gegend ein klein wenig heller scheinen als gewöhnlich. Emily wich Unrat und Bettlern aus, sprang im letzten Moment vor einer riesigen Ratte davon und erreichte schließlich das kleine Haus, in dem der Arzt wohnte. Es war sauber gestrichen und hatte sogar einen kleinen, mit Rosen bepflanzten Vorgarten. Emily betätigte den Türklopfer und atmete erleichtert auf, als ihr sogleich geöffnet wurde. Dr. Jitters Haushälterin, eine ältere Frau mit weißer Haube, musterte sie kritisch.
»Geht es Ihnen nicht gut? Ihre Mutter wurde doch schon beerdigt, soviel ich weiß.«
Emily zuckte kurz zusammen, aber sie war von Miss Jonston derart unfreundliche Bemerkungen gewöhnt. Manche Menschen sehen in jedem einen Feind, weil Bitterkeit ihr Herz verschlossen hat, hatte Emilys Mutter ihr dieses Verhalten erklärt. Es half, sich nun an diese Worte zu erinnern.
»Dr. Jitter sagte, ich könnte mich an ihn wenden, wenn ich Schwierigkeiten hätte«, beharrte sie. ›Also so ist das.«
Miss Jonstons Gesicht wurde noch um ein paar Nuancen griesgrämiger, was Emily kaum für möglich gehalten hätte.
›Dann kommen Sie mal rein. Ich werde dem Herrn Doktor Bescheid geben.«
Bisher hatte Emily nur an der Tür vorgesprochen, um den Arzt zu ihrer Mutter zu holen. Nun tat sich ein spärlich eingerichtetes, aber sehr ordentliches Heim vor ihr auf, das in seiner Strenge nur das Werk von Miss Jonston sein konnte. Emily durfte auf einer hölzernen Bank Platz nehmen, während die Haushälterin davoneilte.
Dr. Jitter kam unerwartet schnell. Sein Hemd war schief zugeknöpft, als hätte er sich beeilt, und auf seinem Gesicht fehlte die übliche Brille. Dadurch wirkte er ein wenig unseriöser als sonst. Emily verspürte einen unerklärlichen Stich in ihrem Magen, aber sie wusste, dass sie keine Wahl hatte. Ohne seine Hilfe kam sie nicht zurecht.
›Es freut mich, dass Sie mir Vertrauen entgegenbringen, Mrs Lawson. Es war verantwortungslos von Ihrem Mann, Sie so einfach in England zurückzulassen.«
›Damals lebten meine Eltern noch«, widersprach Emily. Niemand hatte vorhersehen können, dass ihr Vater auf der Straße von einer Kutsche überrollt wurde, bei der das Pferd durchgegangen war. Von der Krankheit ihrer Mutter hatte es vor vier Jahren auch noch keine Anzeichen gegeben.
»Trotzdem wäre es seine Pflicht gewesen, sich Ihrer anzunehmen. Mir war stets klar, dass die Ehe mit großer Verantwortung verbunden ist. Deshalb habe ich bisher gezögert, denn mein Beruf bringt es mit sich, dass ich oft außer Haus bin und mich in gefährliche Gegenden begeben muss.«
Er setzte sich neben Emily und lächelte sie an. Unwillkürlich rückte sie ein Stück von ihm weg, denn mit solcher Vertraulichkeit hatte sie nicht gerechnet.
›Haben Sie schon etwas gegessen? Ich kann in der Küche Bescheid geben.«
Emily lehnte dankend ab, obwohl ihre bisherigen Mahlzeiten sich auf den Zwieback und Tee beschränkt hatten.
›Ich wollte fragen, ob ... ob Sie mir helfen könnten. Ich brauche eine Arbeit. Als Näherin oder Wäscherin vielleicht.«
Hoffnungsvoll blickte sie zu ihm hoch. Ihr war klar, dass sie nicht ewig von seinem Wohlwollen abhängig sein konnte. Aber ein Mann in seiner Stellung musste doch Leute kennen, die andere Menschen für Hilfe im Haushalt bezahlten.
›Haben Ihre Eltern Ihnen denn gar nichts hinterlassen?«
Das Mitgefühl in seinen Augen erschien ihr beschämend.
›Ich habe noch etwas Geld, aber ich muss für die Zukunft vorsorgen.«
Das stimmte sogar. Dr. Jitter stieß einen leisen Seufzer aus und strich wieder kurz über ihren Arm. Der Titel Mrs musste etwas an Wirkung eingebüßt haben.
»Eine verheiratete Frau sollte nicht arbeiten müssen. Schändlich von Ihrem Mann. Wirklich schändlich.«
»Es ist aber nun einmal so«, erwiderte Emily, die langsam ungeduldig zu werden begann. »Können Sie mir also helfen, eine Anstellung zu finden? Falls nicht, werde ich mich anderweitig umsehen.«
Sie hatte es geschafft, recht zuversichtlich zu klingen. Der Arzt brauchte nicht zu wissen, dass sie keine Ahnung hatte, an wen sie sich noch wenden könnte.
»Übereilen Sie nichts. Sie wissen nicht, wie gefährlich die Welt da draußen ist.«
Zu ihrer Erleichterung stand er auf.
»Ich werde erst einmal dafür sorgen, dass Sie etwas zu essen bekommen. Miss Jonston wird ein Zimmer für Sie herrichten. Ich denke, es wird in meinem Haushalt auch eine Aufgabe für Sie geben.«
Er lächelte und entfernte sich mit einem Neigen des Kopfes. Emily sah sich nochmals in dem kahlen Raum um. Sie hätte erleichtert sein müssen über dieses Angebot, kam aber nicht gegen das Gefühl an, mit einem Fuß in eine Falle getappt zu sein. Nun konnte sie sich nicht freikämpfen, ohne Verletzungen davonzutragen.
Sie wartete eine Weile, bis Miss Jonston sie abholte und in die Küche geleitete. Dort wurden ihr Brot und Käse vorgesetzt, außerdem ein Glas Apfelmost. Obwohl sie keinen echten Hunger verspürte, merkte sie, dass die Nahrung ihr guttat. Sie fühlte sich mit gefülltem Magen weniger wehrlos und verletzlich. Vielleicht würde Dr. Jitter ihr anbieten, dass sie Miss Jonston im Haushalt zur Hand gehen sollte. Es wäre sicher nicht angenehm, unter der Fuchtel eines solchen Drachen zu stehen, aber sie hätte immerhin fürs Erste ein Auskommen.
»Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer«, knurrte die Haushälterin, als sie kurz darauf wieder zur Tür hereinkam. Emily erhob sich folgsam. Sie würde später noch losziehen, um ihre spärlichen Habseligkeiten aus der Wohnung zu holen und bei der Gelegenheit auch die Schulden bei der Vermieterin zu begleichen. Jetzt, da sie eine Anstellung in Aussicht hatte, musste sie das von der Mutter vererbte Geld nicht mehr mit aller Kraft Zusammenhalten.
Der ihr zugewiesene winzige Raum befand sich unmittelbar unter dem Dachgeschoss und enthielt nichts weiter als ein schmales Bett und einen Tisch. Dennoch war sie zufrieden, denn in ihrem Elternhaus hatte sie noch weniger Platz für sich allein gehabt.
»Hier können Sie erst einmal warten, bis der Herr Doktor nach Ihnen sieht«, erklärte die Haushälterin und schob Emily herein.
»Aber soll ich nicht irgendeine Arbeit ...«
Die Tür war zugefallen, bevor sie ihre Frage hatte zu Ende sprechen können. Emily blieb etwas ratlos zurück, setzte sich nach kurzem Zögern auf die Matratze und blickte durchs Fenster nach draußen. Unter ihr wuchs dichtes Gebüsch, und der Raum lag nicht so hoch, wie es zunächst den Anschein gehabt hatte.
Sie würde, falls es notwendig war, durchs Fenster nach draußen springen können, ohne größere Verletzungen zu riskieren. Aber hätte sie wirklich den Mut dazu?
Entschlossen verjagte sie diese abwegigen Gedanken. Dr. Jitter war ein ehrenwerter Mann und in seinem Haus drohte ihr mit Sicherheit keine Gefahr. Gleichzeitig erfüllte es sie mit Erleichterung, dass sie die geerbten fünf Pfund bei sich in ihrem Beutel trug. Es war ihr zu gefährlich erschienen, sie unbeaufsichtigt in der Wohnung zu lassen.
Kapitel 2
»Die Geschichte des Sklavenhandels also?«
Frau Dr. Grüneberg lächelte Mareike auf ihre übliche, nachsichtige Art an. Sie war die einzige Professorin am Lehrstuhl für neuere Geschichte, aber erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen. Mareike bewunderte diese Frau mit ihrem grau melierten Haar und der edlen, makellos weißen Bluse. Stets kämpfte sie um ihre Anerkennung, und stets hatte sie das Gefühl, nicht ganz ernst genommen zu werden.
»Ich wollte speziell auf die weibliche Perspektive eingehen«, fügte Mareike sogleich hinzu. Ihre Lieblingsprofessorin befasste sich mit Genderstudies, also konnte das von ihr vorgeschlagene Thema für sie dadurch interessanter werden.
»Sie meinen das Schicksal der aus Afrika verschleppten Frauen?« Frau Dr. Grüneberg rückte ihre silberne Brille auf der Nase zurecht. ›Ein sehr düsteres Kapitel der europäischen Geschichte, würde ich sagen. Aber natürlich noch politisch aktuell.«
Die Professorin hatte aufgehört zu lächeln und nun nachdenklich die Stirn gerunzelt. Fast sah es aus, als könne sie sich für eine solche Thematik erwärmen. Mareikes Herz tat einen freudigen Sprung.
»Ich dachte, ich könnte besonders auf die Sklavereigegner eingehen, also jene Leute, die schließlich das Verbot des Handels durchsetzten. Darunter gab es auch einige Frauen, die damals sehr aktiv waren. Ich würde gern mehr über sie herausfinden, also darüber, was für Erfahrungen sie motiviert haben, sich für die Rechte von Menschen einzusetzen, die nach damaligem Empfinden ... also dem durchschnittlichen Europäer müssen Afrikaner ja damals viel fremder gewesen sein, als sie es heute für uns sind.«
Sie hätte fast noch hinzugefügt, dass man aus diesem Grund auch viel leichter von der Behauptung hatte überzeugt sein können, dass Schwarze von Natur aus minderwertig seien. Dann wurde ihr bewusst, dass sie über gefährliches Terrain tappte. Bei einer solchen Thematik konnte einem auf die eine oder andere Weise schnell Rassismus unterstellt werden, selbst wenn man es nicht so meinte. Frau Dr. Grüneberg lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Ihr Schreibtisch war voll mit Papieren, die aber systematisch in Stapel geordnet waren. Alles an ihrer Erscheinung wies auf Ordnung und Selbstdisziplin hin, was bei ihrer Karriere sicher hilfreich gewesen war.
»Haben Sie da schon eine bestimmte Person im Auge?«, fragte die Professorin.
»Ich bin auf ein paar Frauen gestoßen, die Texte gegen den Sklavenhandel verfassten. Es wird wahrscheinlich nicht einfach sein, Informationen über sie zu bekommen, aber ich werde mir Mühe geben.«
»Nun, Sie scheinen sich ja schon ein wenig in Ihre Thematik eingearbeitet zu haben. Ich bin wirklich gespannt auf Ihre Abschlussarbeit. Sie sind eine meiner fleißigsten und vielversprechendsten Studentinnen.«
Mareike spürte, dass ihre Wangen rot anliefen. Allein durch diese Worte ging ein Traum für sie in Erfüllung.
»Danke. Vielen Dank. Das Thema ist also angenommen?«
Die Professorin nickte und blickte unauffällig zu ihrer Wanduhr. Mareike fühlte sich daran erinnert, dass draußen noch fünf weitere Studenten saßen, um die wöchentliche Sprechstunde von Frau Dr. Grüneberg zu nutzen. Folgsam stand sie auf, verabschiedete sich und trat nach draußen.
Es war vier Uhr nachmittags. Ihr Job als Kellnerin würde erst in zwei Stunden beginnen, aber in der Cafeteria wartete Tina auf sie, um die Neuigkeiten zu erfahren.
Das Sommersemester ging diese Woche zu Ende. Ein paar Leute saßen in Gruppen zusammen, um sich auf bevorstehende Prüfungen vorzubereiten, zwei asiatische Mädchen tippten eifrig in ihre Laptops, und auf der Wiese vor der Cafeteria hockten ein paar Jungs mit Rastalocken. Tina hatte sich an einen Tisch in der hintersten Ecke zurückgezogen, als wollte sie nicht auffallen, doch trotzdem stand Christian aus dem Hauptseminar über »Krankenpflege im Wilhelminischen Kaiserreich« neben ihr. Er redete angeregt, fuhr dabei immer wieder mit der Hand durch sein glattes, pechschwarz gefärbtes Haar. Seine Füße steckten in modischen Sneakers, die Jeans war hochgekrempelt, und er trug ein Holzfällerhemd, um möglichst lässig auszusehen. Mareike fand ihn einen Moment lang anziehend, dann überwog ihre Abneigung gegen solch demonstrativ zur Schau gestellte Selbstverliebtheit. Aber der coole Christian war wegen Tina da, sie selbst wäre nur der Störenfried. Aufgrund ihrer Verabredung mit der Freundin blieb ihr jedoch nichts anderes übrig, als trotzdem hinzugehen.
Tina winkte ihr erfreut zu. Christian sah leicht genervt aus, verzog sich aber, nachdem er noch ein paar Worte mit Tina gewechselt hatte.
»Stell dir vor, er möchte mit mir in die Cocktailbar, die vor ein paar Wochen in Schwabing aufgemacht hat«, plapperte die Freundin aufgeregt, als ihr Schwarm außer Hörweite war. Mareike lächelte gezwungen. Sie war überzeugt, dass Christian sich alle zwei Wochen ein neues Mädchen suchte, wollte Tina ihre Freude aber nicht verderben.
»Sei bloß vorsichtig. Du weißt ja, wie es beim letzten Mal ausging.«
Erst vor zwei Wochen hatte Tina sie in Tränen aufgelöst angerufen, weil ein Mann sich nach dem ersten Sex wieder einmal nicht meldete und außerdem laut Facebook nun in einer Beziehung war – nur nicht mit Tina. Mareike kannte solche Situationen aus dem Leben ihrer Mutter zur Genüge. Nur war Karin, ihre alleinerziehende Mama, mit den Jahren härter im Nehmen geworden. Liebhaber, die sich nicht meldeten, wurden einfach durch neue ersetzt. An Interessenten mangelte es der Mutter auch mit Ende vierzig nicht.
»Christian ist nicht so. Ich finde ihn total süß«, schwärmte Tina mit leuchtenden Augen. Mareike wusste aus Erfahrung, dass Widerspruch nun sinnlos wäre.
»Na, erzähl schon. Wie war dein Treffen mit unserer allmächtigen Feminismusgöttin?«, drängte die Freundin. Mareike teilte glücklich eine Zusammenfassung des Gesprächs mit.
»Eine Stelle als ihre wissenschaftliche Assistentin hat sie dir aber noch nicht angeboten«, stellte Tina mit mäßiger Begeisterung fest.
»Ich muss mir eben Mühe geben mit meiner Abschlussarbeit. Wenn die richtig gut wird, klappt es vielleicht.«
Nun war es an Tina, ein skeptisches Gesicht zu machen.
»Na ja, dein Thema finde ich auf jeden Fall cool. So richtig exotisch. Wie bist du denn darauf gekommen?«
Mareike zögerte ein wenig mit ihrer Antwort. Sie zeigte sich nicht gern emotional.
»Ein Ex von meiner Mutter war der Auslöser, denke ich. Er hieß William und war Nigerianer. Er mochte Reggae und erzählte mir viel über afrikanische Kultur.«
Sie hatte William gemocht, weil er trotz seines unkonventionellen Musikgeschmacks ein sehr fleißiger, disziplinierter Mann gewesen war, der sogar versuchte, ein wenig Ordnung in das Leben seiner deutschen Freundin zu bringen. Die Beziehung war nach zwei Jahren gescheitert. Warum, wusste Mareike nicht. Sie war den steten Wechsel der Männer im Leben ihrer Mutter zu sehr gewöhnt, um das seltsam zu finden. Nur hatte sie William mehr vermisst als die anderen vor und nach ihm.
»Das klingt ja richtig spannend. Ich war als Teenager mal mit einem Türken liiert, und mein Vater ist fast ausgeflippt.« Tina warf Mareike einen neidischen Blick zu. »So eine Mutter wie deine hätte ich auch gern gehabt.«
Mareike fragte sich, ob ihre Mutter nicht gern eine Tochter wie Tina gehabt hätte, mit der sie endlos über Männer und Affären plaudern konnte. Stattdessen war sie mit einer verklemmten Streberin geschlagen. Zwar hatte sie diesen Vorwurf nie offen ausgesprochen, aber bei ihren nicht gerade seltenen Streitereien hatte er immer wieder im Raum gestanden wie ein hässliches Möbelstück, das man vergeblich zu übersehen suchte.
»Ich habe mir manchmal ein so geregeltes Familienleben gewünscht, wie du es hattest«, teilte sie Tina mit, die mit den Schultern zuckte.
»Das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie muffig es sein kann. Alles, was ich getan habe, war immer falsch und unanständig.«
Ähnlich hatte Karin der Tochter ihre Kindheit in einer bayrischen Kleinstadt beschrieben. Produzierten strenge Elternhäuser immer chaotische Rebellinnen, deren Töchter dann erst wieder von solider Beständigkeit träumten? Vielleicht wäre auch das historisch betrachtet ein Thema für eine wissenschaftliche Arbeit, aber sie hatte nun schon ein anderes gewählt.
»Jedenfalls klingt deine Mutter für mich wie eine Frau, die ein interessantes Leben geführt hat«, redete Tina weiter. »Die macht einfach, was sie will, ohne sich um die Meinung anderer zu scheren.«
Und ich musste mein Leben lang darunter leiden, fügte Mareike im Geiste hinzu, verzichtete aber auf einen Streit mit ihrer Freundin.
»Nach den Gesprächen mit William habe ich immer wieder nach Beweisen dafür gesucht, dass nicht alle Europäer böse Rassisten waren. Gerade bei den Frauen aus früheren Jahrhunderten denke ich mir, dass sie ja Unterdrückung aus eigener Erfahrung kannten, und deshalb ...«
»Jetzt klingst du wie eine Aufnahme von einer Grüneberg-Vorlesung«, unterbrach Tina etwas gelangweilt. »Aber sag mal, wohin wurden die ganzen Sklaven denn damals gebracht? Doch nicht nach Europa, oder?«
Man merkte, dass Tina Geschichte nur im Nebenfach studierte.
»Nein, natürlich nicht nach Europa, obwohl es sie dort manchmal schon als Hausdiener gab«, erklärte Mareike. »Die meisten brachte man in die Kolonien. In die amerikanischen Südstaaten zum Beispiel oder nach Jamaika. Die Geschichte dieser Insel ist besonders spannend, weil es dort auch viele Sklavenaufstände gab. Einer von ihnen wurde auch von einer Frau angeführt, die ...«
»Warst du schon mal dort?«, unterbrach Tina.
»Wo? In Jamaika? Natürlich nicht. Das ist viel zu weit weg. Eine solche Reise kann eine Studentin sich doch nicht leisten.«
»Wieso nicht? Also Christian erzählte mit gerade, dass er letzten Sommer mit ein paar Jungs in Thailand war, und das war richtig cool.«
Christian verfügte wahrscheinlich über begüterte Eltern. Mareikes Mutter Karin war bei ihren Arbeitsstellen ebenso unbeständig gewesen wie bei ihren Lebensgefährten. Derzeit arbeitete sie als Sekretärin in einer Baufirma, schon seit anderthalb Jahren. Mareike war darüber erleichtert, denn es klang wie ein solider Job, der ihrer Mutter ein annehmbares Einkommen garantierte. Dennoch konnte sie nicht auf besondere finanzielle Unterstützung von ihr hoffen.
„Ich könnte so eine Reise niemals bezahlen. Ich muss ja schon für meine monatliche Miete jobben«, erklärte sie. Tina neigte nachdenklich den Kopf zur Seite und spießte ein Stück Wurst auf ihre Plastikgabel.
»Ja, klar, deine Mutter, die ist nicht so das Karriereweib. Aber dein Vater, der hat doch Kohle?«
Mareike schluckte betreten. Einmal auf einer Party in Tinas WG hatte sie mehr Wein getrunken, als gut für sie war, und der Freundin von ihrem Vater erzählt. Karin und Helmut hatten sich bereits drei Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter getrennt. Laut ihrer Mutter begann der einstige Sozialrevolutionär, sich in einen hoffnungslosen Spießer zu verwandeln, sobald er eine gut bezahlte Stelle in einer großen Firma bekommen hatte. Helmut war seiner Unterhaltspflicht nachgekommen und hatte die Tochter auch regelmäßig zu sich eingeladen. Leider war seine neue Frau davon nicht begeistert gewesen, was immer wieder zu Spannungen geführt hatte. Als Teenager hatte Mareike angefangen, die Einladungen abzulehnen, in der heimlichen Hoffnung, der Vater würde darüber Bestürzung zeigen und nach den Gründen fragen. Aber er hatte ihre Entscheidung einfach hingenommen. Vielleicht sogar mit Erleichterung.
»Ich rede nicht oft mit meinem Vater«, sagte sie leise.
»Aber er ist nun mal dein Vater. Da hat er gewisse Pflichten. Ich finde, er könnte dir durchaus mal eine Reise finanzieren.«
Tina bestätigte ihre eigene Aussage durch ein energisches Nicken, wodurch ihre langen Glitzerohrringe ins Schwingen kamen.
»Ich weiß nicht ... ich rufe nicht gern bei ihm an.«
»Dann tue es endlich mal!« Tina ergriff ihre Hand, die auf dem Tisch lag. »Du bist einfach immer zu brav, Mareike. Man kommt im Leben nur voran, wenn man sich auch mal etwas traut. Ich finde, so eine Reise nach Jamaika würde dir guttun. Du bekommst so auch mehr Einblick in das Thema deiner Abschlussarbeit. Nicht nur dieses ganze trockene Bücherwissen, du entwickelst ein richtiges Gefühl für die Kultur der einstigen Sklaven.«
Mareike dachte an die Legenden über Granny Nanny, die große Rebellenführerin. Sie hatte einige Artikel über sie gelesen und manchmal durchaus den Wunsch verspürt, den Ort des Geschehens besuchen zu können. Aber wie viel hätte das heutige Jamaika noch mit der Kolonie aus dem 18. und 19. Jahrhundert gemein? Für Tina zählten vor allem weiße Sandstrände und Partys unterm Sternenhimmel, bei denen sie attraktive Jungs kennenlernen konnte. Aber Mareike würde auf der Insel recherchieren wollen. Die Vorstellung, das ein paar Wochen lang tun zu können, ohne durch andere Verpflichtungen abgelenkt zu sein, weckte eine fast fieberhafte Erregung in ihr. Hatte Tina am Ende recht und sie sollte einen Anruf bei ihrem Vater tätigen, um einmal etwas von ihm einzufordern? Diese Idee ließ sie noch nervöser werden als die Aussicht auf einen Besuch der Sprechstunde ihrer Lieblingsprofessorin.
Aber den hatte sie heute auch schon hinter sich gebracht.
Kapitel 3
London, März 1830
Emily hatte bereits die Augen geschlossen, als es an ihrer Tür klopfte. Sie wandte sich verärgert um. Sicher war es Miss Jonston, die ständig etwas an ihrer Arbeit auszusetzen hatte. Seit einer Woche war sie Dr. Jitters Dienstmädchen, eine Anstellung, die sie allein seiner Großherzigkeit zu verdanken hatte. Niemand hätte einem jungen Mädchen ohne Referenzen so eine Chance gegeben, wie er ausdrücklich betont hatte. Ihr wäre allein die Plackerei in einer der Fabriken geblieben, eine deutlich schlechter bezahlte Arbeit, ungleich härter und zudem auch nicht mehr so leicht zu bekommen, da zu viele Leute vom Land nach London strömten, wo sie sich ein besseres Leben erhofften.
Emily hatte die eingefallenen, kränklichen Gesichter der Arbeiterinnen oft genug auf den Straßen gesehen, um zu ahnen, welches Schicksal ihr erspart worden war. Außerdem verhielten diese Mädchen sich oft so laut und derb wie Prostituierte. Sie wusste nicht, wie sie mit ihnen zurechtgekommen wäre. Miss Jonston war zwar streng und unfreundlich, aber sie sprach niemals vulgäre Worte. Allmählich begann Emily, sich an ihr ständiges Nörgeln zu gewöhnen, zudem ihre Fähigkeiten beim Staubwischen und Servieren langsam besser wurden. Was hatte sie jetzt nur angestellt, um so spät noch geweckt zu werden?
»Was gibt es denn?«, rief sie erschöpft. Sie würde sich die Schimpftirade der alten Frau einfach anhören und dann weiterschlafen.
Aber es war Dr. Jitter persönlich. Er trug einen Morgenmantel und hielt eine brennende Kerze in der Hand. Auf seinem Gesicht fehlte die sonst allgegenwärtige Brille. Aus unerfindlichen Gründen fand Emily sein Auftauchen nun unangenehmer, als ein unangekündigter Besuch der Haushälterin es hätte sein können.
»Was wünschen Sie, Sir?«
Sie wickelte sich in ihre Decke, obwohl es recht warm im Zimmer war, und setzte sich aufrecht hin.
»Ich wollte einmal sehen, wie es Ihnen so geht«, meinte der Doktor und trat ein, obwohl sie ihn nicht dazu aufgefordert hatte. Aber es war sein Haus, daher konnte sie ihn kaum daran hindern.
»Es geht mir sehr gut«, sagte Emily schnell. »Ich bin sehr dankbar, hier eine Arbeit zu haben. Aber sie ist anstrengend, daher bin ich nachts müde.«
Er ignorierte ihre indirekte Aufforderung, sie schlafen zu lassen, und setzte sich auf den einzigen Stuhl in ihrem Zimmer.
»Ja, natürlich. Für so eine zarte Person ist es nicht einfach, körperlich arbeiten zu müssen. Sie hätten ein besseres Schicksal verdient. Ihr Ehemann verhielt sich wirklich verantwortungslos.«
Er hatte Jeremiah in letzter Zeit kaum erwähnt, was Emily erleichtert hatte. An ihr ebenso kurzes wie nicht besonders angenehmes Dasein als Ehefrau wurde sie nicht allzu gern erinnert.
»Ich lerne nun, wie ich allein zurechtkomme. Das gefällt mir«, sagte sie und meinte es völlig ehrlich.
Dr. Jitter runzelte die Stirn.
»Eine Frau braucht in dieser Welt einen Beschützer«, mahnte er. »Die Lage, in die Ihr Ehemann Sie gebracht hat, ist sehr unerfreulich, denn Sie haben ja nicht einmal die Möglichkeit, eine neue Ehe einzugehen. Traurig, sehr traurig.«
Er musterte Emily, als sei sie ein vor Hunger wimmerndes, ausgesetztes Kätzchen. Doch sah er dabei aus wie jemand, der angesichts dieses Elends nur den Kopf schüttelte, anstatt einfach eine Schüssel Milch zu holen.
»Ich werde schon zurechtkommen. Danke für Ihre Fürsorge«, meinte Emily dennoch brav und ließ ihrem nächsten Gähnen freien Lauf. Vielleicht würde er jetzt endlich verstehen, dass sie im Moment nur allein sein und die Augen schließen wollte.
»Ich möchte Sie unterstützen«, redete Dr. Jitter leider weiter. »Ihnen zur Seite stehen. Mrs Lawson ... Emily, es bricht mir das Herz, Sie so völlig allein und erschöpft zu sehen.«
Er ergriff ihre Hand. Sie versuchte, sie ihm so schnell wie möglich zu entziehen, aber sein Griff war eisern. Als er sich zu ihr beugte, nahm sie einen merkwürdigen Geruch an seinem Atem wahr. Die Betrunkenen auf den Straßen stanken ähnlich, nur viel stärker. In Emilys Zuhause war niemals Alkohol getrunken worden, daher vermochte sie seine Wirkung auf Menschen kaum einzuschätzen.
»Ich würde jetzt wirklich gern schlafen, Sir!«, rief sie.
Dr. Jitter ließ tatsächlich ihre Hand los. Etwas Böses blitzte in seinen Augen auf, aber gleich darauf lächelte er.
»Es widerstrebt mir, Sie weiter zu belästigen. Aber bedenken Sie bitte, wo Sie ohne meine Fürsorge wären«, meinte der Arzt.
Emily nickte.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar. Bitte entschuldigen Sie meine Müdigkeit.«
Gleichzeitig betete sie, dass er jetzt endlich gehen würde.
»Sie müssten nicht so hart arbeiten. Wir könnten uns auch anderweitig einigen«, redete er unerbittlich weiter. »Ich wäre bereit, für Sie zu sorgen, wie ... wie ein Ehemann. Dadurch hätten Sie ein viel angenehmeres Leben.«
Wieder lächelte er, nun etwas sanfter und versöhnlicher. Emilys Kopf drehte sich. Sie verstand nicht ganz, worauf er anspielte, musste aber wieder an das Fenster in ihrem Zimmer denken. Es gab ein Entkommen aus der Lage, in der sie sich befand.
Nur glaubte sie nicht mehr, einfach hinaus springen zu können. Der Garten lag zu tief unten, sie könnte sich verletzen, da sie keinerlei Erfahrung mit solchen Abenteuern hatte. Kurz raubte Panik ihr die Luft zum Atmen, dann zwang sie sich zur Ruhe. Dr. Jitter war nicht bösartig, nur manchmal etwas seltsam.
»Ich arbeite gerne hier als Dienstmädchen«, sagte sie schnell. Es entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber das brauchte er nicht zu wissen. »Ich habe ja schon einen Ehemann und brauche sonst niemanden.«
Eine Falte erschien auf Dr. Jitters Stirn.
»Ich glaube, Sie sind zu unerfahren, um die Lage wirklich einschätzen zu können. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich auch Ihre Schulden bezahlt habe.«
»Welche Schulden? Ich ... ich ...«
»Sie hatten Schulden bei der Vermieterin. Sie hat deshalb hier vorgesprochen. Außerdem haben sich noch ein paar andere Leute gemeldet. Ich fürchte, Ihre Mutter hat in den letzten Monaten über ihre Verhältnisse gelebt. Eine Frau allein kommt eben nicht zurecht.«
Emily war übel geworden. Ihre neue Arbeit hatte sie so sehr in Anspruch genommen, dass sie die Forderungen der Vermieterin schlichtweg vergessen oder vielleicht auch nur verdrängt hatte. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass ihr Arbeitgeber für sie zahlen würde, ohne das vorher mit ihr zu besprechen.
Sie dachte an die fünf Pfund, die sich immer noch in dem Umschlag befanden. Eine leise Stimme in ihrem Kopf mahnte, das Geld nicht so einfach dem Arzt zu übergeben. Aber was sollte sie sonst tun?
»Ich werde meine Schulden selbstverständlich begleichen«, stammelte sie. »Durch meine Arbeit in Ihrem Haus.«
Bisher hatte Dr. Jitter ihr keinen Lohn überreicht, aber er musste ihr irgendetwas schuldig sein. Wenn sie weiter fleißig blieb, hätte sie irgendwann alles zurückgezahlt.
»Ach Emily. Machen Sie es doch nicht so schwer. Wir können uns ganz leicht einig werden.«
Nun hatte er etwas gelallt. Bevor Emily antworten konnte, hielt er wieder ihre Hand und neigte sich zu ihr, näher, als ihr schicklich schien. Sie hatte sich zum letzten Mal von Jeremiah derart bedrängt gefühlt, der aber als Ehemann ein Recht darauf gehabt hatte. Dr. Jitter stand es eindeutig nicht zu, sein Gesicht so dicht an ihres zu bringen, aber wie sollte sie ihn daran hindern?
Sie versetzte ihm einfach einen kräftigen Schubs, der ihn tatsächlich rückwärts taumeln ließ. Dabei stolperte er über den Stuhl, der umgefallen war, und landete mit einem lauten Knall neben dem Möbelstück auf dem Boden. Zum Glück hatte er die Kerze vorher abgestellt, ging es Emily durch den Kopf. Gleich darauf begriff sie, was geschehen war, und fürchtete, ihr Herzschlag könnte plötzlich aussetzen. In ihrem Bemühen, alles richtig zu machen, tappte sie von einer Falle in die nächste.
»Verfluchtes Weib!«, schrie der Arzt auf. Sie überlegte panisch, einfach davonzulaufen. Aber wo sollte sie mitten in der Nacht Unterschlupf finden, ohne einen Penny in der Tasche und nicht einmal anständig bekleidet? Ohne weiter nachzudenken, lief sie zu der Matratze und zog den Umschlag mit ihrem Geld heraus. Egal, was jetzt geschah, sie würde es auf jeden Fall brauchen. Dann packte sie den Schal, den ihre Mutter für sie gestrickt hatte, um sich weniger schutzlos zu fühlen.
»Ich bedauere diesen Unfall, Sir«, sagte sie so gefasst wie möglich. »Wenn Sie wünschen, werde ich Ihr Haus verlassen.«
Sie war überzeugt, nun herausgeworfen zu werden, und hoffte, ein klein wenig Würde zu bewahren, wenn sie freiwillig ging.
Dr. Jitter kämpfte sich mühsam wieder auf die Beine. Sie hätte ihm gern geholfen, aber nun widerstrebte es ihr, ihm die Hand zu reichen.
»Das würde dir so passen, du Miststück«, knurrte er und stützte sich am Tisch ab. »Einfach weglaufen, nach allem, was ich für dich getan habe.«
»Bitte, Sir, es tut mir sehr leid. Ich ... ich werde meine Schulden bezahlen. Auf der Stelle, wenn Sie wollen.«
Ihre Hand war zu einer schützenden Faust geballt, um ihr letztes Geld festzuhalten. Dennoch hielt sie ihm seufzend den Umschlag entgegen. Vielleicht würde er sich wieder anständig verhalten, wenn sie ihm nichts mehr schuldig war. Dann konnte sie weiter als sein Dienstmädchen arbeiten. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie sonst gehen sollte, und die Vorstellung, sich völlig allein auf den Straßen Londons durchschlagen zu müssen, raubte ihr die Luft zum Atmen.
Dr. Jitter versuchte, ihr den Umschlag zu entreißen, aber sie wich zurück. Zuerst sollte er sagen, wie viel sie ihm zahlen musste.
»Woher hast du Geld?«, fragte er ehrlich erstaunt.
»Meine Mutter hat es mir hinterlassen. Ich hätte die Vermieterin bezahlen können, nur wusste ich nicht, dass sie hier war.«
Sie fühlte sich etwas weniger hilflos und nahm eine aufrechte Haltung an.
»Unsinn!«, erwiderte der Arzt. »Deine Mutter war bettelarm, ich musste ihr sogar Medikamente schenken, weil ich Mitleid mit ihr hatte. Du hast mich bestohlen! Gib es zu, das macht die Sache leichter.«
Emily schnappte nach Luft.
»Ich weiß nicht einmal, wo Sie Ihr Geld aufbewahren, Sir. Ich hätte nie ...«
»Du wolltest mich ausnehmen und dich dann davonmachen«, unterbrach er. »Ich sorge dafür, dass du ins Gefängnis kommst, du kleines Luder. Oder du bist jetzt ein bisschen nett zu mir.«
Wieder streckte er die Arme nach ihr aus, und nun bekam Emily wirklich Angst. Ihr Bild, das sie sich von dem ehrenwerten Arzt gemacht hatte, zerbrach wie eine umgekippte Porzellanfigur.
»Lassen Sie mich in Frieden, Sir. Gehen Sie. Wir reden morgen weiter.«
Ihre Stimme war so laut geworden, dass sie selbst darüber erschrak. Dr. Jitter schubste den kleinen Tisch zur Seite, der noch schützend zwischen ihnen gestanden hatte.
»Jetzt hör auf, dich so anzustellen, verdammt! Es ist alles nicht so schlimm, du warst doch schon verheiratet.«
Als er ihren Ellbogen packen wollte, versetzte Emily ihm einen Tritt und traf sein Schienbein. Wieder taumelte er, hob jedoch die Hand, um nach ihr zu schlagen. Sie wich schnell aus. Dabei stieß sie gegen das Bett, schwankte und fiel mit einem Knall auf den Boden. Ihre Schulter schmerzte von dem Aufprall, aber sie hielt immer noch ihr Geld fest.
Dr. Jitters Gesicht tauchte wie eine dunkle Wolke über ihr auf. Sie verkrampfte sich in dem verzweifelten Wunsch, irgendwie Widerstand zu leisten. Dann erklang plötzlich eine vertraute, tiefe Frauenstimme.
»Ist etwas vorgefallen, Sir? Ich habe Lärm gehört und wollte nachsehen.«
Niemals hätte Emily sich vorstellen können, über den Anblick von Miss Jonstons griesgrämiger Miene erfreut zu sein. Dr. Jitter hatte sich schlagartig aufgerichtet und lächelte die Haushälterin an.
»Es ist nichts geschehen. Ich hörte Mrs Lawson rufen, weil es ihr nicht gut ging. Da wollte ich kurz nachsehen. Es war wohl ein vorübergehender Schwächeanfall.«
Er warf Emily einen warnenden Blick zu. Sie kämpfte sich auf die Beine und nickte Miss Jonston zu. Die alte Frau hätte ihr ohnehin nicht geglaubt, wenn sie Vorwürfe gegen den Arzt erhob.
»Dann lassen Sie mich das Mädchen versorgen, Sir«, meinte die Haushälterin. »Gehen Sie schlafen. Ein so hart arbeitender Mann muss nachts ruhen.«
Ein wenig klang es, als redete sie mit einem unartigen Jungen, den sie besänftigen wollte. Zum allerersten Mal fand Emily die resolute Art der Haushälterin sympathisch.
Dr. Jitter räusperte sich.
»Gut, ich gehe dann. Morgen müssen wir aber noch einige Dinge besprechen.«
Emily wusste, dass diese Worte vor allem an sie gerichtet gewesen waren. Als die Tür hinter ihm zugefallen war, atmete sie erleichtert auf. Miss Jonston machte jedoch keine Anstalten, sich zu entfernen. Ruhig stellte sie die umgestürzten Möbelstücke wieder auf. Ordnung zu schaffen sah sie offenbar als ihre Lebensaufgabe an.
»Haben Sie wirklich geglaubt, er will Sie hier nur als Dienstmädchen?«, murmelte sie unterdessen. »Eine, die beim Staubwischen Vasen umwirft?«
»Das ist nur am ersten Tag passiert. Danach war ich vorsichtiger«, protestierte Emily schwach.
Miss Jonston setzte sich auf den von ihr hingestellten Stuhl.
»Sie sind nicht die Erste«, erzählte sie dann. »Es gab schon zwei vorher. Beides so junge Dinger, die hübsch aussahen, aber sonst nicht viel konnten. Er wird Sie nicht heiraten, machen Sie sich keine Hoffnungen.«
»Aber ich habe doch schon einen Ehemann!«, rief Emily empört. So wenig begeistert sie auch von Jeremiah gewesen war, sie hätte ihn allemal Dr. Jitter vorgezogen.
»Ja, ja. Aber der ist ziemlich weit weg«, meinte die Haushälterin seufzend. »Der Doktor wird Sie früher oder später rauswerfen, egal, wie nett Sie zu ihm sind. Wenn Sie Ärger machen, droht er Ihnen, Sie aus irgendeinem Grund vor Gericht zu bringen.«
Das passte zu der Erfahrung, die Emily gerade gemacht hatte.
»Ich habe das Geld von meiner Mutter«, rief sie und hielt ihren Umschlag hoch. »Er behauptet, ich hätte es ihm gestohlen. Aber das stimmt nicht.«
Die Haushälterin verzog nur das Gesicht.
»Können Sie beweisen, dass Sie das Geld von Ihrer Mutter haben? Natürlich nicht. Also steht seine Aussage gegen Ihre. Wer sind Sie im Vergleich zu ihm?«
Emily kam sich plötzlich so klein und hilflos vor, dass sie auf ihr Bett sank. Am liebsten hätte sie sich einfach die Decke über den Kopf gezogen, um die Welt nicht mehr sehen zu müssen.
»Sie sollten das Haus verlassen«, ging die Stimme der Haushälterin unerbittlich auf sie nieder. »Er hat Sie bereits in der Hand. Gehen Sie am besten aus der Stadt fort, denn er ist in der Lage, Ihnen die Polizei auf den Hals zu hetzen. Männer wie er mögen es nicht, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen.«
Emily rollte sich zusammen. Sie hatte den Eindruck, in ein tiefes schwarzes Loch zu stürzen. Allein der strenge Blick von Miss Jonston erinnerte sie daran, dass sie handeln musste, anstatt sich zu bemitleiden.
»Unten am Hafen sind etliche Herbergen«, riet die Haushälterin. »Schauen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich ein billiges Zimmer für die Nacht finden, denn auf den Straßen ist es nicht sicher. Sobald es hell geworden ist, nehmen Sie eine Reisekutsche oder ein Schiff. Haben Sie irgendwo Familie?«
Emily schüttelte schluchzend den Kopf.
»Nur meinen Mann.«
»Dann müssen Sie wohl zu ihm«, stellte Miss Jonston unerbittlich fest und stand auf. »Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Sie können sich also hinausschleichen, bevor der Doktor nach Ihnen sieht. Oder Sie bleiben und versuchen, sich mit ihm zu arrangieren. Das ist Ihre Entscheidung. Ich bin jetzt müde und gehe schlafen.«
Im Türrahmen blieb sie noch einmal kurz stehen.
»Eigentlich bin ich heilfroh, nicht mehr so jung zu sein«, stellte sie fest. »In meinem Alter ist man vor den Kerlen sicher.«
Der Blick, den sie Emily zum Abschied zuwarf, war beinahe mitfühlend.
Selbst das Wetter schien sich gegen Emily verschworen zu haben. Regentropfen schlugen hart gegen ihr Gesicht, sobald sie die trügerische Sicherheit von Dr. Jitters Haus hinter sich gelassen hatte, und ein eisiger Wind blies ihr entgegen. Sie wickelte sich den Schal um den Kopf und rannte schluchzend los. Noch niemals hatte sie sich zu so später Stunde auf die Straßen Londons wagen müssen, und nun wusste sie nicht einmal, wohin sie gehen sollte. Sehnsüchtig drehte sie sich noch einmal nach dem schmucken Haus des Arztes um, wo sie ein neues Heim zu finden gehofft hatte. Die ersten Schritte, mit denen sie sich davon entfernte, taten fast weh. Dann begann sie zu laufen, denn das Wetter ließ ihr keine andere Wahl.
Je näher sie dem Hafen kam, desto lauter und schmutziger wurde die Umgebung. Emily war auf einmal erleichtert über den Regen, denn es waren nicht allzu viele Leute unterwegs, und wer auch immer irgendwohin gehen musste, beeilte sich, schnell ans Ziel zu kommen. Sie stolperte über zwei Betrunkene, die am Straßenrand herumlagen, doch sonst hielt sie niemand auf.
Leider hatte sie keine Ahnung, wo sie eine passende Herberge finden konnte. Es widerstrebte ihr, einfach an irgendeine Tür zu klopfen, ohne überhaupt zu wissen, was sich dahinter verbarg. Bei wärmeren Temperaturen hätte sie sich lieber nach einem Versteck umgesehen, wo sie bis Tagesanbruch ausharren konnte, doch nun hatte sie Angst, sich ein Fieber zu holen, wenn sie allzu lange draußen blieb. Eine andere Möglichkeit wäre die Rückkehr in ihr altes Heim gewesen. Die Schulden waren ja bereits bezahlt und so hilflos, wie sie im Moment aussehen musste, hätte vielleicht einer der Nachbarn Mitleid und würde sie wenigstens für eine Nacht aufnehmen. Sobald sie durch diesen Plan ein wenig Hoffnung geschöpft hatte, fiel ihr ein, dass Dr. Jitter sicher genau dort nach ihr suchen lassen würde, sobald er ihr Verschwinden bemerkt hätte.
Völlig erschöpft fand sie kurz Zuflucht unter dem Vordach eines Hauses. Ihr Kleid war so nass, als sei sie in einen Fluss gefallen, und ihre Hand schmerzte vom Schleppen der Tasche, in die sie schnell all ihre Habseligkeiten geworfen hatte. Wenn sie nur ein wenig zur Ruhe kam, würde sie vielleicht Zuversicht gewinnen, versuchte sie sich einzureden. Oder wenigstens der Regen konnte nachlassen.
Leider begann sie, nur erbärmlich zu frieren, während Fäden von Regen ihr weiterhin die Sicht erschwerten. Ihre Zähne klapperten bereits, als sie zwei Herren in eleganten Anzügen bemerkte, die aus einem der Häuser traten und ihre Mantelkrägen hochschlugen. Anders als die schäbigen Gestalten in der Hafengegend schienen sie Emily vertrauenswürdig. Sie raffte ihren letzten Rest an Mut zusammen und lief los.
»Entschuldigen Sie bitte, Sirs«, stammelte sie und versuchte verlegen, ihr Gesicht trocken zu wischen. Sie trug eine Haube, die aber schon vor Nässe triefte. »Wissen Sie, wo ich hier in der Gegend eine anständige Herberge finde?«
Als zwei skeptische Augenpaare sie musterten, wurde ihr bewusst, wie lächerlich ihre Bitte klingen musste.
Dort, wo zwei feine Herren abstiegen, würde sie sich nicht einmal eine Tasse Tee leisten können.
»Tut mir leid, Miss. Wir brauchen im Moment keine weibliche Gesellschaft«, erwiderte einer von ihnen durchaus freundlich. Bevor Emily empört einwenden konnte, dass sie missverstanden worden war, hatten die beiden sich schon abgewandt.
»Die sah aus wie eine begossene Kanalratte. So verzweifelt sind wir wirklich nicht!«, meinte der andere Gentleman lachend, während sie gemeinsam davoneilten. Emily kam sich vor, als sei sie gerade angespuckt worden. Schluchzend begann sie, die Straße entlangzulaufen, denn es regnete nun endlich etwas weniger. Nach drei Schritten rutschte sie aus und fiel der Länge nach hin. Nun war sie nicht nur eine nasse, sondern auch eine schmutzige Kanalratte, dachte sie, während sie sich wieder auf die Füße kämpfte. Die Tasche war zum Glück unversehrt. Der Umschlag mit dem Geld, ihr wertvollster Besitz, steckte immer noch in ihrem Mieder. Sie bemühte sich, ihr schmerzendes Knie zu ignorieren und einfach weiterzugehen.
»Haben Sie sich verletzt, Miss?«
Es war eine tiefe, brummende Männerstimme, die mit einem seltsam singenden Unterton sprach. Emily drehte sich um und musste einen Schreckensschrei unterdrücken.
Der Mann sah aus, als hätte jemand seine Haut mit Kohle beschmiert. In der nächtlichen Gasse glich er einem Schatten, nur das Weiße in seinen Augen leuchtete, außerdem ein paar Strähnen von schlohfarbenem Kraushaar, die unter seinem Hut hervorlugten. Nach ein paar Atemzügen hatte Emily sich gefangen. Er war nicht der erste dunkelhäutige Mann, den sie zu Gesicht bekam. Nur so nahe war sie bisher keinem gekommen, hatte noch nie seine Stimme gehört.
»Ich bin ausgerutscht«, erwiderte sie schnell. »Aber mir ist nichts Schlimmes geschehen.«
Er nickte, lächelte freundlich, sodass nun auch helle Zähne aufblitzten, und wollte weitergehen. Emily überkam ein Gefühl von Verlust, denn er war der erste Mensch in dieser nächtlichen Stadt, der freundlich zu ihr gewesen war.
»Ich brauche ein Zimmer für die Nacht. Irgendwo, wo es nicht zu teuer und sicher ist!«, rief sie ihm hinterher. »Können Sie mir vielleicht etwas empfehlen? Ich ... ich habe ein bisschen Geld. Ich will wirklich nur irgendwo bleiben können, bis es hell wird.«
Sie wollte nicht noch einmal missverstanden werden. Der Mann drehte sich wieder zu ihr um. Aus seinem Blick sprach weiterhin nichts als Mitgefühl.
»Ist Ihnen ein Unglück geschehen? Dieser Teil der Stadt ist wirklich kein Ort, an dem eine junge Frau nachts allein herumlaufen sollte.«
Das hatte Emily auch schon bemerkt.
»Ich ... ich bin jetzt Waise, also meine Eltern sind gestorben, und dort, wo ich war, kann ich nicht bleiben«, plapperte sie drauflos. Es tat so wohl, endlich jemandem ihr Herz ausschütten zu können. Er lauschte geduldig und hielt ihr ein Taschentuch hin, mit dem sie ihr Gesicht abtrocknen konnte.
»Haben Sie denn sonst keine Familie? Niemanden, der sich um sie kümmert? Sie reden wie jemand, der schon ein paar Bücher gelesen hat.«
Emily verstand nicht ganz, wie das eine mit dem anderen zusammenhing.
»Mein Vater illustrierte Bücher. Ich habe natürlich auch ein paar gelesen, vor allem religiöse Schriften«, erzählte sie und verspürte einen Stich von Wehmut. Wie sicher und geborgen ihr Leben damals noch gewesen war!
»Jetzt habe ich einen Ehemann«, fügte sie gleich hinzu, um erneut auf ihre Respektabilität hinzuweisen. »Er ist in Jamaika.«
»Das ist ganz schön weit weg«, bemerkte der dunkelhäutige Fremde in Übereinstimmung mit Miss Jonston.
»Ja, das könnte man so sagen.« Plötzlich musste Emily grinsen, und er lächelte zurück.
»Mein Name ist übrigens Mrs Lawson«, stellte sie sich vor.
»Ich bin Jamie Morton«, erwiderte der Mann. »Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen eine Unterkunft, wo sie ein paar Tage bleiben können. Ich kenne die Besitzerin, machen Sie sich keine Sorgen.«
Noch vor einem Tag hätte Emily sich niemals vorstellen können, einem ihr völlig unbekannten Mann fremder Abkunft einfach zu folgen. Aber nun blieb ihr keine Wahl. Auch wenn er nicht aussah wie ein Gentleman, hatte er sich im Gegensatz zu den anderen bisher wie einer benommen.
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen«, meinte sie brav und ließ ihn auch ihre Tasche tragen, als er sich anbot.
Die Herberge war ein kleines Haus direkt am Hafen, schäbig, aber erfreulich sauber. Eine rundliche Frau begrüßte Jamie Morton mit einer herzlichen Umarmung, um Emily gleich darauf skeptisch zu mustern.
»Die junge Lady braucht ein Zimmer«, sagte er unbeirrt. »Für eine Nacht. Oder vielleicht auch für länger.«
»Ich kann das bezahlen«, fügte Emily gleich darauf hinzu. Die Wirtin nannte einen erfreulich geringen Preis. Mit ihren fünf Pfund würde sie hier mehrere Wochen bleiben können, stellte sie erleichtert fest. Dann fiel ihr wieder Dr. Jitter ein. Wenn er Anzeige wegen Diebstahls gegen sie erstattete, wäre sie nirgendwo in London sicher. Warum war sie nur so dumm gewesen, der Wirtin ihren richtigen Namen zu nennen?
»Morgen muss ich leider gleich weg«, stellte sie enttäuscht fest. Aber wohin sollte sie gehen? Ihre Mutter hatte einmal zwei Schwestern in der Nähe von Liverpool erwähnt. Aber sie kannte nicht einmal den Namen der Ortschaft, in der sie lebten.
»Jamaika«, dachte sie laut. »Ich muss zu meinem Mann nach Jamaika.«
Ihre Mutter hatte wieder einmal recht gehabt. Sie kam ohne Jeremiah nicht zurecht, auch wenn sie ihn kein bisschen vermisste und Angst hatte vor der Wildnis, in der er sich nun aufhalten musste. Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlimm. Es gab dort immerhin viele Zuckerrohrplantagen, die englischen Herrschaften gehörten. An diesen Orten musste auch ein zivilisiertes Leben möglich sein.
Die Wirtin zuckte nur mit den Schultern und forderte die Bezahlung für die erste Nacht ein. Emily überlegte verlegen, wie sie den Umschlag unauffällig aus ihrem Mieder ziehen konnte, da legte Jamie Morton schon ein paar Münzen auf den Tisch.
»Ich zahle das, Cat. Und gib der Lady auch ein gutes Frühstück, bevor sie geht.«