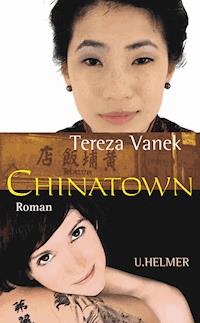5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frauenschicksalsroman um eine Liebe, die nicht sein darf. Für alles Leser:innen von Susanne Abel und Trude Teige »In der bereits von Straßenlaternen in gelbliches Licht getauchten Altstadt schloss er Martha noch einmal in die Arme. Sie lehnte den Kopf an seine Schulter und spürte, wie seine Lippen kurz ihre Wange streiften.« Köln, 1918: das lang ersehnte Ende des ersten Weltkriegs bringt Martha statt Freude großen Kummer, ihre Jugendliebe ist gefallen. Wahrscheinlich wird aus ihr eine jener alten Jungfern werden, die der große Krieg übrigließ. Doch als sie dem tunesischen Kolonialsoldat Amir begegnet, weckt dieser leidenschaftliche Gefühle in ihr. Martha wagt einen mutigen Schritt und folgt ihm nach Paris. Dann verdüstert sich die politische Lage und bald schon marschieren Hitlers Truppen auch nach Frankreich. Marthas Liebe zu Amir ist nun verboten und sie muss nicht nur um das Leben ihres Mannes fürchten, sondern auch um das ihrer Tochter …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Martha, Mon Amour. Eine verlorene Liebe« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zitat
Für alle, die mit dem Herzen sehen
O du so ferne mir entrückt,Wenngleich mein Herz dein Wohnplatz ist,Vergessen ließ dich deine WeltDen, dessen ganze Welt du bist.
Ibn Zaidun (1003–1071), An Wallada
Kapitel 1
Köln, August 1919
»Diese Studiererei ist doch nicht so wichtig, Kind«, sagte Amelia Schwind und warf Martha ein weiteres Hemd zu, das geflickt werden musste. »Die Zeiten sind zu hart für deine verrückten Ideen.«
Martha suchte den Leinenstoff nach Rissen ab, bevor sie die Nadel einfädelte. Es waren nur drei Löcher am rechten Ärmel, das hätte sie in einer halben Stunde erledigt und könnte dann noch für eine Weile mit ihrem Vater nach draußen gehen. Auch wenn er nicht mehr reden konnte, las sie in seinem Gesicht, wie wohl ihm die Sonne und das Lachen von spielenden Kindern im Volksgarten taten.
»Mit einem Studium der Pädagogik und Psychologie könnte ich mir eine Arbeit suchen, und das käme der ganzen Familie zugute«, beharrte Martha, während sie emsig zu stopfen begann. Früher waren ihr alle Handarbeiten verhasst gewesen, aber inzwischen wusste sie, wie beruhigend es für den Geist sein konnte, sich auf eine rein manuelle Tätigkeit zu konzentrieren.
Ihre Mutter seufzte und ließ die eigene Näharbeit für einen Moment sinken. »Diese Flausen hat dir dein Vater in den Kopf gesetzt! Aber es wäre vernünftiger, dich nach einem Ehemann umzusehen, der dich versorgt. Den Luxus, ein studiertes Fräulein zu sein, kannst du dir einfach nicht mehr leisten.«
Der heftige Drang, ihre eigene Mutter mit der Nadel ins Fleisch zu stechen, erschreckte Martha. Früher war sie niemand gewesen, der langen Groll hegte oder zu böswilligen Gedanken neigte. Hatte dieser große Krieg nicht nur aus Männern Krüppel gemacht, sondern auch die Psyche vieler Frauen krank werden lassen?
Sie atmete tief durch.
»Mein Bräutigam lebt nicht mehr«, stellte sie so gefasst wie möglich fest, obwohl ihre Stimme heiser wurde. »Das weißt du.«
Die Nachricht war bereits kurz nach Beginn des Krieges eingetroffen, als Martha noch voller Hoffnung gewesen war, das ganze Spektakel fände bald ein Ende und Harald würde unversehrt und voller Tatendrang zu ihr zurückkehren. Wie schnell und unangekündigt das Leben menschliche Träume in Scherben hauen konnte, hatte sie dann sehr bald lernen müssen. Harald war für immer aus ihrer Welt verschwunden, ohne dass sie einen Tag zu zweit allein hätten verbringen dürfen. Nun wurde ihr zweiter großer Wunsch vom Tisch gefegt.
»Es tut mir leid«, flüsterte die Mutter zu Marthas Erstaunen. »Ich hätte das nicht so sagen dürfen, aber weißt du, Harald hätte nicht gewollt, dass du dich für immer in der Trauer vergräbst.«
Nein, das hätte er nicht. Er hätte sich gewünscht, dass Martha ihr Studium abschloss, denn er war stolz darauf gewesen, wie hartnäckig sie dieses Ziel verfolgt hatte. Ganz sicher hätte er ihr keinen anderen Mann gewünscht, den sie selbst nicht wollte. Mit dem Handrücken wischte sie sich schnell die Augen trocken. Die Mutter meinte es nicht böse. Ihre Zunge war von Natur aus ein Reibeisen. »Entschuldige mich bitte, ich mache das später fertig«, murmelte Martha nur und legte das zu flickende Hemd zur Seite. Sie würde zur Not auf das Abendessen verzichten und stattdessen weiterarbeiten.
Bevor die Mutter einen Einwand erheben konnte, lief sie aus dem Zimmer.
Inzwischen hatte sie Übung darin, den Vater in seinen Rollstuhl zu heben. Es ging ihm in den letzten Wochen besser, und sie konnte spüren, dass er sich bemühte mitzuhelfen. Martha zog ihm die Schuhe an und setzte ihm einen Hut auf, damit er vor der Sonne geschützt war. Dann schob sie ihn durch den Hausflur ins Freie.
Die Wohnung in der Poststraße hatte der Vater glücklicherweise zu besseren Zeiten erworben, sodass sie nicht fürchten mussten, auf die Straße gesetzt zu werden. Mehrere von Marthas früheren Mitschülerinnen wohnten nun in überfüllten, dreckigen Mietskasernen im Griechenmarktviertel. Sie sollte dankbar sein, noch ihr eigenes Zimmer zu haben und einen Vater, der zwar nicht mehr arbeiten konnte, als früherer Gymnasiallehrer aber eine gute Rente bezog. Dass die Mutter durch das Flicken von Kleidung dazuverdienen musste, damit sie regelmäßig zu essen hatten, durfte Martha nur in Gedanken aussprechen. Amelia Schwind setzte alles daran, diese Schmach vor der Welt zu verbergen. Die Aufträge bekam sie von einer Schneiderin in der Nähe, und die Kleidung wurde in Taschen versteckt transportiert, damit die Nachbarn nichts davon mitbekamen.
Martha wich einer Pferdekutsche auf dem Rothbergerbach aus, und gleich darauf blieb der Rollstuhl im Schlamm der Straße stecken, sodass sie kräftig schieben musste, bis ihre Arme schmerzten. Als sie endlich den Volksgarten erreicht hatten, atmete sie erleichtert auf. Die Luft war frischer, und das Grün der spätsommerlichen Natur sorgte dafür, dass ihre Anspannung nachließ.
»Schau mal, da vorn ist eine Bank. Da setzen wir uns hin!«, rief sie dem Vater aufmunternd zu.
Sein linkes Augenlid zuckte, was sie als Zeichen der Zustimmung auslegte. Im Schatten eines Baumes konnte sie für einen Moment die Augen schließen und dem Gesang der Vögel lauschen. Auf einer Wiese nicht weit entfernt versuchten zwei junge Männer, sich durch das Spielen des Akkordeons und Gesang etwas dazuzuverdienen.
»Wer hätt dat vun d’r Tant gedaach«, sang Martha leise mit. Sie hatte den Eindruck, dass die Augen ihres Vaters aufleuchteten, doch ihr selbst war auf einmal wieder zum Heulen zumute. Ebendieses Lied hatte sie zusammen mit Harald gesungen, als sie sich heimlich aus dem Haus geschlichen hatte, um mit ihm gemeinsam am Karnevalsumzug teilzunehmen. Dem letzten vor dem Krieg, als die Welt noch ein verlässlicher Ort gewesen war, der ihr die Möglichkeit eines erfüllten Lebens bot.
Sie drückte die Hand ihres Vaters, die sich schlaff anfühlte, aber dennoch warm war. Ein Lächeln zuckte um seine Lippen, als wollte er ihr Trost spenden. Ein kluges Mädchen wie du wird doch nicht so einfach aufgeben. Früher hatte er das immer gesagt, wenn Martha von Schwermut übermannt worden war. Auch nach der Nachricht von Haralds Tod hatte er sie noch getröstet und sie an ihren großen Traum von einer Laufbahn als Psychologin erinnert. Jetzt hatte sie nur noch seine Hand, doch war wenigstens Leben in ihr.
»Sieh an, das Fräulein Schwind!«, riss eine unangenehm schrille Stimme sie aus ihren Gedanken.
Sie blickte auf. »Guten Tag, Frau Küppers«, grüßte Martha höflich und musterte die rundliche Frau mit dem breiten Blumenhut, der schon etwas zerfleddert war. Früher hatte sie bei ihnen im Haushalt geholfen, bis die Mutter sie vor zwei Jahren unter einem Vorwand entlassen hatte, um Geld zu sparen.
»Was ist denn mit dem Herrn Lehrer passiert?«, fragte Frau Küppers mit echter Betroffenheit. Sie hatte es offenbar noch nicht gehört.
»Schlaganfall. Vor einem Jahr«, erklärte Martha.
»Wie tragisch!« Frau Küppers musterte den Vater seufzend. »Es gibt jetzt leider so viele Verletzte und Krüppel. Schlimm ist das. Die ganzen jungen Leute, die noch ihr Leben vor sich hatten.«
Es sollte wohl ein Hinweis darauf sein, dass der Vater immerhin lange ein zufriedener Mann gewesen war. Die Kriegsfront war ihm aufgrund seines Alters erspart geblieben, stattdessen hatte das Unglück ihn einfach im Schlaf überfallen, nachdem er sich mit starken Kopfschmerzen hingelegt hatte.
»Sie haben es auch nicht leicht, Fräulein Schwind«, plapperte Frau Küppers weiter. »Zuerst der gefallene Verlobte und nun ein so kranker Vater. Aber eine junge, kräftige Frau wie Sie, die kommt schon klar.« Sie klopfte ihr aufmunternd auf die Schulter, was sie früher niemals gewagt hätte. Auch Standesgrenzen hatte der Krieg erschüttert. »Ich wünschte ja, meine Tochter wäre ein bisschen so, aber der Herrgott hat es mir nicht vergönnt.« Sie drehte sich zu einem schmächtigen Mädchen um, das stumm hinter ihr stand und wohl diese Tochter sein musste.
Es war nicht gerade nett von Frau Küppers, in ihrer Gegenwart so über sie zu reden. Martha lächelte das Mädchen an, denn es sah so blass und verloren aus, als hätte es eine schwere Krankheit hinter sich. Die Spanische Grippe vielleicht?
»Mein Name ist Martha«, stellte sie sich vor.
Das schmale Gesicht zuckte nervös.
»Jetzt sag doch was!«, herrschte Frau Küppers ihre Tochter an und versetzte ihr einen Schubs.
»Eva«, flüsterte die Kleine, als müsste sie jedes Wort mühsam herauspressen. »Eva Küppers.«
»Tut mir leid, sie hat keine Manieren«, klagte die Mutter und setzte sich neben Maria auf die Bank.
Eva blieb verkrampft stehen. »Es ist nicht schlimm. Viele junge Mädchen sind schüchtern«, versuchte Martha, Eva zu verteidigen, denn das Kind kam ihr wie ein gescholtener Hund vor. »Meine Mutter hat mir immer vorgeworfen, vorlaut zu sein«, fügte sie dann mit einem Schmunzeln hinzu.
»Herrje, das wäre mir lieber.« Frau Küppers war in Fahrt gekommen. »Also ein Mädel, das nicht auf den Mund gefallen ist. Stattdessen bin ich mit einer Bekloppten geschlagen. Wenn sie am Tag drei Worte sagt, dann ist das viel, und im Haushalt taugt sie auch nichts. Sogar beim Abspülen fällt ihr das Geschirr aus der Hand. Zwei Kinder hatte ich noch, aber die sind beide tot. Nur diese Kleine ist mir geblieben, aber die wird wohl nie richtig erwachsen.«
Sie klopfte mit der Hand auf den Platz neben sich, und Eva hockte sich endlich hin.
Wieder erinnerte sie Martha an einen folgsamen Hund. »Wie alt bist du denn?«, fragte sie bemüht freundlich, an Eva gewandt. Frau Küppers wollte zu einer Antwort ansetzen, doch diesmal kam die Tochter ihr zuvor.
»Vierzehn«, hauchte sie und starrte dabei ihre Schuhspitzen an.
»In der Schule hieß es, sie zeichne gut«, redete ihre Mutter weiter. »Aber wozu taugt das denn? Das können sich nur feine Damen erlauben.«
»Würdest du mir einmal deine Bilder zeigen? Du könntest mich besuchen kommen«, wandte Martha sich wieder an Eva, über deren Gesicht ein Lächeln huschte.
Sie nickte. Frau Küppers sah verwirrt aus.
»Sie wollen meine Tochter wirklich einladen, Fräulein Schwind? Es wäre natürlich eine Ehre für uns. Ihre Frau Mutter war immer so nett!«
Ganz ehrlich hatte sie nicht geklungen, aber Eva lächelte immer noch.
»Ich bin wirklich neugierig, was Ihre Tochter so malt«, beharrte Martha.
»Na ja, so besonders ist es auch wieder nicht«, wandte Frau Küppers ein, doch sah sie offenbar keinen Weg mehr, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. »Ich schicke Ihnen Eva natürlich gern vorbei«, sagte sie und stand schnell auf. »Grüßen Sie die gnädige Frau von mir. Ich wünsche ihr viel Kraft für alles Weitere. Und Ihnen natürlich auch, Fräulein Schwind. Sie sind so nett, sich um den Herrn Vater zu kümmern.« Mit einem kurzen Blick auf Hermann Schwind, dem sie verlegen zunickte, entfernte sich Frau Küppers. Eva trottete hinterher.
Martha musterte die hängenden Schultern des Mädchens, das in seinem Leben wohl selten freundliche Worte zu hören bekam. Durch ihr Studium hatte sie solchen Menschen helfen wollen. Vielleicht gab es immer noch Wege, wie es ihr gelingen konnte. Falls Frau Küppers ihrem Versprechen nicht nachkam, würde sie selbst nach Eva sehen.
Sie erhob sich ebenfalls, um den Vater heimwärts zu schieben. Der Ausflug hatte ihr wieder etwas Lebensmut geschenkt. Da sie nicht den Rest ihrer Tage Hemden flicken wollte, würde sie sich nach einer Arbeit umsehen. Ganz gleich, was ihre Mutter dazu meinte, es gab jetzt vermutlich mehr offene Stellen für junge Frauen als wohlhabende Männer auf Brautschau.
Drei Wochen später hatte Martha etliche Annoncen in Zeitungen studiert und war von einer Adresse zur nächsten gelaufen, bis sie sogar die Absätze an ihren besten Schuhen ruiniert hatte. Es widerstrebte ihr, Geld für die Straßenbahn auszugeben, daher musste sie wohl oder übel alle Strecken zu Fuß bestreiten. Sie hatte sich für Stellen als Verkäuferin, Kindermädchen und Stenotypistin vorgestellt, doch war sie bei den zahlreichen anderen Bewerberinnen stets übergangen worden. Der große Krieg hatte ein ganzes Heer alleinstehender Frauen zurückgelassen, die sich nun selbst versorgen mussten. Martha fehlte als gutbürgerlicher Tochter die notwendige Erfahrung in praktischen Tätigkeiten. Ihr abgebrochenes Studium an der Handelshochschule Mannheim schien Arbeitgeber eher abzuschrecken. Der Traum, den sie sich nicht hatte erfüllen können, lag nun als Hindernis auf dem Weg, den sie stattdessen gehen musste.
Nachdem sie einen weiteren Tag erfolglos herumgelaufen war, überquerte sie den Neumarkt und sah einen Trupp britischer Soldaten vorbeimarschieren, denn Köln war von den Engländern besetzt worden. Die Leute wichen aus, manche warfen den gesund und wohlgenährt wirkenden Männern hasserfüllte Blicke zu, doch die meisten wirkten so erleichtert wie Martha, dass der lange Krieg endlich ein Ende gefunden hatte. An der Ecke des Bürgerhospitals hockte ein Bettler, dem beide Beine fehlten. Martha legte zwei Pfennige in die völlig leere Schale neben ihm. Er blickte kurz auf und musterte sie aus glasigen roten Trinkeraugen. Dann sackte sein Kopf zur Seite.
Martha lief weiter. Ihr Magen knurrte, denn sie hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen, doch bereute sie es nicht, ihr letztes Geld hergeschenkt zu haben. Zu wissen, dass viele Leute in dieser neuen Friedenszeit noch mehr litten als sie, war auf unerfreuliche Weise tröstlich.
»Ein Herz für Bettler wie zu alten Zeiten! Die kleine Martha hat sich nicht verändert!«, rief eine junge Frau und kam durch die Menschenmenge auf sie zugeeilt.
Martha musste einen Moment angestrengt nachdenken, erst dann erkannte sie in der elegant gekleideten, geschminkten jungen Frau mit der modisch gewellten Frisur eine frühere Mitschülerin.
»Franzi! Wie schön, dich zu sehen!«
Sie meinte es ehrlich, denn nach den wiederholten Misserfolgen dieses Tages sehnte sie sich nicht danach, in die gedrückte Stimmung ihres Zuhauses zurückzukehren. Franziska König musste den unangenehmen Folgen des Krieges irgendwie entkommen sein. Zu Schulzeiten war sie deutlich magerer gewesen und hatte zerschlissene, geflickte Kleidung getragen.
Mit einem erfreuten Lächeln umarmte sie Martha. »Wie geht es dir, Fräulein Neunmalklug?«, fragte sie mit freundlichem Spott. »Ich weiß noch, wie du jahraus, jahrein die Klassenbeste warst. Damals machte ich mich darüber lustig, dass aus dir garantiert so eine bebrillte alte Jungfer werden würde, aber ehrlich gesagt wäre ich ganz gern ein bisschen so schlau gewesen wie du.«
»Besonders viel nützt mir das jetzt nicht«, gab Martha zu und musste auf einmal mit den Tränen kämpfen, was ihr peinlich war.
Franziska hakte sich bei ihr ein. »Tut mir leid, da habe ich wohl das Falsche gesagt. Sollen wir zusammen irgendwo einen Kaffee trinken?«
Martha schüttelte den Kopf. Ihrer Mutter würde es nicht gefallen, wenn sie allein Kaffeehäuser aufsuchte. Das eigentliche Problem bestand aber darin, dass sie sich keinen Kaffee leisten konnte.
»Na komm schon, ich lad dich ein«, drängte Franziska. »Du hast mich öfter mal abschreiben lassen, weißt du das noch? So hast du mir die Tracht Prügel erspart, die mein Vater mir angedroht hatte, wenn ich wieder ein miserables Zeugnis nach Hause brächte.«
Sie schob Martha zu einem kleinen Kaffeehaus um die Ecke. Es sah wenigstens nicht teuer aus, und Franziska wirkte so, als könnte sie sich zwei Getränke mühelos leisten. Martha gab nach, denn Franziskas Fröhlichkeit war für einen Moment ansteckend.
»Es tut mir wirklich leid um deinen Verlobten«, sagte Franziska, als sie vor zwei köstlich duftenden Tassen saßen. »Damals dachte ich, du machst dir nichts aus Jungs!«
»Die meisten interessierten mich auch nicht, aber Harald, der war anders«, erzählte Martha. Die Kellnerin brachte zwei Stück Apfeltorte, die Franziska ebenfalls bestellt hatte, ohne auf Marthas Proteste zu achten.
Martha genoss es, ihre Gabel in den weichen Teig sinken zu lassen. Es fühlte sich an wie früher, als es sonntags daheim Kuchen gegeben hatte und die Welt ein angenehmer, sicherer Ort gewesen war. Dann berichtete sie Franzi, wie Harald sie in ihrem Wunsch nach einem Studium unterstützt und auch in allen anderen Dingen stets nach ihrer Meinung gefragt hatte, anstatt einfach seine eigenen Pläne zu schmieden.
»Er wollte Arzt werden. Wir stellten uns vor, dass wir vielleicht einmal gemeinsam in einem Krankenhaus arbeiten würden, wo ich mich um Menschen mit psychischen Problemen kümmern wollte. Aber jetzt, da …« Die Tränen überschwemmten ihre Augen, und sie vermochte keinen Bissen des Kuchens hinunterzuschlucken. Verlegen wandte sie sich ab und suchte nach einem Taschentuch.
»So viele Frauen haben ihre Männer, Väter und Söhne verloren«, sagte Franziska leise. »Im Haus meiner Eltern gibt es mehr Witwen als verheiratete Frauen, würde ich sagen. Ja, es ist schlimm. Aber wir müssen an die Zukunft denken.« Sie drückte Marthas Hand, was unerwartet wohltat.
»Ja, ich weiß«, stimmte Martha zu. »Ich will mir jetzt eine Arbeit suchen, aber auch das mag mir nicht gelingen. Stets die Klassenbeste zu sein ist wohl keine Garantie für Erfolg im Leben!« Nun gelang es ihr selbst, spöttisch zu lachen.
»Das also ist der Grund, warum du durch die Stadt irrst wie ein Hund, der sich verlaufen hat«, meinte Franziska. »Vielleicht … Warte mal: Ich habe jetzt einen … guten Bekannten, der einige einflussreiche Leute kennt.« Sie reckte stolz das Kinn.
Martha rutschte auf ihrem Stuhl herum, denn sie hatte eine ungute Ahnung. »Wer ist dieser … Bekannte?«
Franziska hob abwehrend die Hand. »Darüber rede ich lieber nicht. Er will, dass es unter uns bleibt. Aber ich werde ihn fragen, ob er jemanden kennt, der so eine kluge Frau wie dich einstellen könnte.«
Martha schluckte. »Ich möchte … eine normale Arbeit, also nicht …«
»Schon klar!« Franziska grinste. »Mir ist es egal, wie du jetzt von mir denkst. Ich sehe eben zu, dass ich überlebe. Da nun so wenige gesunde Männer übrig sind, können wir Frauen nicht zu wählerisch sein.« Sie zuckte mit den Schultern.
»Ich denke nicht schlecht von dir!«, widersprach Martha. »Ich will mein Geld auf andere Weise verdienen. Davon abgesehen, so hübsch wie du bin ich nicht.«
»Ach was, du bräuchtest nur die richtigen Kleider, dann ginge das schon. Aber ich kenne dich ja. Du willst eine Arbeit, wo du dein kluges Köpfchen brauchst. Die wird sich schon finden lassen.« Sie winkte die Kellnerin herbei, zahlte und hinterließ ein großzügiges Trinkgeld.
»Ich schlage vor, wir treffen uns in zwei Tagen wieder hier«, meinte sie zum Abschied, als sie wieder auf der Straße standen. »Dann kann ich dir vielleicht schon sagen, wo du vorsprechen kannst. Also verlass dich auf die kleine, dumme Franzi!«
Nach einer weiteren Umarmung, die Martha teures Parfüm einatmen ließ, war die alte Freundin auf hohen Absätzen in der Menge verschwunden. Martha starrte ihr eine Weile stumm hinterher. Es hatte eine Zeit gegeben, da sie Mädchen wie Franziska als leichtfertig bezeichnet hätte, aber in dieser neuen Welt waren alle alten Sicherheiten zum Einsturz gekommen.
Am nächsten Morgen brachte Martha ihrem Vater das Frühstück und half ihm danach auf die Toilette. Zunächst war es ihr unangenehm gewesen, den gebrechlichen Mann wie ein Kind zu behandeln, doch inzwischen hatte sie Übung darin. Seine Beweglichkeit schien etwas besser geworden zu sein, aber er konnte weiterhin nicht sprechen, auch wenn seine Augen deutlich machten, dass er seine Umwelt wahrnahm.
Anschließend führte sie ihn wieder zu seinem Bett zurück.
»Heute Nachmittag machen wir wieder einen Ausflug«, versprach sie ihm. »Aber zunächst muss ich weiter nach Arbeit suchen.«
»Was soll eigentlich werden, wenn du arbeitest?«, vernahm sie die unzufriedene Stimme ihrer Mutter in ihrem Rücken. »Ich schaffe es nicht, ihn allein in den Rollstuhl zu hieven, geschweige denn, ihn … an andere Orte zu bringen.«
Martha seufzte und wischte sich die Hände mit einem Tuch ab. »Wir könnten jemanden einstellen«, überlegte sie laut. »Wenn ich ein Gehalt habe und wir vielleicht noch zusätzlich ein Zimmer untervermieten …«
»Auf keinen Fall!« Ihre Mutter hatte gequält aufgeschrien. »Sollen wir alle in einem Raum wohnen?«
»Nein, denn es wäre nur Vaters Arbeitszimmer, das er jetzt wirklich nicht mehr braucht«, erwiderte Martha und trug das Frühstücksgeschirr in die Küche.
Die Mutter folgte ihr auf den Fersen. »Trotzdem, es würde mir missfallen, hier einen Fremden zu haben«, redete sein weiter. »Allerdings wäre ein Hausmädchen nicht schlecht. Ich habe dich nicht dazu erzogen, die Aufgaben einer Dienstmagd zu erledigen.«
Martha hatte die Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt, um abzuspülen. »Es schadet nicht, ein paar praktische Dinge zu können«, erklärte sie, während sie die Tassen ins Wasser tauchte. »Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Vaters Rente nicht ewig bekommen.«
Der Arzt hatte ihm nach dem Schlaganfall nur noch wenige Monate in Aussicht gestellt. Das lag schon fast ein Jahr zurück, doch Hermann Schwind war nicht gestorben. Allerdings gab es keine Hoffnung, dass er jemals wieder fähig wäre, ohne fremde Hilfe auszukommen. Manchmal fragte Martha sich, ob es für den Vater nicht eine Erlösung wäre, aus dem Leben zu scheiden, doch gleichzeitig graute ihr vor dem Moment des endgültigen Abschieds. Er und Harald waren stets die zwei Pfeiler der Sicherheit in ihrem Leben gewesen. Die Mutter mit ihren ständigen Klagen und Vorwürfen glich hingegen eher einer Last, die Martha zu tragen hatte.
»Ich sage ja, du solltest dich nach einem Ehemann umsehen«, sagte Amelia Schwind auch schon, half Martha aber immerhin, das Geschirr in den Schrank zu räumen. »In deinem Alter plante ich bereits meine Hochzeit. Du hast Zeit mit dem Studium verloren und …«
»Und ich wollte Harald heiraten!«, unterbrach Martha aufgebracht. »Ich will keinen anderen als ihn.«
»Kind, bitte, du bist immer so dickköpfig«, klagte die Mutter. »Es tut mir ja auch leid um Harald und all die anderen Männer, die nicht zurückgekommen sind. Aber du musst an deine Zukunft denken. Harald hätte sicher nicht gewollt, dass …«
»Du hast keine Ahnung, was er gewollt hätte! Also halt den Mund.« Zu ihrem eigenen Entsetzen hatte Martha nun geschrien. Sie wandte sich um und drückte ein Geschirrtuch gegen ihre Augen. Wenn sie nicht bald eine Arbeit fand, sondern ständig mit der Mutter im Haus sitzen musste, würde sie sich nur zunehmend respektlos verhalten.
Amelia Schwind war mit versteinerter Miene stehen geblieben. »Was ist nur aus dir geworden?«, flüsterte sie. »Ich hätte es niemals gewagt, so mit meiner Mutter zu reden. Waren es diese verrückten Ideen, die dein Vater dir in den Kopf gesetzt hat?«
Bevor Martha etwas erwidern konnte, schlug ihre Mutter die Hände vors Gesicht und lief schluchzend aus dem Zimmer. Martha blieb zermürbt von Schuldgefühlen zurück. Sie räumte das restliche Geschirr weg und lief nach draußen, um sich eine neue Zeitung zu besorgen. Irgendwann musste es ihr einfach gelingen, eine Arbeitsstelle zu finden! Es wäre das Beste für alle Beteiligten, wenn sie nicht mehr ständig daheim mit ihrem Schicksal haderte.
Der Zeitungsjunge war zwar mager und schmutzig, doch hatte er wenigstens eine Aufgabe. Martha fragte sich, ob es auch eines Tages ihr Schicksal sein würde, laut schreiend auf der Straße Waren feilzubieten. Es wäre ihr lieber als der Weg, den Franziska eingeschlagen hatte.
Mit der neuesten Ausgabe der Kölnischen Zeitung lief Martha wieder nach Hause zurück, als sie hörte, wie jemand ihren Namen rief. Eva Küppers stand vor ihr, immer noch blass und mit hängenden Schultern, aber offenbar war sie fähig zu reden.
»Du bist mich besuchen gekommen? Wie schön!«, sagte Martha und lächelte das Mädchen an. Frau Küppers hatte bisher keine Nachricht geschickt, wann ihre Tochter kommen würde, doch nun stand die Kleine da und musterte sie mit ihren ernsten Augen.
»Sie wollten doch meine Zeichnungen sehen!«
Ihre Stimme klang heiser, als fiele ihr das Sprechen schwer. Sie musste viel Mut für diesen Besuch aufgebracht haben.
»Ja, natürlich will ich das«, sagte Martha schnell. »Komm herein.«
Sie hatten noch etwas Brot und Marmelade vom Frühstück übrig, überlegte Martha, denn Eva sah aus, als bekäme sie nicht genug zu essen. Die Stellensuche würde wohl heute ein wenig warten müssen. Sie schob das Mädchen in die Küche und setzte Teewasser auf.
»Magst du vielleicht auch ein Glas Milch?«
Eva nickte verlegen. Martha holte die letzten Vorräte aus dem Schrank, erleichtert, dass die Mutter es nicht mitbekam.
Das Milchglas leerte Eva in einem Zug, dann musterte sie Brot, Butter und Marmelade mit leuchtenden Augen. »Ist das alles für mich?«, flüsterte sie ungläubig.
»Ja, iss nur.«
Martha würde noch Vorräte für das morgige Frühstück einkaufen müssen, wenn sie keinen weiteren Ärger mit ihrer Mutter riskieren wollte.
Nachdem Eva alles schnell verschlungen hatte, bekamen ihre Wangen ein wenig Farbe.
»Nun, wo sind jetzt deine Zeichnungen?«, fragte Martha, denn sie war wirklich neugierig.
Eva biss sich auf die Lippen, zog dann ein paar zusammengefaltete Zettel aus ihrer Rocktasche. »Ich nehme dafür die Rückseite von Flugblättern, die meine Mutter manchmal nach Hause bringt. Wollen Sie sie wirklich sehen?«
Ihr Blick drückte Ungläubigkeit aus, doch Martha nickte. »Na klar, her damit! Deshalb bist du doch hier.«
Eva sah wieder verkrampft aus, als hätte sie plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Martha faltete die Blätter vorsichtig auseinander und wurde sofort in eine märchenhafte Welt aus Feen, Kobolden und auch einigen Monstern gezogen, die mit präzisen Strichen wiedergegeben waren. Sie wusste nicht genau, was sie erwartet hatte. Vielleicht hübsche Bilder von Blumen oder Vögeln, wie junge Mädchen sie einander in Poesiealben zeichneten. Keinesfalls so viel entfesselte Fantasie und Eigenwilligkeit.
»Wie … kommst du darauf?«, fragte sie fassungslos.
Evas Gesicht zuckte nervös. »Die Bilder waren schon immer da. Sie kommen, wenn ich die Augen schließe. Es geht mir besser, wenn ich male.« Wieder nagte sie an der Unterlippe. »Ich weiß, es ist hässlich. Meine Mutter sagt, ich bin nicht richtig im Kopf. Es tut mir leid, ich gehe wieder.«
Sie war vom Stuhl geklettert, doch Martha legte eine Hand auf ihren Arm. Eva fuhr erschrocken zusammen, regte sich aber nicht.
»Deine Zeichnungen sind sehr gut«, versicherte Martha. »Ich habe noch niemanden kennengelernt, der so etwas kann. Du solltest Unterricht nehmen.«
»Dafür haben wir kein Geld«, flüsterte Eva. »Ich sollte lieber etwas Vernünftiges machen … wie Putzen oder Kochen. Nur bin ich zu ungeschickt dafür. Also, danke für das Essen. Meine Mutter wartet.«
Ihr Blick wanderte sehnsüchtig in Richtung Tür, doch Martha war nicht willens, sie einfach so gehen zu lassen.
»Jemand sollte diese Zeichnungen sehen«, beharrte sie. »Also ein echter Kunstkenner. Du brauchst Unterstützung.«
Nun verzog Eva ungeduldig das Gesicht. »Warum sollte mich jemand unterstützen? Sie sind sehr nett, Fräulein Schwind, aber meine Mutter wird böse sein, wenn ich zu lange weg bin. Seit wir keine eigene Wohnung mehr haben, passe ich auf Kinder früherer Nachbarn auf, und dort können wir dann schlafen.«
Eva war bereits im Begriff, aus der Küche zu treten, als Martha eine Idee kam. »Habt ihr denn wenigstens ein eigenes Zimmer?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Ich schlafe bei den Kindern. Meine Mutter … woanders.«
Es klang, als hätte Frau Küppers einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Franziska. Martha holte Luft. »Ihr könntet hier wohnen«, schlug sie vor. »Mein Vater braucht sein Arbeitszimmer nicht mehr. Deine Mutter müsste sich um ihn kümmern, wenn ich nicht da bin. Ich will mir demnächst eine Arbeit suchen.« Vor Evas fassungslosem Blick straffte sie die Schultern. »Also wenn deine Mutter meinen Vater versorgt und noch ein paar Aufgaben im Haus erledigt, dann müsstet ihr keine Miete zahlen und könntet bei uns mitessen.«
So war es früher mit Dienstmädchen gewesen. Sie ging davon aus, dass Amelia Schwind zustimmen würde, da ihr so die verhassten Arbeiten im Haushalt abgenommen wurden.
»Schlage es deiner Mutter mal vor!«, beharrte Martha. »Es wäre besser für euch. Und auch für uns.«
Eva brauchte dringend regelmäßige Mahlzeiten. Die Möglichkeit, ihr Zeichentalent zu fördern, würde sich später ergeben.
Nun starrte die Kleine Martha immer noch ungläubig an. »Wir sollen hier wohnen? Bei Ihnen?«
»Aber ja. Es würde mich freuen. Und meine Mutter auch.« Die zweite Aussage stimmte nicht ganz, aber sie würde es schaffen, Amelia Schwind von ihrer Idee zu überzeugen.
Eva nickte zögerlich. »Ich werde es meiner Mutter sagen.«
»Unbedingt. Sie soll so bald wie möglich vorbeikommen, dann können wir alles besprechen.«
Mit weiterhin hängenden Schultern, aber etwas energischer als vorher, verließ Eva nun das Haus. Martha starrte ihr eine Weile hoffnungsvoll hinterher. Sie ging davon aus, dass Frau Küppers das Angebot annehmen würde, wodurch sie und ihre Mutter entlastet wären.
Nur eine eigene Arbeit … die fehlte noch, um all ihre Pläne umzusetzen.
Nach weiteren zweieinhalb Tagen, da sie von einer möglichen Arbeitsstelle zur nächsten gerannt war, erhielt Martha das Angebot, bei einer Modistin anzufangen. Sie sollte zehn Stunden täglich anwesend sein und würde zunächst vor allem Böden schrubben und Kaffee kochen, doch könnte sie allmählich lernen, wie Hüte und Brautgestecke angefertigt wurden.
»So eine feine Dame kann Eindruck auf die Kundschaft machen«, begründete die Besitzerin des Ladens, eine magere Frau im schwarzen Kleid, ihre Entscheidung. »Zunächst aber musst du beweisen, dass du keine zwei linken Hände hast, wie viele von diesen studierten Leuten.«
Martha bedankte sich für das Angebot, obwohl ihr etwas flau im Magen war. Sie hatte sich niemals viel aus Hüten oder sonstigem Putz gemacht, fürchtete darüber hinaus, dass es ihr tatsächlich an der notwendigen Geschicklichkeit mangeln könnte. Das Wissen, jede Hoffnung auf eine Tätigkeit, die sie wirklich begeistert hätte, verloren zu haben, schmerzte auf einmal wieder so heftig wie eine frische Wunde. Dennoch war sie erleichtert, dass sie ein wenig eigenes Geld verdienen könnte, auch wenn die Bezahlung kaum besser war als die wenigen Münzen, die ihre Mutter für das Flicken von Hemden erhielt. Es wäre ein Anfang.
Sie machte sich auf den Heimweg und überlegte, ob sie ihrer Mutter die Art der Tätigkeit nicht besser verschweigen sollte. Amelia Schwind war früher selbst Kundin bei Modistinnen gewesen und hätte sich für ihre Tochter sicher eine angesehenere Arbeit gewünscht. Aber für Martha war es wenigstens ein kleiner Erfolg.
Regen setzte ein, als Martha den Neumarkt erreicht hatte. Die Kirchenglocken von St. Aposteln kündigten die dritte Stunde des Nachmittags an, und Martha fiel die Verabredung mit Franziska ein. Fast hätte sie die ehemalige Mitschülerin vergessen oder vielleicht auch verdrängt, denn der Umgang mit einer Frau von derart unsittlichem Lebenswandel gehörte zu den Dingen, die ihre Mutter niemals gutgeheißen hätte. Aber Franziska hatte ihr Kaffee und Kuchen bezahlt! Es wäre sehr unhöflich gewesen, sie zu versetzen.
So sah Martha sich nach dem kleinen Kaffeehaus um. Wahrscheinlich hatte Franziska die Verabredung auch vergessen, aber da aus dem Nieselregen ein heftiges Gewitter zu werden drohte, wäre ein Unterschlupf jetzt sowieso nicht schlecht. Nun, da sie eine Anstellung in Aussicht hatte, würde sie sich einen Kaffee gönnen!
Sie hatte gerade ihren völlig durchnässten Hut abgelegt und sich das Gesicht mit einem Taschentuch abgetupft, da kam Franziska durch die Tür. Irgendwie hatte sie es geschafft, nur ein paar Tropfen abzubekommen. Die Feder an ihrem Barett hing schief, doch ihr Gesicht war wieder tadellos geschminkt. Auf dünnen Absätzen balancierte sie auf Martha zu.
»Wie schön, dass du gekommen bist. Sonst hätte ich herausfinden müssen, wo du wohnst, um dir eine Nachricht zu schicken.« Sie ließ sich auf dem Stuhl gegenüber nieder und zog eine Zigarette aus ihrem Handtäschchen, die sie in einen eleganten Halter steckte.
»Ich habe großartige Neuigkeiten«, verkündete sie, während sie den kleinen Raum mit Rauch füllte. »Du wirst es nicht glauben, was für ein Glückspilz du bist!«
Martha lächelte nachsichtig. »Das bin ich wirklich. Ich habe eine Arbeit gefunden. Bei einer Modistin.« Als Franziska eine Schnute zog, fühlte sie sich gedrängt, ihre neue Zukunft zu verteidigen. »Wenn ich lerne, wie man Hüte macht, dann kann ich eines Tages mein eigenes Geschäft haben.«
»Mit den schäbigen Kappen, die du immer auf dem Kopf hast, wirst du nicht reich werden«, meinte Franziska schmunzelnd. »Wirklich, so ein Fräulein Neunmalklug wie du taugt nicht dazu, andere Frauen zu verschönern. Du hast keinen Blick dafür.«
Obwohl sie zu Schulzeiten niemals eng befreundet gewesen waren, hatte Franziska schonungslos eben jene Schwäche erkannt, wegen der Martha sich selbst Sorgen machte. »Ich werde es lernen!«, wandte sie trotzig ein.
»Ach was!« Franziska wedelte mit der Hand, die ihre Zigarette hielt. »Ich habe etwas Besseres für dich!« Sie beugte sich vor und riss ihre schwarz umrandeten Augen auf. »Du magst doch die Wissenschaft und willst stets den Armen und Elenden helfen. Da passt du in eine Arztpraxis.«
Ohne nachdenken zu müssen, stimmte Martha innerlich zu. Schließlich hatte sie früher gedacht, als Psychologin in einer medizinischen Einrichtung tätig zu werden. »Ich bin weder Ärztin noch ausgebildete Krankenschwester«, wandte sie ein.
»Na, wenn schon!« Franziska winkte ab. »Ich weiß von einem Arzt, der eine Sprechstundenhilfe sucht. Du musst seine Patienten in Empfang nehmen und Bücher führen oder was weiß ich. Das erklärt er dir schon.«
Für Martha klang es weitaus machbarer als das Verzieren von Hüten, doch sie blieb skeptisch. »Ich habe keinerlei Erfahrung in diesem Bereich«, wandte sie ein.
»Dann wirst du diese Erfahrung eben machen!«, beharrte Franziska, bestellte ihnen erneut Kuchen und außerdem zwei Gläser Likör. »Das ist ein sehr angesehener Arzt und trauernder Witwer, denn seine Frau ist an der Spanischen Grippe verstorben«, redete sie weiter. »Ich bin mir sicher, er wird dich mögen. Mein Bernie meint, er hätte eine Schwäche für kluge, tüchtige Frauen. Das passt doch alles. Also bedanke dich jetzt endlich bei der dummen kleinen Franzi!«
Ein wenig hatte sie wie ein forderndes Kind geklungen. Martha lehnte sich skeptisch zurück. »Ich bin dir dankbar für deine Mühe, aber ich suche eine Arbeit, keinen Mann, dem ich gefalle.«
Franziska kicherte glucksend. »Also manchmal bist du bemerkenswert dämlich. Wenn du ihm gefällst, hast du bessere Aussichten auf die Stelle, kapiert? Da kommen alle alten Jungfern mit zig Jahren Erfahrung nicht gegen dich an.«
Das konnte sogar stimmen. Martha schwankte zwischen Freude und Misstrauen, beschloss aber, es wenigstens zu versuchen. »Wo finde ich diesen Arzt?«, fragte sie.
»In Lindenthal. Virchowstraße, eine noble Adresse. Du kannst dich morgen vorstellen. Mit Empfehlung von Bernhard Schöndorf. Ja, das ist mein Bernie. Jetzt habe ich doch den Namen ausgeplaudert.« Wieder kicherte Franziska, nun etwas unsicher.
»Ich erzähle es nicht weiter«, versprach Martha.
»Nein, das solltest du wirklich nicht. Du musst sagen, dass du in der Anwaltskanzlei Schöndorf bereits im Büro gearbeitet hast. So haben mein Bernie und ich es abgesprochen. Er wird dich empfehlen. Da siehst du mal, was ein Mann alles tut, wenn eine Frau ihm zu gefallen weiß.« Stolz reckte sie das Kinn und hob dann das Likörglas. »Jetzt lass uns endlich anstoßen! Oder willst du weiterhin die Heilige spielen und dein feines Näschen rümpfen?«
Martha holte Luft und folgte Franziskas Aufforderung. Sie hatte schon so viele Vorstellungsgespräche hinter sich, da würde sie ein weiteres auch überleben, obwohl sie nicht ernsthaft damit rechnete, genommen zu werden.
Der Regen hatte wieder nachgelassen, sodass Martha in Ruhe nach Hause laufen konnte. Franziskas Angebot, sich eine Pferdekutsche zu teilen, lehnte sie ab, denn sie wollte nicht weiter auf die Großzügigkeit ihrer früheren Mitschülerin angewiesen sein. Auf dem Heimweg überlegte sie, wie viel sie ihrer Mutter erzählen sollte. Reichte es zu erwähnen, dass sie eine Arbeit in Aussicht hatte? Nächsten Montag sollte sie bei der Modistin beginnen, vorher noch bei dem Arzt vorsprechen. Die zweite Stelle würde der Mutter sicher mehr zusagen, aber die Aussicht, sie tatsächlich zu bekommen, schien Martha gering. Sollte sie vielleicht gar nichts sagen, bis alles geklärt war?
All diese Überlegungen erwiesen sich als hinfällig, denn als Martha das Haus erreicht hatte, wo ihre Familie im Erdgeschoss wohnte, sah sie Frau Küppers davorstehen. Mit der rechten Hand hielt sie Eva fest, die sich in der Lage sichtlich unwohl fühlte. In der linken trug sie bereits einen Koffer.
Marthas Angebot war schneller angenommen worden als erwartet. Sie hatte damit gerechnet, alles noch in Ruhe mit allen Beteiligten besprechen zu können, doch dazu fehlte ihr jetzt die Zeit.
»Da sind Sie ja, Fräulein Schwind!«, rief Frau Küppers und kam ihr ein paar Schritte entgegen. »Jetzt hoffe ich, dass meine Tochter nicht wieder irgendwelchen Unsinn erzählt hat, den sie sich so gern ausdenkt.«
Eva wandte verlegen das Gesicht ab.
»Rausgeworfen hat man uns!«, zeterte Frau Küppers weiter. »Einfach vor die Tür gesetzt, weil diese Tagträumerin nicht einmal mit drei kleinen Kindern fertig wird. Sie hat wieder irgendwas gekritzelt und es nicht mitbekommen, wie ein Junge seine Schwester die Treppe hinuntergeschubst hat. Jetzt sind wir die letzte Bleibe los, die wir noch hatten.«
Sie schnaubte. Eva war rot angelaufen, während ihre Mutter wütend die Lippen aufeinanderpresste. Ihr Gesicht sah erschöpft aus.
»Das tut mir sehr leid«, sagte Martha und überlegte, wie sie ihre eigene Mutter gleich davon überzeugen sollte, beide aufzunehmen.
»Mein Evchen hat mir erzählt, Sie hätten wieder Arbeit für mich«, meinte Frau Küppers auch schon. »Stimmt das?«
Martha las Verzweiflung in den geröteten Augen. Die beiden besaßen nicht mehr, als in den verbeulten Koffer passte, und hatten jetzt nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
»Können Sie sich vorstellen, auf meinen Vater aufzupassen, wenn ich außer Haus bin?«
»Ja, natürlich!« Frau Küppers Gesicht erhellte sich. »Er war immer ein netter Mann, der Herr Lehrer«, sagte sie mit echter Wärme in der Stimme. »Ich kümmere mich gern um ihn.«
»Dann kommen Sie doch rein!«
Martha lief voran, um ihrer Mutter die Stirn zu bieten. Sie fand Amelia Schwind im Wohnzimmer über die Näharbeit gebeugt, die sie schnell hinter einem Kissen versteckte, als Frau Küppers aufgetaucht war.
»Ich habe jemanden gefunden, der Vaters früheres Arbeitszimmer beziehen und dafür auf ihn aufpassen wird«, sagte Martha mit Entschlossenheit. »Denn ich selbst arbeite ab nächster Woche. Dann haben wir etwas mehr Geld.«
Amelia riss ungläubig die Augen auf und öffnete den Mund, doch schienen ihr keine passenden Widerworte einzufallen. Sie begrüßte Frau Küppers mit der gnädigen Herablassung der Hausherrin und gewann ihre Fassung schnell wieder. »Es steht doch nicht einmal ein Bett im Arbeitszimmer«, wandte sie ein.
»Wir finden schon eine Lösung. Es ist ein Notfall«, meinte Martha und öffnete die Tür zu dem Raum, wo sich ihres Vaters Schreibtisch und Bücherregale befanden.«
»Wir können auch ein paar Nächte auf dem Teppich schlafen. Das ist wirklich nicht schlimm«, versicherte Frau Küppers auch schon. Nun, da ihre Lage sich gebessert hatte, war sie sanftmütiger geworden und lächelte die Tochter sogar einmal an. »Wir haben ein eigenes Zimmer. Wer hätte das gedacht?«, flüsterte sie und strich Eva kurz über den Kopf, als hätte sie begriffen, wem das zu verdanken war.
»Packen Sie schnell aus, und dann führe ich Sie zu meinem Vater«, schlug Martha vor. Frau Küppers nickte und klappte energisch den Koffer auf.
Martha ging zu ihrer Mutter, die sich erneut ins Wohnzimmer zurückgezogen hatte.
»Früher war sie ja ganz tüchtig«, meinte Amelia Schwind. »Aber jetzt sehen die beiden so zerlumpt aus.«
»Das wird schon werden. Sie brauchen nur ein Bad und saubere Kleidung«, versicherte Martha und schloss für einen Moment erleichtert die Augen.
Es sah aus, als hätte sie zumindest einen Plan erfolgreich umsetzen können.
Frau Küppers übernahm bereits am nächsten Morgen die Pflege von Marthas Vater, sodass dem Besuch bei Herrn Dr. Helmut Kobler nichts im Weg stand. Martha packte den Zettel mit der Adresse, den Franziska ihr beim Abschied überreicht hatte, in ihre Handtasche. Sie verbrachte etwas mehr Zeit vor dem Spiegel als sonst, denn Franziskas Worte, dass sie unbedingt gefallen musste, waren nicht ganz ohne Wirkung geblieben. So sehr sie sich auch bemühte, sich keiner falschen Hoffnung hinzugeben, kam sie nicht gegen den Wunsch an, ebendiese Stelle zu bekommen. Von allen Arbeiten, für die sie sich bisher vorgestellt hatte, war es die einzige, die sie auch als Tätigkeit reizte.
Ihre Röcke reichten alle bis zum Knöchel, was nicht der neuen Mode entsprach, aber wahrscheinlich hatte ein Witwer konservative Vorstellungen. Sie zog eine weiße Bluse und eine graue Weste an, frisierte ihr Haar zu einem Dutt und setzte einen jener Hüte auf, der laut Franziska jede Modistin in den Ruin treiben würde. Mehr konnte sie nicht aus sich machen. Es müsste genügen.
Ihre Schuhe waren schon zerkratzt, und als sie sich mit einem Stadtplan auf den Weg gemacht hatte, begann auch noch einer der Absätze zu wackeln. Tränen schossen Martha in die Augen. Sie wollte nicht humpelnd bei Dr. Kobler ankommen. Schließlich nutzte sie das letzte Geld in ihrer Handtasche, um sich eine Droschke zu mieten.
Die Virchowstraße bestand aus einer Aneinanderreihung von Villen und eleganten Häusern. Martha kam sich wie eine schäbige Bettlerin vor, als sie aus der Droschke kletterte. Wäre sie zu Fuß hergelaufen, hätte sie vielleicht wieder den Rückweg eingeschlagen, aber nachdem sie Geld in diese Reise investiert hatte, wollte sie nicht kneifen.
Sie fand die richtige Adresse, atmete tief durch und drückte auf die Türklingel. Herr Dr. Kobler bewohnte ein zweistöckiges Haus. Die Praxis war im Erdgeschoss untergebracht.
Die Tür ging einen Spalt auf und eine Frau mit grauen Haarsträhnen und Brille schob ihr Gesicht hindurch. »Sie wünschen?«
Martha stellte sich vor. »Mir wurde gesagt, dass der Herr Doktor eine Sprechstundenhilfe sucht und ich mich vorstellen dürfte«, fügte sie hinzu. Hoffentlich hatte Franziska keinen Unsinn erzählt.
Die Frau musterte sie missbilligend. »Wer hat Ihnen das gesagt?«
Jetzt wurde es schwierig, denn Martha wollte nicht lügen, obwohl Franzi das vorgeschlagen hatte. »Eine Bekannte von Herrn Bernhard Schöndorf. Sie sagte, ich könne heute erscheinen.«
Ein Murren folgte, aber die Tür wurde geöffnet. »Na gut, dann kommen Sie mal herein.«
Ein elegant eingerichteter Korridor tat sich auf, den Martha zögernd zu betreten wagte.
»Ich bin Fräulein Angmeier. Zwanzig Jahre lang war ich hier Sprechstundenhilfe«, stellte die Frau sich vor.
Ihr Kleid war so grau und schmucklos wie ihr Haar, sodass sie insgesamt an eine in die Jahre gekommene Maus erinnerte. Damit glich sie jener Vorstellung, die Franziska von alten Jungfern hatte, und Martha schöpfte Hoffnung, ebenfalls für die Stelle infrage zu kommen.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen«, meinte Martha brav, doch das schmale Gesicht wurde nicht freundlicher.
Sie wurde in einen kleinen Raum geführt, in dem ein großer Tisch und mehrere Regale standen.
»Hier werden die Patienten empfangen«, sagte Fräulein Angmeier. »Das Wartezimmer ist rechts und der Behandlungsraum links. Ich habe immer viel Wert auf Ordnung bei der Ablage von Dokumenten gelegt.« Sie warf einen zufriedenen Blick auf die akkurat gestapelten Ordner in den Regalen. »Mit einem Telefonapparat können Sie hoffentlich umgehen«, redete sie weiter.
Martha zögerte einen Moment. »Ich habe schon manchmal die Telefonhäuschen benutzt«, sagte sie schließlich, denn sie wollte nicht lügen. Einen imposanten Apparat, wie er hier auf dem Tisch thronte, konnte ihre Familie sich nicht leisten.
»Na gut, daran soll es nicht scheitern.« Fräulein Angmeier musterte Martha noch einmal von Kopf bis Fuß. »Welche Referenzen haben Sie denn? Ich hoffe, Sie haben bereits in einem Büro gearbeitet oder wenigstens eine entsprechende Ausbildung.«
Wieder schwankte der Boden unter Martha. »Ich habe vor zwei Jahren Abitur gemacht«, verkündete sie und zog das Zeugnis aus ihrer Tasche. »Danach habe ich … ein Studium der Psychologie begonnen, das ich aber leider aus persönlichen Gründen abbrechen musste.«
Fräulein Angmeiers Kinn sackte nach unten. »Also, Verrückte kommen nicht zum Herrn Doktor.«
»Natürlich nicht.« Martha lächelte gezwungen.
»Es geht in einem solchen Studium nicht nur um Verrückte, sondern um menschliches Verhalten. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich lerne gern neue Dinge und könnte mir gut vorstellen, in einer Arztpraxis …«
»Der Herr Doktor hätte gern eine junge Dame mit einschlägiger Berufserfahrung«, unterbrach Fräulein Angmeier Martha gnadenlos.
Martha fühlte sich, als hätte sie einen Tritt in den Magen erhalten. Sie mochte diesen sachlichen, aufgeräumten Raum weitaus mehr als den herausgeputzten Laden der Modistin.
»Ich werde ihm natürlich sagen, dass Sie hier waren«, redete Fräulein Angmeier etwas sanfter weiter. »Kann man Sie irgendwie erreichen?«
Martha blinzelte die Tränen weg. »Ich schreibe meine Adresse auf«, schlug sie vor. Fräulein Angmeier hielt ihr Notizblock und Bleistift entgegen. Martha beugte sich, um zu schreiben, als sie Schritte in ihrem Rücken vernahm.
»Haben wir Besuch? Die Praxis öffnet doch erst wieder in einer Stunde«, sagte eine tiefe Stimme, und ein mittelgroßer Mann von etwa vierzig Jahren trat ein. Auf seinem Gesicht wuchs ein Backenbart, er trug ebenfalls eine Brille, sah aber weniger verbissen aus als die Empfangsdame.
»Nein, Herr Doktor, nur diese junge Frau ist hier, um sich als meine Nachfolgerin zu bewerben«, sagte Fräulein Angmeier schnell.
Martha knickste und stellte sich nochmals vor.
»Sie hat Abitur, aber leider kaum Berufserfahrung«, redete die Empfangsdame weiter. »Nur ein abgebrochenes Studium.«
Es hatte nicht gerade schmeichelhaft geklungen, doch der Arzt musterte Martha aufmerksam. »Was für ein Studium?«
»Psychologie«, wiederholte Martha. Falls nun wieder ein Kommentar über Verrückte kam, würde sie sich damit trösten, dass diese Stelle für sie eindeutig nicht die richtige war.
»Eine ungewöhnliche Wahl«, sagte der Arzt aber nur und holte einen der Stühle aus dem Wartezimmer, den er Martha entgegenschob. »Setzen Sie sich. Dann können wir uns besser unterhalten.«
Er selbst nahm auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch Platz. Fräulein Angmeier blieb mit unzufriedener Miene stehen.
»Was hat Sie dazu bewogen, Psychologie zu wählen?«, fragte Dr. Kobler. »Für gewöhnlich werden junge Damen eher Lehrerin oder Sekretärin?«
Ähnlich hatte Marthas Mutter geredet, und auch Fräulein Angmeier würde wahrscheinlich zustimmen.
»Ich … wollte begreifen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie es tun«, erklärte Martha. Sie fürchtete, dass nun ein Hinweis auf allgemeine moralische und religiöse Normen kommen würde, aber der Arzt sah weiterhin wissbegierig drein. »Es war schon in der Schule so, dass ich vieles am Benehmen von Menschen merkwürdig fand«, redete Martha daher weiter. »Manche der Mädchen waren unglaublich gemein zu anderen, verschafften sich eben dadurch aber Respekt. Dann gab es einige, die waren geborene Opfer. Sie waren wie gelähmt, wenn man sie angriff. Ich wollte verstehen, warum das so ist und wie man ihnen vielleicht helfen kann.«
Fräulein Angmeier hatte den Kopf leicht zur Seite geneigt und musterte Martha ebenfalls wie ein aufmerksamer Spatz. »Die Lehrer hätten den bösartigen Mädchen durch Strafen angemessenes Betragen beibringen müssen, dann hätte es keine solchen Probleme gegeben«, meinte die Empfangsdame nun.
Immerhin zeigte sie Interesse am Gespräch.
»Es hätte den Lehrern sicher helfen können, die Gründe für das Betragen dieser Mädchen zu kennen«, sagte Martha. »Meines Erachtens ist es die Aufgabe eines Psychologen herauszufinden, warum manche Menschen stets andere angreifen müssen, um sich stark zu fühlen.«
Der Arzt rieb die Handflächen aneinander. »Haben Sie eine Idee, warum das so sein könnte?«
Martha holte Luft. Bisher hatten nur ihr Vater und Harald solches Interesse an ihrer Meinung gezeigt. »Ich glaube, tief drinnen fühlten die gemeinen Mädchen sich schwach«, versuchte sie, ihre Überlegungen in klare Worte zu fassen. »Sie wurden gemein, um das zu verbergen. Die Opfer hingegen wussten nicht, wie sie sich wehren sollten, und daher hörten die Angriffe nicht auf.«
Dr. Kobler hatte nachdenklich die Stirn gerunzelt. »Das heißt, Sie verurteilen diese Leute alle nicht, sondern wollen sie einfach verstehen?«
»Ich verurteile natürlich Gemeinheiten«, sagte Martha. »Aber man müsste die Ursachen bekämpfen, finde ich.«
Der Arzt sah kurz Telefon und Regale an. »Wie ist es mit den Männern, die aus dem Krieg zurückkamen und nun nicht mehr in der Lage sind, das Leben zu bewältigen. Sie leiden darunter, dass ihre Familien sie für Schwächlinge halten.«
»Vielleicht sollte man sie für eine Weile aus den Familien herausholen und in ein Sanatorium schicken. Das wäre auch eine Entlastung für die Angehörigen.« Fräulein Angmeier murrte wieder.
Der Arzt nickte nach einigem Zögern. »Das können die Krankenversicherungen leider nicht zahlen. Es gibt zu viele solcher Fälle«, meinte er nur. »Aber grundsätzlich wäre es keine schlechte Idee. Also …« Er stand auf. »Falls Sie Ihr Studium tatsächlich nicht fortsetzen können, was bedauerlich ist, dann würde ich mich freuen, Sie nächsten Monat hier begrüßen zu dürfen. Fräulein Angmeier verlässt mich, weil sie sich um ihren kranken Neffen kümmern will.«
Die Empfangsdame nickte. »Aber ich werde nächsten Monat noch zwei Wochen hier sein und kann der Nachfolgerin alles zeigen«, fügte sie hinzu.
Martha lächelte und bedankte sich. Zwar war zu befürchten, dass sie gleich zu Arbeitsbeginn mit einem Drachen zu kämpfen hätte, aber Fräulein Angmeier war sicher auch jemand, von dem man viel lernen konnte.
»Na, dann ist ja alles geklärt«, meinte der Arzt zufrieden. »Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen, Fräulein Schwind?« Er sah ehrlich interessiert aus.
»Durch eine Bekannte von Herrn Bernhard Schöndorf«, wiederholte Martha. Auf einmal war auch das ihr nicht mehr peinlich.
Dr. Kobler fragte nicht weiter nach. »Da hat Bernd mir einen Gefallen getan.«
Er lächelte auf eine Weise, die Martha fast schon zu warm vorkam. Sie wollte nicht werden wie Franziska, obwohl sie diesen Herrn hier sympathisch fand. Sie hatte eine Arbeit in Aussicht, die sogar reizvoll klang.
Den Rückweg legte sie beschwingt zu Fuß zurück, denn nun konnte selbst ein wackeliger Absatz sie nicht aufhalten.
Kapitel 2
Köln, Juli 1921
»Pass um Gottes willen auf!«, rief die Mutter, als Martha ihr Fahrrad stolz aus der Wohnung schob. »Ich verstehe wirklich nicht, warum du dafür Geld ausgeben musstest.«
»Weil ich nicht jeden Tag bei Wind und Wetter eine Stunde zu Fuß unterwegs sein will und die Trambahn auf Dauer auch ins Geld geht«, erklärte Martha, obwohl sie das schon oft genug wiederholt hatte. Die Mutter war nicht überzeugt davon, und völlig unrecht hatte sie nicht. Martha hatte ein halbes Jahr lang sparen müssen, um sich ein gebrauchtes Fahrrad leisten zu können, das sie in einer Zeitungsannonce entdeckt hatte. Nun gehörte es ihr, schon leicht klapprig, aber noch völlig funktionsfähig, und versprach grenzenlose Freiheit.
»Sie wird sich schon nicht gleich den Hals brechen, gnädige Frau«, meinte Frau Küppers, die mit einem Tablett in der Hand aus dem Schlafzimmer getreten war. Sie versorgte den Vater gewissenhaft, was für Martha eine enorme Entlastung war.
»Es schickt sich nicht für junge Damen, so breitbeinig herumzustrampeln«, murmelte Amelia Schwind, aber es klang resigniert, als hätte sie bereits eingesehen, dass der Kampf verloren war.
»In Köln fahren inzwischen etliche Frauen Fahrrad«, widersprach Martha.
Eva war ebenfalls im Hausflur aufgetaucht und sah ihr zu – mit dem üblichen ernsten Blick aus den riesengroßen Augen.
Auf der Straße brachte Martha das Fahrrad in die richtige Position, damit sie aufsteigen konnte. Kurz fühlte sie sich verunsichert. Sie hatte schon ein paar Runden im Volksgarten gedreht, aber die ganze Strecke bis nach Lindenthal war doch eine Herausforderung. Sie raffte ihren Rock, den sie der neuen Mode entsprechend hatte kürzen lassen. Die Kleidung für Frauen wurde immer praktischer und weniger einengend, sodass es mühelos möglich war, ein Fahrrad zu besteigen. In der Theorie zumindest, denn nun geriet Martha kurz ins Schwanken und musste sich noch einmal mit dem Fuß auf dem Boden abstützen. Dann brachte sie mit dem anderen Bein das Pedal in Bewegung und strampelte los. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Eva ihr erfreut zuwinkte. Jetzt begann das Abenteuer.
Ihr Gefährt an Pferdekutschen, gelegentlichen Automobilen und zahlreichen Fußgängern vorbeizumanövrieren, beanspruchte Marthas ganze Aufmerksamkeit. Ihr Rock bekam deutlich mehr Dreck ab, als wenn sie zu Fuß unterwegs gewesen wäre, da sie Pfützen nicht so leicht ausweichen konnte. Aber das Tempo, mit dem sie vorankam, war erstaunlich.
In Lindenthal herrschte etwas weniger Verkehr, und Martha konnte kräftig in die Pedale treten. Wind wehte ihr durchs Haar, und sie glaubte, wie ein Pfeil durch die Luft zu fliegen. Ähnlich musste sich das Reiten anfühlen, doch hatte sie niemals Gelegenheit dazu gehabt, es auszuprobieren.
Vor Dr. Koblers Haus kettete sie das Fahrrad an den Gartenzaun und warf einen Blick auf die Armbanduhr, die der Vater ihr noch vor seinem Schlaganfall zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie war zwanzig Minuten früher angekommen als erwartet, konnte daher in Ruhe noch Kaffee für den Doktor und sich kochen, bevor die ersten Patienten eintrafen.
Die Berufstätigkeit hatte Marthas Leben völlig verändert und ihr geholfen, die Schwermut abzuschütteln. Nicht nur ihre Eltern waren finanziell abhängig von ihr, sondern auch Eva und Frau Küppers, was ihrem Dasein eine neue Bedeutung schenkte. Aber auch Dr. Kobler begrüßte sie die meiste Zeit mit einem Lächeln, als wäre er froh über ihre Anwesenheit. Angeblich war Martha bei den Patienten beliebt. Sie schaffte es, aufgebrachte Gemüter zu beruhigen und gelegentliche Streitereien im Wartezimmer zu schlichten, was dem Arzt ebenso wichtig erschien wie die von Fräulein Angmeier hinterlassenen tadellos geführten Akten.
Sie hatte nach Abbruch ihres Studiums nicht damit gerechnet, eine Tätigkeit zu finden, die sie nicht nur ernähren, sondern ihr auch Freude machen würde, aber ebendies war eingetreten.
Martha füllte die Kaffeetasse und klopfte an die Tür des Arbeitszimmers, wo Dr. Kobler morgens noch Fachzeitschriften studierte, bevor die Patienten eintrafen. Sie wurde sofort hereingebeten.
»Ich habe hier etwas, das Sie interessieren könnte, Fräulein Schwind«, sagte Dr. Kobler und schob ihr einen Artikel zu, in dem es um die Behandlung von Kriegsversehrten durch Elektroschocks ging.
»Wir haben ja auch so einen Fall. Peter Ganz beginnt, immer wieder zu zittern, wenn er laute Geräusche hört«, sagte Dr. Kobler und nippte an seiner Tasse. »Ich gebe ihm Beruhigungsmittel, doch habe ich Bedenken, dass er sich zu sehr daran gewöhnt. Elektroschocks scheinen mir aber zu brutal.«
Martha nickte sofort. Sie fand diese Vorstellung ebenso grauenhaft.
»Könnte er nicht öfter ins Grüne fahren?«, fragte sie. »Ich glaube, er bräuchte Ruhe und eine freundliche Umgebung.«
»Er verlässt nur ungern sein Zuhause. Seine Mutter bringt ihn hierher«, erzählte der Arzt. »Ich fürchte, der Vater verachtet ihn für seine Probleme. Das schadet dem jungen Mann, aber ich kann ihn schlecht von seiner Familie trennen, wenn er selbst es nicht will.« Dr. Kobler nahm seine Brille ab und rieb sich die müden Augen.
»Vielleicht könnte er mit der Mutter wegfahren«, überlegte Martha. »Die kümmert sich ja um ihn.«
»Aber sie wird nicht wagen, sich gegen den Vater aufzulehnen, fürchte ich. Das ist manchmal eines der größten Probleme. Man kann Patienten nicht aus ihrem Umfeld reißen. Selbst, wenn es ihnen nicht guttut.«
Martha stimmte zu und räumte die Kaffeetassen wieder weg. Es war an der Zeit, alles für die Ankunft der ersten Patienten herzurichten. Sie warf einen prüfenden Blick in das Wartezimmer, wo die Putzfrau gute Arbeit geleistet hatte, und positionierte sich dann hinter dem großen Tisch der Rezeption. Die Akten der Patienten, die heute kommen sollten, hatte sie bereits am gestrigen Abend vorbereitet. In der Mittagspause würde sie sich den Artikel durchlesen, von dem Dr. Kobler gesprochen hatte.
Um zehn vor acht klingelte es zum ersten Mal, und Martha machte sich auf den Weg, um aufzumachen. Zu ihrem Erstaunen sah sie Fräulein Angmeier vor sich, die im Laufe des vergangenen Jahres noch grauer und schmächtiger geworden war. Hinter ihr stand ein blasser junger Mann in zerschlissenem Anzug.
»Mein Neffe Gunther«, stellte sie ihn vor. »Ich unterstütze ihn, weil seine Eltern beide tot sind. Aber …« Sie verstummte und ihr Mund verkrampfte sich für einen Moment. »Es ist manchmal schwierig«, fuhr sie fort. »Er hat … Probleme.«
Der Neffe stand nur missmutig da und warf Martha einen Blick zu, der nicht gerade freundlich wirkte. Warum brauchte er überhaupt die Hilfe einer älteren Tante? Er musste auf jeden Fall schon über zwanzig sein.
»Ich würde gern mit dem Herrn Doktor sprechen«, redete Fräulein Angmeier weiter. »Er ist ein sehr kompetenter Arzt und … diskret.«
Der einstige Drachen sah erschöpft aus.
»Ich werde ihm Bescheid geben«, versprach Martha und ging zu seinem Büro. Zu ihrer Erleichterung respektierte Fräulein Angmeier den Umstand, dass ihre Nachfolgerin nun das Sagen hatte.
Dr. Kobler versicherte, dass er seine frühere Sprechstundenhilfe und ihren Verwandten heute begutachten würde, doch mussten die Termine eingehalten werden. »Wir können sie vielleicht dazwischenschieben, wenn es schneller geht als erwartet oder jemand nicht kommt«, meinte er. »Sie können warten, wenn sie wollen. Oder kurz vor der Mittagspause wiederkommen, dann rede ich gern mit ihnen.«
Martha trug diese Botschaft zu Fräulein Angmeier, die zu ihrer Überraschung einwilligte, einfach abzuwarten.
»Wir sind mit dem Zug gekommen und haben hier nicht einmal ein Hotelzimmer«, erklärte sie.
Der Neffe murrte, widersprach aber nicht.
Martha brachte den beiden schnell noch zwei Tassen Kaffee.
»Haben Sie vielleicht einen Schuss Schnaps, damit es besser schmeckt?«, fragte der Neffe mit einem schiefen Grinsen.
»Gunther, bitte, du bist beim Arzt«, meinte Fräulein Angmeier und musterte ihn tadelnd.
Er murrte etwas lauter und sah seine Tante wütend an.
»Es gibt hier leider keinen Schnaps, mein Herr, nur Milch und Zucker zum Kaffee«, sagte Martha knapp und entfernte sich, weil wieder die Türklingel geschellt hatte.
Innerhalb von zwanzig Minuten hatte sich das Wartezimmer gefüllt. Martha rief nacheinander die Patienten auf und brachte ihre Krankenakten zu Dr. Kobler. Die meisten der Leute kannte sie bereits, denn Dr. Kobler war in Lindenthal sehr beliebt. Frau von Haltersheim, eine Kriegswitwe, erschien meist mehrfach in der Woche, da sie an Kopfschmerzen und Schlafstörungen litt. Auch ihr wurden Beruhigungsmittel verschrieben, was sie aber nicht davon abhielt, immer wieder hier aufzuschlagen. Martha vermutete, dass sie sich einsam fühlte, was der wahre Grund für ihre Beschwerden sein dürfte.
»Wie schön, Sie wiederzusehen, Fräulein Angmeier«, begrüßte sie nun die frühere Sprechstundenhilfe. »Ist das der Herr Neffe, der Sie von hier weggeholt hat?«
Fräulein Angmeier nickte. Die Blicke, mit denen sie die Arztpraxis musterte, drückten Sehnsucht aus. »Er war im Krieg und nun …« Sie verstummte für einen Moment. »Er braucht eine Frau, die sich um ihn kümmert.«
»Aber es gibt doch so viele junge Mädchen heutzutage, die sich nach einem anständigen Kerl sehnen«, plapperte Frau von Haltersheim weiter. »Ich bin mir sicher, dass der Herr Neffe …«
»Das ist meine Sache!«, unterbrach der junge Mann in einem reichlich unhöflichen Tonfall. »Ich nehme eben nicht jede.«
Martha fragte sich, ob die Mädchen tatsächlich vor seiner Tür Schlange standen, denn sie konnte an seinem missmutigen, eingefallenen Gesicht nichts Reizvolles finden. Aber wahrscheinlich waren viele zu verzweifelt, um wählerisch zu sein. Gunthers Widerwillen, sich eine Braut zu suchen, hatte seine Tante genötigt, ihre Arbeit zu kündigen. Für Martha war das ein Glücksfall gewesen, aber sie ahnte, dass ihre Vorgängerin lieber bei Dr. Kobler geblieben wäre.
»Ich sehe es ja ein«, fuhr Frau von Haltersheim unbeirrt fort. »Die jungen Frauen heutzutage sind von fremden Einflüssen verdorben. Es ist nicht mehr so leicht, eine anständige zu finden.«
Im Wartezimmer saß eine junge Dame von etwa fünfundzwanzig, die aber nur verärgert das Gesicht abwandte. Martha, die durch die geöffnete Tür alles beobachten konnte, beschloss, diesen Kommentar ebenfalls zu ignorieren.
»Durch die fremde Besatzung geht unser Land völlig kaputt«, stimmte ein älterer Herr sogleich zu. »Wenn sie uns wenigstens anständige Soldaten geschickt hätten, aber bei den Franzosen sind Leute dabei, die wie halbe Tiere aussehen. Haben Sie von dem Vorfall in Frankfurt gehört?«
Martha erinnerte sich daran, dass vor einigen Monaten französische Soldaten auf Leute geschossen hatten, angeblich weil sie provoziert worden waren. Sie kannte aber keine Details, mischte sich daher nicht in das Gespräch ein.
»Sie schicken uns Afrikaner, die hier Leute massakrieren und die letzten ehrbaren Frauen schänden!«, rief Gunther plötzlich lautstark. »Hätte ich eine Gemahlin, ich würde sie nicht mehr auf die Straße lassen.«
Wie gut, dass er keine hat, dachte Martha. Da ihr sein Tonfall nicht gefallen hatte, begab sie sich ins Wartezimmer. »Ich muss um Ruhe bitten«, sagte sie so freundlich wie möglich. »Der Herr Doktor will sich auf seine Arbeit konzentrieren, und manche Leute in diesem Raum sind geschwächt.«
Gunther schoss in die Höhe. »Ich bin für dieses Land im Schützengraben gelegen, habe meine Kameraden verrecken sehen und lasse mir jetzt nicht von einem Mädchen den Mund verbieten!«, schrie er Martha an.
Sie trat einen Schritt zurück, war aber nicht willens, sich einschüchtern zu lassen. »Ich handle hier im Auftrag von Herrn Dr. Kobler, in dessen Haus Sie sich befinden«, erwiderte sie eisig. »Es steht Ihnen jederzeit frei zu gehen, wenn Sie sich nicht an die Regeln halten wollen.«
Der junge Mann hob die Hand, als wollte er zuschlagen, doch seine Tante zupfte ihn am Ärmel. »Gunther, bitte, sie tut nur ihre Pflicht!«
Er schüttelte den Griff unwirsch ab, setzte sich aber hin und starrte mürrisch auf seine Schuhspitzen.