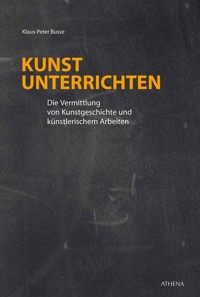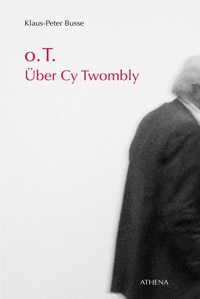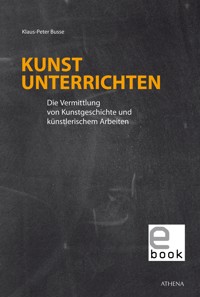Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ruhr | Atlas
- Sprache: Deutsch
In den letzten Jahren gehören Begriffe wie Mapping und Atlas zum Wörterbuch der Kunst- und Kulturwissenschaften. In den vielen Debatten über die Globalisierung, über Migrationsprozesse und über den Klimawandel zeigen sich zugleich Auseinandersetzungen mit Räumen und Raumbewegungen. Noch nie gab es so viele Landkarten und kartografische Übersichten, die diese Debatten begleiten. Gleichzeitig erscheinen diese Themen in den Künsten. Und auch hier zeigt sich, dass der Begriff Mapping die vielen Erscheinungsformen der Raumerkundung in Kunst, Wissenschaft und Alltag nicht abdecken kann, weil er sich nur auf den Umgang mit Karten beschränkt. Es ist also wichtig, die Begriffe genau zu bestimmen, die in dieser kulturellen Debatte benutzt werden. Der Ruhratlas ist eine mehrteilige Publikation zur Kartografie und Nutzung von Räumen und Orten im Ruhrgebiet. Sie untersucht die Bilder über das Emscherland, kartografiert den Phoenix-See in Dortmund-Hörde, beschreibt die Raumlust und das Reisen in der Region. Der Ruhratlas stellt wichtige Kunstwerke vor, die sich mit Orten im Ruhrgebiet auseinandersetzen. Das Buch Im Ruhrgebiet. Mapping und Raumspiele (Band 1) untersucht und ordnet Bilder als Annäherung an die Metropolregion. Zugleich entwirft das Buch neue Perspektiven auf das Mapping als Methode der zeitgenössischen Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Ruhrgebiet. Courtesy Frank Georgy, Köln
Übersichtskarte aller im Ruhr-Kohlen-Gebiet, Rheinisch-Westfälischen-Kohlen-Revier, bestehenden Voll- und Anschluss-Eisenbahnen, nebst den darin vorkommenden Zechen. Köln : Königliche Eisenbahndirection, 1891. ETH-Bibliothek Zürich, Rar K 285, https://doi.org/10.3931/e-rara-38964 / Public Domain Mark
INHALT
EIN STILLGELEGTER BAHNHOF
RAUMERKUNDUNG
MAPPING
RAUMCHOREOGRAFIEN UND RAUMSPIELE
DAS RUHRGEBIET IM BILD
DER MYTHOS DES EMSCHERBILDES
MUSEEN IM EMSCHERLAND
TOUR DE RUHR
KLAUS-PETER BUSSE | KURT WETTENGL DISKURSGELÄNDE
DANK
EIN STILLGELEGTER BAHNHOF
Bahnhof Ückendorf-Wattenscheid. Postkarte. ca. 1910. Herkunft nicht ermittelbar. Archiv des Verfassers
Fährt man mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit der Eisen- oder Straßenbahn durch das Ruhrgebiet oder wandert man entlang bekannter und neu entdeckter Wege irgendwo im Emscherland, trifft man auf Baustellen. Bäche werden kanalisiert, Gebäude werden abgerissen, neue Radautobahnen und innovativ geplante Wohnviertel entstehen. Ehemalige Verwaltungsgebäude und Kirchen werden neu genutzt, und aus dem Kühlturm einer Brauerei entsteht ein Kulturzentrum. Bagger und Planierraupen stehen bereit, um Erdmassen zu bewegen. Die Landschaft verändert sich. Das war im Ruhrgebiet immer so, und bis heute zeigen sich diese Zeichen des Wandels. Überall treffen dabei die Bauarbeiten auf Relikte der regionalen Geschichte: verlassene Gebäude, alte Brücken und Strecken alter Eisenbahnlinien, auf denen früher Kohle und Stahl transportiert wurde. Solche Orte, die vergessen, noch nicht umgewandelt oder abgerissen wurden, sind »lost places«. Häufig hatten solche Orte in ihrer Bau- und Nutzungsgeschichte wichtige Funktionen. Das gilt für den stillgelegten Bahnhof in Gelsenkirchen-Ückendorf, gelegen an einer ehemals wichtigen Bahnstrecke zwischen Essen und Bochum, der heute Aufmerksamkeit erregt, weil die ehemalige Trasse dieses Verkehrsweges zu einem Ruhr-Rad-Weg umgebaut wird. Die Verwilderung dieses Geländes wurde beseitigt, und Wanderer*innen und Bewohner*innen erkennen die ehemalige Gleiswege. Man sieht sogar, dass dieses Bahnhofsgelände groß gewesen sein muss. Mehrere Gleisstränge liegen nebeneinander, es gibt Prellböcke und Meldestationen, deren Abbau vergessen wurde. Im Blickfeld liegen auch die zahlreichen Abzweigungen einzelner Bahnstrecken, ein verlassenes Gebäude und ein Schuppen mit Rampe. Nur wenige Menschen können heute diese Spuren im Raum erklären, die darauf hinweisen, dass sich an diesem Ort eine typische Raumchoreografie des Ruhrgebiets seit dem 19. Jahrhundert verdichtet hatte. Mapping und Bildarchive: Historische Karten und Fotografien in den Stadtarchiven erklären diese Choreografie des Bahnhofsgeländes in Gelsenkirchen. Ein Gleisplan aus dem Jahr 1913, der im Archiv des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum liegt, zeigt, was hier geschah. Zwischen Essen und Bochum hatte sich die Notwendigkeit ergeben, einen Umschlagplatz der Güter einzurichten, der die Logistik der Zechen Holland, Fröhliche Morgensonne und anliegender Betriebe sicherstellte. Das geschah durch die Bündelung von Zügen, für die man Rangierflächen benötigte. Für den Personenverkehr baute man einen Bahnhof. So entstand die komplexe Gestaltung des Geländes mit einem Empfangsgebäude, einem Güterschuppen mit Laderampe, mit Versorgungseinrichtungen für die Lokomotiven, eine Drehscheibe mit Lokschuppen, Werkstätten, Stellwerke und Wohnungen für die Eisenbahner. Der Ort zeugt von der Wichtigkeit des Gütertransports in der Entwicklung des Emscherlands und von ihrem Einfluss auf die Nutzung des Raums. Das Bahnhofsgelände muss eine sehr betriebsame Atmosphäre gehabt haben, wie, insgesamt gesehen, die Eisenbahnlinien für den Güter- und Personenverkehr die Raumchoreografien des Ruhrgebiets seit dem 19. Jahrhundert festlegten und immer wieder veränderten. Warenumschlag und Logistik prägen das Ruhrgebiet bis heute. Kohle, Stahl und Erze mussten transportiert werden, ebenso alles, was man im Bergbau und in der Stahlindustrie benötigte. Ladeschuppen hatten eine zentrale Bedeutung, von denen aus verteilt wurde, was im Alltag wichtig war. Die frühen Lastkraftwagen hatten hier eine wichtige Funktion, die von den Güterschuppen Waren an ihren Zielort brachten, wenn keine Gleise dorthin führten. Heute sind es die Eisenbahnlinie zwischen China und Duisburg wie die vielen Logistikzentren im Ruhrgebiet, die sich in seinen vielfältigen Räumen prägend verbergen. Seit man im Emscherland die Kohle entdeckte, wurde es Transportgebiet. Seine Kanäle, die ehemalige Nutzung der Ruhr und Schiffshebewerke dokumentieren diese Entwicklung. Der Transport gestaltet einen Raum.
Bahnhofsgelände Ückendorf-Wattenscheid. Der Güterschuppen diente dem Warenumschlag von der Eisenbahn in den Nahtransport durch Pferdegespanne und durch die ersten Lastkraftwagen. Im Umfeld siedelten sich mittelständische Betriebe an. Die Zechen hatten eigene Gleisanschlüsse. Foto: Archiv des Verfassers
Bahnhofsgelände Ückendorf-Wattenscheid. Ansicht von der Straßenseite. 2021. Foto: Archiv des Verfassers
Wenn Orte wie der ehemalige Bahnhof in Gelsenkirchen eine Aufmerksamkeitsschwelle überschreitet und sich Menschen anschicken, offenen Fragen an einen Ort nachzugehen, beginnt ein Spiel mit dem Raum: Der Ort wird Ausgangspunkt für Recherchen, die sich in vielfältigen Produktionen niederlegen können. Ein Amateur-Historiker oder eine lokale historische Gesellschaft (von denen es im Ruhrgebiet viele gibt) werden vielleicht ein Buch über den Ort veröffentlichen oder Vorträge halten. Andere Personen könnten das Gelände in einer Modelleisenbahn-Anlage nachbauen (was nicht außergewöhnlich ist), und Künstler*innen kämen auf andere, verwegene Ideen, wenn man ihre Aufgabe als eine künstlerische, mithin sogar partizipatorische Auseinandersetzung mit einem Ort versteht, die Veränderung des Emscherlands mit ihren Mitteln zu reflektieren. So entstünden unter Umständen künstlerisch gemeinten Konzepte, die Gleispläne als Ausgangspunkte für Raumzeichnungen zu benutzen, einen Container als Bahnhofsbüro einzurichten, in dem Bilder aus der Nachbarschaft gesammelt werden, Schulklassen zu begleiten, die das Gelände untersuchen, oder für den neu entstandenen Ruhr-Radweg Bildportale zu entwickeln, die diesen Ort erklären und die auf die Erinnerungen der Bevölkerung zurückgreifen. Es ginge darum, in vielfältigen Raumspielen das Gelände um den ehemaligen Bahnhof zwischen Gelsenkirchen und Wattenscheid in einen performativen Ort des Grabens und Wühlens, des Suchens und Findens zu verwandeln.
RAUMERKUNDUNG
In den letzten Jahren gehören Begriffe wie »Mapping« und »Atlas« zum Wörterbuch der Kultur- und Kunstwissenschaft. In den vielen Debatten über die Globalisierung, über Migrationsprozesse und über den Klimawandel zeigen sich zugleich Debatten über Räume und Raumbewegungen. Noch nie gab es so viele Landkarten und kartografische Übersichten, die diese Debatten begleiten, als ob man die Räume verorten müsste, um die es in den Debatten geht. Gleichzeitig erscheint dieses Thema in den Künsten. Die Biennale in Venedig im Jahr 2019 und die Ausstellungen der »Manifesta«, die im Jahr 2026 im Ruhrgebiet stattfinden wird, sind dafür nur Beispiele. Das Mapping in der Kunst hat dabei einen gesellschaftskritischen Hintergrund. Als Methode erzeugt das Mapping Wissen über Räume, die innerhalb gesellschaftlicher Debatten über Nachhaltigkeit, Klimawandel, Migration und Stadtentwicklung verhandelt werden, was den Rang dieser Form der künstlerischen Auseinandersetzung betont. Das gilt auch für die Untersuchungen und Erörterungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Ruhrgebiets. Dabei ist der Begriff »Mapping« höchst untauglich, die vielen Erscheinungsformen der Raumerkundung in Kunst, Wissenschaft und Alltag abzudecken, weil er sich nur auf den Umgang mit Karten beschränkt. Es ist wichtig, eine genaue Erklärung der Begriffe anzustreben, die in dieser kulturellen Debatte benutzt werden.
Das Engagement der kulturellen Institutionen im Ruhrgebiet zur kulturellen Sicherung der Region ist beeindruckend und historisch gewachsen. Die Entwicklung des Emscherlands ist ausgesprochen gut in Bildern dokumentiert. Diese Bilder sind in Archiven wie Museen zugänglich. Sie werden in Ausstellungen und Publikationen immer wieder neu vorgestellt. Das Interesse der Bürger*innen des Emscherlands an diesen Bildern ist groß. Seitdem die Region im Jahr 2010 Kulturhauptstadt war, entwickeln sich darüber hinaus viele Projekte in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Auch sie haben ein gewachsenes Fundament. Zu ihnen gehörte die »Emscherkunst«, betreut von der »EGLV« in Essen, die für den wasserwirtschaftlichen Umbau der Emscher und Lippe verantwortlich ist. In diesen Ausstellungen entwickeln Künstler*innen Blickfelder auf die Region und verorten dort ihre künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Region. Das ist in der zeitgenössischen Kunst nicht außergewöhnlich. Das Vor-Ort-Sein der Kunst ist ein Merkmal vieler künstlerischen Projekte, die diesen Bezug zwischen Kunst und Ort einrichten. Während der Ausstellungen der »Emscherkunst« konnte hautnah beobachtet werden, was in in ihrem Umkreis geschah und wie Besucher*innen in diesen Ausstellungen handelten. Im Umgang mit den Kunstwerken, die an unterschiedlichen Orten des Emscherlands verwirklicht wurden, zeigte sich ihr Interesse, die Narrative der Orte fortzusetzen oder in diese Narrative einzugreifen. Orte sind »mehrschichtige Palimpseste«, »tragen ganz besondere Geschichten in sich, die an ihnen stattgefunden haben«, und bilden auf diese Weise »Lebensgeschichten« ab.1 Kunstwerke öffnen einen Diskurs über die »Orte in der Erinnerung« (Pierre Nora) und ermuntern zugleich, diese Orte neu zu denken. Dieser Diskursraum ist heute ein Merkmal vieler Ausstellungen über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Stadträumen auch in außerkünstlerischen Zusammenhängen geworden. Auch dort spielt das Mapping eine tragende methodische Rolle und fügt sich in einen partizipatorischen Umgang mit den Ausstellungsangeboten ein. Wenn sich Menschen in diese Form der Verhandlung ihrer Kultur einbringen, muss diese Mitwirkung einen Ort haben, der sie initiiert und dokumentiert. Denn die Narrative, die solche Ausstellungen auslösen, benötigen ein Archiv. Wie dies geschehen kann, weiß die Kunst bereits. Über die Blicke nach Hagen in das Archiv von Sigrid Sigurdsson und nach Frankfurt in das Historische Museum wird dieses Buch erzählen. Es deutet viel darauf hin, dass solche Raumerkundungen nur dann gelingen, wenn sie in stringente Vermittlungs- und Partizipationsprogramme eingebunden sind, in denen man erfahren kann, die eigene Welt zu verhandeln und zu gestalten. Künstlerische Prozesse, Vermittlungsprogramme und Institutionen sind eng miteinander verbunden und verdichten sich in ihren Netzwerken. Es liegt nahe, dass lokale Museen die kulturellen Orte dieser Verdichtung sind.
Marl 1956: die Vermessung der Wasserwege im Ruhrgebiet (hier der Lippe). Courtesy Emschergenossenschaft Essen
Der Tourismus macht beispielhaft anschaulich, wie diese Verhandlung und Gestaltung eines Raums abläuft. So ist der Umgang mit Landkarten für Touristen selbstverständlich. Sie schauen nach, wohin ihre Reise geht, wo sie ein Flugzeug wechseln müssen, welche Orte sie auf der Reise besuchen werden und wie das Wetter an diesen Orten sein wird. In vielen Fällen markieren sie die Ergebnisse ihrer Recherchen auf einer Landkarte, die sie oft selbst zeichnen. Manche Reisende notieren während der Tour Erlebnisse und Erfahrungen. Sie benutzen dafür Bücher. Sie zeichnen in Heften oder arrangieren Fotografien in digitalen Fotoarchiven, die jeden besuchten Ort speichern und ihn in sozialen Netzwerken verfügbar machen. Auf diese Weise entstehen immer wieder neue Hotspots. Die sozialen Netzwerke ersetzen den traditionellen Reiseführer, wie ihn noch Roland Barthes in den 1950er-Jahren als Begleiter an immer dieselben Orte verstand, die dadurch Alltagsmythologeme wurden. War gestern noch eine kleine Kirche auf einer Wiese in Südtirol ein Geheimtipp unter Wanderern, wird sie durch Facebook zu einem Anlaufspunkt chinesischer Touristenströme auf dem Weg vom Kreuzfahrtschiff in Venedig nach München, und die Einheimischen müssen Barrieren bauen, damit die Menschenmengen die Weideflächen der Bauern nicht zerstören, wenn die jeweils neuen Hotspots dazu benutzt werden, sich selbst, aber nie den historischen Ort in fotografische Szenen zu setzen: die Epoche des Selfies vor einer Landschaft. Es scheint, als würden diese Orte zu Nicht-Orten im Sinne Marc Augés, die durch die touristische Belagerung ihre Identität verlieren. Kreuzfahrtschiffe transportieren in sehr kurzen Zeiträumen tausende Touristen an zentrale Orte, von denen Tagesausflüge in Städte oder zu Sehenswürdigkeiten unternommen werden. Nicht selten bilden sich dabei so große Ansammlungen von Menschenmassen, dass diese Ausflugsorte, die häufig zum kulturellen Erbe einer Region gehören, unsichtbar werden. Die Aura und die Atmosphäre dieser Orte verschwinden. Bewegungen in Räumen haben unmittelbare Folgen für die Nutzung und die Struktur dieser Räume. Sie haben nicht selten eine zerstörerische Kraft. Das gilt nicht nur für europäische Orte, sondern auch für die Landschaftsräume Asiens, Australiens und Neuseelands. Die Routen der Kreuzfahrtschiffe liegen in den Räumen weltweiter Umweltverschmutzung und Landschaftsveränderung. Sie werden zu Zeichen der Unvernunft im Umgang mit der Natur und mit ihren Ressourcen. Der Zusammenhang von touristischen Raumbewegungen und der Struktur dieser Räume ist unübersehbar. Durch diese Raumbewegungen verändern sich auch die Karten, die es von diesen Räumen gibt. In diesem Vorgang entwickeln sich aber auch Karten, wie diese Raumbewegungen gesteuert werden können. Sie werden Sperrgebieten kennzeichnen, in denen man keinen Massentourismus wünscht. Reisebewegungen folgen ihren Kodierungen, und der Umgang mit ihnen ist ein kommunikatives Spiel zwischen Festlegungen und Spielräumen in überregionalen und regionalen Debatten. Touristen sind häufig besonders kreative Kartograf*innen. Solche Menschen machen sich auf den Weg, um die Orte in Sizilien zu besuchen, an denen der Roman »Il Gattobardo« von Giuseppe Tomasi di Lampedusa spielt, oder um die Orte in Mecklenburg zu finden, die Uwe Johnson in seinen Romanen beschreibt.2 Es gibt sogar Menschen, die nach Italien reisen, um dort in Tabakläden nach alten Postkarten zu suchen, die die Geschichte eines Dorfes oder einer Landschaft rekonstruierbar machen. Man kann bis an die Ränder des Vorstellbaren gehen: Reisende Kartografen folgen immer neuen Ideen und Konzepten. Sie fahren von Paris nach Marseille und markieren die interessantesten Rastplätze, um dort literarische Texte zu verfassen. Andere folgen dem Transport von Klavieren nach Sibirien3, fotografieren die schönsten Autobahnausfahrten4, untersuchen Raststätten5, fahren mit der Straßenbahn durch das Ruhrgebiet und ärgern sich, weil der öffentliche Nahverkehr dort nicht funktioniert. Aber entdecken kann man dabei viel: die sich verändernde Welt, seit Joseph Roth 1926 durch die Emscherregion mit diesem Verkehrsmittel reiste.
Die Erkundung von Räumen arbeitet mit Karten oder anderen Medien, die vorgegeben werden. Diese Erkundung folgt einer Methode und einer Zielsetzung. In vielen Fällen werden die Bewegungen in einem Raum und die Entdeckungen in diesem Vorgang dokumentiert. Die kartografische Bewegung ist dabei an unterschiedliche Skripte und Medien gebunden. Erwartungen und Interessen werden bestätigt, in Frage gestellt und sogar widerrufen. Denn besonders reizvoll werden Raumbewegungen, die unerwartete Dinge und Erfahrungen ans Licht bringen, vielleicht sogar Lernbewegungen oder wahre Entdeckungsreisen werden. Sie sind der Ort der Phantasie und der Träume. Es scheint, dass man zwischen Personen unterscheiden sollte, die Karten anlegen, um eine empirische Untersuchung von Räumen zu dokumentieren, und jenen Personen, für die eine Raumerkundung ein forschendes Abenteuer ist. Für die einen Projekte gelten objektive Interessen, beispielsweise der Wissenschaften, andere Projekte sind subjektiv oder künstlerisch gemeint. Aber auch für Wissenschaftler*innen können subjektive, ja sogar künstlerisch gemeinte Beobachtungen zur Grundlage von Forschungen werden. Diese Prozesse sind häufig eine methodische Gemengelage. Das gilt auch für ihre Inhalte. Der Umgang mit Karten und die Erkundung von Räumen ereignen sich in vielen unterschiedlichen kulturellen Bereichen. Sie setzen eine Bewegung voraus, und wenn es nur die des Fingers, des Auges oder ein Blick auf diese Bewegungen ist.
Der Umgang mit Räumen - als Methode der Raumerkundung - ist nicht auf die empirische Untersuchung von Räumen und auf die objektive kartografische Darstellung in Landkarten festgelegt. Er ist vor allem durch ein subjektives Interesse an Räumen und durch Methoden gekennzeichnet, die eine persönliche Raumerkundung möglich machen. Jede Raumerkundung verlangt ein Methodenrepertoire, das einer Konfiguration bedarf. Dabei spielen wissenschaftliche, künstlerische und alltägliche Arbeitsweisen zusammen. Heute sind die Kulturwissenschaften, Kunst, Literatur und das alltagsästhetische Verhalten die Areale, zwischen denen sich der Umgang mit dem Raum ereignet und abbildet.6 Der Umgang mit einem Raum blickt über den Rand einer Disziplin oder über den Rand der Skripte einer Handlungsdomäne hinaus. Er kennt die Grenzen von Domänen eigentlich nicht. Der Historiker Karl Schlögel sieht dies noch grundsätzlicher. »Wenn alle Aspekte des menschlichen Lebens eine räumliche Dimension haben und wenn Raum sich darstellt als Komplex unendlich vieler Aspekte, dann gibt es so viele Karten, wie es Aspekte des menschlichen Lebens gibt.«7 Die historische Arbeitsweise Karl Schlögels konfiguriert Methoden zwischen den Domänen. Viele seiner Zugriffsweisen auf Orte und Räume könnten aus der zeitgenössischen Kunst stammen (weil sie inzwischen damit arbeitet), andere entsprechen alltäglichen Beobachtungen von Menschen, die sich in Räumen bewegen, und weitere Zugriffe haben ein wissenschaftliches Fundament. Karl Schlögel profitiert von den Schriften Walter Benjamins, Franz Hessels, sogar von den Ideen des Schriftstellers Charles Baudelaire, vielleicht auch von den »Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge«, die Rainer Maria Rilke verfasst hat. »Stadterkundung heißt nicht bloß sich informieren, sondern Produktion von Komplexität im Kopf, Erzeugung von Wissen über die Zwischenräume, Training der Sinne für das Indirekte und Implizite, für alles im Schatten des Bekannten und Offiziösen.«8