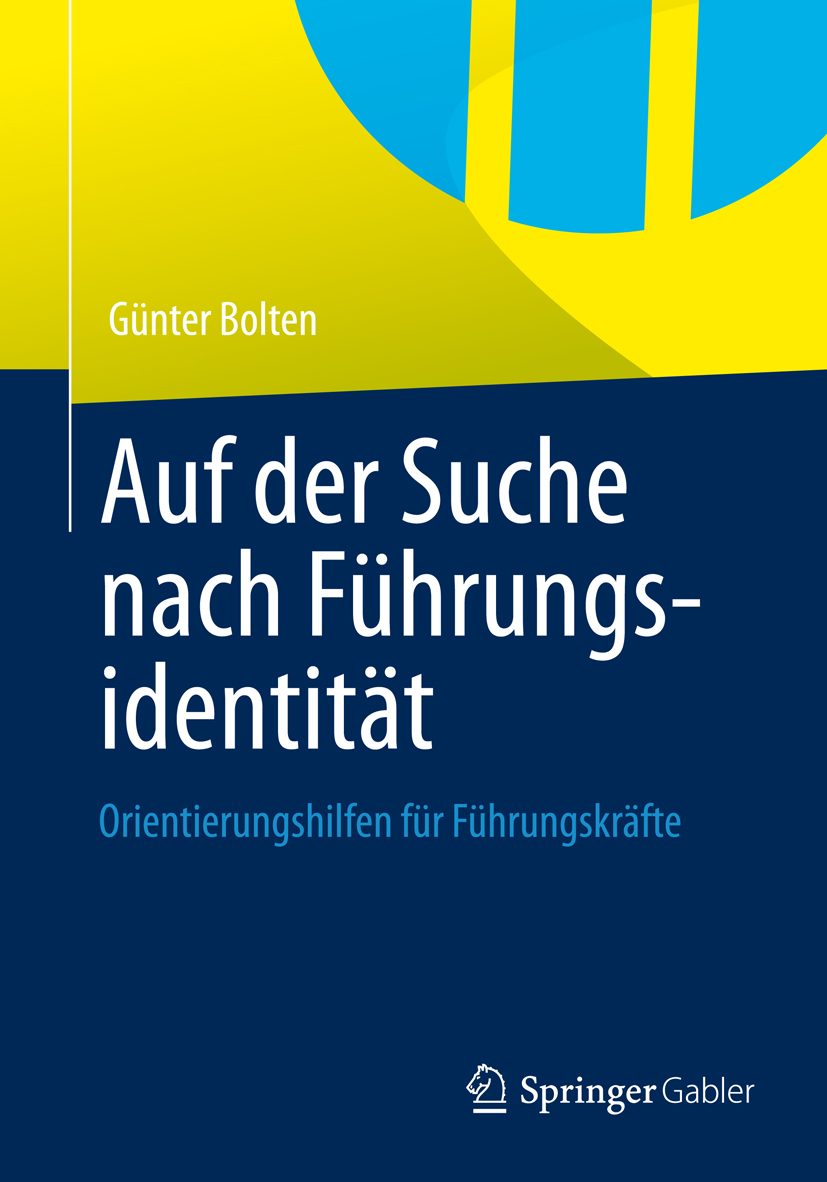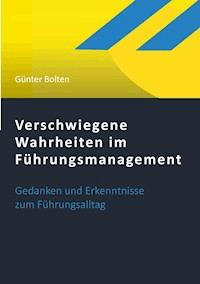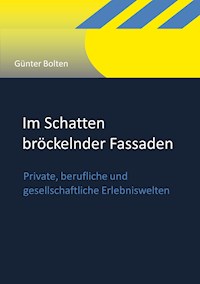
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Im Schatten bröckelnder Fassaden" beschreibt Lebenswirklichkeiten und spiegelt Erfahrungen, Gegebenheiten und Empfindungen, die sich zu Verunsicherungen bis hin zu persönlichen Schicksalsschlägen entwickeln können. Nicht selten werden sie zu übertünchten Herausforderungen missbraucht. Je mehr Fassadenhürden zu überwinden sind, desto stärker wird der Wunsch, die vorhandenen Gegebenheiten zu überstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
A.
Vorwort
B.
Realitäten, denen man sich nicht verschließen darf
B.1 Angst - der schlimmste Fallstrick
B.2 Das Phänomen Identität hat viele Fassetten
B.2.1 Zur privaten Erlebniswelt
B.2.2 Zur beruflichen Erlebniswelt
B.2.3 Zur gesellschaftspolitischen Erlebniswelt
B.3 Im Fassadenrausch von Zeit und Geschwindigkeit
B.4 Authentizität - Die Kunst, echt zu sein
B.4.1 Der Wahrheit verbunden bleiben
B.4.2 Authentizitätsmerkmale und Risiken
B.4.3 Mut, sich zu riskieren
B.5 Interdependenzen - Grundlage für Entwicklungen unterschiedlicher Erlebniswelten
B.6 Das Phänomen „Macht“
B.7 Der rationale Schleier als Kalkül
B.7.1 Mangelnde Entscheidungsbereitschaft und -sicherheit
B.7.2 Problemlösungsprozesse als Problemfall
B.8 Chancengleichheit - Fassettenvielfalt mit Hürden
B.9 Feindbildetiketten
B.10 Wenn Anonymität als Maske missbraucht wird
B.11 Kultur als Identitätsträger
B.12 Wenn Ethik als Fassadenbluff verkommt
B.13 Wenn Fassadenwelten zu Betrugsmanövern mutieren
C.
Persönliche Alltagserfahrungen
C.1 Menschen sind selten mit sich im Reinen
C.2 Macht, Gier und Neid
C.3 Beziehungskonflikte
C.3.1 Nähe und Distanz - ein Karussell der Gefühle
C.3.2 Im Sog familiärer Wechselbäder
C.3.2.1 Perspektivenwechsel
C.3.2.2 In Geiselhaft von Dominanzfallen
C.3.3 Wenn Eintönigkeit zur Gewohnheit wird
C.3.4 Wir sind verletzlicher, als wir glauben
C.3.5 Selbstisolation - Versteckspiel aus Verzweiflung
C.3.6 Lügen - Fassaden für Verschleierungen
C.3.7 Auf Denkfehlern beruhende Trugschlüsse
C.3.7.1 Zur Interdependenz zwischen Emotion und Vernunft
C.3.7.2 Rollenerwartungen - Konfliktfallen
C.3.7.3 Im Zwiespalt der Selbstoptimierung
C.4 Zusammenfassung
D.
Unternehmenswirklichkeiten
D.1 Stimmungsbilder aus der Unternehmenswelt
D.2 Identitäts- und Authentizitätsoptionen
D.2.1 Lernprozesse als Identitätsmechanismen
D.2.1.1 Lineare Denk- und Lernverknüpfungen
D.2.1.2 Interdependente Faktorverknüpfungen
D.2.1.3 Konsequenzen für Organisation und Management
D.2.2 Taktik und Strategie
D.2.2.1 Taktisch-strategische Blockadehaltungen
D.2.2.2 „Lean“ - ein richtungsweisender Fassadenkult?
D.3 Selfmanagement im Führungskollektiv
D.3.1 Milieu-Dominanz - ein weitverbreitetes Sicherheitspolster
D.3.2 Fassaden scheinbarer Objektivität
D.3.2.1 Mitarbeiterbeurteilungen
D.3.2.2 Kollektivmanöver als Entscheidungshilfe
D.3.3 Gewöhnungsbedürftige Rituale
D.3.4 Inszenierte Spielregeln - ein Führungsphänomen?
D.3.4.1 „Vererbte“ Arroganz
D.3.4.2 Informelle Kontakte - Impulsgeber für Networking
D.3.4.3 Ablenkung als Ausweichmanöver
D.3.5 Chefsessel - Orte der Unberechenbarkeit?
D.3.6 Götter in Weiß
D.4 Theoriegestützte Führungsempfehlungen
D.4.1 Konzepte und Modelle
D.4.1.1 Zielgerichtete Führung (MbO)
D.4.1.2 Kooperative Führung
D.4.1.3 Delegative Führung (MbD)
D.4.2 Situative Führung
D.4.3 Zusammenfassung
D.5 Zwischen Macht und Ohnmacht
D.5.1 Schattenseiten wirtschaftlicher Profitabilität
D.5.1.1 Der Wettbewerbsfaktor Zeit
D.5.1.2 Das Shareholder-Value Debakel
D.5.1.3 Konsequenzen
D.5.2 Eklatante Irrtümer
D.5.2.1 Win-Win-Situationen
D.5.2.2 Pläne sind häufig das Papier nicht wert, auf dem sie stehen
D.5.2.3 Images und Symbole - unterschätzte Spiegelbilder
D.5.2.4 Motivationsmodelle erzeugen nicht zwangsläufig Motivation
D.5.2.5 Interaktion findet überall statt, ohne dass es Allen bewusst ist
D.5.2.6 Führungsreife - im Zweifel ein Irrglauben
D.5.2.7 Investitionsträchtige Unruhestiftung
D.6 Transformationseffekte - des Pudels Kern
D.6.1 Vertikale Transformationseffekte
D.6.2 Horizontale Transformationseffekte
D.7 Konsequenzen für die Führungsarbeit
E.
Gesellschaftspolitische Perspektiven
E.1 Macht und Ohnmacht - Gesellschaftliche und politische Realitäten
E.2 Politisches Machtgebaren ist immer systemisch legitimiert
E.3 Ordnungspolitische Beziehungsgeflechte im Wettstreit
E.3.1 Rechtsordnung als rechtsstaatlicher Rahmen
E.3.2 Beziehungsgeflechte zwischen Wirtschafts- und Staatordnung
E.3.3 Selbst- und Mitbestimmung
E.3.4 Systemwettbewerb und Leistung
E.4 Fassetten politischer Visionen
E.4.1 Demokratische Ordnungssysteme - das Individuum im Mittelpunkt
E.4.2 Totalitäre Ordnungssysteme
E.4.3 Licht und Schatten zwischen Anspruch und Wirklichkeit
E.4.4 Schattenrisse in Klassengesellschaften
E.4.4.1 Das soziale Fundament
E.4.4.2 Bürokratie - ein ausufernder Fassadenpoker?
E.4.4.3 Systemwettbewerb im Sog der Weltpolitik
E.4.4.4 Bildung - Jedermanns Geheimreservat
E.5 Bildung - die gesellschaftspolitische Herausforderung
E.5.1 Staatliche Bildungsgänge
E.5.2 Betriebliche Bildungsaktivitäten
E.5.2.1 Betriebliche Weiterbildung ist nicht zwangsläufig erfolgreich
E.5.2.2 Strategische Ausrichtungen
E.6 Digitale Herausforderungen
E.6.1 Mediale Dilemmata
E.7 Eliten - für die Gesellschaft richtungsweisende Initiatoren
F.
Im Spannungsfeld wechselwirksamer Lebenssituationen
F.1 Zur individuellen Lebenssituation
F.1.1 Wirkungsketten zwischen Privatsphäre und Berufswelt
F.1.2 Die Öffentlichkeit im Blickfeld
F.2 Thesen aus Best-Praxis-Situationen
F.2.1 Kernprobleme im zwischenmenschlichen Miteinander
F.2.2 Schöpfe Deine Möglichkeiten besser aus und mach' mehr aus Dir
F.2.3 Optimiere Dein Persönlichkeitspotential
F.2.4 Es gibt selten Erfolg ohne Widerstand
F.2.4.1 Falls Du Verantwortung übernimmst, bereite Dich vor, nicht enttäuscht zu werden
F.2.4.2
Falls Du gesellschaftspolitisch interessiert oder engagiert bist, solltest Du wissen:
F.3 Präsentationstableaus als Mustervorlage für Situationsanalysen
F.3.1 Erstelle Dein Persönlichkeitsprofil
F.3.1.1 Dein aus dem Fließtext abgeleitetes Fragebrainstorming
F.3.1.2 Festlegung auf Kernfragen und methodisches Vorgehen
7
F.3.1.3 Bewerte Deine Kernfragen analog dem Basistableau:
F.3.1.4 Auswertung des Persönlichkeitstableaus
G.
Fragen und Fakten, die bleiben
A Vorwort
Menschen brauchen Reize jeglicher Art, über bestimmte Dinge nachzudenken. Wir sind abhängig von Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen und die unser Leben erleichtern oder erschweren bzw. in vielen Lebenssituationen steuern.
Die Intention dieser Trilogie entstand aus der Erkenntnis, dass man sich häufig von zunächst nicht erkennbaren Entwicklungen überrascht zeigt. Private und berufliche Alltagserfahrungen sind Vorboten für gesellschaftliche Auseinandersetzungen, wie sich auch umgekehrt gesellschaftliche „Selbstverständlichkeiten“ eingebürgert haben, die als Rahmenbedingungen unser Verhalten beeinflussen und bestimmen. Kaum jemand wird leugnen, dass es auch in seinem Leben bröckelnde Fassaden gab bzw. gibt, die es zu überwinden gilt.
Unter Fassade versteht man die Vorderseite eines Gebäudes. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind Fassaden ein für jedermann erkennbares Aushängeschild, das nicht erkennen lässt, wie es in einem selbst wirklich aussieht und was man denkt und empfindet. Im übertragenen Sinne definiert der Autor Fassaden als scheinbar glaubhafte Bilder oder Vorstellungen (Visionen) der Realität. Sie suggerieren meist positive Erwartungen und setzen Signale, die nicht immer der Wahrheit entsprechen.
„Im Schatten bröckelnder Fassaden“ beschreibt wahre Lebenswirklichkeiten und spiegelt Erfahrungen und Erwartungen, Gegebenheiten und Empfindungen als Überhitzungserscheinungen, die sich zu verunsichernden Situationen bis hin zu persönlichen Schicksalsschlägen entwickeln können. Nicht selten werden sie zu übertünchten Herausforderungen missbraucht. Manch ein Profiteur aus Business und Gesellschaft neigt zu diesem Kult der Übertreibung. Man fühlt sich damit vertraut oder empfindet es als beunruhigend. Je mehr Fassadenhürden zu überwinden sind, desto stärker wird der Wunsch, die vorfindlichen Gegebenheiten deutlich zu überstehen.
Fassaden produzieren auf der einen Seite Widerstände und auf der anderen Seite Vorbilder, die Verunsicherungen reduzieren, weil sie für die Zukunft ein Idealbild eines anzustrebenden neuen Zustandes darstellen. Fassaden lassen häufig den Alltag vergessen (z.B. Boulevardpresse). Je höher sie sind, desto größere Schatten werfen sie. Übertragen auf alltägliche Situationen ist niemand davon verschont. Die meisten Menschen müssen damit fertig werden, wollen sie nicht vom Strudel ihrer Empfindlichkeiten hinweg gespült werden.
Das eigentliche Übel ist der willkürliche Umgang mit vorbildbehafteten Ansprüchen und Erwartungen. Das eigene Ich hält häufig mit der Realität nicht Stand und erzeugt Unruhe und Ängstlichkeit. Es versinkt im Verborgenen! Solche Situationen müssen ertragen und getragen werden. Es gibt Tatsachen, die wir nicht wahrhaben wollen.
Freude, Herzlichkeit im Miteinander, innere Zufriedenheit und Harmonie sind nur wenigen Menschen vergönnt. Unser Tagesgeschehen wird über weite Strecken von Ungeduld und Oberflächlichkeit bestimmt. Im Alltag bläst uns häufig kalter Wind entgegen.
Je nachdem, in welche Familien man hineingeboren ist, spielen unterschiedliche private und gesellschaftliche Zwänge eine Rolle. Durch die vielen Rollen, die wir spielen, werden wir konfliktanfälliger. Anpassung ist Ausdruck für Erlebnisvarianten, von denen jedem Leser einige - wenn nicht sogar viele - bekannt sein werden. Anpassung ist die wichtigste Fähigkeit aller Lebewesen dieser Welt.
Rolf Ganzen1 beschrieb als Phänomen vieler Menschen, dass sie „lügen, heucheln, nach dem Mund reden, buckeln, gekünstelt lächeln“ usw.
Solche Verhaltensformen gewinnen eine Art Selbstmacht und bewirken Anpassungszwänge mit sich ergänzenden Einordnungsritualen. Die Menschen werden mit Ängsten groß. Selbst Religionsgruppierungen machen bereits in jungen Jahren deutlich, was Obrigkeit bedeutet. Menschen fügen sich gemeinsam in die Massengesellschaft ein und wollen mit ihr verschmelzen.
Wer sich anpassen kann, gehört zu den Gewinnern. Ein Mindestmaß an Anpassung wird es immer geben. Überlebensnotwendiges Anpassungsverhalten bewirkt oftmals hektische Ungeduld, die uns ergreift. Man glaubt, sich nach scheinbar erfolgreichen Menschen richten zu müssen und im Umgang mit ihnen auf kein Thema verzichten zu dürfen. Bei Erfolgen entwickeln sich Motivation und Identität mit einhergehendem Vertrauen. Nicht selten führt übertriebenes Anpassen in Form blinder Unterwürfigkeit zu abnehmender Kritikbereitschaft (Kritikfähigkeit) - bei Misserfolgen, Enttäuschungen und Verunsicherung bis hin zu kontraproduktivem Verhalten und emotionaler Aggressivität.
Leider macht man sich zu selten Gedanken oder will sich keine Gedanken darüber machen, dass der Ausgangspunkt für aktuell empfundene Entwicklungen - lange bevor er sich bemerkbar macht - in der Vergangenheit liegt. Sich damit nicht rechtzeitig auseinanderzusetzen, ist ein folgenschwerer Fehler.
Schattenbilder verlieren und lösen ihr verdecktes Rollenverhalten durch befreiende Echtheit im Umgang mit der Komplexität des Alltags und mit uns selbst. „Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden“ (Heinz Rühmann). Man sollte über seinen eigenen Schatten springen können!
Wenn auch der Begriff Fassade von den meisten Menschen negativ besetzt ist, können Fassaden durchaus auch beabsichtigte positive Wirkungen beispielsweise auf Visitenkarten oder auf vom Zwang zur Schönheit dominiertem persönlichem Behübschen hervorrufen. Auf Aufmerksamkeit gerichtete und nach Möglichkeit erwartungsvolle Reaktionen sei hingewiesen. Sie behübscht sich und geht zum Frauentreff; er behübscht sich und geht zum Herrentreff. Auch Vermarktungen von Filmgrößen oder Produkten sind nichts Anderes als fassadenwirksame Vorgaben, um optisch etwas zur Erlangung der Aufmerksamkeit darstellen zu können. Imagebilder beherrschen die Szenerie. Auch die Optimierung des Körpers wird zu Fassade.
Die eigentliche Fassade eines jeden Menschen ist sein ihm anhaftendes Image, seine Ausstrahlung, seine Wirkung auf Andere. Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, eine ihnen von Natur mitgegebene aufmerksamkeitswirksame Aura zu vermitteln. Ihre Ausprägung weist auf bestimmte Charakterzüge als Persönlichkeitsmerkmale, die in „Schatten bröckelnder Fassaden“ analysiert werden. Man gewöhnt sich sehr schnell an den Horizont vielschichtiger Fassetten.
Der Autor möchte das Unvernünftige, Irrationale und Triebhafte aufdecken, das sich unter einer Oberfläche von scheinbar rationalen, wohl durchdachten Strukturen verbirgt. Das Leben ist kompliziert genug. Häufig passiert auch Undenkbares. Deshalb soll „Im Schatten bröckelnder Fassaden“ Menschen bewegen, über sich selbst stärker nachzudenken, um auf ihre jeweiligen Lebenssituationen ehrlicher zu reagieren. Der (die) Leser(in) wird sich schnell an sich selbst erinnern. Das ist spannend und macht neugierig.
Wenn man auch für die Vielzahl täglich anstehender Probleme keine für jedermann gültigen Lösungen aufzeigen kann, so ist doch eine gute Analyse bereits die halbe Therapie, um die Lebenswirklichkeit mit ihren Fallstricken besser verstehen und bewältigen zu können. Selbstwirksame Lösungsansätze sollen einen Schlüssel zum Erfolg aufzeigen!
„Im Schatten bröckelnder Fassaden“ ist das Ergebnis aus vielen Gesprächen und persönlichen Erlebnissen des Autors mit Menschen aller Couleurs. Diese Gespräche spiegelten eine Sehnsucht nach Offenlegung von Lebenserfahrungen und verborgenen Wahrheiten.
Niemand kann vor seinen Gefühlen fliehen. Der Autor will keine Irritationen auslösen, sondern Gedanken auf erlebte und erlebbare Lebenswirklichkeiten richten. Es mag sein, dass manch ein(e) Leser(in) unmittelbare Situationsbeschreibungen nicht wahrhaben will - als Ziegelsteine sind sie nicht gedacht.
Der Verfasser hofft, in seiner Einschätzung unterschiedlicher Erlebniswelten realitätsnah an die Wahrheit zu kommen, um ggf. auch persönliche Grenzen des Machbaren verschieben zu können.
Er dankt insbesondere Jens Kreykenbohm für seine ergänzenden Anregungen sowie allen Gesprächspartnern für ihre Bereitschaft zum Dialog - auch jenen wenigen, die Orientierung gaben, ohne es wirklich gewollt zu haben.
1 Deutschlandfunk Sendung „Freistil“ am 22.09.2019
B Realitäten, denen man sich nicht verschließen darf
Der Betrachtungshorizont von Themen und Problemen wird umso größer, je stärker man sich der Wirklichkeit annähert.
B.1 Angst - der schlimmste Fallstrick
Angst ist eine natürliche Reaktion auf einen ungewissen Ausgang anstehender Ereignisse. Veränderungen produzieren Verlierer und stiften Unruhe (z.B. Digitalisierung, Unternehmensübernahmen usw.). Wenn wir uns ängstigen, eine belebte Straße zu überqueren oder einen Menschen zu verlieren, empfinden wir natürliche Ängste im Sinne eigenen Selbstvertrauens. Was immer wir unternehmen, entscheiden und fühlen, es ist häufig mit Ängsten verbunden.
Leugnen Menschen ihr Vertrauen zu sich selbst und orientieren sich an Fassadenwelten - also außerhalb ihrer eigenen Authentizität, dann klopfen Ängste von außen an und bringen Unsicherheit und Widerstände mit sich. In vielen Fällen führt unser inneres Gefühl in die Eigenverantwortung, wenn man beispielsweise eine Freundschaft oder im Krankheitsfall eine Chemotherapie ablehnt.
Darüber hinaus ist Angstmacherei von außen häufig ein Spiel, Werte und Gefühle zu manipulieren und nicht selten zu zerstören. Es gibt kein besseres Geschäft als das mit der Angst. Wissend, dass Menschen für von draußen kommender Angst anfällig sind, bringt man ihnen so viel Angst bei, dass sie anschließend das vollziehen, was ihre „Anstifter“ wollen - beispielsweise Landabgabe für Reinwaschen sündigen Verhaltens vor Jahrhunderten. Auf vergleichbare Weise entstandener psychischer Druck ist heute der Krankheitserreger schlechthin, der ständig an einem nagt, sobald man das Vertrauen zu sich selbst verloren hat.
Die naturgegebene Angst ist eine Reflektion unserer inneren Empfindungen und Gefühle, durch die wir emotional gehen. Angst, Einsamkeit und Hoffnung verbinden sich und bestimmen unsere Empfindungen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Eine Häufung „suggerierter Ängste“ schaltet unsere natürlichen Reflexe ab und macht uns a la longue kaputt.
B.2 Das Phänomen Identität hat viele Fassetten
Identität ist Gleichsetzung und Schaffung von Gleichheit mit Personen, Zielen, Aufgaben und Handlungen. Um Identität zu schaffen bzw. auszubauen, bedarf es der Pflege vorangegangener und fortlaufender Identifikationsprozesse und der Arbeit am Image. Zur Identität gehört das kulturelle Selbstvertrauen. Identifikation ist der Prozess hin zur Identität. Dabei spielen die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten eine besondere Rolle. Es geht um grundsätzliche Verhaltensweisen, die in ihrer Verschiedenartigkeit und ihren Wechselwirkungen auf Dauer angelegt sind. Identität ist immer Antrieb für persönliches Engagement! Weder als Privatmann, Mitarbeiter oder Chef sollte man Schuldmanagement betreiben.
B.2.1 Zur privaten Erlebniswelt
Als Privatperson wird man stets von Aktion und Reaktion, Stabilität und Instabilität sowie Eigen- und Fremdsteuerung herausgefordert. Modehäuser oder attraktiv beworbene Produktneuheiten sind Brutstätten für die Entdeckung vielfältiger Identitäten.
Beispielsweise sorgen in der Öffentlichkeit stehende Damen (Ansagerinnen) durch Veränderung ihres Outfits (übertrieben verlängerte Haarsträhnen) für den besonderen „Kick“. Nicht wenige Nachahmerinnen sehen darin ihre neue imagefördernde Identität. Gleiches gilt aus Herrensicht für die Autoindustrie. Ähnliche Effekte werden mit allgemeinen Produkten wie Dessous, Hygiene, Kleidung usw. verfolgt. Werbung lebt von Blendwerken der Illusion und deren Wirkungseffekte auf das Nachfrageverhalten der jeweiligen Zielgruppen. Man ist größtenteils nicht in der Lage, sich der Mode zu entziehen. Passt man sich den Verkaufsstilen an, weil man auf sich aufmerksam machen will oder als Frau begehrlich sein will, dann wird Mode zur Maskerade für ein neuartiges Lebensgefühl und raubt wirkliche Individualität. Man bildet sich ein, wie man auszusehen hat. Wenn der Jugend entwachsene Damen mit aufgeschlitzten Hosen herumlaufen, deutet das auf eine erhoffte verjüngende Wirksamkeit ihrer angenommenen Fassadenwelt hin.
Der geniale Trick vieler Modemacher: Man ist nicht nur an der Findung, sondern auch an der Entstehung und Weiterentwicklung seiner eigenen Identität beteiligt, indem man Produktanbieter „beteiligt“ und sich in deren Abhängigkeit begibt.
Im Gegensatz zu diesen eher extrovertierten Identitätswirklichkeiten äußern gesundheitlich geschwächte oder kranke Menschen eine vollkommen andersartige Identitätsgefühligkeit. Insbesondere schwerkranke Menschen und deren Familien erzeugen Ängste. Wenn der Strom an Schicksalsschlägen (Herz-Op, Schlaganfall, Brustkrebs usw.) nicht nachlässt, fragt man sich schicksalsbetroffen, „wann das denn einmal aufhört“?
Die Mehrheit dieser Menschen neigt offenbar dazu, ihre Identitätsbefindlichkeit nach dem Motto „Ich lasse mir Nichts anmerken“ zu zerstreuen, obwohl alle Familienmitglieder darunter leiden. Man lebt eine Identität vor, die nicht der Wirklichkeit entspricht. In vielen Fällen bzw. nach Schicksalsschlägen ist es in unserer Gesellschaft immer noch üblich, diese zu verheimlichen und nicht darüber zu sprechen. Das passiert oft innenfamiliär, aber vor allem auch nach außen hin. Das Resultat ist wieder eine Fassade.
B.2.2 Zur beruflichen Erlebniswelt
In der Businesswelt ist die Eingangstür zum Erfolg Identität, Souveränität und Integrität.
Wer als Führungskraft souverän sein will, muss u.a. Qualifikationen seiner Mitarbeiter erkennen und anerkennen und sich damit auch ernsthaft auseinandersetzen können. Ziel derartiger Aktivitäten ist es, Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu identifizieren bzw. eine Motivation aufzubauen, um eine stärkere emotionale Bindung und Vertrauen zu schaffen.
Aus der Unterschiedlichkeit der Unternehmen und ihrer jeweiligen Organisation lassen sich unterschiedliche Identitätssegmente ableiten. Unternehmenssolidarität Führungssolidarität, Abteilungssolidarität, die Solidarität unterschiedlicher Hierarchieebenen und Teamsolidarität sind Sinnbilder unterschiedlicher Identitäten. Eine Wertpapierabteilung wird sich sehr vom Identitätsverständnis einer Kreditabteilung unterscheiden. Aus Sicht jedes Einzelnen werden Motivation und Identität sehr verschieden empfunden. Dagegen ist aus Sicht der Unternehmen Einheitlichkeit und ein gemeinsamer Weg, der eine gewisse Kontinuität aufweist, erstrebenswert, um eine gemeinsame Identität - sprich ein familiäres „Wir-Gefühl“ - zu erschaffen und zu erhalten.
Allerdings liegen häufig Welten zwischen den Interessen der Manager und den Themen, die Mitarbeiter bewegen. Damit stellt sich die Frage, wieweit alle Beteiligten „an einem Strick“ ziehen und ein einheitliches Erscheinungsbild verkörpern können. Führung wird dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, unterschiedliche „Identitätsmerkmale“ in Einklang zu bringen.
B.2.3 Zur gesellschaftspolitischen Erlebniswelt
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien dienen Staaten zur Aufrechterhaltung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Systems. A la longue kann das nur gelingen, wenn die Bürger dahinterstehen und sich mit dem System identifizieren - wenn nicht, wird der Versuch unternommen, es stimmig zu machen. Erschwert wird diese Entwicklung allerdings in demokratischen Ordnungssystemen durch die dort vorherrschende Meinungsfreiheit. In den letzten Jahren kam es in Deutschland zu Absplitterungen einzelner Gruppen wie beispielsweise den sog. Reichsbürgern. Insbesondere in Demokratien kann es auf jeder Ebene auch immer zu Unterwanderungen des Systems kommen.
Nicht ohne Grund werden in autoritär geführten Staaten Verhaltenserwartungen vorgegeben und identitätswirksam eingehämmert. Dem Volk wird eine Zwangsjacke als Maulkorb verordnet. Da die Bevölkerung meist über Generationen hinweg nichts Anderes gesehen und kennengelernt hat, wird sie sich damit arrangieren (müssen) und womöglich am Ende des Prozesses von ihrem System sogar überzeugt sein und sich schließlich damit identifizieren - eine erfolgreiche „Gehirnwäsche“.
Wer dagegen ist, der muss seine Überzeugungen stillschweigend als persönliche Identität mit sich tragen. Der Identitätenschwindel wird letztendlich als Normalität ertragen. Vergleichbare Vorkommnisse treffen - wenn auch in unterschiedlich abgemilderter Form - für alle Staatsformen zu. Die Vielfalt gelebter Identitäten in aller Welt - also auch in Demokratien - wird uns täglich vor Augen geführt.
B.3 Im Fassadenrausch von Zeit und Geschwindigkeit
Mehrheitlich beschleicht Menschen das Gefühl, etwas verloren zu haben, was sie nie wirklich hatten - ausreichend Zeit. Im Umgang mit der Zeit wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Gewinnt dabei wirklich jeder Einzelne am Schluss für sich selber oder gewinnt er für ein System? Kann man hier nicht eine gewisse Korruptheit nachweisen? Jeder begründet sich aus seiner Realität bzw. aus der von der Gesellschaft oder anderen Systemen (Regularien) vorgegebenen Realität.
Jeder erlebt auf seine Weise Stress. Private u./o. berufliche Zwänge sind die Ursache. Man hetzt von Aufgabe zu Aufgabe, von Termin zu Termin. Man bemüht sich, sein Verhalten über die Zeit zu begründen und ist dabei, sich selbst zu ignorieren, um meist Anderen zu gefallen oder dem vorgegeben Stress gerecht zu werden., Nicht selten drücken sich Menschen vor neuen Aufgaben mit der Begründung, sie hätten keine Zeit, um einen gewissen Selbstschutz (Fassade) für sich aufrecht zu halten. Gelingt dieser Selbstschutz wirklich oder belügt man sich selber? In Wirklichkeit haben viele Menschen eine Menge Zeit und nutzen sie als willkommene Ausrede. Der Umgang mit der Zeit ist immer stärker interessengeleitet. Die Folge ist, schlechter mit der Ressource Zeit umzugehen. Oft fehlt ein weitreichender Blick, um weitere Konsequenzen abzuschätzen.
Der Umgang mit der Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Gesellschaft ist gespalten in diejenigen, die für sich Recht und Handeln in Anspruch nehmen - jenen, die sich einfach über vieles hinwegsetzen und prinzipiell aus ihrer Natur heraus ,,die Schuld immer bei Anderen suchen und denen, die davon betroffen sind und sich anpassen (müssen). Die Einen klagen die Anderen an und umgekehrt. Die vermeintlichen Gewinner sind überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns und versuchen, auf ihre Art die Masse fremd zu bestimmen. Dabei avanciert Geschwindigkeit zum Maßstab für das allgemeine Zeitempfinden. Sie bestimmt den privaten wie auch beruflichen Alltag und führt zu teils überhasteten Entscheidungen. Nach dem Motto „je schneller, desto besser“ soll Geschwindigkeit (an Lautstärke zunehmende schnellere Sprechgeschwindigkeit, tendenzielle Verkürzung ganzer Sätze, unverständliche Wortwahl usw.) Handlungsfähigkeit und Souveränität vermitteln. Die Zeit ist immer gegenwärtig. Sie drängt sich auf, sie wird genutzt und benutzt und zerbröselt doch wieder wie ein Sandklumpen im Wasser.
Alltägliche Floskeln wiederholen sich im üblichen Begrüßungsritual beispielsweise mit der Nachfrage nach dem Befinden eines Menschen. Alles andere als „Danke gut“ will man nicht hören. Eingeübte Verhaltensfloskeln sind zeitverkürzende Regeln im gegenseitigen Umgang. Frage und Antwort werden im Lichte der gewohnten Optik gefiltert.
Vergleichbare Rituale bestimmen das berufliche und gesellschaftliche Umfeld. In vielleicht stärkerem Ausmaß neigt man dazu, sich besser darstellen zu wollen als man in Wirklichkeit ist. Man möchte nicht durchschaut werden, sondern die Optik verbessern, indem man sich von der Mehrheit zu unterscheiden versucht bzw. das Abstandsgefälle als gängiges taktisches Blendwerk zum Schutz für die eigene Person nutzt.
„Gewinner“ bevorzugen den Zeitfaktor als Vorwand für Entscheidungen und geplante Vorhaben, während sich „Verlierer“ den Gegebenheiten unterwerfen und anpassen. Entstehender Druck auf beiden Seiten sowie die Gewöhnung daran reduziert gegenseitige Wertschätzung, die zwar in Sonntagsreden symbolträchtig gepriesen wird, in der Realität jedoch sehr selten aus Zeitmangel ge- und erlebt wird. Sogar Werte, Regeln und Normen werden als Fassaden missbraucht.
Beispielhaft sei ein Mitarbeiter erwähnt, der seinen Vorgesetzten um ein Gespräch bittet. Die Antwort des Vorgesetzten, er habe bis zum Aufzug Zeit, da er gerade auf dem Weg zu einer Sitzung sei, ist eine unverfrorene zeitbegründete Pseudoablehnung.
Ein weiteres spannungsbeladenes Verhältnis zwischen Unternehmensleitungen und Mitarbeiter(innen) ergibt sich aus dem Umstand, dass Unternehmen nicht selten ihre Gewinnsituation durch Personalabbau zu verschönern versuchen. Die anfallenden Arbeiten des ausgeschiedenen Personals müssen meist im gleichen Zeitrahmen wie bisher vom verbleibenden Personal bei gleichem Lohn übernommen werden. Solche Umbrüche vollziehen sich meist in rasantem Tempo, was zu Demotivation und unverhohlener Abneigung führt.
Zeit und Geschwindigkeit prägen menschliches Verhalten. Vor Wahlen wird häufig Vieles versprochen, was nach den Wahlen nicht gehalten wird. Man baut darauf, dass Zeit schnell vergessen lässt. Aufsteiger in Beruf und Gesellschaft versuchen, Unsicherheit zu vertuschen, indem sie sich extrem dominant, arrogant und kurzatmig geben, sich also aus ihrer Warte schnelllebig überhastet zeigen.
Im Spannungsfeld zwischen Sein und Schein, zwischen Dominanz und Laissez fair, zwischen Stress und Unstress werden Zeit und Geschwindigkeit zu Fassadenwirklichkeiten. Dabei kommen meistens die Menschen zu kurz, die Aufmerksamkeit verdient hätten. Häufig sind dies die eigenen Familien.
B.4 Authentizität - Die Kunst, echt zu sein
In Anlehnung an Karl Jaspers2 ist ein Phänomen von Menschen, Sehnsucht nach Wahrheit zu haben und authentisch zu sein. Authentizität bedeutet Echtheit, sich mit sich selbst identifizieren können und auch nach außen entsprechend stimmig wirken.
B.4.1 Der Wahrheit verbunden bleiben
Es gibt kaum einen Menschen, der nicht mit sich selbst, seinen eigenen Problemen oder auch Problemen seines Umfeldes (z.B. Arbeit, Sozialleben) hadert. Wer möchte in seinem Innersten nicht frei sein von Kriegsschauplätzen persönlicher Auseinandersetzungen mit emotionalen Rollenklischees und Geschlechteridentitäten? Daraus abgeleitete äußere Anfälligkeiten spielen eine besondere Rolle und bestimmen unser Alltagsverhalten.
Manchmal scheinen Probleme so groß zu sein, dass man sich bewusst in Lügen verstrickt, da die Angst gegenüber Dritten - aber auch mit Personen aus dem vermeintlich engen Vertrauenskreis, Gespräche über die eigene Problematik undenkbar macht. Man lügt sich sehr schnell etwas vor. Zwischen Lüge und Wahrheit kann kaum noch unterschieden werden. Nicht selten erscheint die Kraft der Lüge als beruhigende Selbsttherapierung. Dennoch wird es immer auch Momente der Wahrheit geben!
Je stärker wir uns Fassadenkulturen beugen, desto abhängiger werden wir oder sind wir bereits. Mit der Zeit verlieren wir unsere geistige und mentale Bewegungsfreiheit. Warnsignale erkennen wir schon nicht mehr. Wir stürzen uns in gängige Verhaltensfloskeln und glauben daran. Dabei nehmen wir an der großen Flucht vor uns selbst teil, weil es eben die Anderen so machen. Die meisten von uns hat diese Veränderung erfasst. Nicht selten bestimmt die emotionale Überfrachtung aus der Vergangenheit unsere gegenwärtige Verfremdung bis in die Zukunft hinein.
Wer diese Wahrheit nicht erträgt, vergreift sich an seiner persönlichen Erlebniswelt. Deshalb sollte es das Ziel eines jeden Menschen sein, mit der Wahrheit besser umzugehen und sie vor alles Andere voranzustellen. Viele werden das höchstwahrscheinlich nicht annehmen, da für sie Macht und Ruhm mehr bedeuten als die Wahrheit. Bei ihnen ist die Vernunft übermütig und führt in Formen egoistischer Knechtschaft, weil sie ihre Triebe und Neigungen nicht überwinden können. Hinter erlogenen Fassaden schaukeln sich häufig Situationen hoch, die Schattenbilder mit falschen Aussagen erzeugen.
Damit fertig zu werden, setzt voraus, mit der eigenen Betroffenheit umgehen zu können, um die Chance zu sich selbst zu öffnen und zugleich die Wahrnehmung der Wahrheit der eigenen Wirklichkeit zu ermöglichen.
Man sollte nicht nach den ersten, vielleicht nicht gelungenen Versuchen aufgeben, sondern durchhalten! Man muss um die Wahrheit ringen, um mit sich selbst zufrieden und im Reinen zu sein. Es macht Sinn, in verfänglichen Situationen lieber nichts als die halbe Wahrheit zu sagen oder zu lügen, Der ehrliche Umgang mit der Wahrheit überwindet die Abhängigkeit von Fassadenwelten.
B.4.2 Authentizitätsmerkmale und Risiken
Authentizitätsmerkmale sind Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit. Wir deklarieren häufig etwas als Wahrheit, was so nicht wirklich erlebt und gelebt wird - wohinter wir uns jedoch gerne verschanzen. Wahrnehmung und Wirklichkeit können weit auseinanderliegen. Das führt zu Unsicherheit, weshalb jeder seine eigene Wahrnehmung hinterfragen und erforschen sollte, was allerdings die wenigsten Menschen wirklich machen.
Es ist wichtig, zu wissen, was man unter Authentizität versteht und was Authentizität bei anderen Menschen bewirkt. Die persönliche „Ausstrahlungskraft“ und das „Ansteckungspotential“ eines Menschen spielen insbesondere in Situationen mit Problem- oder Veränderungspotential eine Rolle. Das bedeutet auch, sich öffentlich zu machen gegenüber Risiken und möglichen Anfeindungen, die damit verbunden sein können.
Wer als Mensch respektiert wird, der wird immer etwas von sich einfließen lassen. Diese Offenheit findet allerdings ihre Grenze, sobald ausschließlich Fassaden das Bild prägen und an der Wirklichkeit vorbeiziehen.
Im Kern geht es nicht darum, was Recht und Unrecht ist. Es geht um die Wahrnehmung von Wahrheit. Sie wird nicht allein durch vorgegebene und offiziell „festgeschriebene Inhalte“ bestimmt, sondern von dem, was in uns als persönliches Wahrheitsempfinden angelegt ist und wo wir zu einer Antwort kommen - also was man dazu empfindet und was man daraus macht, wie man darauf reagiert und wie man damit umgeht. Glaubwürdigkeit macht die Persönlichkeit eines Menschen aus. Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen über die Dinge sind persönlich gefühlte Wahrheit. Dabei wirken sich verändernde gesellschaftliche Werte und Normen auf das Verhalten ein und bestimmen uns.
Die Orientierung an Werten und Normen hat nicht unbedingt etwas mit Menschenfreundlichkeit zu tun. Hier geht es um ein bestimmtes Steuerungskonzept, das auch als riesige Manipulation missbraucht werden kann. Manchmal müssen wir lange auf das Ergebnis dieser Wahrheit warten.
Unser persönliches Ich - die eigene Wahrheit steht häufig im Widerspruch zu deklarierten Wahrheiten. Man hegt Zweifel. Haben kirchliche Würdenträger noch nie an ihrem Gott gezweifelt? Man kann es kaum glauben. Zweifeln nicht auch die Gläubigen, für die es schwierig sein wird, persönliche Zweifel vom Glauben abzustreifen? Der Mensch ist menschlicher als viele Dogmen, die ihm vorgegeben werden (z.B. Abtreibung missgebildeter Föten). Wie weit man sich dabei nach außen zu erkennen gibt, hängt vom Selbstverständnis und Selbstbewusstsein ab.
Auch wer nicht an Gott glaubt, bedient sich dennoch gewisser Werte, die in allen Völkern aus deren religiöser Kulturgeschichte abgeleitet werden. Die verschiedenen Texte und Legenden, die im Laufe der Zeit (-geschichte) in die Bibel eingegangen sind und zur Mystik wurden, ermittelten Werte und Normen zu etwas zeitlos Gültigem, zu erstrebenswerten Leitbildern in Form von deklarierten Glaubenswahrheiten als anzuerkennender Verhaltenskodex und/oder Wertemaßstab. Teilweise wurden Schöpfungsmythen als Symbolsprache zu „ritualen Wahrheiten“ erhöht, an denen man sich zu orientieren hat, und die auch heute noch gelten. „Man kann nur ins Morgen schauen, wenn man das Gestern verstanden hat bzw. versteht“ ist die gängige Vorstellung; aber nicht die erkennbare Wirklichkeit, sondern eine Utopie. Jede Religion sucht ihre Mystik zur Unterstützung und Festigung ihrer mentalen Identität.
Dabei werden Utopien gerne als erstrebenswerte Ziele empfunden und hochsterilisiert. Die Wirklichkeit jedoch zeichnet sich durch Standards aus. Standards sind zwar auch Ziele, die man aber nicht aufgibt. Ziele kann man niedriger setzen, Standards nicht.
Sogar bei Kindern bedient man sich zur Vermittlung von „Werten und Normen“ oft mit Märchen (Bsp., Gebrüder Grimm)
Meist werden jedoch negative Aspekte zur Vermittlung von bestimmten Werten hervorgehoben, weil es dem Menschen an sich leichter fällt, einen negativen Aspekt in einen positiven Wert umzuwandeln.
Manchmal ersticken wir sogar an unserer Moral, weil Fassaden im Widerspruch zur inneren Befindlichkeit stehen. Moral kommt nicht aus dem Verstand. Dennoch werden häufig über die Moral als scheinbarer Wertemaßstab verstandesmäßige Erwartungen angesprochen und übergestülpt. Schaut man sich alltägliche Gesetzmäßigkeiten und das Leben in seiner Gänze an (sofern man dazu überhaupt in der Lage ist), dann scheint hinter Allem eine lenkende Intelligenz zu sein. Die Moral jedoch ist weniger eine Kopfkreation als vielmehr das Ergebnis aus gefühlvollen Empfindungen.
Normen und Werte, Kultur und Ideologien sind Bollwerke, die Menschen für sich ausnutzen oder hinter denen sie sich verstecken. Die oft beschworene heile Welt (Fassade) ist häufig gar nicht so heil! Viele hochsterilisierte Reden entpuppen sich als hohl und verlogen. Ethische, kulturelle, religiöse Werte und Normen versiechen zu Fassaden, wenn sie zu Eigennutz missbraucht werden.
Die Realität ist immer das, was wahr ist bzw. was jeder Einzelne als wahr empfindet. Wer glücklich und zufrieden sein will, der sollte den Versuch nicht aufgeben, der Vielfalt wahrer Werte und Normen zu entsprechen. Er muss sozusagen zur Wirklichkeit erwachen. Die Wahrheit sollte Vorrang vor allen persönlichen Prioritäten haben!
B.4.3 Mut, sich zu riskieren
Um seinen Alltag bewältigen zu können, muss man sich in vielerlei Hinsicht immer wieder neu entscheiden. Ist man sich nicht sicher, wie eine Situation ausgeht, ist jede Entscheidung ein Wagnis, das gerne in der Hoffnung ignoriert wird, die vorhandene Situation nicht verändern zu müssen. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, im schlimmsten Fall keine negative Kettenreaktion auszulösen und selbst nicht in Erklärungsnot zu geraten. Dienlicher als Entscheidungsblockaden ist Mut, sich zu riskieren. Eine Entscheidung ist immer eine Erleichterung - man schiebt Nichts mehr vor sich her.
Mut ist eine Haltung und Eigenschaft, die eine nüchterne Sicht der Dinge gibt und gleichzeitig etwas Emotionales entfacht. Entscheidend ist die Willenskraft jedes Einzelnen, aus der heraus sich Mut entwickeln kann. Jeder möchte näher zu sich selbst sein, um zu spüren, was er will, worauf es ihm ankommt, wofür er sich einsetzt? Mut ist ein Gespür dafür, wie sich eine Situation entwickelt und wie belastbar man ist. Dabei ist es egal, ob eine getroffene Entscheidung aufgeht oder nicht.
Trotz Furcht vor Offenlegung der eigenen Situation und/oder der eigenen Meinung ist es ein Geschehen mit offenem Ausgang.
Sosehr man ein auf sich selbst bezogen positives Image zu pflegen versucht, fühlt man sich dennoch oft mutlos. Wie geht man damit um, wenn man in seiner Mutlosigkeit Angst hat? Dinge nicht wirklich schaffen zu können, ist nicht schön und macht wenig Sinn. Menschen dürfen sich nicht verlieren in ihrer Mutlosigkeit!
Mutig sein bedeutet, dass man sich für eine Aufgabe, ein Ziel oder einen Menschen in die Waagschale wirft. Für ungewisse Situationen braucht man Mut zur eigenen Verwundbarkeit3. Auf diese Art eröffnet man sich die Chance zu erhoffter Überwindung von Problemen und deren Anfälligkeiten. Das wiederum führt sehr schnell zu Übertreibungen, die sich zu dem Problem schlechthin (z.B. einer neuen Beziehung) entpuppen. Und genau das ist das eigentliche Problem.
Viele Menschen sind damit beschäftigt, sich ihren Ängsten zu stellen, Um damit besser fertig zu werden, müssen Stolpersteine überwunden werden. Angst lähmt und ist kein guter Motivator. Es ist eigentlich nicht schlimm, Angst zu haben; schlimm aber ist, wenn die Angst Einen hat. Wie fasst man Mut, mit der Vielzahl der auf uns einwirkenden Situationen und Fassaden fertig zu werden?
Die Bereitschaft, sich zu riskieren, ist Ursprung für ersehnte Erfahrungen. Jede Entscheidung ist ein Wagnis. Spreche ich in einer Beziehung ein Tabuthema an oder nicht? Spreche ich bei einem Menschen seine Schwierigkeiten an, ohne zu wissen, wie er darauf reagieren wird. Das sind Situationen, in denen man sich riskiert, sich ins Spiel bringt und auf ein Geschehen mit offenem Ausgang einlässt. Deswegen braucht es immer wieder mutige Schritte, sich selbst in die Hand zu nehmen und seine intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten zu nutzen.
Wer immer nur Angst hat, wie er bei anderen ankommt oder ob er alles überhaupt gut genug kann, der wird nichts Neues machen. Der Mut, sich zu riskieren, unperfekt zu sein, sich zu zeigen, öffnet die Tür zur eigenen Zufriedenheit und Freundschaft mit Anderen. Angst vor Verwundbarkeit sperrt Menschen ein. Wer auf Dauer die Zentralverriegelung Angst aktiviert und Niemanden an sich heranlässt, führt ein sehr einsames Leben.
Der erste Eindruck im Umgang mit Menschen löst immer Gefühle aus. Wehre aus Deinem Unterbewusstsein entspringende Vorurteile ab und gönne Dir die Chance einer Revision!!
Für ungewisse Situationen und Befindlichkeiten braucht man das Wissen, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur Regeneration in sich trägt. Diese Gewissheit mag Trost gegen zu frühe Resignation sein. Scheitern wird häufig als Makel angesehen. Wenn etwas schief geht, nimm dennoch den nächsten Anlauf. Auch wenn man den Sieg nicht mehr im Auge hat, sollte man den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Hab' Vertrauen in Dich selbst! Drücke Dich nicht vor Verantwortung und Risiken! Aus Unsicherheit sind noch nie Zuversicht und Freiheit hervorgegangen. Löse Dich von Deinen eigenen Fesseln und überwinde Sturheit und Starrsinn!!
Mit sich selbst fertig werden setzt voraus, positiv mit der eigenen Betroffenheit umgehen zu können, den Mut aufzubringen, frühzeitig genug dialogfähig zu sein und die Dinge nicht schleifen zu lassen. Selbstmotivation ist ein wesentlicher Bestandteil menschlichen Handelns. Was immer man denkt oder fühlt, es gibt Nichts im Leben, was nicht auch eine positive Seite hat! Wenn man sich aus Enttäuschungen u/o. Misserfolgen als Verlierer fühlt, sollte man dennoch ernsthaft darüber nachdenken, auch daraus etwas Sinnvolles abzuleiten und zu machen!
B.5 Interdependenzen - Grundlage für Entwicklungen unterschiedlicher Erlebniswelten
Lebensräume unterscheiden sich in der unterschiedlichen Ausrichtung ihrer wechsel-seitigen Motivations- und Identitätstiefen.
Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Lebensräumen zu diskutieren macht nur Sinn, wenn sie auf die „Lebensführung“ der Menschen ausgerichtet sind. Wie weit beeinflusst die Privatsphäre den beruflichen Erfolg und welchen Einfluss übt das Berufsleben auf das Privatleben aus? Das trifft in gleicher Weise für unseren Umgang mit der Gesellschaft zu, in der wir leben und mit der wir uns arrangieren.
In allen Lebenswirklichkeiten unterscheiden sich Menschen und grenzen sich voneinander ab. Wissen, Fertigkeiten und affektive Besonderheiten machen den Unterschied aus. Eliten bilden sich und werden zu Vorbildern, an denen sich die Mehrheit ausrichtet. Man kommt einfach nicht an der Realität vorbei, dass Eliten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass Elitisierung in jeder Hinsicht (Privat-, Berufssphäre und Gesellschaft) distanzierende Mehrklassenideologie verfestigt.
Ausschließlich einseitig private, berufliche oder gesellschaftspolitische Fixierungen machen wenig Sinn und sind schädlich für das Zusammenspiel unterschiedlicher Lebensräume. „Im Berufsleben ist unser Blick geschärft für das Entdecken von Chancen. Im Privatleben erkennen manche nicht einmal, dass es hier überhaupt so etwas gibt wie Chancen.“4 Auch gesellschaftspolitische Zwänge können das Privat- und Berufsleben beeinflussen und sogar zu Stillstand führen, wie umgekehrt die Bevölkerung auf Regierungen Einfluss ausüben kann.
Zur Lösung solcher Probleme reichen allein lineare Denkmuster (wenn, dann ...) nicht mehr aus. Schnittmengen-Prozesse führen zu wirkungsvolleren Verhaltensformationen. Logik und Emotionalität zeichnen menschliches Handeln aus.5 Obwohl wir uns durch unsere logischen Fähigkeiten hervorheben zu können glauben, sind es doch Emotionen, die sozusagen als Spiegelreflexe aus unserem Unterbewusstsein hervortauchen und unser Handeln überwiegend bestimmen.
Abbildung 1: Interdependenzen
Zwischen diesen Erlebniswelten bestehen gegenseitige Abhängigkeiten in Form von Wechselwirkungen. Alles, was realisiert werden kann, bedarf des Zusammenspiels dieser Aktionsebenen als steuernde Größen. Nur darüber kann man aktiv werden - und zwar nicht im Sinne von Entweder/Oder, sondern im Sinne von sowohl / als auch. Der inhaltliche Fokus von Privatsphäre und Öffentlichkeit ist eher langfristig angelegt, wohingegen die einzelnen Ebenen eher kurzfristig ausgerichtet sind.
Dass Vernetzungen der Erlebniswelten langfristig zu Identität führen und Identitäten wiederum Vernetzungen ermöglichen, ist realitätsnah. Motivation und Identität sind wechselseitige Verstärker. Motivation führt langfristig zu Identifikation, wohingegen Identifikation die Motivationsfähigkeit und Motivationsleistung begünstigt.
Da Aufgaben bei entsprechender Motivationsbereitschaft gerne wahrgenommen und übernommen werden, muss man wissen, wo der Schwerpunkt der jeweils eigenen Interessen liegt. Niemand sollte perspektivlos sein. Am schlimmsten ist Perspektivlosigkeit!
Bei der Identifikation (Prozess hin zur Identität) sind verschiedene Bedürfnisse aufeinander abzustimmen. Damit soll eine Aktivitätenidentität in unterschiedlichen Lebenssituationen (privat. und öffentlich) hergestellt werden. Letzten Endes geht es um einen Gleichklang, der erzielt werden soll.
Der Vorteil der Identifikation liegt in einer starken Kopplung zwischen Menschen und deren Erlebniswelten. Voraussetzung dafür ist, dass sich Menschen mit ihrer Aktivitätengesamtheit identifizieren. Hier steht kein kurzfristiges Optimieren im Vordergrund, sondern eine enge Verzahnung zwischen den jeweiligen Lebenswirklichkeiten. Wenn man an einer Stelle anfängt, hat man zugleich Schnittstellen zu den beiden anderen Lebensbereichen. Jede Aktivität ist also aus persönlicher Sicht wie auch aus Sicht des Umfeldes konfliktträchtig, weil jedes Handeln praktisch schon bei der Zuordnung sehr eng untereinander übergeht in alle anderen Erlebniswelten.
Überschneidungen zwischen Motivation und Identifikation gibt es in allen Lebens-lagen und zwischen allen Lebensräumen. Förderung der Identifikation erfordert sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Jeder hat seinen persönlichen Handlungsrahmen, der unabhängig davon ist, was Menschen in verschiedenen Situationen erleben. Es geht immer darum, dass sich Menschen mit ihrem Einsatz möglichst überall identifizieren können.
Sich mit dem, was man tut, zu identifizieren, bedeutet mehr als eine Imagevariante. Wenn man sich zusätzlich mit denen identifizieren kann, die mit einem etwas tun, führt das zum Gleichklang!
Es wäre allerdings ein Fehler, die unterschiedlichen Lebensräume (privat, und gesellschaftlich) gleichsetzen zu wollen, auch wenn sie sich in der längerfristigen Sichtweise ergänzen. Es ist wichtig, inwieweit man sich im Rahmen seiner Eigenverantwortung mit ihnen identifiziert und interessante Aufgaben als herausfordernd und fördernd ansieht.
Über die starke Bindung von Berufs- und Privatwelt hinaus beeinflussen Staat und Öffentlichkeit die Interessen und Befindlichkeiten der Bürger (Unternehmer und Beschäftigte). Um eine stärkere emotionale Bindung zu schaffen, bedarf es auch hier einer zumindest gefühlten Zustimmung,
Allerdings liegen häufig Welten zwischen den Interessen der Menschen verschiedener Lebensräume. Aus dieser Verschiedenheit lassen sich unterschiedliche Identitätssegmente ableiten. Wer von der Arbeit leben muss, hat andere Interessen als der Wohlhabende. Beim Vermögen gibt es keine breite Mittelschicht.
Aus Sicht der Bürger sind persönliche Sicherheit, politische Stabilität, Wohlstand, Fairness, Gerechtigkeit, Freiheit, Nähe und Sympathie, Eigenverantwortung, positive Zustimmung zu Eigenaktivitäten usw. Wünsche, die bei Erfüllung auch Sinnbilder unterschiedlicher Identitäten eines Menschen werden - seiner Individualität, seiner Unternehmenssolidarität und seiner Einbindung in die Gesellschaft. Beispielsweise denken nicht wenige Menschen in Deutschland über die Abschaffung geschichtlich begründeter Privilegien (Beamtenprivilegien oder Entlohnung kirchlicher Würdenträger durch den Staat) nach. Handelt es sich dabei nicht aus heutiger Sicht um überholte schichtenspezifische Fassadenwelten?
Dagegen ist aus Sicht von Unternehmern Einheitlichkeit und damit einhergehende Identität erstrebenswert
Aus Sicht des Staates verkörpern Integration und Integrität die Identität seiner Bürger.
Damit stellt sich die Frage, wieweit und in welcher Zahl Menschen aus allen Lebensräumen „an einem Strang“ ziehen und ein einheitliches Erscheinungsbild verkörpern können? Je besser das gelingt, desto stärker kann den individuellen und gemeinnützigen Werten und Normen6 entsprochen und möglichen Konfliktsituationen vorgebeugt werden.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass das Pendel der beschriebenen Wirkungsketten in seine Umkehrung schwenkt, sobald sich die Lebenssituation ins Negative (Misserfolge, keine Anerkennung, ständige Existenzängste, verlorenes Selbstvertrauen, mangelnder Respekt usw.) wendet. Wer mit Ängsten lebt, der neigt dazu, sich in die Selbstisolation zu begeben und nichts Neues zu planen.
B.6 Das Phänomen „Macht“
Macht auf sich alleine gestellt macht keinen Sinn, sondern nur im Umgang mit Menschen - sei es innerhalb der Familie, in einem Team oder einer Gruppe, in Unternehmen oder innerhalb der Gemeinschaft eines Volkes. Macht und Rangstreben stecken in der Natur nicht nur des Menschen. Macht braucht Alphatiere!
Wer in die Geschichte schaut, der wird feststellen, dass es keine Kultur gibt, in der es nicht irgendwie geartete Führungsgestalten gibt. Andernfalls würde jeder machen, was er im Extremfall will. Es würde Chaos herrschen. Das allgegenwärtige Instrument von Macht ist Hierarchie. Hierarchie ist sozusagen ein kulturelles Grundgesetz.
Wer Macht hat, nimmt Einfluss und versucht im Sinne seiner Ziele und Interessen Entwicklungen zu steuern und nach Möglichkeit durchzusetzen - also letztlich zu bestimmen. Macht haben knüpft immer an Rahmenbedingungen an, die Macht ermöglichen - auch wenn man sie sich einfach stiehlt. Das bedeutet, Macht über Andere ausüben zu können - im privaten, im unternehmerischen und im gesellschaftlichen Leben. Macht hat den Drang, sich zu erhalten. Andererseits läuft einkonservierte Macht Gefahr, aus Blindheit von Realitätsverlusten überrollt zu werden. Auf das Shareholder-Value Debakel in der Führung von Unternehmen sei an dieser Stelle hingewiesen.7
Wenn Macht Sinn machen soll, muss sie finalisiert werden, Allerdings ändern sich viele Menschen, die (plötzlich) Macht haben, weil sie mit Macht nicht wirklich umgehen können! Ein vielleicht seltenes Beispiel sei erwähnt, weil es in einem gesellschaftspolitisch relevanten Bereich vorgefallen ist, in dem man es so nicht vermutet hätte.