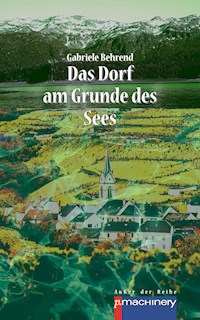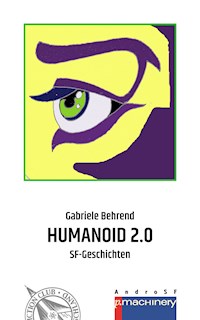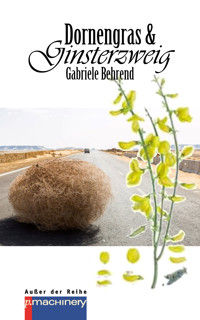4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Emilia liegt nach einer Verzweiflungstat im Wachkoma. Ihre Ärztin zieht Jules Meyer zur Behandlung hinzu. Meyer ist der führende Experte in der In-Mind-Therapie, hat aber noch nie mit einem komatösen Patienten gearbeitet. Er lässt sich auf das Experiment ein und taucht in die verschiedenen Bewusstseinsebenen Emilias ab. Ob er ihr zwischen reifem Weizen, dem Inneren einer geheimnisvollen Kate, dem Blattwerk einer Bauernhortensie oder dem steinernen Abgrund, in dem sie zu versinken droht, helfen kann, ins Leben zurückzukehren, ob er das überhaupt will, das zeigt sich im Schatten der Hydrangea. Eine Inner-Space-Story, die den Leser einlädt, in ein fremdes Bewusstsein einzutauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gabriele Behrend
Im Schatten der Hydrangea
AndroSF 165
Gabriele Behrend
IM SCHATTEN DER HYDRANGEA
AndroSF 165
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Mai 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Gabriele Behrend
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 328 4
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 775 6
1.
Sie sah auf ihren verwüsteten Garten, der sich braun, vertrocknet und verdorrt vor ihr ausbreitete. Ihre linke Hand ruhte am Gürtel, in dessen Schlaufen sich Schaufel, Rechen und eine Gartenschere befanden. In der Rechten hielt sie einen Topf mit einer blühenden dreiköpfigen Hydrangea in der perfekten Mischung eines sanften Hellblaus, das von rosa Äderchen durchzogen war. Dies war ihr die liebste Farbe der Hortensien, aber letztlich war sie von jeder Ausprägung dieser Pflanze hingerissen. Warum? Das war ihr gar nicht klar.
Ihr Vater hatte ihr diese Liebe wohl eingepflanzt, sie sah ihn heute noch in der Erinnerung an den Beeten rund um das Haus ihrer Kindheit stehen. Bei allem, was in der Zwischenzeit passiert war, war es verwunderlich, dass sie die Liebe zu den Hortensien durch alle dunklen Zeiten stets in ihr Leben hinübergerettet hatte.
Sie schüttelte leicht den Kopf, als ob sie Nachbilder verscheuchen wollte, die ihr den klaren Blick auf das Chaos zu vernebeln drohten. Dann kniete sie sich inmitten der Dürre auf den Boden, griff nach der kleinen Schaufel an ihrem Gürtel, zückte sie und stieß sie in den festgebackenen Grund.
Sie brauchte weniger Kraft als vermutet; war die Krume erst durchbrochen, so war die Erde darunter pulvertrocken. Nach einer Weile hatte sie ein Loch gegraben, das den Ballen der mitgebrachten Hortensie aufnehmen würde. Sie befreite die Pflanze von dem Plastiktopf, in dem sie ruhte, und bettete sie in die trockene Erde. Dann erhob sie sich und ging zu der kleinen Laube hinüber, an deren Außenwand der Wasserhahn für den Gartenschlauch angebracht war.
Für einen Moment kroch die Angst in ihr hoch, dass das Wasser abgestellt worden sein könnte, aber nach einem kurzen Zögern floss es aus der Leitung, hinein in den darunter abgestellten Eimer. Sie sah zu, wie sich das Gefäß füllte, drehte dann den Hahn wieder zu und ergriff den Eimer.
Als sie wieder bei ihrer Schönen angekommen war, kniete sie sich auf den Boden und wässerte die Pflanze. Gierig sog die Erde das Nass auf. Sie sah, wie der erste Schwall Wasser schnell versickerte. Vorsichtig goss sie nach, bis sie, ihrem Gefühl gehorchend, den Eimer zur Seite stellte. Sie setzte sich, schlang die Beine zum Schneidersitz und besah sich ihr Werk.
Es war ein Anfang. Wenigstens ein Anfang. Einer von vielen zwar, aber dieser zählte. Jetzt, in diesem Moment. Nur dieser Funke barg die Hoffnung in sich. Emilias Hoffen, Emilias Sehnen. Und doch würde er nicht reichen.
Denn wenn sie nach diesem Stelldichein im Schrebergarten nach Hause ginge, bliebe nur das Bild des großen Sterbens in ihrer Erinnerung und sie würde sich dafür bestrafen, würde sich das Leben nehmen, da sie es den Pflanzen, die ihr das Liebste im Leben waren, schon längst genommen hatte. Emilia würde alles tun, damit sie diese Schuld abgeben konnte – an das Nichts, an das Vergessen, an die Vergebung. Dann würde sie zu ihren Kindern zurückkehren, solange ihre Beine sie noch trugen. Aber wenn sie schon alles von sich gab, dann wenigstens im Antlitz der Hydrangea. So musste es sein.
»Ihr habt einen neuen Fall für mich?«
Jules hatte sich hastig in seinen Stuhl geworfen, beinahe hätte er die Videokonferenz mit der Charité vergessen. Das mochte daran liegen, dass er zurzeit seine Freizeit genoss, nachdem der letzte Fall endgültig abgeschlossen worden war und er nicht sonderlich erpicht darauf war, gleich wieder in die Röhre zu gehen.
Agnieszka Kowal wartete kurz und ließ ihren Gesprächspartner sich sammeln. Dann antwortete sie: »Ja, wir haben hier ein medikamenteninduziertes Wachkoma nach Selbsttötungsversuch. Ich denke, das ist ein wertvoller Fall für unsere Studie. Sie werden kein Bewusstsein vorfinden, das sich gegen Sie wehren wird. Der Zugang sollte einfach sein.«
»Können Sie mir mehr über den Patienten sagen?«
»Weiblich, zweiunddreißig Jahre alt. Kundenservice-Mitarbeiterin im Fintec-Bereich. Man hat es nicht kommen sehen. Diesmal. Ist schon das zweite Mal, dass sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Wir denken, dass Sie, Herr Meyer, hier wirklich etwas bewirken können. Die Frage stellt sich doch, warum diese junge Frau so lebensmüde ist. Aber auch, warum keiner ihrer Versuche erfolgreich war. Sind es wahre Tötungsabsichten oder wohlkalkulierte Hilferufe? Wenn ja, ist der letzte etwas über das Ziel hinausgeschossen. Aber ob das Absicht war oder ein Versehen, das herauszufinden ist Ihre Aufgabe.«
»Ich würde mir gerne vor Ort ein Bild machen. Spricht etwas dagegen, wenn ich direkt bei Ihnen in Berlin die Behandlung vornehme?«
»Nein, nichts. Sie wissen ja, unsere Einrichtungen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.«
»Wann soll ich also da sein?«
»Nehmen Sie sich das Wochenende noch frei. Es reicht, wenn Sie am Montag eintreffen.«
Jules nickte in die Kamera. »Gut, dann bin ich so gegen zehn Uhr bei Ihnen. Ich buche gleich den Flug.«
Agnieszka Kowal lächelte knapp in die Kamera. »Genießen Sie Ihre Freiheit. Toben Sie sich aus.«
Jules zögerte kurz, dann grinste er. »Danke für die Anweisung, ich werde mich danach richten.«
Das Bild von Agnieszka erlosch, Jules war wieder allein mit sich. Umgehend loggte er sich in sein Konto bei der bevorzugten Billigairline ein und suchte einen passenden Flug. Kurz überlegte er, ob er vielleicht früher nach Berlin abreisen sollte, um dort die Sau rauszulassen. Dann entschied er sich aber, dass er lieber einen ruhigen Abend mit Freunden bei sich in Düsseldorf verbringen wollte. Ein bisschen die eigene Identität stärken, bevor man sich wieder in das Denken und Fühlen eines anderen Menschen begab – das konnte nicht schaden.
Schließlich stand er auf und verließ den Konferenzraum in der Düsseldorfer Uniklinik. Er wanderte die Gänge entlang, ziellos, wie er es öfter machte. Aber egal, welchen Weg er auch nahm, sie endeten alle in dem Raum, in dem die Röhren aufgebaut waren, hier, ebenso wie in Berlin.
Es waren zwei ausgemusterte MRT-Röhren, deren Technik so modifiziert worden war, dass die eine als Sender und die andere als Empfänger funktionierte. Während der Therapie lag Jules in der Senderröhre und der Patient in der anderen. Das war die vereinfachte Darstellung, die Magie aber entspann sich im Austausch von Patient und Therapeut.
Jules gelang es, über die Pfade des Bewusstseins seines Patienten in dessen Gedankenwelt einzutauchen. Er manifestierte sich in dem emotionalen Gemälde seines Patienten, wurde ein Teil seiner Welt, seiner Architektur, und nahm aus dieser Position heraus vorsichtig Kontakt mit seinem Klienten auf. Akzeptierte dieser ihn als Teil seines Selbst, konnte er mit ihm in ein Zwiegespräch treten, in dessen Verlauf die Therapie durchlaufen wurde. Der Zeitfaktor war der entscheidende Vorteil. Durch diese In-Mind-Therapie wurde jede mögliche Abstoßung des Therapeuten umgangen. Denn der Therapeut war nicht länger ein fremdes Gegenüber, sondern ein Teil des Erlebens des Patienten. Es gab somit keine Patienten-Therapeuten-Übertragung oder Widerwillen seitens des Patienten.
Die Akzeptanz aufseiten des Probanden hing natürlich auch von der Fähigkeit des Therapeuten ab, und da kam Jules ins Spiel. Seit Anbeginn der Forschung auf diesem Gebiet war er mit dabei. Er hatte einige der ersten Fälle begleitet, hatte an der Weiterentwicklung der Glove-Technik mitgetüftelt, sodass er jetzt, mit gerade mal sechsundvierzig Jahren als der In-Mind-Therapeut galt. Er war die Wahl für schwere Fälle, der Ansprechpartner für alle anfallenden Fragen. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass sogar Berlin um seinen Rat fragte. Jules war unprätentiös, hielt sich meistens lieber zurück, als vorzupreschen oder sein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen. Genau diese Eigenschaften ließen ihn immer wieder in die inneren Welten seiner Patienten gleiten wie die Hand in den Handschuh. Er lebte die Glove-Technik.
Jules klopfte mit den Knöcheln seiner rechten Hand auf die Empfängerröhre. Diesmal sollte es also eine Komapatientin sein. Einen solchen Fall hatte er noch nicht gehabt. Er wusste nicht, wie sich die innere Welt eines komatösen Patienten gestaltete. War sie überhaupt vorhanden? Gab es Bilder, mit denen er arbeiten konnte? War das Hirn abgeschottet? Welche Schranken hatte er zu umgehen?
Fragen über Fragen. Jules schüttelte den Kopf. Spannend war das allerdings, sehr spannend.
Dann machte er sich auf den Weg, seine Freunde zu treffen. Ein gutes Essen im Buttershakers, das war sein Plan, darauf freute er sich.
Währenddessen war Agnieszka Kowal zu ihrer Wachkoma-Patientin zurückgekehrt. Sie warf einen Blick in die Akte. Lebenszeichen unverändert. Status unverändert. Es handelte sich um eine junge Frau, Emilia Sophie Eglund, zweiunddreißig Jahre alt. Man hatte sie in einem Schrebergarten gefunden, inmitten von Unkraut und vertrockneten, abgestorbenen Hortensien. Sie hatte Tabletten genommen. Anscheinend hatte sie bereits längere Zeit dort gelegen, bis sie von einem benachbarten Schrebergärtner entdeckt worden war. Seltsam, dass es anscheinend niemanden gab, der sie vermisste. Hier, in der Charité, war von Besuch weit und breit nichts zu sehen, und sie lag schon die dritte Woche auf Station.
Die Ärztin strich ihrer Patientin leicht über den Arm. »Wir werden dir helfen, Emilia«, murmelte sie leise. Dabei fiel ihr ein Tattoo auf dem Innenarm auf, eine blaue Hortensie. Die Hydrangea in ihrer schönsten Form. Agnieszka lächelte. Sie hatte jetzt einen Schlüssel zu Emilias Geist, sie spürte es. Und sie war lange genug Ärztin, um zu wissen, dass ein bisschen Bauchgefühl ab und an ganz gut war.
Wieso nennt sie mich Emilia? Ich bin doch Emmi! Ich war immer Emmi, immer, mein Leben lang. Das erste und das zweite. Es wird niemals anders sein. Emmi, Emmi. Das Denken verflicht sich zu einem einzigen Wort, meinem Namen, der Bezeichnung meines Seins. Emmi. Aber das ist nicht freudig, das ist nicht willkommen. Ich fühle mich nicht wohl mit diesem Stempel. Emmi. Für immer klein. Das Nesthäkchen. Nicht reif fürs Leben, immer auf Hilfe angewiesen. Niemals wachsen dürfen, immer Tochter sein. Emmi. Ich hasse es. Aber ich kann nicht anders. Weil sie mich nicht lassen. Aber halt, habe ich mich nicht von Mutter und Schwester abgewandt? Habe ich sie nicht aus meinem Leben verbannt? Einen Herzschlag lang halte ich inne. Lächle in meiner Innenwelt, und die Sonne strahlt für einen Moment in meine Dunkelheit. Dann denke ich an meinen Vater, und die Dunkelheit fällt wieder um mich herum. Wie ein Mantel hüllt sie mich ein. Ich höre ihn, wie er mich ruft. Emmi! Kleine Prinzessin, Emmi! Papas Liebling, nicht wahr? Und die Umarmung der Dunkelheit wird quälend eng. Ich bekomme kaum Luft, und mir wird klar, dass ich in einem Käfig gefangen bin, der sich nie öffnen wird. Denn Vater ist tot. Ich kann ihn nicht aus meinem Leben streichen, weil er sich mit seinem Lungenkrebs schon lange daraus verpisst hat. Somit bleibt nur die Erinnerung an seine Umarmung, an das Leuchten in seinen Augen, wenn er mich in den Arm nahm und an das »Emmi!«, das mich auf ewig klein halten wird. Ich will nicht mehr denken, ich will vor allem nicht mehr fühlen. Ich will nichts und ich will mir nichts zu meinem Trost zugestehen. Die Wellen meines Bewusstseins beruhigen sich wieder, bis es still und starr ist, wie ein zugefrorener Wintersee.
Agnieszka Kowal blickte auf die Monitore, machte eine Notiz in der Akte und wandte sich ihren anderen Patienten zu.
Das Wochenende lag hinter Jules. Er saß im Taxi und war auf dem Weg zur Charité, um Agnieszkas Team zu treffen. Er bereitete sich auf den Moment vor, in dem er sich in die Röhre legen würde. Er fragte sich erneut, wie es diesmal sein würde. Wie würde sich das Bewusstsein seiner Patientin von innen zeigen? Da überraschte ihn eine Nachricht auf seinem Handy. Er sah eine blaue kugelige Blüte, die aus vielen Einzelblüten bestand.
»Was ist das?«, tippte er.
»Eine Hortensie«, kam es prompt zurück. »Machen Sie sich vertraut mit ihr.«
Jules war irritiert, aber er suchte im Internet einen Artikel über die Blume. Es handelte sich um eine robuste Pflanze, deren Blütezeit als Zierstrauch in den 1960er-Jahren lag. Zwei Jahrzehnte später hatte sie ihre Anziehungskraft zunächst wieder verloren. Erst später wurden wieder mehr Hortensien angebaut. Eine langweilige Blume, befand er für sich. Man sollte die Pflanzenteile nicht rauchen, da sie dann Blausäure freisetzen würden, was zu Atemlähmung und der Zerstörung des zentralen Nervensystems bis hin zum Tod führen konnte. Abgesehen davon gab es anscheinend nichts Außergewöhnliches über sie zu berichten.
»Wieso eine Hortensie?«, fragte er Agnieszka dann auch gleich nach der Begrüßung.
»Sie hat sich eine tätowieren lassen.« Die Ärztin sah nachdenklich in Emilias Akte. »So was hat immer eine Bedeutung.«
»Gut«, nickte er. »Dann werde ich mir noch ein paar Bilder ansehen, damit ich genug Material für meinen Besuch habe. Ich soll doch nur die Bestandsaufnahme machen und nicht die ganze Therapie durchführen, oder?«
»Ja, sicher. Wir brauchen die Empfehlung, wie man am besten mit ihr arbeiten kann. Wenn Sie da die grundlegenden Studien betreiben, haben Sie uns schon sehr geholfen. Danach übernimmt einer unserer Therapeuten.«
»Wollen wir sie uns mal anschauen?«
»Ich bringe Sie zu ihr. Kommen Sie.«
Agnieszka Kowal und Jules Meyer gingen gemeinsam durch die Flure zum Krankenzimmer. Agnieszka wirkte wie immer kühl und distanziert, während Jules hier und da vertraute Gesichter begrüßte und einen Scherz machte. Er strahlte dabei eine lässige Selbstverständlichkeit aus, die Agnieszka unter die Haut ging – was ihr nicht gefiel. Schließlich war er so etwas wie ein Kollege. Unwillkürlich ging sie schneller.
Im Zimmer angekommen, händigte sie ihm die Krankenakte aus und zog sich zurück. »Sie finden mich in meinem Büro, sollten Sie tiefer gehende Fragen haben. Ich wünsche Ihnen morgen einen guten Start mit der Behandlung. Aber lernen Sie Ihre Patientin jetzt erst einmal in Ruhe kennen!«
Jules sah Agnieszka irritiert nach, dann drehte er sich dem Bett zu und konzentrierte sich auf seinen neuen Fall.
»Dann wollen wir mal, Emilia. Emilia Sophie Eglund. Deine Eltern waren anscheinend fantasievoll und sehr romantisch.«
Er trat einen Schritt näher und legte seine Hand auf Emilias Rechte. Vorsichtig strich er mit dem Daumen über ihren Handrücken, einerseits um den Port nicht zu berühren, der dort befestigt war, andererseits, um sie nicht zu erschrecken. Aber es zeigte sich kein Lebensfunke in den halb geöffneten Augen der Patientin.
Jules musterte sie. Ein hübsches, puppenhaftes Gesicht, das jetzt allerdings seltsam verzerrt anmutete, war umgeben von einer Flut brauner Locken. Irgendjemand hatte ihr einen schmalen Haarreif in die Lockenpracht gesetzt, sodass ihre Stirn und ihr Gesicht frei blieben. Ihr Brustkorb hob und senkte sich mühsam, aber stetig. Sie war nicht zierlich, wie die dünne Krankenhausdecke verriet, die links und rechts von ihrem Körper fest gestopft worden war. Die aufgedunsene, fahle Haut verriet, dass Emilia vor ihrem Selbsttötungsversuch keine gute Zeit gehabt hatte.
Aber die Voruntersuchungen ließen Hoffnung zu. Das EEG zeigte keine dramatischen Verschlechterungen. Das ursprüngliche Koma hatte im Krankenhaus weniger als vierundzwanzig Stunden angehalten, danach atmete sie wieder selbstständig. Alles positive Zeichen – ebenso wie das relativ junge Alter der Patientin. Also beschloss auch Jules, guten Mutes zu sein.
Dass die Angehörigen nicht auftauchten, war ein Hindernis. Er hätte viele nützliche Informationen für seine Arbeit erhalten können. So aber musste er sich der Aufgabe fast völlig unvorbereitet stellen. Alles, was er als Werkzeug an der Hand hatte, war das Bild einer Hydrangea. Aber nun ja, besser als nichts – und freute sich nicht jede Frau über Blumen?
»Reiß dich zusammen«, rügte er sich. »Morgen steigst du in die Röhre und dann hast du seriös zu sein.«
Dunkelheit umgibt mich. Da ist alles steingrau-anthrazit gemasert. Die Kanten meines Ortes, meines Denkens, meines Seins verschwimmen, fasern rauchig, wolkig aus, direkt in die absolute Schwärze. Manchmal durchzuckt ein dunkelroter Blitz die Düsternis, ein dunkles Rot, das an den Synapsen grellweiß aufleuchtet. Für einen Moment ist es dann hell, aber das lässt die Dunkelheit nur umso massiver erscheinen.
Ich weiß nicht, zu was ich in der Lage bin. Soll ich die Dunkelheit erhellen? Wie? Soll ich durch die Düsternis irren, auf der Suche nach – ja, nach was denn nur? Nach mir? Nach dem Licht? Was geschieht, wenn ich mich verlaufe? Was, wenn ich verloren gehe und eins werde mit dem Dunklen? Bin ich dann nicht mehr?
Irgendetwas in meinem Sein ist dagegen. Irgendetwas in mir löckt wider den Stachel und hat etwas dagegen, sang- und klanglos zu vergehen. In meiner ganzen Verwirrung nehme ich dieses Zeichen des Widerstandes wahr. Ich halte mich daran fest, denn es gefällt mir, dass es ihn gibt, den Willen, zu überdauern.
Also treibe ich auf einem grauen See in einem dunkelgrauen Nebel und lausche und sinne und strecke meine Fühler aus. Ich ertaste meine Grotten und Winkel, Ecken und Seitenarme, Fjorde und Höhlen. Ich verlasse mein Floß und gehe an Land, klettere auf meine Grate und Gipfel, meine Halden und Hügel. Ich vermesse meine Welt mit allen Sinnen, die mir noch zur Verfügung stehen. Und ich bemerke, wie sich die Gewitter häufen. Immer öfter strahlt es rot um mich herauf, dunkelrot mit gleißendem ausgefranstem Rand, der sich mit anderen ausgefransten Rändern zu einem Flickenteppich der Helligkeit verbindet. Da gibt es noch immer Stellen und Passagen von Grau und Nachtschwarz, aber das Licht setzt sich allmählich durch.
Aber dieser Prozess ermüdet den Geist. Immer wieder gleite ich ab in das tintenschwarze Nichts, pumpe mit meinem Herzen gegen das Vergehen an, schnappe nach Luft. Etwas in mir will leben, will sich an die organischen Funktionen klammern, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keine andere Option.
Wenn ich genug Kraft gesammelt habe, stehe ich wieder auf. Streife erneut durch meine Orte, durch mein Sein. Kartografiere, vermesse, was von mir übrig geblieben ist, und dehne meine Grenzen allmählich wieder weiter aus. Jeder Schritt erschließt ein Stück neue Welt. Die Gewitter kleiden meine Orte mit der Zeit in ein Gewand aus hellem Licht. Ich spüre die Erschütterungen nicht mehr. Denn ich bin zu beschäftigt damit, mich über die Helligkeit zu freuen. Ich versuche, dem kalten Licht mit meinem Lachen einen Hauch von Wärme zu verleihen. Ich will aus dem unpersönlichen Schlaglicht ein heimeliges Glühen machen, ein Licht, in dem ich mich zu Hause fühlen kann. Aber das will nicht gelingen. Noch nicht. Ich werde weiter daran arbeiten müssen. Vorerst gilt es, den Sieg über das allzu lebendige Schwarzgrau zu feiern.
Auf einmal reißt der Himmel meiner Welt auf und flutet mich mit Erinnerungen. Da stürzt das Bild eines Mannes auf mich hinunter, und ich weiß, das ist mein Vater. Frauenporträts folgen, und ich identifiziere sie als Mutter und Schwester. Und ich höre es rufen: Emmi! Emmi, Emmi! Ich schreie auf, mir wird übel. Ich will davonlaufen. Doch meine Beine tragen mich nicht, und die Bilder und die Stimmen kommen näher. Da ziehe ich die Beine an, lege die Hände auf die Ohren und presse meine Augenlider zusammen. Nichts sehen, nichts hören, aber wimmern, nur wimmern. Ich kann es nicht abstellen. Ich flüchte in die Dunkelheit.
Doch statt der Schwärze bläut es vor mir auf. Aus den blauvioletten Schemen schält sich das Bild einer Pflanze mit sattgrünen Blättern und drei Kugelblüten. Eine Hydrangea. Ich flüchte mich in ihren Schatten. Klein bin ich auf einmal, ganz klein, sodass ich mich in die Gabelung der Stängel hocken kann, einen Stamm der Hortensie umfasse und mich an ihn schmiege.
Und alle Last fällt von mir ab. Da gibt es keine Bilder, nur Duft und Farbe und Leben um mich herum.
2.
Heute war es also soweit. Nach einem leichten Frühstück, das hauptsächlich aus Kräutertee bestand, hatte sich Jules auf den Weg zur Station gemacht, wo er in ein paar Minuten in die Röhre steigen sollte, um ein neues Gehirn kennenzulernen. Der erste Moment war nicht immer so spektakulär, wie ein Außenstehender sich das denken mochte. Oftmals waren es unvollständige Stillleben oder gänzlich weiße Leinwände, die sich erst nach und nach mit Bildern bedeckten, Bildern, die sich dann mit Leben füllten.
Jules hatte sich gestern noch einmal mit der Bildersuche im Internet beschäftigt, hatte versucht, sich in einen Farb- und Blumenrausch hineinzuversetzen, aber es war ihm nicht allzu gut gelungen. Er hatte jedoch genug Bilder gesehen, um sich problemlos an den Aufbau und die Farbe einer Hortensie zu erinnern. Er konnte sie imaginieren und hatte so eine Ahnung, dass dies notwendig werden könnte.
Agnieszka Kowal erwartete den Therapeuten bereits.
»Guten Morgen, Herr Meyer. Schön, dass Sie da sind. Dann können wir ja gleich anfangen.«
Sie nickte zu den umgearbeiteten MRT-Röhren hinüber. Der Schlitten der Senderröhre war komplett ausgefahren und wartete einladend auf ihn. Die Empfängerröhre war hingegen geschlossen, und Jules wusste somit, dass Emilia bereits Position bezogen hatte.
»Ich ziehe mich kurz um, dann können wir loslegen.«
Agnieszka nickte leicht. »In der Kabine eins liegt alles für Sie bereit.«
Fünf Minuten später trat Jules wieder neben die Ärztin. Er trug jetzt ein blaues T-Shirt mit dem Logo der Charité, blaue Shorts und weiße Socken.
Agnieska sah an ihm herunter. »Kein Metall?«
Er hob kurz die linke Braue, dann verneinte er mit einem Kopfschütteln.
»Gut. Dann nehmen Sie Platz, Herr Meyer.«
Jules tat, wie ihm geheißen. Er setzte sich auf den ausgefahrenen Schlitten, schwang die Beine hoch und ließ sich rücklings auf der Liege nieder. Eine Schwester legte eine leichte Decke über ihn, stopfte sie um seinen Körper, damit er während der Sitzung nicht auskühlen konnte. Jules’ Arme lagen auf der Decke. Schnell wurde ihm noch ein Blutdruckmesser aus Kunststoff an den rechten Zeigefinger geklemmt und der Panikknopf in die Linke gelegt.
Dann wurde er auch schon in die Röhre geschoben. Langsam ging es hinein, und Jules schloss die Augen. Das tat er jedes Mal, denn eigentlich konnte er die Enge der Röhre kaum ertragen. Am liebsten wünschte er sich Haldol herbei, Haldol, das ihn lässiger machte, das ihn entspannte und in die Tiefe der Röhre einsinken ließ, statt ihn atemlos zurückzulassen, mit pochendem Herzen und trockenem Mund, bei dem Anblick der Enge um ihn herum.
»Geht es Ihnen gut? Einmal für Ja, zweimal für Nein klingeln, bitte.«
Jules zögerte einen Moment.
»Wir können Sie auch wieder herausholen. Es liegt bei Ihnen.« Agnieszkas Stimme klang so gleichmütig wie immer.
Da betätigte er den Panikknopf einmal.
»Gut, dann fangen wir an!«
Die Maschine startete, war erst leise, dröhnte aber immer mehr, bis sie schließlich in ein rhythmisches Klacken und Klopfen ausbrach. Jules hasste den Lärm. Es war jedes Mal, als ob der Himmel auf ihn niederfiel. Statt sich verwirren zu lassen, konzentrierte er sich auf seine Mitte, ging die Atemübungen aus dem Yoga durch und praktizierte die Muskelrelaxation nach Jacobson.
Irgendwann wichen die Geräusche zurück, verwuchsen mit dem Hintergrund. Waren weiterhin existent, aber nicht mehr störend.
Irgendwann fing er an zu schweben, umgeben von weißer Watte. Sie war dicht um ihn herum, aber er spürte keine Enge, keinen Druck. Er war in Trance. Schön war das, so schön, dass er hier verweilen wollte. Im Sein, ungebunden und frei. Aber dann entsann er sich des Anblicks seiner Patientin und wusste wieder, weswegen er hier war.
Also fing er an, seine Umgebung abzusuchen. Irgendwo musste es eine Veränderung geben, meistens waren es Farbnuancen, die ihm den Weg aus seiner erleuchteten Sphäre wiesen. Und auch jetzt bemerkte er nach einem gründlichen Scan der Wolken eine Spur Dunkelheit am östlichen Rand seines Blickfeldes. Er drehte sich herum, manövrierte sich mit rudernden Armen und schlagenden Beinen zu dem Punkt, an dem die Dunkelheit in sein Licht tropfte. Er holte Luft, führte die Arme über seinem Kopf zusammen und stieß sich ab in die Dunkelheit.
Er fiel. Er fiel durch verschiedene Schichten von Grau. Von Lichtgrau bis hin zu Anthrazit. Das Licht zog sich in Etappen zurück, die Wärme wich einer Eiseskälte, und das stete Lärmen wurde von einer allumgreifenden Stille geschluckt.
Jules landete hart auf einem dunkelgrauen felsigen Boden, auf dem eine leichte Staubschicht lag. Wie silberner Puder war der Staub dort hingehaucht, und es gab keine Anzeichen, dass sich hier irgendjemand oder irgendetwas über den Boden bewegt hatte. Erst als sich Jules aufrichtete und sich die ersten Schritte vorantastete, wurde die Struktur der Schicht zerstört. Er sah hinter sich und erkannte in dem düsteren Zwielicht seine Fußabdrücke. Unwillkürlich dachte er an die Mondlandung. One small step for men …
Komm, Jules, rügte er sich aber sodann, so wichtig bist du nicht. Er schüttelte sich, lockerte seine Arme und Beine und sah sich um. Seltsam, dass es so dunkel war. Er hatte schon viel erlebt – erste Räume, die wie mit Milchglas umgeben waren, weiße Räume, verlassene Wiesen, sonnendurchglühte Wüstendünen. Viel Stille, ja, aber meistens waren die Landepunkte allesamt irgendwie lebendiger als diese Höhle, in der er sich befand. Und heller. Er kniff die Augen zusammen. Irgendwo musste das diesige Zwielicht doch seine Quelle haben.
Er tappte vorsichtig drauf los. Immer voraus, mutmaßte er. Einen Schritt vor den anderen setzen, nicht anecken. Sich selbst nicht verletzen, aber auch nicht den Patienten. Denn alles, was er sah, was ihm hier geboten wurde, war bereits der Patient. Er musste sich behutsam in ihm bewegen, sich zurechtfinden. Und auch wenn dieser Teil wie abgestorben war, konnte er dennoch einen wichtigen Funken des Geistes des Patienten repräsentieren. Denn Jules musste erst noch herausfinden, ob dieses Bild bewusst projiziert wurde oder ob es tatsächlich ein abgestorbenes Hirnareal darstellte, in dem schlichtweg keine Projektionen mehr erzeugt werden konnten.
Bei aller Beklemmung spürte Jules, wie sich seine Neugier regte. Nach einem überraschend kurzen Marsch erreichte Jules den Ausgang der Höhle. Das Licht war hier um einige Nuancen heller, aber von Licht, von Sonnenschein, konnte man immer noch nicht sprechen. Ein krankes, senffarbenes Licht, das von grauen Schleiern durchzogen war, senkte sich auf ein reifes Weizenfeld, das sich sanft bis zum Horizont wellte. In dessen Mitte schien eine kleine Hütte zu stehen, soweit Jules das aus dieser Entfernung sagen konnte. Er suchte den Rand des Feldes nach einem möglichen Einlass ab, einem Trampelpfad, einer Lücke in den Reihen des Weizens, durch die er zu der Hütte vordringen konnte. Die Hütte war das Herzstück dieses Bildes, erst von dort würde er zum Kern vordringen können. Die Hütte, so ahnte Jules intuitiv, war das Portal. Der Treffpunkt mit dem Ich seiner Patientin.
Aber so sehr er sich auch abmühte, er fand keinen Eingang in die Reihen des Weizens. Also wandte er sich nach links und stapfte los. Langsam und vorsichtig setzte er seine Schritte, langsam wurde er ein Teil des Bildes. Der einsame Wanderer am Feldrand, Caspar David Friedrich hätte seine Freude an dem Anblick gehabt. Jules betrachtete den Weizen genau. Aber dieser zeigte keine Abwehrreaktion, da wich nichts vor seiner Anwesenheit zurück. Stoisch thronten die Ähren auf ihren trockenen festen Halmen, wiegten sich nur sacht in einer kaum spürbaren Brise vor und zurück, vor und zurück.
Jules ging und ging, ein Schritt nach dem anderen. Irgendwann, als der Horizont sich schon ungezählte Male nach hinten verschoben hatte und die Hütte drohte, aus dem Blickfeld zu verschwinden, hielt er inne, sah zurück und wischte sich den Schweiß aus der Stirn.
Jules dachte nach. Das Bild hatte sich kaum verändert, es hatte keine Gegenwehr gegeben, alles schien ideal. Vielleicht sollte er jetzt zum zweiten Schritt übergehen. Also drehte er sich zum Feld und flüsterte: »Lass mich ein!«
Nichts rührte sich. Die Brise strich weiter über die Ähren, diese schwangen wie zuvor, vor und zurück, vor und zurück.
»Zeig mir den Weg zu dir!« Jules erhob seine Stimme um zwei Nuancen. Halblaut drangen die Worte durch das staubige Licht. Nichts geschah.
Er zögerte einen Moment. Er wollte Emilia nicht verschrecken, indem er seine Forderung zu laut kundtat, aber vielleicht gab es keine andere Möglichkeit. Vielleicht konnte sie die leisen Töne nicht wahrnehmen? Jules gab sich einen Ruck.
»Ich bin müde vom Wandern!«, rief er. »Lass mich einen Moment in der Hütte ruhen!«
Da hielt die Brise inne, drehte sich und wehte Jules ins Gesicht. Es war ihm, als würden Hunderte kleiner Hände sein Gesicht abtasten, seinen Körper. Würden sie ihn wiegen und für zu leicht befinden? Oder würde er diese Prüfung bestehen? Er ließ sich darauf ein, öffnete sich dem Wind und schwieg dabei, hielt still und wartete ab.
Die Brise wandte sich schließlich ab. Einen Moment regte sich kein Halm auf dem Feld. Dann fuhr ein Windstoß in die Reihen des satten reifen Weizens und bog die Halme auseinander. Jules folgte dieser Einladung und tappte in die Gasse. Hinter sich schlossen sich die Halme wieder zu einer undurchdringlichen Wand, aber vor ihm bogen sie sich auseinander, boten einen Weg dar, einen Pfad, der Jules in weiten Schwüngen immer dichter an die Hütte heranführte.
Schließlich stand er auf einem schmalen Streifen pudrigen gelben Sandes, der sich an das Podest schmiegte, auf dem die kleine Hütte errichtet war. Auf der Jules zugewandten Seite war eine Veranda angelegt, auf der drei Schaukelstühle nebeneinander sanft vor und zurück schwangen. Rechts daneben gab es eine Tür, die von einem Fliegengitter beschirmt wurde. Wiederum rechts davon stand ein weiterer Schaukelstuhl mit einem Korb an seiner Seite. Bücher quollen aus der Tiefe des Korbes, eine Menge Bücher. Er war auch groß genug dafür. In die Wand waren zwei Fenster eingelassen, deren stumpfes Glas durch je ein Fensterkreuz in vier gleiche Flächen aufgeteilt wurde.
Ansonsten war die Veranda leer. Kein Zeichen von Leben, kein Funke, kaum Farbe, nur dieses monochrome Senfgelb, das sich wie Leim auf Jules’ Sinne legte. Er war müde von der Wanderung. Also machte er zwei Schritte und setzte sich auf die dritte Stufe, die zu der Veranda hochführte. Streckte seine Beine aus und spannte seine Muskeln leicht an, nur um sie dann wieder zu lösen. Stützte sich auf seinen Armen ab und legte den Kopf in den Nacken. Er nickte ein.
Die Brise, das Feld und die Hütte, der Himmel, der Staub und der Sand hielten inne, witterten, zogen sich um den Fremdkörper zusammen, der dort am Rand der Veranda saß. Vorsichtig, ganz vorsichtig und äußerst behutsam überzogen sie ihn mit ihren Anteilen. Der Staub wurde von der Brise über den schlafenden Körper geblasen. Der Sand rieselte über die Beine den Weg empor bis zu den Schultern, bis zum Kopf und stürzte sich an den Armen vorbei wieder auf den Boden. Das Feld raschelte seine Zustimmung, die Hütte knarzte ermutigend.
Als alles Werk getan war, zogen sich Staub, Sand und Wind zurück und betrachteten, was sie geschaffen hatten. Der Mann, der dort saß, trug nicht länger seltsame blaue Kleidung, mit seltsamen unbekannten Zeichen. Nun trug er Jeans und Chaps, ein kariertes Hemd und einen hellen Stetson auf dem Kopf. Der Wind blies ihm den Hut in den Nacken.
Jules wachte von dem Windstoß auf. Verwirrt fuhr er sich über das Gesicht und bemerkte ungewohnt kräftigen Bartwuchs. Dann besah er sich seine Beine, bemerkte die Verwandlung, die er durchlaufen hatte und schmunzelte. Ein Cowboy, yippie-ya-yeah! So passte er viel besser ins Bild. Er erhob sich.