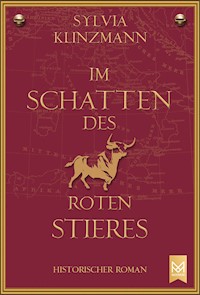
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salvatierra-Reihe
- Sprache: Deutsch
Liebe, skrupellose Machtgier und Angst – Willkommen in der Familie Borgia Rom, 1497. Die schöne, wohlbehütete 15-jährige Alessia Bertorelli de Salvatierra verliebt sich unsterblich in den begabten Maler Giacomo, dem sie Modell sitzt. Die beiden wollen heiraten. Alessias Vater Alvaro ist ein bekannter Anwalt, der sich mit der Familie - nach der Flucht vor der Inquisition aus Spanien – in Rom ein neues Zuhause aufgebaut hat. Doch die Vergangenheit holt ihn ein. Er ist der uneheliche Sohn des machtgierigen und vor nichts zurückschreckenden Rodrigo Borgia, der vor fünf Jahren zum Papst Alexander VI. gewählt wurde. Und plötzlich erleben die Bertorellis hautnah, allen voran Alessia, was es bedeutet, Mitglied dieser skrupellosen Renaissancefamilie zu sein. Der Schatten des roten Stieres, das Wappenzeichen der Borgia, ist einfach überall. Alessia muss um ihre Liebe kämpfen, sich gegen Intrigen, Unterdrückung und den brutalen Willen ihrer Verwandten wehren und wird trotzdem zum Spielball im politischen Machtspiel der Borgia. Wem kann sie überhaupt noch vertrauen? Das Buch ist eine Reise nach Italien Ende des 15. Jahrhunderts: Das Zeitalter von Da Vinci und Michelangelo – und Rodrigo Borgia und seiner machtgierigen Familie. Sein Regiment als Papst Alexander VI. ging als das denkwürdigste Kapitel der katholischen Kirche in die Geschichte ein. Ein ergreifender Roman voller Leidenschaft, Blut und Tränen und dem Kampf um die große Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvia Klinzmann
Im Schatten des roten Stieres
Historischer Roman
Zum Buch
Liebe, skrupellose Machtgier und Angst – Willkommen in der Familie Borgia
Rom, 1497. Die schöne, wohlbehütete 15-jährige Alessia Bertorelli de Salvatierra verliebt sich unsterblich in den begabten Maler Giacomo, dem sie Modell sitzt. Die beiden wollen heiraten. Alessias Vater Alvaro ist ein bekannter Anwalt, der sich mit der Familie – nach der Flucht vor der Inquisition aus Spanien – in Rom ein neues Zuhause aufgebaut hat.
Doch die Vergangenheit holt ihn ein. Er ist der uneheliche Sohn des machtgierigen und vor nichts zurückschreckenden Rodrigo Borgia, der vor fünf Jahren zum Papst Alexander VI. gewählt wurde.
Und plötzlich erleben die Bertorellis hautnah, allen voran Alessia, was es bedeutet, Mitglied dieser skrupellosen Renaissancefamilie zu sein. Der Schatten des roten Stieres, das Wappenzeichens der Borgia, ist einfach überall.
Alessia muss um ihre Liebe kämpfen, sich gegen Intrigen, Unterdrückung und den brutalen Willen ihrer Verwandten wehren und wird trotzdem zum Spielball im politischen Machtgefüge der Borgia. Wem kann sie überhaupt noch vertrauen?
Das Buch ist eine Reise nach Italien Ende des 15. Jahrhunderts: Das Zeitalter von Da Vinci und Michelangelo – und Rodrigo Borgia und seiner machtgierigen Familie. Sein Regiment als Papst Alexander VI ging als das denkwürdigste Kapitel der katholischen Kirche in die Geschichte ein.
Ein ergreifender Roman voller Leidenschaft, Blut und Tränen und den Kampf um die große Liebe.
Inhalt
Zum Buch
Impressum
Widmung
Personenverzeichnis
Prolog
I. Teil: Im Vatikan (1497)
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
II. Teil: Florenz (1498)
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
III. Teil: In der Engelsburg (1498)
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Begriffserklärungen
Über die Autorin Sylvia Klinzmann
Zehn Fragen an … Sylvia Klinzmann
MAXIMUM
Mehr von Sylvia Klinzmann
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2021 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2021
Lektorat: Anna Hoffmann (Harper Collins/Books2read)
Korrektorat: Dr. Rainer Schöttle
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Covergestaltung: Alin Mattfeldt
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Made in Germany
ISBN 978-3-948346-26-3
Widmung
Für Papa. Wo immer du auch jetzt sein magst. Ich weiß, du bist stolz auf mich.
Personenverzeichnis
Mit * gezeichnete Namen: Historisch verbürgte Personen
Familie Bertorelli de Salvatierra:
Alvaro Bertorelli: Anwalt, ehemaliger Sekretär der spanischen Königin Isabel von Kastilien
Lea Bertorelli: seine Gemahlin, ehemalige jüdische Hofstickerin Isabels von Kastilien
Alessia Bertorelli: Tochter von Lea und Alvaro
Aaron Bensinior/Bruder Horatio: Leas Bruder, ein ehemaliger Jude, der zum Christentum übergetreten ist
Anna: Dienerin im Hause Bertorelli
Sara: Köchin im Hause Bertorelli
Ricardo: Diener im Hause Bertorelli
Familie Borgia*:
Rodrigo Borgia: Papst Alexander VI.
Cesare Borgia: Papstsohn
Juan Borgia: Papstsohn
Lucrezia Borgia: Papsttochter
Jofré Borgia: jüngster Papstsohn
Sancia von Aragon: Gemahlin Jofrés
Adriana di Milo: Cousine des Papstes, Hausvorsteherin des päpstlichen Haushalts
Giulia Farnese Orsini: Geliebte des Papstes
Vanozza dei Cattanei: ehemalige Geliebte des Papstes und Mutter von Cesare, Juan, Jofré und Lucrezia
Weitere Personen:
Catalina de Mendoza/de Torralba: Nichte des spanischen Erzbischofs von Sevilla, Witwe des spanischen Herzogs Diego de Torralba
Bianca: Catalinas Dienerin
Carlo: Catalinas Diener
Giacomo di Luna: Maler und Alessias Geliebter
Pino Puccini: florentinischer Bildhauer, Giacomos Freund
Marco Carducci: Pinos Freund, der eine Künstlerwerkstatt in Florenz besitzt
Francesco Contarini: florentinischer Gönner Giacomos
Miguel Coralla/Michelotto*: Cesares rechte Hand
Johannes Burkhard*: Zeremonienmeister des Papstes
Fabio Carafa: römischer Adeliger, ein Freund Cesares
Piero degli Albizzi: florentinischer Adeliger, mit dem Alessia verheiratet wird
Giulio degli Albizzi: Pieros Bruder
Lorenzo Pisani: Pieros Kammerdiener
Chiara: Alessias Dienerin
Fausto: Folterknecht
Matteo: Folterknecht
Klosterbrüder:
Bruder Eugenio: Eremit, der Bruder Horatio gesund pflegt
Bruder Domenico: Prior des Klosters des Heiligen Estéban in der Estremadura
Bruder Matias: Abt des Mutterklosters in Sevilla
Tomás de Torquemada*: spanischer Großinquisitor
Girolamo Savonarola*: florentinischer Dominikanermönch, der in Florenz hingerichtet wird
Silvestre Maruffi: Dominikaner, der mit Savonarola hingerichtet wird
Domenico Buonvicini: Dominikaner, der mit Savonarola hingerichtet wird
Kardinal Isuagli*: Gouverneur Roms und Richter bei Alessias Gerichtsverhandlung
Pietro Menzi*: Bischof von Cesena, Hauptauditor bei der Gerichtsverhandlung
Prolog
Sevilla, Ebene von La Tablada, im Jahre des Herrn 1482
Der von Windböen gepeitschte Regen prasselte auf die Ebene von La Tablada vor den Stadttoren Sevillas nieder. Blitze, gefolgt von Donnerschlägen, erhellten die Szenerie und warfen ein gespenstisches Licht auf die sieben Scheiterhaufen, die wie schaurige Mahnmale in den Himmel hinaufragten. Die Feuer waren längst von den sintflutartigen Niederschlägen gelöscht worden. Nur das Zischen und Qualmen der nassen Holzstapel zeugte davon, dass sie zuvor lichterloh gebrannt hatten. Der Ort war bis auf einige wenige Familienangehörige der Delinquenten verlassen. Büttel, kirchliche Würdenträger und Schaulustige, die dem Hinrichtungsspektakel beigewohnt hatten, waren aus Angst zurück in die Stadt geflüchtet. Vor einem Unwetter, wie es Sevilla noch nie erlebt hatte. Als hätte Gott beschlossen, die Stadt und seine Einwohner für immer auszulöschen. Der Wind begann nachzulassen, doch noch immer goss es in Strömen.
Aaron Bensinior öffnete vorsichtig die Augen. Er musste ohnmächtig gewesen sein, denn er wusste nicht, wo er sich befand. Sein Verstand schien von einer Nebelschicht umhüllt zu sein, und ein brennender, alles durchdringender Schmerz ließ ihn keinen klaren Gedanken fassen. Er lag zusammengekauert auf dem schwelenden Scheiterhaufen. Der Rauch brannte in seinen Augen und erschwerte ihm das Atmen. Über ihm leuchteten Blitze am Himmel, und die mächtigen Donnerschläge ließen ihn zusammenzucken. Nur langsam lichteten sich die Nebelschwaden in seinem Gehirn, kehrte nach und nach die Erinnerung an die grausame Wirklichkeit zurück. Mit einem Mal sah er alles wieder deutlich vor sich: den Prozess, das gegen seine Schwester Lea und ihn gefällte Todesurteil und schließlich den Beginn des Autodafés. Mit schmerzverzerrtem Gesicht richtete sich der junge Jude auf und schaute an sich hinunter. Er war nackt, seine Beine, die Arme und der Oberkörper waren von Blasen überzogen. Sie brannten höllisch, obwohl die kühle Nässe des Regens Linderung zu verschaffen schien. Aaron berührte seinen Kopf. Dort, wo einmal üppige Locken sein schön geschnittenes Gesicht umrahmt hatten, fühlte er nun verkohlte Haarstoppel. Ich lebe, dachte er tapfer, nur das zählt! Alles andere ist unwichtig!
Er richtete seinen Blick nach links. Am Pfahl war niemand mehr angebunden. Wo ist Lea? Was ist mit ihr passiert? Tränen schossen in Aarons Augen. Ist ihr Körper von den Flammen verzehrt worden? Nein, das kann nicht sein! Ihr Scheiterhaufen – der letzte in der Reihe – war erst kurz vor Ausbruch des Unwetters angezündet worden. Es gab nur eine Möglichkeit – ihr musste die Flucht gelungen sein. Konnte Alvaro de Salvatierra, ihr christlicher Geliebter, die Hinrichtungsstelle rechtzeitig erreichen und Lea befreien? Aber warum hatten sie ihn dann zurückgelassen? Fragen über Fragen wirbelten dem jungen Mann durch den Kopf. Doch es blieb ihm keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Er musste den Ort des Grauens verlassen, bevor das Gewitter nachließ und die Büttel wieder zurückkamen.
Aaron glitt von dem Holzstapel hinunter und biss sich auf die Lippen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien. Suchend blickte er sich um und hob schließlich einen starken Ast vom Boden auf, den die Flammen verschont hatten. Er würde ihm als Stock dienen. Vorsichtig machte er die ersten Schritte. Es tat weh, aber er konnte laufen.
Etwas weiter vorn kniete eine Frau weinend über einem schwelenden Holzstapel. Vielleicht hatte sie gesehen, was mit seiner Schwester geschehen war. Er blieb neben ihr stehen und berührte vorsichtig ihre Schulter, bevor er wieder seine Blöße bedeckte.
Die Frau sah zu ihm auf und stieß einen Schrei aus. „Jehova steh mir bei!“ Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht.
„Bitte, gute Frau, fürchtet Euch nicht vor meinem Anblick. Ich weiß, die Flammen müssen mich schrecklich zugerichtet haben.“
Aaron schwankte vor Schwäche, sodass die Frau aufsprang und ihn stützte.
„An dem letzten Pfahl war meine Schwester angebunden. Sie ist verschwunden. Habt Ihr gesehen, ob sie jemand befreit hat?“ Aaron blickte die Frau hoffnungsvoll an.
Sie überlegte einen Augenblick. „Ich glaube, da waren zwei Männer. Einer trug etwas auf seinen Armen davon. Es könnte ein Mensch gewesen sein, vielleicht Eure Schwester. Mehr kann ich Euch nicht sagen.“ Sie begann zu schluchzen. „Ich habe versucht, meinen Gemahl zu retten. Aber es war zu spät.“ Sie ließ Aaron los und sank wieder vor dem Scheiterhaufen mit den Überresten ihres Mannes nieder.
„Danke. Möge Jehova Euch beistehen!“, murmelte Aaron. So schnell es ging, humpelte er über das Podest und stieg an dessen Ende die hölzernen Stufen hinunter. Er lehnte sich einen Moment lang an die Plattform, um durchzuatmen. Das Laufen strengte ihn mehr an, als er sich eingestehen wollte, und er spürte, wie trotz des Regens und der kühlen Witterung der Schweiß an seinem geschundenen Körper hinablief. Über den dunklen Himmel zuckten weiterhin Blitze. Er blickte sich um. Zu seiner Linken sah er die schwachen Umrisse der Stadtmauer von Sevilla, auf der anderen Seite breitete sich die Ebene aus, an deren Ende er einen kleinen Pinienhain ausmachen konnte. Er musste es schaffen, dorthin zu gelangen, um sich erst einmal zu verstecken.
Aaron holte tief Luft und lief los. Die Schmerzen raubten ihm fast den Verstand, sodass er ab und zu stehen blieb, um neuen Atem zu schöpfen. Er würde nicht aufgeben. Er musste weiterleben und herausfinden, was mit seiner Schwester geschehen war und warum sie ihn allein auf dem Scheiterhaufen zurückgelassen hatte. Aaron nahm all seine Kraft zusammen und zwang sich weiterzugehen. In jeder Faser seines Körpers spürte er nun den Schmerz. Selbst Gesicht und Kopfhaut brannten.
Der Regen hatte den Boden aufgeweicht. Immer wieder blieb der junge Mann im Morast stecken. Als er glaubte, keinen Schritt weiter gehen zu können, sah er endlich die Umrisse des Waldes vor sich. So rasch wie möglich lenkte er seine Schritte dorthin. Vielleicht konnte er sich im Schutz der Bäume ein wenig ausruhen.
Ein erneuter Blitz zuckte über den Himmel. Vor Schreck übersah er eine aus dem Boden ragende Wurzel, stolperte und schlug der Länge nach auf dem Waldboden hin. Er war nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten. Seine Kräfte hatten ihn endgültig verlassen. Dann soll es so sein!, dachte er. Wenn Jehova es will, werde ich jetzt und hier meinen letzten Atemzug tun.
Das Rauschen in Aarons Kopf wurde immer stärker, bis er schließlich das Bewusstsein verlor. Er merkte nicht einmal mehr, wie sich ein Fuchs näherte und ihn neugierig beschnupperte.
Als Aaron diesmal wieder zu sich kam, spürte er, wie etwas Kühles über seine Stirn strich. Er öffnete die Augen und blickte in ein Gesicht, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Stahlblaue, von Falten umrandete Augen musterten ihn freundlich; und ein lächelnder Mund entblößte schief stehende gelbliche Zähne. Ein grauer Haarkranz umrahmte das Gesicht des Mannes, der sich über Aaron beugte und mit einem feuchten Tuch dessen Stirn abtupfte.
„Endlich bist du aufgewacht. Wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen?“
Der junge Mann nickte.
„Das wundert mich nicht. Dein Leib ist eine einzige große Wunde.“
Aaron berührte mit einer Hand seinen bandagierten Kopf. Dann blickte er an seinem Körper hinunter und entdeckte, dass dieser ebenfalls vollständig mit Leinentüchern umwickelt war. Er lag auf einer Strohpritsche, in deren Nähe ein Feuer brannte. Es spendete nicht nur Wärme, sondern war auch die einzige Lichtquelle. Im rötlichen Schein der Flammen erkannte Aaron, dass er sich in einer Höhle befand. Neben seinem eigenen Lager gab es auf der anderen Seite des Raumes eine zweite Schlafstelle. Links davon standen ein aus grobem Holz gezimmerter Tisch und ein Schemel, rechts ein Vorratsregal, über dem an einer Schnur befestigte, getrocknete Kräuterbündel hingen.
„Wo bin ich? Wer seid Ihr?“ Aaron versuchte sich aufzurichten, doch sofort durchzuckte ihn ein stechender Schmerz. Der Mönch drückte ihn sanft zurück.
„Du solltest dich nicht so viel bewegen, mein Junge“, sagte er, „sonst könnten deine Wunden wieder aufplatzen.“
Er zog sich den niedrigen Holzschemel heran, setzte sich neben Aaron und glättete die aus grobem Wollstoff gewebte Kutte, die um seine hagere Gestalt schlackerte. „Mein Name ist Eugenio. Ich habe vor einiger Zeit den Konvent des Heiligen Estéban verlassen, um hier oben in der Einsamkeit Gott näher zu sein. Zweimal im Jahr gehe ich nach Sevilla hinunter, besuche meine Brüder im Kloster und zelebriere gemeinsam mit ihnen die Messe. Ich bringe ihnen meine Heilkräuter und erhalte im Gegenzug Waren, die ich hier in der Wildnis nicht bekommen kann.“
Eugenio legte das feuchte Tuch beiseite.
„Es war dein Glück, mein Junge, dass ich dich ausgerechnet an jenem Tag fand, an dem ich aus Sevilla zurückkehrte. Du bist Jude, nicht wahr?“
Aaron blickte den Mönch ratlos an. Was war geschehen? Wieso lag er hier in dieser Höhle? Wer war er? Ein Jude? In seinem Kopf herrschte nichts als Leere.
„Ich … ich weiß nicht.“
„Als ich deinen Körper säuberte und deine Wunden versorgte, da fiel mir auf, dass du beschnitten bist. Außerdem weiß ich, dass einen Tag vor meiner Rückkehr in der Ebene von La Tablada ein großes Hinrichtungsspektakel veranstaltet wurde. In Anbetracht deiner vielen Brandwunden schloss ich daraus, dass du einer der verurteilten Juden sein musst. Aber sag, du kannst dich wirklich nicht entsinnen, was geschehen ist? Auch nicht, wie du heißt?“ Eugenio blickte mitleidig auf seinen Patienten.
Aaron versuchte, die verworrenen Gedanken zu ordnen, die in seinem Kopf herumschwirrten.
„Ich heiße Aaron, Aaron Bensinior“, brachte er schließlich hervor, „nein … ich, mein Name ist Miguel Calderon.“
„Also wie denn nun, Junge? Du kannst doch keine zwei Namen haben.“ Der Mönch blickte den Verletzten verwundert an.
„Aaron Bensinior ist mein jüdischer Name. Als wir die christliche Taufe erhielten, wurde aus Bensinior Calderon.“
„Du bist ein converso – ein Konvertit?“
Aaron nickte.
„Und warum hat man dich dann zum Tode verurteilt? Bist du in deine alten Glaubensregeln zurückverfallen?“
Der junge Mann schüttelte unverzüglich den Kopf. „Nein! Aber das hat man mir und meiner Schwester vorgeworfen, als man uns festnahm.“
Konnte er sich dem Klosterbruder anvertrauen oder würde ihn der Mönch zurück in das Inquisitionsgefängnis bringen? Aaron schloss für einen Moment die Lider und sah sich wieder mit Lea in dem mit dunklen Tüchern verhangenen Raum sitzen, den stechenden Blick des Inquisitors Tomás de Torquemada auf sich gerichtet. Dann erschien der Folterkeller vor seinem inneren Auge, die Streckbank, auf der ihn der Marterknecht festgebunden hatte. Er erschauderte. Es war, als spürte er wieder den Schmerz seiner gedehnten Glieder, hörte erneut den Schrei seiner Schwester, die alles mit ansehen musste.
Nein, er würde kein Wort über seine Vergangenheit verlieren. Er war Miguel Calderon, ein Neuchrist, der zu Unrecht von der Inquisition zum Tode verurteilt worden war.
„Wie lange bin ich schon hier?“, fragte er den Eremiten.
„Etwa zwei Wochen. Du bekamst hohes Fieber und bist die meiste Zeit ohne Bewusstsein gewesen. Doch nun genug geredet! Du musst dich ausruhen! Zuvor werde ich noch deine Verbände erneuern.“ Bruder Eugenio begann, die Leinentücher von Aarons Beinen abzunehmen. „Mach dir keine Sorgen! In ein paar Wochen bist du wieder hergestellt“, sprach er dem jungen Mann Mut zu. „Die Wunden heilen gut. Es werden allerdings Narben zurückbleiben.“
Neben der Pritsche stand ein Tontiegel. Der Mönch tauchte seine Finger hinein und strich die daran haften gebliebene fettige Paste auf die Wunden. Angewidert verzog Aaron das Gesicht.
„Was ist das? Es riecht ekelhaft.“
„Das mag schon sein, aber es hilft gut bei solchen Verbrennungen. Die Salbe wird aus Wacholder, ungesalzenem Schweineschmalz und Eiern zubereitet.“
Nach und nach wechselte Bruder Eugenio alle Verbände und bedeckte die Wunden dick mit der Pomade. Aarons Gesicht betupfte er mit Johanniskrautöl. Erschöpft schloss dieser die Augen. Das Gespräch mit seinem Wohltäter hatte ihn angestrengt. Sein letzter Gedanke, bevor ihn der Schlaf übermannte, galt der Zukunft.
Er musste herausfinden, was mit Lea geschehen war.
I. Teil: Im Vatikan (1497)
1. Kapitel
Rom, Italien, Januar 1497
Leise öffnete Alessia das große Holzportal und spähte nach draußen. Auf der Straße war niemand zu sehen. Das Mädchen hielt einen Moment inne und lauschte, ob im Haus auch niemand ihr Fortgehen bemerkt hatte. Alles blieb still; und so schlüpfte sie hinaus.
Schnellen Schrittes lief sie die Via Pelamantelli hinunter. Der warme Umhang, den sie über dem Samtkleid trug, und das Tuch, das ihre dunklen Locken bedeckte, sollten sie zum einen gegen die kühle Abendluft und zum anderen gegen neugierige Blicke schützen. Schließlich war es ungewöhnlich für ein junges Mädchen, zu solch später Stunde ohne Begleitung in den dunklen Gassen Roms unterwegs zu sein. Und in der Straße, in der ihr Wohnhaus und die Kanzlei ihres Vaters lagen, kannten viele Leute die hübsche Tochter des Advokaten Alvaro Bertorelli. Alessia fühlte sich unwohl, wenn sie darüber nachdachte, wer ihr des Nachts begegnen könnte. Aber sie wollte sich nicht von Ricardo, dem Diener ihrer Eltern, begleiten lassen, da sie befürchtete, er könne sie bei ihrem Vater verraten.
Bald darauf erreichte sie den Campo de’ Fiori. In einem der engen Gässchen, die von dort abzweigten, lag das Haus, das sie nun schon seit einigen Wochen heimlich aufsuchte. Wie jedes Mal, wenn sie den düsteren Platz überquerte, lief ihr ein Schauer über den Rücken. Der Campo war eine der öffentlichen Hinrichtungsstätten der Stadt. Hier hatten schon viele Verbrecher und Ketzer am Pranger gestanden und sogar am Galgen oder auf dem Scheiterhaufen ihr Leben verloren. Merkwürdigerweise hatten sich gerade dort Wirtshäuser und Garstuben angesammelt. Anscheinend gab es Menschen, die bei einem Krug Wein der Anblick der am Galgen baumelnden Gehenkten nicht zu stören schien. Auch an diesem Abend musste sich Alessia wieder laute Rufe und zweideutige Aufforderungen anhören, als sie, den Blick nach unten gerichtet, die Lokale schnellen Schrittes passierte.
Endlich erreichte sie ihr Ziel. Die Eingangstür des kleinen Hauses war wie üblich nicht verschlossen, und so betrat Alessia den dunklen Flur. Rasch stieg sie die Treppe hinauf bis unters Dach und klopfte an die Tür der Kammer. Diese wurde aufgerissen, eine Hand ergriff Alessias Arm und zog sie ins Innere.
„Endlich, cara mia! Ich habe schon gedacht, du kämest heute nicht mehr.“
Ein gut aussehender dunkelhaariger Jüngling schloss Alessia in seine Arme. Dann drückte er ihr zwei Küsse rechts und links auf die Wangen.
„Wie könnte ich diese Stunden mit dir versäumen wollen, Giacomo?“, erklärte Alessia freudestrahlend.
Sie zog das Tuch von ihren Locken und legte es zusammen mit dem Umhang über die Lehne eines Stuhles. „Wo doch unser Werk so kurz vor der Vollendung steht. Lass es mich anschauen!“
Sie ging zu einer großen Staffelei, die unter dem Dachfenster aufgebaut war und auf der eine Leinwand von außerordentlichem Ausmaß lehnte. Im Schein der vielen Kerzen, die Giacomo angezündet hatte, begutachtete sie das kurz vor der Fertigstellung stehende Gemälde. Es zeigte eine junge Frau in sitzender Position mit entblößtem Oberkörper. Das Mädchen wies die dunklen Locken und die katzenartigen grünen Augen Alessias auf. Die Mundwinkel waren zu einem leichten Lächeln nach oben verzogen, in die blassen Wangen zwei zierliche Grübchen eingegraben. Alessias Blick wanderte von dem schlanken weißen Hals über die wohlgeformten Schultern bis hinunter zu den spitz zulaufenden Brüsten mit den rosigen Knospen.
„Ich denke, noch ein oder zwei Sitzungen, dann sollte das Bild fertig sein“, bemerkte Giacomo, der hinter sie getreten war.
Ein Gefühl der Traurigkeit überkam Alessia bei dem Gedanken daran, dass sie bald keinen Grund mehr haben würde, den hübschen Maler mit den unschuldig dreinblickenden braunen Engelsaugen aufzusuchen. Sie hatte sich im Laufe der letzten Wochen in den jungen Künstler verliebt.
Giacomo di Luna stammte aus Urbino, wo er von seinem Vater in der Malerei unterrichtet worden war. Nach dessen Tod ging er nach Perugia, in die Lehre des Meisters Perugino. Und seit einem Jahr weilte er in Rom, in der Hoffnung, von den hiesigen Adeligen Aufträge zu bekommen, mit denen er sich über Wasser halten konnte. Alessia war ihm eines Tages auf der Piazza Navona begegnet. Giacomo hatte sie angesprochen, ob sie ihm nicht Modell sitzen wolle, und sie hatte eingewilligt.
„Mach dich bereit, cara mia, ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen!“
Als der junge Maler ihr bei ihrem ersten Besuch in seiner Kammer eröffnet hatte, sie mit entblößtem Oberkörper malen zu wollen, hatte sie sich zunächst geziert. Schließlich hatte sie sich noch nie vor einem Mann nackt gezeigt. Doch Giacomo war es mit einem schmelzenden Blick aus seinen braunen Augen gelungen, sie zu überzeugen. Trotzdem wusste sie vor Scham nicht, wo sie hinschauen sollte, als sie ihre Kleider abgelegt hatte. Giacomo hatte die peinliche Situation mit ein paar lustigen Geschichten aus seiner Zeit in Perugia überspielt und ihr so nach und nach die Scheu genommen. Ihre Sitzungen mussten allerdings im Geheimen stattfinden. Hätten Alessias Eltern gewusst, was sich in der kleinen Dachkammer abspielte, hätten sie ihre fünfzehnjährige Tochter gewiss in das nächstbeste Kloster gebracht. Da sie ihr nicht erlaubten, ohne Begleitung in die Stadt zu gehen, war es einfacher für das Mädchen, sich nachts, wenn alle schliefen, aus dem Haus zu schleichen.
Alessia nahm auf dem Stuhl Platz und zupfte das transparente Tuch, das auf ihrem Schoß lag, zurecht. Es musste jedes Mal möglichst genauso fallen wie am ersten Tag.
„Dreh dein Gesicht noch ein wenig nach rechts!“, wies Giacomo sie an. „Ja, so ist es gut.“
Prüfend betrachtete er zuerst sein Modell und lenkte den Blick danach wieder auf die Leinwand. Mit der linken Hand griff er nach der Palette und mit der rechten nach einem Pinsel aus dem neben ihm stehenden Tongefäß. Dann konzentrierte er sich auf seine Arbeit.
Alessia genoss es, ihn in aller Ruhe beobachten zu können, sein weich fallendes Haar, die von dichten Wimpern umrandeten Augen, seine schmalen Hände mit den feingliedrigen Fingern, die solch großartige Kunstwerke auf die Leinwände zu zaubern vermochten. Giacomo war nur ein wenig größer als sie selbst. Über seinen Beinkleidern trug er einen bis zu den Knien reichenden, weiten Kittel, der über und über mit bunten Farbflecken versehen war. Sollte Alessia ihm gestehen, was sie für ihn empfand? Fühlte er das Gleiche für sie? Bisher hatte er außer einiger tiefer Blicke noch keinerlei Andeutungen gemacht. Und wenn es so wäre, wie ginge es dann weiter? Würde ihre Liebe bestehen können? Was würden ihre Eltern dazu sagen? Alessia kannte deren eigene Liebesgeschichte zur Genüge. Ihre Mutter, eine jüdische Stickerin, liebte ihren Vater, den Sohn eines christlichen Marqués. In Spanien, wo die beiden geboren und aufgewachsen waren, war eine solche Liebe aussichtslos, ja sogar verboten gewesen. Trotz vieler Schwierigkeiten hatten sie schließlich zueinandergefunden. Sie waren zusammen aus Kastilien geflohen und hatten hier in Rom unter einem anderen Namen ein neues Leben begonnen. Wenigstens konnte Alessia somit darauf hoffen, dass ihre Eltern bei der Wahl eines Ehegatten für ihre Tochter ein gewisses Maß an Toleranz zeigen würden.
„Alessia!“, riss Giacomo sie aus ihren Gedanken. „Bitte konzentrier dich und verändere nicht ständig deinen Ausdruck!“
Unverzüglich erschien wieder das zart angedeutete Lächeln auf ihrem Gesicht, das Giacomo bereits auf der Leinwand festgehalten hatte.
Nach zwei Stunden konnte sie nicht mehr still sitzen. Immer wieder musste sie gähnen und fühlte sich trotz des Feuers, das im Kamin brannte, durchgefroren.
„Lass uns aufhören für heute, Giacomo!“, bat Alessia den Maler. „Ich bin müde, und mir ist kalt.“
„Nur noch einen kurzen Augenblick, cara!“ Giacomo schaute angestrengt auf die Leinwand und setzte einige weitere Pinselstriche. „So, das wär’s! Die Feinheiten kann ich nun ohne dich zu Ende bringen.“
Bei seinen Worten stockte Alessia der Atem. So rasch hätte sie nicht mit dem Ende gerechnet. Hatte er nicht zuvor gesagt, er würde noch ein oder zwei Sitzungen benötigen? Sie erhob sich und griff nach ihren Kleidern. Jetzt sag ihm, was du für ihn empfindest, es ist die letzte Gelegenheit!, vernahm sie eine innere Stimme. Doch sie konnte sich nicht überwinden, ihm ihre Gefühle zu offenbaren.
Nachdem sie sich angezogen hatte, bot ihr Giacomo noch einen heißen Würzwein an, den sie gern annahm.
„Was glaubst du, wirst du das Porträt schnell verkaufen können?“, fragte sie und trank einen Schluck des köstlichen Getränks.
„Ich hoffe es.“ Giacomo blickte ihr tief in die Augen, sodass ihr ein wohliger Schauder über den Rücken lief. „Das Gemälde eines solch bezaubernden Geschöpfes wird gewiss rasch einen Liebhaber finden.“ Er nahm ihre Hand in die seine und strich mit seinem Daumen zärtlich über ihre Haut.
Verlegen senkte Alessia die Lider.
„Ich kann dir jederzeit wieder Modell sitzen“, schlug sie ihm beflissentlich vor.
„Ja, das wäre schön. Wenn es so weit ist, schicke ich dir eine Nachricht.“
Sie leerte den Becher und erhob sich. „Ich sollte jetzt besser gehen. Es ist schon spät geworden.“
Wie sonst auch begleitete Giacomo das Mädchen auf deren Rückweg bis zu ihrem Haus, da er sie mitten in der Nacht nicht allein gehen lassen wollte. Es war kalt, und so gingen sie Arm in Arm, um sich gegenseitig zu wärmen. Alessia genoss es, dem jungen Maler so nah zu sein. Schon bald bogen sie in die Via Pelamantelli ein und erreichten das Haus, in dem die Familie Bertorelli seit vielen Jahren wohnte. Giacomo gab dem Mädchen noch einen Kuss, bevor er sich verabschiedete.
„Wir sehen uns bestimmt bald wieder!“, sagte er. „Ich lasse es dich wissen, wenn ich das Bild verkauft habe.“
„Gut, und denke daran, ich kann dir wieder Modell sitzen, wann immer du willst.“ Am besten schon morgen, fügte sie in Gedanken hinzu.
Eine kurze Berührung ihrer Hände, ein letzter Blick, dann drehte sich Giacomo um und lief die Straße hinunter.
Alessia betrat das Haus erst, als sie ihn nicht mehr sehen konnte. Eine Träne lief an ihrer Wange hinab und verlor sich in der Flut ihrer dunklen Locken, die weit bis über ihre Brust reichten.
Giacomo ging schnellen Schrittes zurück in Richtung des Campo de’ Fiori. Auch er war nicht gern nachts in den dunklen Straßen Roms unterwegs, in denen zu später Stunde nicht nur allerhand finsteres Gesindel herumstrolchte, sondern ab und zu sogar wilde Wölfe ihr Unwesen trieben.
„Dio mio“, stieß er hervor, als ihm plötzlich aus einer Nebengasse zwei sich jagende Katzen vor die Füße sprangen und er beinahe gestolpert wäre.
Erleichtert atmete er auf, als er sein Wohnhaus vor sich liegen sah, wo er kurz darauf die Dachkammer betrat. Er legte seinen Umhang ab und zündete Kerzen und Kienspan an. Nachdenklich blickte er auf den Stuhl, auf dem vor nicht allzu langer Zeit Alessia gesessen hatte. Es war ihm, als hinge der frische Verbenaduft, der dem Mädchen anhaftete, noch in der Luft. Traurigkeit überkam ihn, als er das Porträt betrachtete und ihm bewusst wurde, Alessia nun nicht mehr sehen zu können. Er vermisste sie schon jetzt, ihr Lächeln, der Anblick ihrer zarten Figur. Wenn er daran dachte, dass er, um überleben zu können, gezwungen sein würde, das Gemälde zu verkaufen und bald ein anderer Mann in den Genuss käme, es jeden Tag anschauen zu dürfen, verspürte er ein eifersüchtiges Ziehen. Habe ich mich in Alessia verliebt?, schoss es ihm durch den Kopf. Wenn er ehrlich war, musste er die Frage bejahen. Er konnte sich ohne Weiteres vorstellen, sein restliches Leben mit der jungen Frau zu verbringen. Ein schöner Traum. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Was hatte er dem Mädchen schon zu bieten? Er war zwar ein begabter, aber dennoch armer und unbekannter Maler, der in einer schäbigen Dachkammer lebte und zumeist nicht wusste, ob er die nächste Miete noch würde zahlen können. Alessia hingegen entstammte einem wohlhabenden Elternhaus. Ihr Vater war ein angesehener Advokat. Niemals würde er seine Tochter einem mittellosen Künstler zur Frau geben.
Giacomo seufzte und verlor sich in den blaugrünen Augen Alessias, die ihm aus dem Porträt entgegenblickten.
2. Kapitel
Rom, Porta Laterana, Januar 1497
Es versprach ein herrlicher Tag zu werden, als die Sonne am nächsten Morgen hinter dem Horizont hervortrat und die Ruinen längst vergangener Zeiten in rötliches Licht tauchte. Obwohl es noch früh war und eine der winterlichen Jahreszeit angemessene, kühle Temperatur herrschte, war Rom bereits zum Leben erwacht. Auf den Gassen tummelten sich Fußgänger, Eselskarren und die edlen Kutschen der Adeligen. Die Bürger waren auf dem Weg zur Porta Laterana, um der Ankunft Jofré Borgias und seiner Gemahlin Sancia von Aragon, einer unehelichen Tochter des neapolitanischen Königs Alfonso II., beizuwohnen. Jofré war der jüngste Sohn des regierenden Papstes und lebte seit seiner Hochzeit mit Sancia in Neapel.
Auch die Familie Bertorelli wollte sich die bevorstehende Prozession nicht entgehen lassen. Alessias Mutter konnte ihre Tochter am Morgen nur mit viel Überredungskunst zu dem bevorstehenden Ausflug bewegen. Deren verquollene rote Augen waren ihr dabei nicht entgangen. Irgendetwas musste vorgefallen sein. Sie beschloss, Alessia in einem geeigneten Moment darauf anzusprechen.
Als sie an der Piazza del Laterano ankamen, hatte sich dort bereits eine große Anzahl Schaulustiger versammelt. Ein Stimmenwirrwarr, das an das Summen von Bienen erinnerte, erfüllte die Luft, und von überallher drang der Essensgeruch der auf die Schnelle aufgestellten Garküchen und Verkaufsstände.
„Hat der Papst eigentlich außer Jofré, Lucrezia und Cesare noch mehr Kinder?“, fragte Alessia.
Der Spaziergang an der frischen Luft tat ihr gut. Auf ihren blassen Wangen zeigte sich wieder ein Hauch von Farbe. Das Mädchen war ein Ebenbild seiner Mutter. Allerdings war Leas Haar bereits von Silberfäden durchzogen, um ihre Augen und den herzförmigen Mund hatten sich Fältchen eingegraben.
„Ja, da sind Juan, der eine Spanierin geheiratet hat, und noch zwei oder drei Ältere, die bereits gestorben sind“, antwortete Lea.
„Ich dachte immer, Kleriker dürften keine Kinder haben“, fuhr Alessia fort.
Wie ihre Mutter trug sie ein Samtkleid nach der neuesten Mode, mit angenestelten, geschlitzten Ärmeln und einem eng sitzenden Mieder, aus dem ein fein gefälteltes Leinenhemd hervorlugte, darüber einen pelzverbrämten Umhang.
„Das dürfen sie auch eigentlich nicht“, mischte sich nun Alvaro Bertorelli in das Gespräch ein. „Aber die hohen Herren geben ihre Söhne und Töchter als ihre Neffen oder Nichten aus. Alexander nicht, er hat all seine Kinder anerkannt.“
„Und wer ist die Mutter der Papstkinder? Lebt sie mit ihnen im Vatikan?“ Alessia wurde des Fragens nicht müde.
„Vannozza dei Cattanei, die Mutter von Juan, Cesare, Jofré und Lucrezia wohnt in einem Haus in der Stadt, nicht im Vatikan“, klärte Alvaro seine Tochter auf. „Dort lebt die augenblickliche Mätresse des Heiligen Vaters, Giulia Farnese-Orsini. Sie ist mit dem Sohn einer Cousine des Papstes verheiratet. Und nun genug gefragt, piccolina! Die Prozession muss jeden Moment ankommen.“
Alvaro legte den Arm um seine Tochter und küsste sie auf die Wange.
Alessia lächelte und lenkte ihren Blick auf einige Gaukler, die die wartende Menge mit Kunststücken unterhielten. Sie konnte gar nicht so schnell schauen, wie die bunten Bälle und Keulen der Jongleure durch die Luft flogen.
„Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange warten, ich bin durchgefroren.“ Lea zog sich ihren Umhang fester um den Körper. „Da vorn ist ein Essensstand. Ich werde uns ein paar Leckerbissen besorgen. Der köstliche Geruch verfolgt mich schon die ganze Zeit über.“
„Gute Idee!“, murmelte Alvaro und schaute seiner Gemahlin nach.
Fröstelnd rieb er seine kalten Hände aneinander. Mittlerweile bereute er es, seinen warmen, pelzgefütterten Umhang zu Hause gelassen zu haben. Das helle Brokatwams, das er über seinen braunen Beinkleidern trug, sah zwar edel aus, bot aber kaum Schutz vor dem kühlen Wind.
Kurz darauf kam Lea mit einer Handvoll dampfender Küchlein zurück. Gerade, als sie das köstliche Gebäck verspeist hatten, ertönten die ersten Fanfarenstöße, die die Ankunft des päpstlichen Empfangskomitees ankündigten. Vorneweg marschierten zwei Herolde, die die Wappen der Borgia und des Neapolitanischen Königshauses trugen. Ihnen folgten die in Purpur gewandeten Vertreter der Kardinalshaushalte, die Kommandeure der Vatikansgarde mit zweihundert Mann sowie die Gesandten Spaniens, Mailands, Neapels, Venedigs und des Heiligen Römischen Reiches, allesamt in Seide und Brokat gekleidet. Am Schluss der langen Kavalkade ritt Lucrezia Borgia auf einem prächtig geschmückten Pferd, um ihren Bruder und ihre Schwägerin persönlich in Empfang zu nehmen. Schon von Weitem leuchtete ihr Wahrzeichen, der grasende rote Stier auf goldenem Untergrund – das Symbol der päpstlichen Familie.
„Ist sie nicht wunderschön, Mama?“, rief Alessia, als sie Lucrezia erblickte. „Schau nur, diese glänzenden blonden Locken und die glitzernden Edelsteine auf ihrem Kleid!“
Lea blickte versonnen auf die kostbar gekleidete Papsttochter, die mittlerweile an den Anfang des Zuges geritten war.
„Mama, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?“ Alessia stupste ihre Mutter in die Seite.
„Was? Oh, eh, ja, sie ist wirklich eine Schönheit“, antwortete Lea.
Für einen Augenblick war es nicht Lucrezia gewesen, die sie dort auf dem feurigen Araberhengst gesehen hatte, sondern eine andere, ebenso stolze junge Frau mit kupferfarbenen langen Locken, in ein weißes, mit Löwen und Türmen besticktes Brokatkleid gehüllt – Isabel von Kastilien. Lea hatte sie einst bei einer Prozession durch Toledo bewundert. Wie immer, wenn sie an Spanien dachte, erfüllte Lea eine leise Wehmut. Obwohl sie viel gelitten hatte, blieb es dennoch das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen war, wo ihre Familie begraben lag und sie Alvaro kennengelernt hatte.
„Kein Wunder, dass sie so prachtvoll gekleidet ist“, fuhr Alessia fort. „Bestimmt will Lucrezia ihre Schwägerin übertrumpfen.“
„Alessia! Mäßige deinen Ton!“, rügte Alvaro seine Tochter mit strenger Miene, auch wenn er ihr im Geheimen zustimmen musste. Wahrscheinlich fürchtete die Tochter des Papstes um die Gunst ihres Vaters, der, wie jedermann wusste, dem weiblichen Geschlecht sehr zugeneigt war. Seine Mätresse Julia Farnese war nicht viel älter als Lucrezia selbst.
Plötzlich ertönten Rufe von allen Seiten: „Da sind sie! Sie kommen!“
Und tatsächlich war der sich nähernde Reisezug des Papstsohnes und seiner Gemahlin auf der anderen Seite des Stadttores zu sehen. Jofré und Sancia führten den Tross hoch zu Pferde an. Danach folgten die Gruppe ihrer Diener und dahinter die achtundzwanzig Maultiere, die mit ihrem Gepäck beladen waren. Sogar Narren und Zwerge befanden sich in ihrem Gefolge.
Die Gemahlin des Papstsohnes war ebenso wie ihre Schwägerin auf das Kostbarste gekleidet. Sie trug ein Gewand aus karmesinrotem Brokat, dessen Mieder über und über mit Perlen bestickt war, und einen mit Fell gefütterten Umhang. Auf ihrem dunklen Haar, das ihr bis zur Taille hinabreichte, saß ein goldenes Diadem. In ihrem Gesicht dominierten die großen dunkelbraunen Augen und lenkten von der leicht gebogenen Nase ab. Ihr Lächeln ließ sie strahlen. Der nicht minder festlich gekleidete Jofré Borgia wirkte neben seiner reifen, einige Jahre älteren Gemahlin unscheinbar.
Die Zuschauermenge beobachtete neugierig, wie sich das Paar und Lucrezia begrüßten. Die Papsttochter umarmte zuerst ihren Bruder, bevor sie Sancia rechts und links auf die Wangen küsste. Applaus und Jubelrufe schallten über den Platz.
„Wie sie sich beäugen, wie zwei lauernde Tiger“, sagte neben den Bertorelli eine Frau zu ihrem Mann.
„Was glaubst du, wer wird den Kampf um die Vormachtstellung in der Gunst des Papstes gewinnen?“
„Die Neapolitanerin hat gute Chancen“, antwortete der Angesprochene. „Sie ist jung und schön. Bestimmt wird sie auch Cesare und Juan nicht kalt lassen. Armer Jofré, es wird nicht leicht für ihn werden.“
Die jungen Borgia saßen wieder auf ihren Pferden auf. Der Zug, der nun doppelt so lang war, begann, sich langsam auf der Via Lata in Richtung Vatikan voranzubewegen. Viele der Schaulustigen schlossen sich an. Sie wollten keinesfalls die Ankunft des Paares im Vatikan und seine Begrüßung durch den Papst und Cesare verpassen.
Alvaro und seine Familie hingegen machten sich auf den Heimweg. Der Advokat hatte noch in seiner Kanzlei zu tun. Er vertrat einen neuen Klienten und musste sich in den Fall einarbeiten.
Allerdings kamen die drei nur langsam vorwärts, da sie zunächst den gleichen Weg wie die Kavalkade zurücklegen mussten. Sie wohnten am südlichen Rand des Stadtteils Regola, dort, wo dieser in das Sant’Angelo-Viertel überging, Es war Leas Wunsch gewesen, in der Nähe ihrer Glaubensgenossen zu wohnen, damit sie, wann immer es ihr möglich war, ihre jüdischen Freunde besuchen konnte. Auch wenn die Juden in Italien noch ein unbehelligtes Dasein fristen durften, hatte Alvaro bei ihrer Ankunft, vierzehn Jahre zuvor, seine Frau davon überzeugt, nach außen hin als Christin zu leben, obgleich Lea im Herzen ihrem Glauben treu geblieben war. In Kastilien war das Leben durch die von Königin Isabel und König Fernando eingeführte Inquisition für Juden und besonders für Konvertiten immer gefährlicher geworden. Lea hatte dies auf schmerzlichste Weise am eigenen Leibe erfahren müssen.
An der Ponte San Angelo überquerten die Prozession und das mitlaufende Volk den Tiber. Somit war der Weg für Alvaro und seine Familie wieder frei, und sie erreichten bald darauf ihr Heim in der Via Pelamantelli, ein stattliches, mehrstöckiges Gebäude mit einer Loggia auf der Vorderseite. Den großzügigen Innenhof hatte Lea, ähnlich den spanischen Patios ihrer Heimat, mit üppigen Pflanzen ausgestattet. Im Erdgeschoss befand sich Alvaros Kanzlei. Er hatte damals nach ihrer Ankunft in Rom ein Studium des Rechts absolviert und sich in all den Jahren einen Namen als Anwalt unter den römischen Bürgern gemacht. Mittlerweile zählte er die vornehmsten Adelsfamilien zu seinen Klienten.
Da er noch einiges aufzuarbeiten hatte, zog sich Alvaro in seine Kanzlei zurück, jedoch nicht, ohne seiner Frau noch einen Kuss auf die Stirn zu hauchen. „Ruhe dich ein wenig aus, meine Liebe!“, riet er ihr. „Es war ein anstrengender Marsch.“
„Du solltest das Gleiche tun, Alvaro! Du arbeitest zu viel!“ Lea strich ihrem Mann über den Arm.
„Mach dir um mich keine Sorgen! Wir sehen uns später beim Abendessen.“ Er winkte Lea und Alessia noch einmal zu, bevor sie im Eingang neben der Kanzlei verschwanden.
Erst jetzt bemerkte Alessias Mutter, dass sie sich in der Tat sehr erschöpft fühlte.
„Ich werde den Rat deines Vaters befolgen und mich eine Weile in meiner Schlafkammer ausruhen.“
Sie umarmte ihre Tochter kurz und zog sich zurück.
Alessia setzte sich in die Wohnstube vor den Kamin und nahm eine Stickerei zur Hand. Sie war sehr geschickt darin, zumal sie in ihrer Mutter eine exzellente Lehrerin hatte. Während sie mit einem rot glänzenden Seidenfaden an den Blüten einer Rosenranke arbeitete, wanderten ihre Gedanken zu Giacomo. Sie musste irgendeine Möglichkeit finden, den jungen Maler bald wiederzusehen.
Sollte sie ihm vielleicht doch beichten, dass sie ihn liebte? Sie konnte ihm ebenfalls nicht gleichgültig sein, das hatte sie während der letzten Wochen an seinen Blicken und den wie zufällig erscheinenden Berührungen bemerkt.
Sollte sie mit ihrer Mutter über ihre Gefühle für ihn sprechen? Vielleicht konnte Lea ihr einen Rat geben. Zumindest würde sie die Lage ihrer Tochter verstehen, hatte sie doch einst selbst um eine ausweglose Liebe gekämpft und gewonnen. Alessia lauschte nur zu gern den Geschichten ihrer Mutter aus deren Vergangenheit: Wie Alessias Großvater seine Tochter, nachdem er erfahren hatte, dass sie einen Christen liebte, einem jüdischen Weinhändler versprach und Lea immer wieder Gründe fand, die Hochzeit aufzuschieben. Wie sie schließlich am Hof Königin Isabels, wo Lea einen Wandbehang mit den Bildnissen der Infanten anfertigen sollte, Alvaro wieder begegnete. Er war mittlerweile zum königlichen Sekretär ernannt worden. Durch die Intrige einer in Alvaro verliebten Hofdame waren Lea und ihr Bruder Aaron in die Fänge der Inquisition geraten.
Erst in Rom hatte die Familie endlich den lang ersehnten Frieden gefunden.
Alessia öffnete die kleine Holzkiste, die neben ihr auf dem Tischchen stand, und entnahm ihr einen Strang grünes Seidengarn. Ja, sie war zufrieden mit ihrem Leben, einzig die Tatsache, dass sie keine Geschwister hatte, stimmte das Mädchen hin und wieder traurig. Aber nach ihrer eigenen schweren Geburt hatte Gott ihren Eltern keine weiteren Kinder mehr geschenkt.
Bevor Alessia den grünen Faden durch das feine Nadelöhr fädelte und sich danach den Blättern der Rosenranke widmete, erhob sie sich und legte noch zwei Holzscheite auf das Kaminfeuer. Die Flammen verbreiteten eine angenehme Wärme im Raum. Ein Blick durch das gegenüberliegende, bis zum Boden reichende Fenster verriet ihr, dass es bereits zu dämmern begann. Während Alessias Gedanken in die Vergangenheit abgetaucht waren, war die Zeit rasch vergangen. Ob ihre Mutter immer noch schlief? Sie beschloss, nach Lea zu schauen, um sie gegebenenfalls zu wecken, damit sie mit Sara, der Köchin, alles Erforderliche für das Abendessen besprechen konnten. Gewiss würde auch ihr Vater bald aus der Kanzlei nach oben in die Wohngemächer kommen.
Alessia legte ihre Stickarbeit auf den Tisch, verließ den Raum und stieg die Treppe zur dritten Etage hinauf. Bereits vor der Schlafkammer ihrer Eltern vernahm sie die angstvollen Schreie ihrer Mutter. Sie öffnete die Tür. Lea warf sich unruhig auf der Bettstatt hin und her.
„Mama, wach auf!“ Alessia setzte sich auf die Bettkante und berührte ihre Mutter sanft an der Schulter. Langsam kam Lea zu sich und blickte ihre Tochter verwirrt an.
„Schon wieder ein schlechter Traum, Mama?“, seufzte Alessia. „Wird dich denn die Vergangenheit nie in Ruhe lassen?“
Lea zuckte hilflos mit den Schultern und setzte sich auf.
„Was hat dich diesmal gequält?“ Alessia ergriff die Hand ihrer Mutter und drückte sie.
„Ich habe geträumt, ich wäre in Sevilla, in diesem scheußlichen Inquisitionskerker. Es war so kalt und dunkel.“ Lea räusperte sich. „Ich lag wieder auf diesem schimmeligen, stinkenden Stroh und musste mich ständig übergeben, wohl auch, weil ich bereits mit dir schwanger ging. Aber dann kam dieser schreckliche Aufseher, der mir immer das Essen brachte, eine wässrige übel riechende Suppe. Er sagte mir, wenn ich nett zu ihm wäre, würde er mir ein Stück Fleisch und Kerzen bringen.“ Lea schüttelte sich bei dem Gedanken an den grobschlächtigen ungewaschenen Kerl, der ihr seinen fauligen Atem ins Gesicht geblasen hatte. „Als ich mich weigerte und ihm sagte, er solle sich zum Teufel scheren, da hat er …“ Lea brach ab, als ihr erneut die Tränen über die Wangen liefen.
„Es war ein Traum. Denk nicht mehr daran! Das alles liegt lange zurück.“ Mit einer zärtlichen Geste wischte Alessia ihrer Mutter die Tränen ab. „Komm, lass uns hinuntergehen! Papa wird bald zum Abendessen kommen.“
Üblicherweise nahm die Familie die cena, das letzte Mahl des Tages, gemeinsam ein. Mittags war das nicht immer möglich, da Alvaro oft in der Kanzlei oder im Gericht zu tun hatte. So versammelten sich die Bertorelli auch an diesem Abend an der langen Tafel in dem nur für die Mahlzeiten genutzten Zimmer. Sie unterhielten sich über die Prozession, während ihr Diener Ricardo die Speisen auftrug, die auf der großen, stets mit einer Vase mit frischen Schnittblumen geschmückten Anrichte bereitstanden. Die Fenster, die dem Raum Helligkeit spendeten, wurden von Vorhängen eingerahmt, dessen beigefarbener Stoff zu den mit Brokat bezogenen Stühlen passte. Bunte Wandbilder, die Lea im Laufe der Jahre angefertigt hatte, schmückten die holzvertäfelten Wände. Da Lea in ihrem Haus wieder nach den mosaischen Regeln lebte, hatten sie eine ehemalige Jüdin als Köchin eingestellt, die für Lea koschere Speisen zubereitete. Alvaro hatte jedoch darauf bestanden, Alessia katholisch zu erziehen, später aber Leas Drängen nachgegeben, ihrer Tochter zumindest den jüdischen Glauben näherbringen zu dürfen. So kam es, dass Alessia ihre Mutter des Öfteren in das Judenviertel nach Sant’Angelo begleitete, wo sie zusammen mit Freunden jüdischen Festlichkeiten beiwohnten.
Als die Familie schließlich beim Dessert angelangt war, betrat eine Dienerin das Zimmer.
„Signor Avocato“, wandte sie sich an den Hausherrn. „Am Haupttor bittet ein Bote um Einlass. Er sagt, er hätte eine dringende Nachricht für Euch aus Spanien.“
Alvaro und Lea blickten sich überrascht an. „Aus Spanien?“ Lea zog skeptisch eine Augenbraue nach oben.
Außer Alvaros Eltern und seinen Brüdern, die immer noch in Toledo lebten, wusste niemand von ihrem Aufenthaltsort in Rom.
„Der Mann kann nur im Auftrag meiner Familie gekommen sein“, überlegte Alvaro. „Hoffentlich ist nichts passiert. Lass ihn eintreten, Anna und führe ihn in die Küche!“, forderte er die Dienerin auf. „Sara soll ihm dort etwas zu essen und zu trinken geben! Ich komme gleich nach.“
„Sehr wohl, Signor Avocato.“ Anna knickste und wandte sich zum Gehen.
„Nein, warte! Ich komme sofort mit und rede selbst mit dem Mann.“ Alvaro erhob sich und verließ zusammen mit Anna den Raum.
Der Bote wartete noch immer vor dem Tor, als Alvaro ihn kurz darauf ansprach.
„Ihr habt eine Nachricht für mich?“
„Ja, für Don Alvaro de Salvatierra von Don Pedro de Salvatierra aus Toledo“, antwortete der Bote und überreichte Alvaro einen versiegelten Brief und ein mit Intarsien verziertes verschlossenes Holzkästchen.
„Vielen Dank. Anna wird Euch in die Küche führen! Dort bekommt Ihr etwas zu essen und zu trinken, und wenn Ihr wollt, könnt Ihr im Haus übernachten“, schlug Alvaro dem Mann vor, der dieses großzügige Angebot dankend annahm und Anna ins Innere des Hauses folgte.
Alvaro blieb noch einen Augenblick vor der Tür stehen und betrachtete nachdenklich den Brief und das Kästchen. Er kehrte nicht ins Speisezimmer zu seiner Familie zurück, sondern begab sich unmittelbar in die Bibliothek. Dort nahm er an seinem Schreibtisch Platz und öffnete als Erstes den Brief. Er erkannte sofort die kleine, eng gesetzte Schrift seines Vaters und begann zu lesen:
Valladolid, den 28. Dezember, anno domini 1496
Mein lieber Sohn,
ich muss Dir leider eine traurige Nachricht übermitteln. Gestern Nacht ist Deine Mutter von uns gegangen. Sie lag schon seit einiger Zeit krank danieder, und so ist mein einziger Trost, dass Gottes Heimholung für sie selbst eine Erlösung gewesen sein muss. Für uns, die wir hier auf Erden zurückgeblieben sind, ist der Verlust jedoch umso schlimmer.
Mein lieber Alvaro, bevor Deine Mutter ihren letzten Atemzug tat, musste ich ihr versprechen, Dir dieses versiegelte Kästchen zukommen zu lassen, was, wenn Du diese Zeilen liest, geschehen ist. Sie konnte mir leider nicht mehr erklären, was sich darin verbirgt, und so hoffe ich, Du wirst es mir irgendwann erzählen.
Alvaro, mein sehnlichster Wunsch wäre, Dich noch einmal zu sehen, bevor auch ich das Zeitliche segnen werde. Doch ich glaube nicht, dass Gott mir diese Gnade gewähren wird. Ich fühle, wie meine Kräfte von Tag zu Tag nachlassen.
Ich hoffe, Dir und Deiner Familie geht es gut, und Ihr könnt in Frieden leben. Sei gegrüßt von Deinen Brüdern und Deinem dich liebenden, trauernden Vater
Pedro, Marqués de Salvatierra
Langsam ließ Alvaro den Papierbogen auf das Schreibpult sinken. Während ihm Tränen über die Wangen liefen, erschien ihm das Bild seiner Mutter, ihre gütigen braunen Augen auf sich gerichtet, so wie er sie vor vielen Jahren zum letzten Mal gesehen hatte. Er war der jüngste der drei Brüder und hatte immer ein besonders inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Alvaro glaubte, ihre kühle Hand auf seiner Schulter zu spüren, eine Geste, mit der sie ihn oft während der hitzigen Diskussionen mit seinem Vater zu beschwichtigen versucht hatte. Er verspürte ein Gefühl der Wut in seinem Inneren. Warum hatte ihm Pedro nicht früher geschrieben, dass seine Mutter krank war? Wenn er es gewusst hätte, hätte er nach Toledo reisen und sie noch einmal sehen können. Alvaro wischte sich über die Augen und lenkte seine Aufmerksamkeit nun auf das vergoldete Kästchen. Es war verschlossen, nur mithilfe eines Dolches, den der Advokat aus einer Schublade seines Sekretärs hervorholte, gelang es ihm, das Vermächtnis seiner Mutter zu öffnen. An der Innenseite des Deckels war ein kleiner Spiegel befestigt, das Kästchen selbst mit dunklem Samt ausgeschlagen. Als Erstes sah Alvaro einen Ring. Vorsichtig nahm er das Schmuckstück in die Hand und betrachtete es eingehend. Es war aus Gold gefertigt, mit einem eingravierten Stier, in dessen Auge ein Rubin funkelte. Außer dem Ring kamen noch zwei weitere versiegelte Briefe zum Vorschein. Der eine war mit dem Namen Rodrigo Borgia versehen, der andere war an Alvaro selbst adressiert. Diesen nahm er als Erstes zur Hand und brach hastig das Siegel auf. Sofort erkannte er, dass seine Mutter den Brief verfasst hatte, und so kamen ihm erneut die Tränen. Alles um sich herum vergessend, begann er zu lesen.
3. Kapitel
Im Vatikan
Langsam näherte sich die Prozession mit Lucrezia, Sancia und Jofré dem Vatikan. An der Engelsburg, dem einstigen Mausoleum Kaiser Hadrians, das nun den Päpsten bei Gefahr als befestigter Zufluchtsort diente, überquerte der Tross den Tiber. Schon von Weitem war der riesige, Schwert schwingende Engel auf dem Dach zu erkennen gewesen. Die Bauarbeiten, die Papst Alexander an der Festung in Auftrag gegeben hatte, standen kurz vor der Fertigstellung. Eine Weile zog das Gefolge am Ufer des stinkenden Flusses entlang, passierte das Borgo-Viertel und erreichte den Petersplatz. Auch hier hatte Alexander seit seinem Amtsantritt einige Verbesserungsarbeiten durchgeführt. Er hatte den vormals ansteigenden, löcherigen Platz begradigen und mit Pflastersteinen versehen lassen sowie den von Innozenz VIII. begonnenen Marmorbrunnen vollendet.
Alexander und Cesare standen hinter einem Fenster der päpstlichen Gemächer in der Curia Superiore und betrachteten den Zug der Neuankömmlinge. Das Herz des Papstes schlug vor Aufregung schneller, als er endlich Jofré entdeckte. Das dunkel gelockte Weib, das zwischen seinem Sohn und Lucrezia ritt, musste seine Schwiegertochter sein. Dem Papst gefiel, was er sah. Er spürte, wie sich sein Phallus regte. Obwohl er die Sechzig bereits überschritten hatte, war der Heilige Vater nach wie vor dem weiblichen Geschlecht zugetan. Er war immer noch eine stattliche Erscheinung, zwar etwas korpulenter, aber groß gewachsen, mit braunen Augen und vollen Lippen. Einzig das fliehende Kinn und die gebogene Nase trübten sein Schönheitsbild.
„Cesare, komm, lass uns hinuntergehen und die Ankömmlinge begrüßen!“, forderte er seinen Sohn auf.
Cesare blieb am Fenster stehen und betrachtete ebenfalls die Frau seines Bruders. Wie konnte es nur sein, dass der unscheinbare Jofré, der gerade einmal fünfzehn Lenze zählte, solch ein Rasseweib hatte heiraten dürfen?
Er strich sich eine Strähne seines schulterlangen rotbraunen Haares aus dem Gesicht. Der zum Erzbischof von Valencia ernannte junge Mann, der bereits einen Kardinalshut besaß, war von auffallendem Äußeren, hoch gewachsen und muskulös. Sein längliches Gesicht trug die fein gezeichneten Züge seiner Mutter Vannozza dei Cattanei: mandelförmige braune Augen und eine lange Nase mit einem hohen Rücken. Seine Tonsur war so klein, dass man sie kaum bemerkte.
Seine kirchliche Laufbahn bedeutete Cesare gar nichts. Viel lieber hätte er sich wie sein Bruder Juan der Kriegsführung gewidmet. Darin lag seine wahre Leidenschaft.
Cesare löste den Blick von der Neapolitanerin, strich die rote Kardinalsrobe glatt, in die er sich seinem Vater zuliebe gehüllt hatte, und folgte Alexander nach unten. Dieser begrüßte bereits überschwänglich Sancia und Jofré. Lucrezia wiederum betrachtete die Szene mit ernster Miene, wie Cesare feststellte. Wahrscheinlich war auch ihr das glänzende Aufblitzen in den Augen ihres Vaters aufgefallen, als er Sancia in die Arme schloss, nachdem sie seinen Amtsring, den sogenannten Fischerring, geküsst hatte.
„Na Schwester, jetzt bekommst du eine Mitstreiterin in der Gunstzuweisung unseres Vaters“, flüsterte Cesare Lucrezia ins Ohr.
„Das glaube ich kaum“, erwiderte sie hochnäsig. „Und du solltest daran denken, dass sie auch für dich eine verbotene Frucht ist. Sie ist die Frau unseres Bruders!“
„Wir werden sehen, liebe Lucrezia, wir werden sehen!“, sagte er und erntete dafür einen bösen Blick von seiner Schwester.
Der Papst drehte sich zu Cesare um und stellte ihm Sancia vor. Mit aufrechtem, alles andere als schüchtern zu nennendem Blick betrachtete Jofrés Gemahlin ihren Schwager, bevor dieser sich hinabbeugte und sie rechts und links auf die Wangen küsste.
Die Gruppe hatte vor den Stufen der Peterskirche angehalten, zu deren Seiten je eine große Statue der Apostel Petrus und Paulus aufgestellt war. Sancia betrachtete das christliche Gotteshaus und konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen. Grau und vernachlässigt ragte das Gebäude in die Höhe, der Campanile, der Glockenturm, schien dem Einsturz nahe zu sein.
„Sieh, mein Kind, dort hinten werdet ihr wohnen“, wandte sich der Papst an Sancia und zeigte auf Santa Maria in Portico, einen links an die Kirchenmauer anschließenden Palast, der im ersten Stock eine Loggia aufwies. Dort lebten Lucrezia, Adriana di Milo, die dem Frauenhaushalt vorstehende Cousine des Papstes, und Alexanders Geliebte Giulia Farnese-Orsini.
„Dann seid ihr ganz in meiner Nähe. Heute Abend werde ich euch mit einem Festmahl in meinen privaten Gemächern willkommen heißen.“
„Ich freue mich schon darauf, Eure Heiligkeit. Ich würde mich nur vorab gern ein wenig ausruhen, die Reise war beschwerlich“, antwortete Sancia.
„Aber natürlich, mein Kind. Lucrezia wird euch eure Gemächer zeigen.“ Der Papst griff nach Sancias Arm und zog sie an sich. „Ach wie herrlich ist es, nun von zwei so schönen Töchtern umgeben zu sein.“
Zum Glück bemerkte Alexander die tödlichen Blitze nicht, die aus den Augen seiner Tochter schossen.
Einige Stunden später versammelte sich die päpstliche Familie zusammen mit Giulia und Adriana di Milo zur cena in der Sala dei Santi, dem Saal der Heiligen. Der Pontifex saß am Kopfende des langen Tisches und schaute zufrieden auf seine Lieben. Sancia und Lucrezia, mit kostbaren Gewändern angetan, hatten zu seiner Rechten und Linken Platz genommen. Alexanders Schwiegertochter blickte sich staunend um. Sämtliche Wände und die Lünetten der Decke waren mit Fresken verziert.
„Gefallen dir die Malereien, Sancia?“, fragte Alexander. „Pinturicchio hat sie erst vor Kurzem beendet.“
„Sie sind wunderschön“, antwortete die Neapolitanerin. „Einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Die Frau dort drüben zum Beispiel sieht aus wie Lucrezia.“
Sancia deutete auf ein Mädchen mit blonden wallenden Locken, das zusammen mit einer bunt gewürfelten Gesellschaft vor einem Thron stand.
„Das ist die heilige Katherina von Alexandrien“, erklärte der Papst lächelnd. „Sie will den Kaiser Maxentius und die fünfzig größten Gelehrten des römischen Weltreiches von den ewigen Wahrheiten des Christentums überzeugen. Und du hast recht. Pinturicchio hat ihrem Gesicht die Züge meiner schönen Lucrezia gegeben.“ Er strich seiner Tochter zärtlich über die Wange. „Auch die Gesichter meiner Söhne kannst du bewundern, meine liebe Sancia. Pinturicchio hat sie in der Sala dei Misteri verewigt. Die Grabeswächter der ‚Auferstehung Christi‘ tragen die Züge von Cesare, Jofré, Juan und meinem bereits verstorbenen Erstgeborenen Pedro-Luis. Ich werde dich morgen herumführen und dir alles zeigen.“
Die Diener brachten die Platten mit dem Essen herein. Obwohl der Papst an seiner privaten Tafel üblicherweise nur ein Gericht servieren ließ, weil er zumeist allein speiste, hatten die Köche an diesem Abend ein reichhaltiges Menü vorbereitet. Alexanders Gäste ließen sich die gebratenen Rebhühner, das zarte Rehfilet und den gesottenen Fisch munden, während sie angeregt plauderten.
Cesare betrachtete immer wieder schmunzelnd seine Schwester, die schmollte wie ein verzogenes Kleinkind. Sowohl Lucrezia als auch Giulia passte die Aufmerksamkeit, die der Papst seiner Schwiegertochter angedeihen ließ, überhaupt nicht. Allerdings behagte sie auch Cesare nicht. Schließlich hatte er vor, sich die Neapolitanerin in sein eigenes Bett zu holen. Zum Glück fehlte der dritte der Papstbrüder – Juan, der Herzog von Gandía –, ebenfalls kein Kostverächter der Weiblichkeit. Der Lieblingssohn des Heiligen Vaters war zurzeit mit dem Angriff gegen die Orsini beschäftigt und belagerte deren Festung bei Bracciano. Alexander hatte seinem Sohn vor Beginn des Krieges den Titel des Generals der Kirche verliehen und ihn zum Oberbefehlshaber der päpstlichen Truppen auserkoren, ein verhängnisvoller Fehler in Cesares Augen. Er kannte seinen Bruder nur zu gut und wusste, dass Juan in der militärischen Kunst weder über Erfahrung noch über Talent verfügte. Trotzdem setzte der Papst seine ganze Hoffnung in seinen Lieblingssohn und hatte ihm zudem den Herzog von Urbino, den Sohn des großen Condottiero Federico di Montefeltro, zur Seite gestellt. Dieser verfügte zwar über mehr Kampferfahrung als Juan, litt aber an der Gicht, was seine Bewegungsfähigkeit stark einschränkte. Zu Anfang konnten die päpstlichen Truppen einige Erfolge verbuchen, doch nun belagerten sie schon seit einigen Wochen die Festung bei Bracciano und hatten herbe Verluste einfahren müssen. Die Orsini würden schon bald für Verstärkung sorgen, dessen war sich Cesare sicher. Die Niederlage nahte.
Die Diener brachten die Nachspeisenplatten herein, köstlich aussehendes Marzipankonfekt, Mandelpudding mit Quittengelee und kandierte Früchte. Jofré nahm eine Praline, steckte sie Sancia in den Mund und gab ihr einen Kuss. Cesare beobachtete die Szene mit einem ironischen Lächeln. Seinem kleinen Bruder stand die Verliebtheit ins Gesicht geschrieben. Nur wie wollte der blasse, unscheinbare Jofré eine Frau wie sie auf Dauer befriedigen? Während Jofré fortfuhr, seine Gemahlin mit Süßigkeiten zu füttern, fing Cesare einen Blick aus Sancias dunklen Augen auf, in dem weder Bescheidenheit noch Zurückhaltung zu lesen war.
„Wo ist eigentlich dein Gemahl, Lucrezia?“, fragte Jofré. „Befindet er sich nicht in Rom?“
„Nein er ist in Pesaro“, antwortete seine Schwester. „Ich erwarte ihn aber bald zurück.“
„Lucrezia kann es kaum abwarten, Giovanni endlich wieder in ihre Arme zu schließen, nicht wahr, Schwesterherz?“ Cesare grinste sie anzüglich an.
„Lass deine dummen Bemerkungen, Cesare!“, rügte Lucrezia ihn und blickte ihm eindringlich in die Augen.
Cesare wusste, dass Lucrezia ihren Gemahl nicht liebte, und er wusste auch, wem ihr Herz stattdessen gehörte. Verschwörerisch zwinkerte er seiner Schwester zu.
Lucrezia war ein Jahr, nachdem Alexander den Heiligen Stuhl bestiegen hatte, mit dem unehelichen Sohn des Grafen von Pesaro vermählt worden, der wiederum ein Cousin Ludovico Sforzas war. Der Pontifex hatte es für nützlich erachtet, sich mit der mächtigen Sforza-Familie zu verbinden, die in Mailand und in Pesaro herrschte. Lucrezia empfand nichts für den vierzehn Jahre älteren Giovanni, der noch nicht einmal bei seinen eigenen Untertanen beliebt war, weil er als feige, launisch und cholerisch galt.
Später, als sich die Gesellschaft aufgelöst hatte, zog sich Lucrezia in ihre Gemächer zurück. Ihre Dienerin Pantasilea half ihr, das Nachtgewand anzulegen, und während die Zofe ihr die langen, bis zur Taille reichenden Locken bürstete, überdachte Lucrezia noch einmal die Ereignisse des Tages.
„Wie gefällt dir die Gemahlin meines Bruders?“, fragte sie ihre Zofe.
„Sie ist eine gut aussehende Frau“, befand Pantasilea. „Ich bin mir nicht sicher, ob Euer Bruder ihr gewachsen sein wird, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Madonna.“
„Dessen bin ich mir auch nicht sicher“, murmelte Lucrezia. „Auf jeden Fall scheint sie großen Eindruck sowohl auf meinen Vater als auch auf Cesare gemacht zu haben. Au!“ Lucrezia zuckte zusammen und griff mit der rechten Hand an ihren Hinterkopf.
„Oh, verzeiht, Madonna!“, entschuldigte sich die Dienerin. „Da hat sich ein Knoten gebildet.“
Vorsichtig zog sie die Bürste immer wieder durch die besagte Strähne.
„Sancia konnte ihren Blick ebenfalls nicht von Cesare lassen“, sagte Lucrezia. „Ich habe genau beobachtet, wie sie immer wieder zu ihm hinübergeschaut hat und er zu ihr.“
„Was hab ich getan?“, ertönte da eine Stimme.
Lucrezia fuhr herum und sah ihren Bruder Cesare in der Türöffnung stehen. Er hatte seine kirchlichen Gewänder abgelegt und trug anliegende Tricothosen und ein dunkles Wams. Lucrezia konnte nicht verhindern, dass ihr Blick auf seine sich unter dem engen Stoff abzeichnenden muskulösen Oberschenkel fiel und zu der hervorstehenden Braguette, die die Stelle seines Gemächts bedeckte und betonte.
Lucrezia erhob sich und bat Pantasilea, sie allein zu lassen. Als die Zofe den Raum verlassen hatte, ging sie auf ihren Bruder zu.
„Ich habe nur soeben erwähnt, dass du und unser Vater sehr angetan wart von unserer neuen Schwägerin.“
„Oh ja, sie ist wunderschön und sehr fraulich.“ Lächelnd betrachtete Cesare Lucrezia, der offensichtlich nicht bewusst war, dass der durchsichtige Stoff ihres Nachtgewandes im Schein des Kerzenlichtes viel mehr von ihrer Figur enthüllte, als ihr lieb gewesen wäre.
„Aber sie wird niemals die Stelle meiner bezaubernden Schwester einnehmen können“, schmeichelte Cesare und zog Lucrezia in seine Arme.
„Vergiss niemals, ich liebe nur dich!“ Er küsste sie auf den Mund. „Und nun schlaf gut und träum etwas Schönes!“
***
Via Pelamantelli
„Alvaro, mein Lieber, hier bist du. Wir haben auf dich gewartet.“ Lea und Alessia betraten die Bibliothek, wo der Advokat, den Kopf auf beide Hände gestützt, noch immer an seinem Schreibtisch saß. Vor ihm lagen das Kästchen und die Briefe.
„Was ist geschehen, Alvaro? Gibt es schlechte Nachrichten?“ Lea näherte sich ihrem Mann und umschlang seinen Oberkörper mit ihren Armen. Alessia blieb vor dem Schreibpult stehen.
„Meine Mutter ist gestorben.“
„Oh nein, Liebster, wie furchtbar. War sie krank?“ Lea blickte in das Gesicht ihres Mannes und erkannte seinen Schmerz. Auch Alessia umarmte ihren Vater.
„Ja, Pedro schreibt, sie sei schon seit einiger Zeit nicht mehr wohlauf gewesen. Aber das ist noch nicht alles, Lea. Hier, lies diesen Brief meiner Mutter!“
Ein ungutes Gefühl beschlich Lea.
„Alessia, lass uns bitte allein!“, forderte sie ihre Tochter auf.
„Nein, ist schon gut. Bleib, mein Kind! Die Sache betrifft uns alle.“
Er reichte seiner Gemahlin das Schreiben. Lea, die in Jugendjahren von ihrem Vater im Lesen und Schreiben unterrichtet worden war, überflog die Zeilen. Ungläubigkeit spiegelte sich in ihren Gesichtszügen wider, während sie das Ungeheuerliche zur Kenntnis nahm.
„Nicht Pedro ist dein richtiger Vater, sondern Rodrigo Borgia?“
„Papst Alexander?“ Alessia schlug die Hände vor den Mund.
Alvaro nickte stumm. Lea legte den Brief aus der Hand und ließ sich auf einen gepolsterten Sessel fallen.
„Es ist damals passiert, als der Heilige Vater in Valencia studierte. Meine Mutter war bereits mit meinem Vater verheiratet und hatte zwei kleine Söhne. Sie hat mir einmal erzählt, dass sie sich eine Zeit lang in Valencia aufgehalten





























