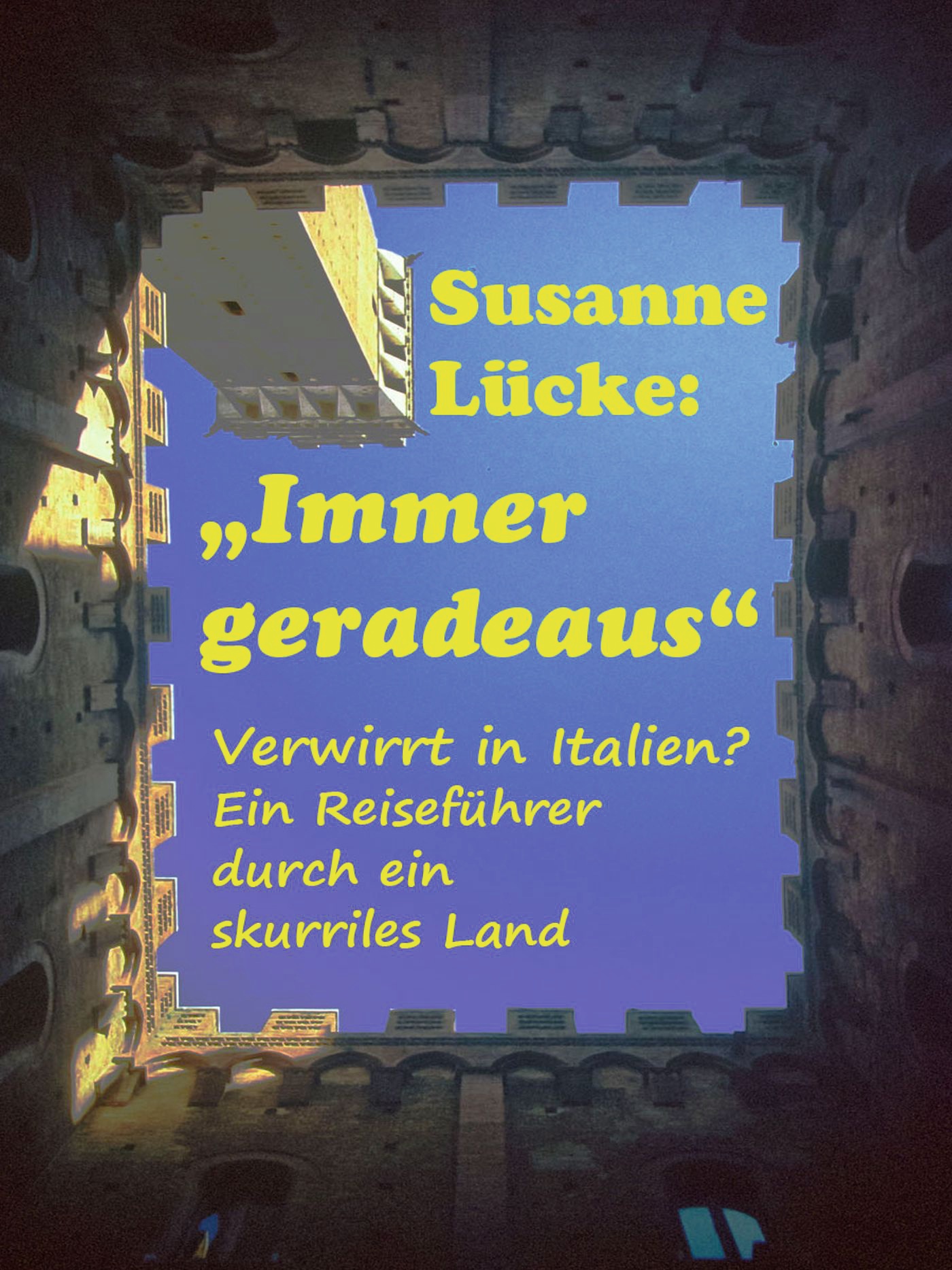
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Skurrile und nachdenkliche Geschichten über Land und Leute aus Italien, dem Land der unvorhersehbaren Möglichkeiten. In Teilen ein wehmütiger Rückblick auf ein exotisches Land, das unter europäischem Einfluss viel von seinem charmanten Chaos verloren hat, und das dennoch seine Eigenart nicht verleugnen kann. Alles ist ein wenig anders als in einem wohl organisierten Land: Zeit ist eine unbekannte Größe, Natur ein Fremdkörper, Vergesslichkeit eine Volkskrankheit, Leidenschaft ein Fatum, gegen das man machtlos ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Gut Ding braucht Weile
Acqua alta in Venedig
Chronos kann kein Italiener sein
Der Speck von Colonnata
Abfahren ist weniger das Problem, aber ankommen
Natur – ja, wenn sie essbar ist
Sie nennen sie zärtlich „Madonnina“
Tradition
Ein Essen auf dem Land
Mit zweihundert Sachen
Die misslungene Emanzipation
Eine Wallfahrt nach Lourdes
Von Kindern in der Schnapsbrennerei
Campo Santo
Ewiges Rom
Moribundus te salutat,
Impressum
Vorbemerkung
Das Porträt eines Landes zu zeichnen, das viele ausgeprägte Gesichter hat, ist, zugegeben, ein schwieriges Unterfangen. Um jedoch dem üblichen Einwand, man müsse „differenzieren“, zuvorzukommen, stelle ich mit Entschiedenheit fest: Man kann differenzieren, man sollte es auch, aber man muss es keineswegs. Stellen wir uns zwei Maler vor, die die Alpen auf die Leinwand bringen sollen. Der eine vertieft sich in eine Almwiese, hinter der ein steiler Fels aufsteigt; er malt die Wiese mit ihren Blumen, den Schmetterlingen, Käfern und Fliegen, dass man all ihre Beine zählen kann, vielleicht die Tautropfen auf den Grashalmen. Er differenziert gleichsam. Der andere wirft mit ein paar pastosen Pinselstrichen den Alpenkamm mit seinen Erhebungen und Taleinschnitten, mit Licht- und Schattenpartien auf die Leinwand und gibt sich mit keinem einzigen Detail ab – zwei Bilder, wie sie verschiedener nicht sein könnten, und dennoch zeigen beide ein und denselben Gegenstand: die Alpen.
Gewiss, Mailand ist nicht Lecce, Rom nicht Florenz, Neapel nicht Verona. Und doch: all das ist Italien.
Immer geradeaus – „sempre diritto” – das ist in Italien die allgemein gängige Antwort auf eine Frage nach dem Weg. Doch es ist weit mehr als das. Es ist das Prinzip italienischen Lebens schlechthin. Italiener laufen immer in der Zielgeraden, sofern sie das Ziel selbst bestimmen dürfen, was sie für sich selbstredend in Anspruch nehmen, und vorausgesetzt, es bieten sich keine Um- und Abwege, die Abwechslung und Unterhaltung verheißen.
Egal ob auf gerader Strecke oder gewundenen Pfaden, der Italiener hat nicht eben viel Sinn fürs Verweilen. Das erklärt vielleicht, weshalb es in diesem schönen Land so wenige Sitzgelegenheiten gibt, weshalb keine richtigen Kaffeehäuser (jedenfalls nicht jenseits des Veneto, dem das Flair alt-österreichischer Kultur hartnäckig anhaftet), weshalb man seinen Cappuccino und die Pasta, das Cornetto zum Frühstück in der Bar im Stehen einnimmt, während man die Zeitung liest, die auf der Eistruhe ausgelegt ist, und draußen der laufende Motor des Zweirads im Haltverbot die Luft verpestet, was so viel heißt wie: Bin sofort zurück, was wiederum im Originaltext „torno subito“lautet, worüber weiter unten ausführlicher zu handeln sein wird.
Offenkundig ist hier also das Verlangen, eine sitzende Haltung einzunehmen, wenig ausgeprägt. Dafür fehlt dem Italiener einfach die Geduld. Geduld beansprucht Zeit, viel zu viel Zeit. Ein Gast, der im Restaurant, unentschlossen in seine Speisekarte vertieft, den Ober auf die Bestellung warten lässt, stellt dessen Geduld auf eine harte Probe; er ist übrigens mit Sicherheit ein Ausländer, vermutlich ein Deutscher. Der Ober fragt streng: „Da bere?“ (ausbuchstabiert heißt das: „Was möchten Sie trinken?“), und danach: „Primo?“, im Volltext: Was möchten Sie als ersten Gang haben? Wer auf die Frage „Secondo?“ nicht sofort antwortet, strapaziert schon wieder ungebührlich die Nerven des Obers. Der Gast hingegen, sofern er Italiener ist, entspricht den Erwartungen der Gastronomen und verdrückt selbst ein Viergängemenü in höchst ungesunder Geschwindigkeit, und es versteht sich, dass er nach Beendigung des Mahls alsbald seinen Platz räumt. Langes Sitzen bei immer noch einem Bier oder Glas Wein oder Herumhängen an der Bar sind italienischen Gastronomen ein Grauen.
Der Italiener liebt also das Tempo. Er spricht schnell, isst schnell und läuft schnell. Vielleicht ist das ein Erbe der alten Römer, die als Erfinder des Geschwindmarsches gelten, der sich bei den verwunderlichen Paraden der Bersaglieri sogar bis in die letzte Nachkriegszeit erhalten hat. Und sie sind – vielleicht auch das ein Erbe der antiken Vorfahren – pragmatisch knapp. Erstehen Sie in einer Bar zum Beispiel eine Flasche Mineralwasser, fragt der Barista nicht etwa umständlich: Soll ich die Flasche aufmachen? Nein, er sagt nur: „Apro?“ – öffne ich?
Knapp und zügig mögen sie es, unsere südlichen Nachbarn, und ohne Umschweife. Direktheit charakterisiert auch den verbalen Umgangston, was unsere erste Geschichte zu illustrieren vermag.
Gut Ding braucht Weile
Der oben erwähnte Mangel und der offenkundig geringe Bedarf an Sitzgelegenheiten gilt freilich nicht uneingeschränkt.
Schauplatz: eine Toilette für Damen („per donne“) irgendwo an der Autobahn im Veneto. Gezahlt wird am Eingang bei einer älteren, korpulenten netten Frau in schwarzem Kittel an einem Tischchen, auf dem ein kleiner Korb mit Münzen steht. Die Dame vor mir kramt in ihrem Portemonnaie, findet kein Kleingeld, und den großen Schein kann die Klofrau nicht wechseln. Die ist großzügig und winkt die Kundin durch. Menschlichkeit siegt. Das ist das Kapital dieses Landes.
Die Riegel der beiden (mehr gibt es nicht) Kabinen stehen auf besetzt, „occupato“. Während sich die Tür der einen Kabine in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen öffnet, eine Dame herauskommt und eine hineingeht, bleibt die andere verschlossen. Vergebens wartet eine immer länger werdende Schlange auf das erleichternde Rauschen der Wasserspülung. Es dauert schon eine schiere Ewigkeit, und der Drang in der eigenen Blase veranlasst die der Türe zunächst Stehenden, energisch gegen die Tür zu klopfen. Drinnen keine Reaktion.
So eilig habe ich’s nicht – Gelegenheit, über das Phänomen „gabinetto“, auch „bagno“ genannt, zu sinnieren. Beinahe ein wenig wehmütig denke ich heute, in Zeiten sauber gekachelter Toiletten mit Wasserspülung gemäß europäischem Standard, an das Abenteuer von früher, einmal in Verlegenheit zu sein und Abhilfe schaffen zu müssen. Dieses Früher erstreckte sich da und dort durchaus noch bis in die achtziger Jahre, sogar an als kultiviert geltenden Plätzen, etwa Florenz. Dort gab es wirklich ein Häuschen, das zwar jedermann frei zugänglich, de facto aber nicht betretbar war. Es stand nahe dem Piazzale Michelangelo, von dem aus man den schönsten Blick auf eine Stadt hat, die ein kulturelles Juwel darstellt und vor Jahrhunderten dem übrigen Europa zeigte, wie Kunst und Kultur auf höchstem Niveau aussehen können. Aber Hygiene scheint selbst mehr als hundert Jahre nach ihrer Entdeckung kein Bestandteil heimischer Kultur gewesen zu sein. Übrigens, jenes Häuschen gibt es heute noch, aber nachdem irgendjemand dort sauber gemacht hat wie, stelle ich mir vor, einst Herkules, der die Ställe des Augias ausmistete, indem er einen Fluss durch sie leitete, ist es heute für einen Euro Eintrittsgeld geradezu einladend und nennt sich „Mister clean“ oder so ähnlich. Und diesen Mister Clean gibt es auch leiblich in Gestalt eines freundlichen jungen Menschen dunkler Hautfarbe. Genauso oder ähnlich wie in München im Hauptbahnhof.
Noch immer kein Lebenszeichen in der Kabine.
Ja, früher! Es ist viele Jahre her – da fragte ich die Padrona einer kleinen Trattoria in Assisi nach dem „gabinetto“. Die Padrona schritt voran, öffnete eine Tür und sagte mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger: „Qua!“. Als ich die Vertiefung im Boden sah, begehrte ich entrüstet auf: „No – per donne!“ – „Sississì – qua!“ kam es mit der Stimme der Juno energisch. Eine Erinnerung an Zeiten, in denen man sich bei Bedarf hinter den nächstgelegenen Busch hockte? Später hatte ich Anlass mich daran zu erinnern, als uns ein Freund mit einer Beinprotese seine komplizierte Strategie schilderte, mit der er diesem archaischen Typ von Abtritt beizukommen suchte.
Merkwürdig, wie bedürfnislos Italiener in Sachen Bedürfnisanstalten sind. Ob in den Boden eingetieft oder mit Porzellanschüssel ausgestattet – das charakteristische italienische Klosett ist kein Ort, der zu längerem Verweilen einlädt. Das sieht man schon daran, dass die Innenseite der Tür so gut wie nie mit Texten und Illustrationen verziert ist, die einem den Aufenthalt kurzweilig gestalten.
Ach ja, wo war es gleich? Man musste den Schlüssel an der Bar erbitten, erst dann hatte man Zutritt zu dem besagten Örtchen. Der glich nun einer wahren Thronbesteigung, denn von der schmalen Tür führte eine steile Treppe zu einer Porzellanschüssel, die allerdings nicht gut verankert und etwas wackelig war. Ein wackeliger Thron sorgt ja immer für Unbehagen, und wenn es keine Möglichkeit gibt ihn zu festigen, verlässt man ihn am besten so schnell wie möglich.
Und es war irgendwo in der Toscana, da musste man sich den Weg von der Küche durch einen engen Gang zwischen Säcken mit Mehl, Reis, Zucker und Eispulver bis zum stillen Örtchen bahnen, dessen Wasserspülung nicht funktionierte und entsprechend Appetit machte auf das Essen, das man eigentlich entschlossen war in diesem Lokal einzunehmen.
Noch immer ist die Tür verschlossen.
„Vielleicht ist etwas passiert?“ kommen jetzt Bedenken unter den Wartenden auf.
„Vielleicht ist jemand ohnmächtig geworden.“ Die Klofrau wird verständigt. Die donnert mit der Faust gegen die Tür. Hinter der regt sich plötzlich etwas. Sie wird vehement von innen aufgerissen, eine kompakte jüngere Frau zeigt voller Zorn auf einen dicklichen, etwa achtjährigen Jungen, der mit heruntergelassenen Hosen auf der Schüssel sitzt, brüllt: „Pazienza – questo ragazzo deve caccare!“ und veranschaulicht mir endlich, was die Bezeichnung gabinetto pubblico bedeutet.
Nun ist anzumerken, dass das etwa gleichlautende deutsche Wort für unsere Ohren ordinärer klingt als für die italienischen das Äquivalent ihrer Muttersprache. Den bloßgestellten Knaben dürfte das allerdings wenig interessieren. Da hockt er, nicht hochrot, sondern sehr blass, von dutzenden teils verdutzter, teils mitleidvoller Augen betrachtet, womöglich für sein Leben traumatisiert. Aber alle nicken nun verständnisvoll und schließen sich an die andere Schlange an. Gut Ding braucht eben Weile, das weiß man doch.
Acqua alta in Venedig
Die Luft ist heiß und wie fast immer feucht in dieser auf Wasser gebauten Stadt, das Haar hängt nass in die Stirn, der Schweiß läuft in der Rinne des Rückgrats hinunter, bis ihm der Hosenbund Halt gebietet und ihn aufsaugt. Ein lebhafter Wind, nicht kühl sondern warm, kommt von der Lagune herüber. Dem Wasser bleibt keine Zeit, sich für grau oder türkis zu entscheiden. Die leeren, an den Holzpfosten vertäuten Gondeln im glänzenden Leichenwagenschwarz vollführen einen Tanz wie nach der Choreographie eines gestörten Kleinhirns.
Die Wellen schwappen über, lecken mit gierigen Zungen das graue Pflaster. Ich bleibe stehen, sprungbereit, und bin gespannt, wann mich eine erwischt. Ein Versuch auszuweichen – zu spät!
„Arriva lo scirocco“, sagt ein Gondoliere sachlich, ohne Beunruhigung. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet.
Diese Einmischung der Natur in die Angelegenheiten der Stadt! Das Hochwasser sucht die Venezianer drei bis viermal im Jahr heim. Leben die Menschen mit dem Hochwasser, seit die ersten Siedler hier vor den Hunnen und Westgoten Schutz suchten?
Noch heute sind die Spuren unverkennbar, die die Kaiserlich Königliche Monarchie der Habsburger hinterlassen hat, trotz aller Feindseligkeit und des Widerstands der Bevölkerung damals, im 19. Jahrhundert. Immerhin ist es dasselbe Gebirge, das beide Reiche begrenzte, voneinander schied und schließlich für mehr als ein halbes Jahrhundert vereinte – nur einmal vom Norden, einmal vom Süden gesehen.
Gibt es eigentlich noch Venezianer? Es gibt sie noch, obwohl die meisten schon fortgezogen sind, dorthin, wo es weniger Wasser und mehr Arbeit gibt. Viele der prachtvollen Palazzi am Canal Grande sind verfallen, Schuttberge türmen sich hinter Fassaden mit scheibenlosen Fensteröffnungen, manche sind in Hotels umfunktioniert oder sind in Fremdenhand. Die extravagante Peggy Guggenheim hat ihre berühmte Sammlung moderner Kunst in einem unfertigen Bau des achtzehnten Jahrhunderts untergebracht. Dort, im schattigen Garten, liegen, so verkündet eine steinerne Tafel mit gemeißelter Inschrift, ihre „darlings“ begraben. Das ist irritierend zu lesen, bis man realisiert: Es waren nicht ihre Liebhaber, sondern ihre Hunde.





























