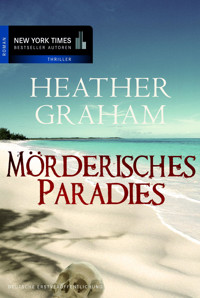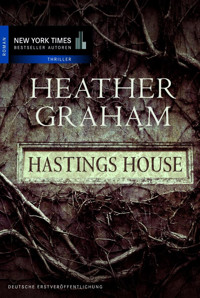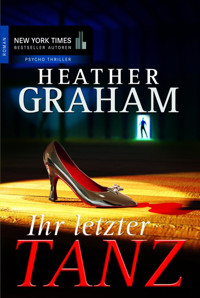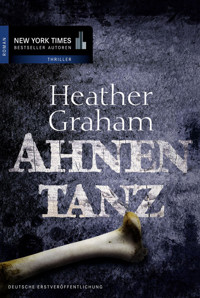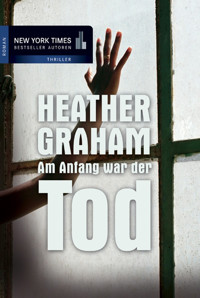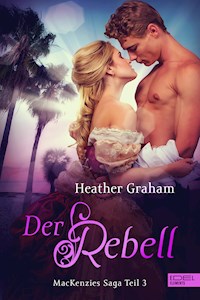Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Highland-Kiss-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie will ihre Freiheit bewahren, doch sein Verlangen ist stärker. Der historische Liebesroman »In den Armen des Schotten« von Heather Graham jetzt als eBook bei dotbooks. Das Schicksal führt sie zusammen … Schottland, 1137: Als Mellyora MacAdins Vater stirbt, steht die schöne Wikingertochter vor einer scheinbar unmöglichen Wahl: einen Fremden heiraten oder ihre geliebte Heimat Blue Isle verlieren. Ihr Zukünftiger, Waryk de Graham, ist der beste Ritter des Königs. Obwohl die Heldentaten des »Lord Lion« im ganzen Land gefeiert werden, ist die stolze Mellyora wild entschlossen, sich ihm nicht hinzugeben. Doch als sie versucht, vor ihrer Bestimmung zu flüchten, läuft sie dem heißblütigen Laird geradewegs in die Arme … und der ist nicht bereit, sie wieder ziehen zu lassen! Wird die stürmische Leidenschaft des Highlanders sie zähmen können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Historical-Romance-Highlight »In den Armen des Schotten« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham ist Band 1 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Schicksal führt sie zusammen … Schottland, 1137: Als Mellyora MacAdins Vater stirbt, steht die schöne Wikingertochter vor einer scheinbar unmöglichen Wahl: einen Fremden heiraten oder ihre geliebte Heimat Blue Isle verlieren. Ihr Zukünftiger, Waryk de Graham, ist der beste Ritter des Königs. Obwohl die Heldentaten des »Lord Lion« im ganzen Land gefeiert werden, ist die stolze Mellyora wild entschlossen, sich ihm nicht hinzugeben. Doch als sie versucht, vor ihrer Bestimmung zu flüchten, läuft sie dem heißblütigen Laird geradewegs in die Arme … und der ist nicht bereit, sie wieder ziehen zu lassen! Wird die stürmische Leidenschaft des Highlanders sie zähmen können?
Über die Autorin:
Heather Graham wurde 1953 geboren. Die New-York-Times-Bestseller-Autorin hat über zweihundert Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Heather Graham lebt mit ihrer Familie in Florida.
Eine Übersicht über weitere Romane von Heather Graham bei dotbooks finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2019
Dieses Buch erschien bereits 2000 unter dem Titel »Insel der Leidenschaft« bei Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Shannon Drake
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Come the Morning«.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2000 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Published by arrangement with Shannon Drake.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Vojtechvlk, Andre Goncales, Zdenka Darula, ESOlex, Daimond Shutter, Trum Ronnarong, blue pencil und Imichman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-811-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »In den Armen des Schotten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Heather Graham
In den Armen des Schotten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
dotbooks.
Prolog
Im schottischen GrenzlandDas Jahr des Herrn 1127
Er glaubte, die Streitaxt seines Gegners hätte ihn getötet und er wäre in einer neuen Welt aufgewacht. Seltsam – sie erschien ihm vertraut, denn sie roch nach süßem Gras und den Lochs, die wie Tränentropfen im Grenzland verstreut lagen. Wenn das der Himmel war, und nichts anderes konnte so köstlich duften, dann wuchsen darin Blumen und Disteln.
Endlich gelang es ihm, die Augen zu öffnen, und zu seinem Erstaunen sah er einen sonderbaren Dreiviertelmond am Himmel, der in einem unheimlichen blutroten Licht erstrahlte.
Und dann spürte er Schmerzen. Er war nicht tot. Doch sein Schädel dröhnte, als wäre er gespalten worden. Beinahe hätte er laut gestöhnt, aber irgendein Instinkt ermahnte ihn zu schweigen. Mit zusammengebissenen Zähnen stützte er sich auf einen Ellbogen und blickte über das Schlachtfeld hinweg. Er sah so viele Leichen, abgetrennte Körperteile und blutüberströmte Arme und Beine im Mondschein. Der süßliche Geruch in der Nacht rührte nicht nur von den hohen Gräsern und Blumen her, sondern auch von dem vielen vergossenen Blut, das die Erde tränkte.
Ein grausiges, groteskes Gemetzel. So wie es immer gewesen war. Wie es immer sein würde. Der Schmerz drohte ihm wieder die Sinne zu rauben. An seiner Haut fühlte er taufeuchtes Gras. Jede kleine Wunde brannte. In jeder größeren schien ein Höllenfeuer zu lodern.
Fast wäre er gestorben. Freund und Feind hatten ihn bei den Toten zurückgelassen. In einer kleinen Hütte aus Lehm und Stein, nicht weit entfernt, brannte Licht. Dort würden die Überlebenden ihre Wunden verbinden und Pläne schmieden. Hoffentlich ist mein Vater bei ihnen, dachte er.
Im nächsten Augenblick überkam ihn nackte Angst. Würde der Vater noch leben, hätte er ihn nicht im Stich gelassen. Seine Hand ruhte auf kaltem Fleisch. Als er sich nach links wandte, durchfuhr ein eisiger Schauer seinen Körper, und Tränen rannen über seine Wangen.
Die blicklosen blauen Augen weit geöffnet, die Brust von einem feindlichen Schwert durchbohrt, lag sein Vater neben ihm – William der Große.
»Da!« Das geflüsterte Wort glich einem heiseren Schmerzensschrei. Liebevoll strich er über die dunkelroten Locken seines Vaters. »Du darfst mich nicht verlassen, Da!« Nun könnte er von neuem das Schwert schwingen. Er war groß und stark, ein vielversprechender Junge, meinten die Männer. Aber eben noch ein Junge, dem die Kraft und das Geschick des Vaters vorerst fehlten, die Weisheit, die Güte, das Urteilsvermögen.
Doch das Alter spielte keine Rolle, und sein Kummer konnte nichts am Ausgang der Schlacht ändern, seine Liebe den Toten nicht wiedererwecken. Jetzt musste er den Kampf fortsetzen. Ohne sich zu schämen, weinte er bitterlich. William der Große war gestorben. So viel hatte er ihm gegeben und beigebracht. Im Licht des Mondes, der hinter einer Wolke hervorglitt, sah er seinen Onkel, den stolzen, attraktiven, fröhlichen Ayryn, seinem Bruder William im Tode ebenso nah wie im Leben. Mit ausgestreckten Armen lag er im Gras, als wollte er den Himmel umfangen.
»Bitte, Onkel, verlass mich nicht auch noch«, wisperte er.
In seiner Kehle stieg ein qualvoller Schrei auf. Wieder warnte ihn sein Instinkt. Er durfte keine Aufmerksamkeit erregen. Und so bezwang er den Schrei, der Verzweiflung, Zorn und Trauer ausgedrückt hätte. Auf seinen Instinkt konnte er sich verlassen. Plötzlich hörte er Schritte.
Verstohlene Schritte in der Nacht, fast lautlos im Gras. Einige Gestalten schlichen zu der Hütte, wo sich die überlebenden Schotten nach der grausigen Schlacht versammelt hatten.
Angstvoll hielt er den Atem an und musterte die Männer. Feinde ... Während sie an ihm vorbeigingen, rührte er sich nicht, wartete und beobachtete die Ereignisse. Erst nachdem sie hinter der Hütte verschwunden waren – zweifellos, um einen Angriff vorzubereiten –, stand er langsam auf.
Eine Zeit lang hielt er inne, sammelte Kräfte und schärfte seine Sinne. Dann eilte er auf leisen Sohlen durch das Gras.
Michael, Oberhaupt der MacInnishs im schottischen Tiefland, lauschte dem Gespräch am lodernden Feuer. In Dunkeld war er geboren worden, in der ältesten Heimstätte der Kelten. Als jüngerer Sohn hatte er sich im Grenzland niedergelassen und eine MacNee geheiratet. Jetzt gab es die MacNees nicht mehr, die traditionellen Besitzer dieses schönen Gebiets, denn seit den alten Zeiten waren fremde Eindringlinge hierher gezogen. Letzten Endes hatten der Kampfgeist der Hochländer und das unwegsame Territorium die Römer aufgehalten. Dann waren die Wikinger über das Land hergefallen. Und immer wieder die Engländer – oder jene, die sich Engländer nannten, so wie die neue normannische Aristokratie. Beharrlich hielten sie an diesem fruchtbaren Land fest und schlugen Wurzeln. Als Eroberer waren sie hierher gekommen und schließlich Schotten geworden.
Aye, nun waren sie alle Schotten. Oft für Barbaren gehalten, hatten sie sich niemals von Rom unterjochen lassen. Nachdem ein römischer Feldherr namens Agricola die Kaledonier zum ersten Mal besiegt hatte, war er in seine Heimat zurückgerufen worden. Bald verließen die Römer ganz Britannien. Mehrere keltische und teutonische Stämme ließen sich in verschiedenen Landesteilen nieder – Pikten, Schotten, Britannier, sogar Angelsachsen. Im Königreich Schottland lebten weiterhin verschiedene Völker, und sie befehdeten einander immer noch. Aber seit den Tagen des großen Kenneth MacAlpin, des Königs der Dalriada-Schotten, bewohnten sie ein geeintes Land.
Jetzt herrschte ein gewisser Frieden. In Schottland regierte König David I. Seine Schwester war mit Henry I. von England verheiratet, sein listenreicher Vater Malcolm III. in den Krieg gegen William den Eroberer gezogen. Wenn er jene Schlachten auch nicht gewonnen hatte, so war es ihm doch gelungen, ein unabhängiges Schottland zu bewahren. David hatte von seinem Vater und seinen Brüdern viel gelernt. In England aufgewachsen, hatte er den Kampf seiner Familie gegen die Auswirkungen der normannischen Eroberung beobachtet.
Mittlerweile ein reifer, kluger, vorsichtiger Mann, wusste er, in welch unsicherer Position sich jeder König befand und dass er in einer gefährlichen Welt lebte. Manche Leute verübelten ihm seine normannische Erziehung. Aber dank seiner Herkunft konnte er auf alte Loyalitäten bauen. Seine Mutter war die Schwester des Edelings Edgar gewesen, einer sächsischen königlichen Hoheit vor der Ankunft des Eroberers. Die bezwingende Macht der Schlachten kannte er ebenso wie die Vorzüge von Bündnissen.
Trotz seiner normannischen Neigungen hatte er sich als echter schottischer Anführer erwiesen, fest entschlossen, die Identität seines Landes zu wahren. Deshalb standen die Schotten hinter ihm, obwohl sie die Normannen verabscheuten und ihnen misstrauten. Er war ein großer Krieger und stets zum Kampf bereit. Wenn die diplomatischen Beziehungen zum südlichen Nachbarn auch stabil blieben – entlang der Grenze kam es häufig zu Gefechten. David wollte nicht nur das Land sichern, das traditionell den Schotten gehörte, sondern die Grenze südwärts verschieben, um die Engländer vom schottischen Herzland fern zu halten. Aus diesem Grund hatte er ein paar einflussreiche, mit ihm befreundeten normannischen Familien schottische Ländereien übereignet – klugerweise nur solche, wo Erbstreitigkeiten unter den Nachkommen verstorbener Familienoberhäupter drohten, um solche Gefahren zu bannen. Widerstrebend fanden sich die Schotten mit der Ankunft neuer Einwohner ab. 1124, im Jahr seiner Thronbesteigung, hatte David einen Aufstand niedergeschlagen. Und die kriegerischen Bewohner dieses zerklüfteten Landes würden ihm sicher immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Die Feudalgesetze, teilweise noch kein Jahrhundert alt, standen im Widerspruch zu alten Traditionen. Um dieses Volk zu regieren, brauchte man viel Kraft und Klugheit. Diese Fähigkeiten hatte David bisher bewiesen. Trotzdem wurde seine Macht immer noch von zwei Bedrohungen herausgefordert – von den Ereignissen an der Grenze und den Wikingern, die sich unablässig Vorteile zu verschaffen suchten. David hatte Geschichte studiert. Nach seiner Ansicht hatte König Harold England vor allem deshalb an die Normannen verloren, weil die Wikinger zur gleichen Zeit im Norden eingedrungen waren wie die Normannen im Süden. Die Wikinger hatten Harold nicht besiegt, aber geschwächt.
Keine königliche Macht konnte die erbitterten Scharmützel im traditionellen Grenzland verhindern. An diesem Abend hatte Michael zahlreiche Familienoberhäupter zusammengerufen. Er war von Lord Renfrew angegriffen worden, einem normannischen Adeligen, der sich nicht mit den ihm zugeteilten Ländereien in Yorkshire begnügen wollte. Mit den Söldnern eines dänischen Heers marschierte er nordwärts, schlug die Bauern in die Flucht, plünderte Kirchen und Abteien und vergewaltigte junge Frauen. Deshalb hatten sich Michaels Clan und seine Verbündeten versammelt, um ihr Land zu verteidigen. Viele tapfere Männer waren gefallen oder lagen im Sterben. Rings um das Feuer saßen die Überlebenden und äußerten ihre Ansichten.
Thayer Cairn, ein großer kräftiger Mann, stand auf, warf noch etwas Brennholz in die Flammen und wärmte seine Hände. Im Widerschein der Glut leuchtete sein Gesicht so rot wie das Blut, das die Erde tränkte. Michael blickte schaudernd zu ihm auf.
»Wo bleibt der König mit seinen Soldaten, wenn wir seine Hilfe brauchen?«, stieß Thayer hervor. »Unser Ruf muss ihn erreicht haben.«
Seufzend starrte Michael ins Feuer. »Wir dürfen den König nicht dauernd verdammen, nur weil ihn irgendwelche Pflichten von uns fern halten. Hier und jetzt müssen wir uns selber verteidigen.«
»Aye, Michael hat Recht«, stimmte Fergus Mann zu, der zu seiner Linken saß. Er hatte seinen Bruder und seinen ältesten Sohn fallen sehen. Doch der zweit- und der drittgeborene Sohn waren am Leben geblieben. Trotz des schweren Verlustes blieb der grauhaarige Krieger bei klarem Verstand und versuchte die Situation zu retten. »Der König spielt keine Rolle. Was wir demnächst tun werden, ist am wichtigsten. Holen wir die Verwundeten und verschwinden wir in den Felsschluchten bei den Lochs. Wir müssen uns neu formieren. Darin liegt unsere einzige Hoffnung. Wenn uns die Feinde verfolgen, sollten wir vorerst zu unseren Brüdern in den Bergen fliehen.«
»Wer hält Wache?«, fragte Michael, als er ein Klopfen hörte.
»Vor der Tür steht McBridie.«
Michael bedeutete Thayer, nach dem Rechten zu sehen. Angespannt warteten die Männer, die in der Hütte saßen. Sobald Thayer die Tür geöffnet hatte, stürmte ein blonder nordischer Krieger herein und durchbohrte seine Schulter mit einer scharfen Pike. Schreiend sank Thayer zu Boden. Weitere Feinde folgten dem Angreifer, einige durchbrachen die Strohmatten an den Fenstern. Wenig später waren die meisten der etwa zwanzig Schotten, die das Gemetzel auf dem Schlachtfeld überlebt hatten, tot oder verletzt.
Nur Michael hielt sein Schwert hoch, als ein hoch gewachsener, mit einem Kettenpanzer und in Leder bekleideter Mann eintrat. Lord Renfrew. Lächelnd strich er durch sein kurz geschnittenes rostrotes Haar. Dann packte er Fergus Manns jüngsten Sohn Patrick und hielt ihm einen Dolch an die Kehle. »Ah, da ist Michael höchstpersönlich, der Laird dieser Ländereien!« Renfrews dunkle Augen verengten sich. »Lasst Euer Schwert fallen. Sonst stirbt der Junge.«
»Nicht, Michael, das ist eine Finte!«, rief Patrick.
»Welche Bedingungen stellt Ihr?«, fragte Michael.
»Bindet dem Mann die Hände fest! Und seid vorsichtig! Nach den jahrhundertelangen Invasionen fließt durch die Adern dieser Männer genug von Eurem Wikingerblut, Ragwald, sodass sie wie die Wilden kämpfen.« Renfrew warf dem Krieger, der Thayer getötet oder schwer verwundet hatte, einen kurzen Blick zu. »Euer Schwert, Michael. Oder ich ersteche den Jungen.«
Tapfer bezwang Patrick seine Angst. »Er wird mich so oder so umbringen.«
Vielleicht hat er Recht, dachte Michael. Aber in der gegenwärtigen Lage fand er es sinnlos, den Tod des Jungen zu beschleunigen, und so ließ er das Schwert fallen. Renfrew nickte grinsend. »Fesselt ihn!«
Während Ragwald gehorchte, leistete Michael keinen Widerstand. Die Hände wurden ihm auf den Rücken gebunden.
»Fesselt sie alle!«, ordnete Renfrew an. »Jetzt sind sie meine Gefangenen.«
Nachdem der Befehl befolgt worden war, fragte Michael: »Was nun?«
»Ja – was nun?«, wiederholte Renfrew spöttisch. »Als Geiseln seid ihr wertlos. Und wenn ihr als meine Sklaven für mich arbeiten würdet? Glaubt mir, viele einst stolze Sachsen dienen in England ihren Herren. Ah, ein verlockender Gedanke, so edle Krieger versklavt zu sehen! Doch es wäre zu mühsam, stets auf meinen Rücken zu achten. Also bleibt mir keine Wahl, und ich werde euch Bastarde aufhängen. Den da zuerst!«, entschied er und zeige auf Thayer. »Er ist ohnehin schon halb tot, und deshalb wird er wie ein Mehlsack herabfallen. Mit ihm wollen wir den Strick für die anderen erproben.«
Lachend schleppten seine Krieger den Verletzten aus der Hütte und rempelten die anderen Gefangenen an. In der Tür drehte sich Ragwald noch einmal um. »Keine Angst, ihr guten Schotten, wir lassen euch nicht lange warten«, höhnte er und eilte ins Freie.
»Hättest du bloß dein Schwert behalten, Michael«, wisperte Patrick. »Dann hättest du wenigstens einen dieser Schurken getötet.«
Unter gellendem Gegröle wurde Thayer zu einem Baum geführt. Dann vernahmen die Schotten ein Geräusch, und ein großer Schatten duckte sich hinter Patrick, der in die Nähe eines Fensters gedrängt worden war.
»Bei allem, was heilig ist ...«, begann Michael.
Im selben Augenblick hob Patrick die Hände, vom Lederriemen befreit, und der Schatten richtete sich auf – der Sohn des Großen William, den Michael neben dem Vater hatte fallen sehen. Aber Waryk war am Leben geblieben. Mit Schlamm und Blut beschmiert stand er da, in den rot geweinten Augen funkelte ein blaues Feuer, er war groß und kräftig für seine vierzehn Jahre. Zum ersten Mal hatte er an einer Schlacht teilgenommen, von seinem Vater zu einem tüchtigen Schwertfechter erzogen.
»Großer Gott«, flüsterte Michael.
Waryk ging zu ihm. »Nun werde ich auch dich losbinden ...«
Doch da kehrte der Wikinger in die Hütte zurück. »Wen haben wir denn da? Ist eine der toten Läuse wieder auferstanden, um sich hängen zu lassen?« Blitzschnell bückte sich Waryk nach Michaels Waffe und der blonde Riese lachte. »Ein grüner Junge will gegen Wölfe kämpfen? Wie du meinst. Ein Strick würde dich gnädiger töten, denn ich werde dich von oben bis unten aufschlitzen.« Siegessicher schwang er seine Streitaxt.
Waryks Schrei erfüllte die Nacht wie die unheimliche Klage eines außerirdischen Geschöpfs. Bevor die Axt herabsinken konnte, stach die ›Laus‹ die Schwertspitze in Ragwalds Kehle. Renfrews nordischer Söldner fiel auf die Knie, mit kaltem Entsetzen in den Augen, bevor der Tod den Blick verschleierte.
Ringsum erstarrten alle Schotten. Patrick, der die Fessel seines Vaters zu lösen begonnen hatte, hielt inne. Und Michael vergaß, dass draußen eine tödliche Schlinge wartete.
Aus der Nacht drang ein Ruf herein. »Was geht da drinnen vor?«
»Schnell!«, befahl Michael.
Patrick und Waryk beeilten sich, die Fesseln der Männer zu lösen. Als ein Feind in die Hütte rannte und sein Schwert hob, fuhr Waryk herum. Klirrend stieß Stahl gegen Stahl, und das Geräusch alarmierte die anderen, die vor der Tür vermutet hatten, die Todgeweihten würden den Allmächtigen um ihr ewiges Seelenheil bitten.
Nun waren die Schotten im Vorteil. Sobald ein Feind die Schwelle überquerte, wurde er niedergestreckt. Blut floss im Feuerschein, in Todesangst stolperten Renfrews Männer über die Leichen ihrer Kameraden. Bald traten sie den Rückzug an, von ihren Gegnern verfolgt. Vor der Hütte in ein heftiges Gefecht verstrickt, hörte Michael die Hufschläge erst, als der Trupp beinahe herangaloppiert war. Mit seiner Streitaxt schlug er seinem Widersacher den Schädel ein, bevor er sich zu den Neuankömmlingen wandte. Da hatten sich der König und seine Soldaten bereits auf Renfrews Söldner gestürzt. Jetzt war der Feind in der Unterzahl. Tote und Sterbende lagen auf dem Schlachtfeld, wo zuvor so viel Blut vergossen wurde.
Aber David zeigte sich barmherzig und die Überlebenden ließen ihre Waffen fallen. Nur ein einziger Zweikampf war noch nicht beendet.
Michael beobachtete Waryk, den Sohn William de Grahams. In den Adern des Jungen floss Normannen- und Wikingerblut. Sein Vater war mit dem König vom Grenzland aus nordwärts und weiter nach Osten gezogen, in Gebiete, wo die Wikinger eine Zeit lang geherrscht hatten. ›Vom grauen Heim‹, so lautete der Name bei Normannen und Engländern, konnte aber auch von Waryks Mutter stammen. Einer Legende zufolge hatte sie zusammen mit dem ältesten schottischen Stamm den Namen Graeme im Grenzland eingeführt. Sie gehörte einer vornehmen Familie an. In den frühen Jahren der Christenheit war ein Graeme der berühmte Feldherr in König Fergus' Heer gewesen, das den Wall der Römer, der gegen die ›Barbaren‹ errichtet worden war, durchbrochen hatte. In diesen Ruinen existierte immer noch ›Graeme's Dyke‹. Von überall kamen die Namen her. Manche Männer hießen einfach nur Thomas, Michael, Fergus und so fort, und andere nahmen die Namen ihrer Väter an, so entwickelten sich Familiennamen. Auf Michaels Urgroßvater Innish führte der Name des Clans MacInnish zurück. Canmore, der Familienname des Königs, stammte von seinem Vater, und der alte gälische Ausdruck Caenn Mor bedeutete ›großer Kopf‹. Ein edler Name, dessen der Junge sich würdig zeigte.
Vom Schmerz des Verlustes angestachelt, vergaß er seine Todesangst. Ringsum waren zahlreiche Männer gefallen und er kämpfte immer noch gegen Renfrew. Verbissen wehrte er alle Angriffe des erfahrenen Kriegers mit dem Schwert seines toten Vaters ab. Wann immer der Normanne kurz innehielt, um Atem zu holen, wurde er attackiert. Den Vorteil seiner überlegenen Kraft glich der Junge durch Schnelligkeit und geschickte Finten aus. Trotzdem entstand der Eindruck, Waryk müsste sich letzten Endes geschlagen geben. Pausenlos schwang Renfrew sein Schwert in grimmiger Entschlossenheit und er würde so lange nicht erlahmen, bis er den Gegner getötet hatte.
Aber als er wieder mit beiden Händen die Waffe hob, um ihm den Gnadenstoß zu versetzen, nutzte Waryk de Graham die Gunst des Augenblicks, um ihm seinen Stahl mit fast übermenschlicher Wucht zwischen die Rippen zu bohren.
Sterbend umklammerte Renfrew den Griff des Schwerts, der aus seiner Brust ragte, und starrte den Jungen ungläubig, aber immer noch überheblich an. Doch der Tod war stärker. Der Junge rührte sich nicht, als der große Normanne zu seinen Füßen lag. Er zog sein Schwert auch nicht aus der Wunde, sondern stand bewegungslos und zitternd vor seinem Opfer.
Verwundert ritt der König zu ihm. »Mein Gott, wer hat diesen jungen Löwen gezeugt?«
»Einer Eurer Männer, Sire«, antwortete Michael müde, »der Große William, der dort drüben liegt.«
»Ah!« David nickte verständnisvoll.
»Sire, ich werde mich um den Jungen kümmern«, versprach Michael. »Sein Vater war mit der letzten Erbin eines alten Geschlechts verheiratet, meiner längst verstorbenen entfernten Verwandten Menfreya. Nun hat er keine Familie mehr, und so müssen seine Freunde für ihn sorgen.«
»Nein, guter Mann. Seid auch künftig sein Freund. Aber ich will seine Vormundschaft übernehmen und ihn zu einem großen Krieger erziehen, der eines Tages für mich kämpfen wird.« David wandte sich zu Waryk, der Renfrews Leiche immer noch reglos anstarrte. »Junger Graham!« Er beherrschte alle drei Sprachen seines Volks, das alte Schottisch oder Gälisch, das ›Teutonische‹ oder Englische und das normannische Französisch, von William dem Eroberer und seinen Rittern eingeführt. Jetzt sprach er Schottisch, mit ausgeprägtem gälischem Akzent.
Der Junge rührte sich nicht.
»Graham!«
Endlich sah Waryk zu dem stattlichen Mann auf, der ihn aufmerksam musterte und seine Fähigkeiten deutlich erkannte. »Du bist also der Graham.«
Verzweifelt schaute Waryk zum Schlachtfeld hinüber, wo seine toten Angehörigen lagen. »Ja, Sire, nur ich allein.«
»Dein Vater war ein großartiger Mann, den ich als Krieger und Freund schätzte.«
»Aye, Sire.«
Schweigend beobachteten die Überlebenden des grausamen Gemetzels den König, der von seinem Pferd stieg und sein Schwert zog. Nichts konnte die Treue und Liebe eines Untertanen so nachhaltig sichern wie die Anerkennung seiner Heldentaten. »Knie nieder, Junge!«
Zunächst schien Waryk nicht zu verstehen, was von ihm erwartet wurde. Wollte der König ihn vielleicht töten?
»Knie nieder!«
Da sank Waryk auf ein Knie, und die Schwertspitze berührte seine Schultern.
»Ich, David, von Gottes Gnaden König des vereinigten Schottlands, schlage dich hiermit zum Ritter, um deine Tapferkeit vor dem Feind zu belohnen.« Langsam ließ David seinen Blick über die Versammlung schweifen. »Nun heißt du Sir Waryk Graham, zu Ehren der Verwandtschaft deines Vater und deiner Mutter. Alle Anwesenden sind Zeugen deines Mutes, und sie hören, was ich sage. Wenn ich dir vorerst auch keine Ländereien geben kann, die deinem Titel Macht verleihen würden, so wird man dich trotzdem als meinen Getreuen Laird Lion achten. In den nächsten Jahren werde ich für dich sorgen. Wenn es an der Zeit ist, wirst du viel gewinnen, vielleicht durch eine vorteilhafte Heirat. In dir, Sir Waryk de Graham, Laird Lion, lebt die Ehre deines Vaters weiter.«
Überwältigt ergriff der Junge die Hand seines Königs, die Augen voller Tränen, die er nicht vergießen wollte. Indem David den Großen William und die Mutter ehrte, an die sich Waryk kaum erinnerte, überreichte er ihm das wunderbarste aller erdenklichen Geschenke. »Bis zu Eurem Tod will ich Euch dienen, Sire«, gelobte der neue Laird mit bebender Stimme.
»Das erwarte ich auch von dir. Steh auf, mein Junge.« Nachdem Waryk gehorcht hatte, fügte David freundlich hinzu: »Heute Nacht bist nur du allein der Graham. Aber glaub mir, du wirst bald eine Familie gründen.« Seine Gedanken wanderten bereits in die Zukunft. Und dieser Bursche, soeben zum Ritter geschlagen, war eine weitere vielversprechende Figur im königlichen Schachspiel.
TEIL IDie Tochter des Wikingers
Kapitel 1
In zehn Jahren hatten sich seine Kampfmethoden etwas geändert. Aber nicht völlig. Waryk, Laird Lion, bevorzugte immer noch sein Schwert, die Klinge seines Vaters, mit dem Korbgriff der Hochlandschotten. An diesem Tag saß er auf einem großen Streitross, blickte den Hang hinab und beobachtete den Angriff auf die kleine königliche Festung Localsh. Fünfzig Reiter unter seinem Kommando sollten den Aufstand niederschlagen, der angeblich viel gefährlicher war als die Aktion, die er bisher mit angesehen hatte. In der Festung wohnten zwanzig Krieger, außerdem Handwerker, Geistliche und Bürger. Die Verteidiger hatten sich auf eine Belagerung vorbereitet, statt die Rebellen anzugreifen. Für eine Attacke waren sie nicht gut genug gerüstet. Aber jetzt mangelte es ihnen allmählich an Wasser, Nahrung, Pfeilen und Öl, das sie siedend heiß hinabgießen könnten, wenn ihre Gegner an den Mauern hochzuklettern versuchten.
Nun errichteten die Aufständischen Katapulte, um das Schloss mit Steinen und Fackeln zu stürmen. Ein Rammbock sollte das Tor aufbrechen. An den Wällen wurden Leitern aufgestellt. Waryk runzelte die Stirn. Damit hatte er nicht gerechnet. Während im benachbarten England nach dem Tod Henrys I. ein Chaos herrschte und seine Tochter Mathilda mit seinem Neffen Stephen um die Krone stritt, strebten mehrere normannische Barone nach größerer Macht. Mit den persönlichen Reitern des schottischen Königs, für ihre wilde äußere Erscheinung bekannt – Waryk befehligte eine relativ kleine Kavallerie –, und den tapferen, siegessicheren Fußsoldaten ließen sich diese armseligen Rebellen nicht vergleichen. Sie besaßen nicht einmal Lederpanzer oder Brustplatten. Nur wenige hatten sich mit Schilden gerüstet, und von der Kriegsstrategie schienen sie nicht viel zu wissen. Sie waren schäbig gekleidet, eher normannisch als schottisch, hier im Tiefland nicht ungewöhnlich. Gewiss, König Henrys Tod löste in England und im Grenzgebiet große Verwirrung aus und belastete die englisch-schottische Beziehung. Trotzdem fand es Waryk sehr sonderbar, was er da sah. In König Davids Diensten ritt er ein ausgezeichnetes Pferd. Über seinem wollenen Unterkleid trug er einen feinmaschigen Kettenpanzer und einen Überwurf, in der gleichen Farbe wie seine tiefblauen Augen. Eine Metallplatte schützte seine Brust. Auch der Helm mit dem massiven Nasenteil bestand aus Metall. Auf den Überwurf und die Satteldecke des Schlachtrosses war Waryks Wappen gestickt, ein fliegender Falke. Nun befand er sich in der Nähe des Ortes, wo er vor Jahren um sein Leben gekämpft hatte – ein wilder, undisziplinierter Junge ohne Schild, ohne Rüstung.
Warum kämpften die Männer dort unten? Früher hatten sie, unzulänglich bewaffnet, für ihr Zuhause gefochten. Und jetzt griffen sie eine Festung an.
»Waryk?« Sein Adjutant Angus erinnerte ihn an die rastlosen Pferde, die hinter ihm standen.
»Wie ein Bauerntrupp«, meinte Waryk.
»Gerade schleudern sie brennendes Öl nach oben«, betonte Angus trocken.
»Aye, aber warum?«, murmelte Waryk. Über diese Frage konnte er nicht länger nachdenken, denn die Aufständischen versuchten die Verteidiger der Festung zu töten. Er hob eine Hand und gab das Zeichen zum Angriff. Natürlich widerstrebte es ihm, gegen seine Landsleute zu kämpfen. »Um Himmels willen, lasst möglichst viele Männer am Leben! Angus, Thomas, reitet mit mir zur Belagerungsmaschine. Theobald, Garth und ihr drei MacTavishes, übernehmt die Männer beim Rammbock. Die anderen attackieren die Leute am Tor und entfernen die Leitern. Los! Wir reiten für Gott, den König und unser Land!«
Den Kopf gesenkt, drückte er die Knie in Mercurys Flanken und sie galoppierten den Hang hinab, um die belagerte Festung zu retten.
Zahlenmäßig waren die etwa hundert Rebellen der Truppe Waryks überlegen, aber nicht, was die Kampfkraft betraf. Er wollte ein Gemetzel vermeiden. Immer wieder fiel es ihm schwer, jemanden nur wegen seiner Gesinnung zu töten. Deshalb starben zu viele ehrenwerte Leute. Wie er aus Erfahrung wusste, befanden sich unter den Normannen des Königs, unter den Schotten, den Stämmen, die in der abgeschiedenen Wildnis lebten, sogar unter den Wikingern anständige Männer. Manche dieser Rebellen glichen alten keltischen Barbaren, teilweise wie Pikten bemalt.
Und sie wehrten sich wie Berserker. Zu seiner Bestürzung suchten sie keine Gnade. Meistens von mehreren auf einmal angegriffen, musste er wohl oder übel einige töten. Verblüfft hörte er verschiedene Sprachen – normannisches Französisch, Gälisch, altes sächsisches Englisch, Norwegisch. Nur wenige flohen, die meisten kämpften bis zum letzten Atemzug.
Im schottischen Tiefland gab es zahllose Schlupfwinkel in dichten Wäldern, auf steilen Hügeln, und ein schneller Rückzug wies nicht auf Feigheit hin, sondern auf kluge Strategie. Während ein paar Rebellen den Kampf fortsetzten, ergriffen immer mehr die Flucht. Zum Waldrand verfolgt, drehten sie sich um und fochten erneut. Einem energischen Angriff endlich entronnen, sah Waryk seinen Adjutanten die Streitaxt hochschwingen, in der Absicht, einen Gegner niederzustrecken.
Sofort ritt Waryk zu Angus. »Halt, wir brauchen ihn lebend!«
Angus hielt inne und Waryk bezweifelte nicht, dass der Feind jedes Wort verstanden hatte. Die Augen weit aufgerissen, starrte er zum Wald hinüber, als erwartete er, ein böser Geist würde ihn anspringen. Dann stürzte er sich auf Angus und zwang ihn, die Axt erneut zu heben. Mit gespaltenem Schädel fiel er zu Boden. Statt Fragen zu beantworten, war er lieber gestorben.
»Tut mir leid, Waryk«, entschuldigte sich Angus erstaunt. »Dazu hat er mich herausgefordert.«
»Aye.« Waryk musterte den Toten. »Welcher Mann kämpft so hart, mit so armseligen Waffen – und fürchtet das Leben?«
»Verdammt will ich sein, wenn ich's weiß.«
»Reiten wir in die Festung und sehen wir nach, wie viele die Revolte überstanden haben.«
Der Turm von Localsh erhob sich in einem alten keltischen Bau. Im Hof, von Holzwänden umgeben, wurden regelmäßig Märkte abgehalten.
Erleichtert begrüßte Sir Gabriel Darrow, der Festungskommandant, das Ende der Belagerung. Auch er wunderte sich über den Angriff und erzählte Waryk, die erste Attacke sei aus heiterem Himmel erfolgt. Plötzlich waren bemalte Verrückte aus dem Wald gestürmt, hatten alle Männer auf den Feldern niedergemetzelt und verlangt, er solle ihnen das Tor öffnen und Localsh übergeben. Sonst würden alle Bewohner sterben, sobald die Festung gefallen sei. »So viel sinnlose Grausamkeit habe ich nur selten beobachtet.«
»Dafür gibt es genug Gründe«, meinte Angus. »Immerhin ist der englische König tot – und sein Neffe ein diebischer Bastard.«
Überrascht wandte sich Waryk zu Angus, der dem schottischen König die Treue hielt. David hatte Henry respektiert und er unterstützte Mathildas Thronanspruch. Andererseits kannte Waryk ihn gut genug, und wenn er es auch nicht aussprach, so wusste er doch, dass David ein Opportunist war, der seinen Vorteil nutzen würde, um die schottische Grenze weiter nach Süden zu verschieben.
»Die normannischen Lords fordern mehr Land, mehr Diener und Lehensmänner«, erklärte Sir Gabriel. »Und die Wikinger plündern und morden, um sich zu bereichern. Diese Belagerer wollten uns alle töten und das Land verwüsten. Keine Ahnung, warum ...«
Während er sprach, schleppten Thomas und Garth einen schwer verletzten Rebellen ins kleine Turmzimmer und legten ihn vor dem Herd auf den Steinboden. Aus mehreren Wunden an den Schläfen und in der Brust quoll Blut, und er war halb bewusstlos. Waryk kniete neben ihm nieder. »Für wen kämpft Ihr? Gelten diese Angriffe dem schottischen König? Handelt Ihr in Mathildas oder Stephens Interesse?«
Der Mann öffnete die Augen und lächelte schwach. »Habt Ihr einen Sohn, mein großer, mächtiger Lord?«
»Noch nicht.«
»Dann wisst Ihr gar nichts.«
»Mann, Ihr werdet sterben. Wenn Ihr einen Sohn habt und meine Fragen beantwortet, will ich für den Jungen sorgen und ihn zu einem Krieger erziehen. Also? Für wen kämpft Ihr?«
Als der Aufständische hustete, rann Blut aus seinem Mund. »Wie wollt Ihr für meinen Sohn sorgen, da Ihr doch selber blutet?«
Erst jetzt merkte Waryk, dass er im Kampf verwundet worden war. »Aye, ich blute und ich habe viele Narben. Aber ich werde nicht fallen und wenn doch, treten mächtige Männer in meine Fußstapfen. Vertraut mir den Jungen an, und ich sichere ihm den Schutz des Königs zu.«
Gequält schüttelte der Mann den Kopf. »Ihr würdet ihn nicht rechtzeitig erreichen, bevor ...« Von heftigen Schmerzen gepeinigt, biss er die Zähne zusammen.
»Was nötig ist, werde ich tun. Das schwöre ich Euch ...«
In diesem Augenblick hörte der Rebell zu atmen auf. »Was fürchtet ein Mann noch mehr als den Tod?«, fragte Sir Gabriel.
»Den Tod geliebter Menschen.« Waryk stand auf und wandte sich zu seinen Männern. »Keine anderen Überlebenden?«
»Sie sind geflohen oder gestorben, Waryk«, erwiderte Thomas.
»Sagt unseren Leuten, sie sollen die Verteidigungsbastionen verstärken. Danach brechen wir auf, Sir Gabriel. Wir lassen Euch fünfzehn Mann und Lebensmittel hier. Nun müssen wir herausfinden, was hinter dem Angriff steckt.«
»Vielleicht werden wir's nie erfahren«, seufzte der Festungskommandant.
»Doch, ich denke schon. Jeder kämpft, um irgendetwas zu erreichen. Und ich glaube, diese Schlachten gleichen den Spitzen der Eisberge in den nordischen Gewässern – was darunter liegt, können wir noch nicht einmal erahnen.«
Zwei Tage später, nachdem Waryks Männer die Mauern von Localsh befestigt hatten, ritten sie davon, abgesehen von den fünfzehn Kriegern, die zurückblieben.
Bevor sie nach Stirling zurückkehrten, steuerten sie die Grenze an und rasteten in einem kleinen englischen Schloss, wo sie von Lord Peter of Tyne eingeladen wurden, einem englischen Baron, dem es trotz zahlreicher Scharmützel in diesem Gebiet gelang, auf seinem Territorium Frieden zu bewahren. Sechzig gut ausgebildete Krieger verteidigten seine Festung. Im Streit zwischen Stephen und Mathilda verhielt er sich neutral, und wegen der unmittelbaren Nähe seines Heims zu Schottland legte er großen Wert auf sein Bündnis mit König David.
Als Sohn eines Adeligen, etwa so alt wie Waryk, war Peter mit David an Henrys I. Hof aufgewachsen. Nachdem er Waryks Bericht gehört hatte, schien auch er vor einem Rätsel zu stehen. »England ist gespalten. Manchmal findet ein Mann den Tod, weil er Stephen unterstützt. Und am nächsten Tag werden fünf Männer gefoltert, weil sie Henrys Tochter die Treue halten. In dieser Zeit geschehen die seltsamsten Dinge.«
»Aye, aber Schottland hat genug eigene Schwierigkeiten, und wir können die Probleme der Engländer wirklich nicht gebrauchen.«
»So viele Normannen und Anglo-Normannen nennen sich Schotten. Und wir alle müssen David aufmerksam beobachten, weil er weiter nach Süden vordringen will.«
»Gewiss.«
»Wenn diese Männer in den Kampf zwischen Henrys Tochter und ihrem Vetter verstrickt werden, die vom Eroberer abstammen, warum sollten sie sich gegen den schottischen König wenden?«
»Irgendjemand beschwört gewaltigen Ärger herauf. Wer es ist, weiß ich nicht. Natürlich werde ich Augen und Ohren offen halten.«
»Vermutlich denkst du an den schottischen König?«, fragte Waryk skeptisch und grinste. Meistens nahm Peter, ein kluger Mann, kein Blatt vor den Mund. Aber er handelte niemals leichtfertig.
»Nun, derzeit sitzt der schottische König auf seinem Thron, während die Engländer ... Mit meiner Loyalität verfolge ich stets meine eigenen Interessen.«
Waryk lachte und sie tranken zusammen bis spät in die Nacht hinein. Als das Herdfeuer langsam verglühte, sah er eine Frau im Schatten der Halle warten. Eleanora. Seit langer Zeit war Peter ein Freund. Sollten sie jemals Feinde werden, würden sie einander nichts vormachen. Müde von der verwirrenden Schlacht hatte er sich in dieser Festung erholt, lang ausgestreckt in seinem Sessel. Nun spannten sich seine Muskeln an. Lächelnd nickte er der Frau zu und leerte seinen Ale-Becher. »Gute Nacht, Peter, und vielen Dank für deine Gastfreundschaft.«
»In der Tat, du musst völlig erschöpft sein.«
»Allerdings.«
»Hat sich meine Schwester lange genug geduldet?« Belustigt hob Peter die Brauen.
»Sieht so aus.«
»Aye, mein Bruder!«, rief Eleanora. »Hört endlich auf mit diesem Gerede über Schlachten und Männer, die wie verrückte Gespenster aus dem Wald schleichen, um zu sterben!«
Waryk ging zu Eleanora hinüber, der Witwe eines reichen englischen Lairds. Seit vielen Jahren war sie seine Geliebte, wenn sie sich auch viel zu selten sahen. Zärtlich ergriff sie seine Hand und führte ihn durch schwach beleuchtete Gänge zu ihrer Suite. Dort waren duftende Kerzen herabgebrannt.
Rasch kleidete sie sich aus, eine wohlgeformte Frau, deren Brüste im flackernden Licht noch üppiger wirkten. Waryk kannte ihre Leidenschaft, ihre erprobten Liebeskünste. Voller Sehnsucht nach dem Geschmack ihrer Küsse und dem Gefühl ihrer Brüste in seinen Händen, zog er sie an sich. Darauf antwortete sie mit süßer Ungeduld, kniete nieder und öffnete seinen Waffengurt. Bald war die Schlacht vergessen.
Eigentlich hatte er beabsichtigt, etwas länger im gastlichen Haus Tyne zu bleiben. Aber am nächsten Tag traf ein Bote von David ein, der ihn drängte, möglichst schnell nach Stirling zu kommen. Offenbar war irgendetwas geschehen. Da Waryk den König kannte, wusste er, dass er nicht grundlos in dessen derzeitige Residenz beordert wurde. Und so verabschiedete er sich von den Geschwistern und ritt mit seinen Männern nach Stirling.
An einem späten Abend trafen sie einen bewaffneten Wachtposten in den Farben des Königs, und Waryk erkannte einen alten Freund, Sir Harry Wakefield, einen von Davids treuesten Beratern. Er stieg ab und begrüßte Sir Harry.
»Neue Kämpfe?«
»Nein, Laird Lion. Ich bin nur beauftragt, jemanden zu eskortieren. Nach dem Tod eines alten Lairds wurde seine Tochter zum König geschickt, und ich soll sie beschützen. Wir haben von den Kämpfen gehört. Im ganzen Land wird Eure Tapferkeit gerühmt, mein Freund.«
Um sich für das Kompliment zu bedanken, neigte Waryk den Kopf. Aber er hätte das Lob gern zurückgewiesen. Was hatte er denn anderes getan, als Verrückte zu töten, die kein bestimmtes Ziel zu verfolgen schienen?
»Dort drüben in dem Wäldchen könnt Ihr mit Euren Männern rasten, Laird Lion«, fuhr Sir Harry fort. »Hier wird niemand ohne meine Erlaubnis vorbeireiten.«
»Danke, Sir Harry. Schlagen wir unser Lager an der Stelle auf, die er uns gezeigt hat, Angus. Thomas soll den Männern Bescheid geben.«
Wie Angus wusste, traute Waryk niemandem, und so würde er in den ersten Stunden selber Wache halten. Erfreut, weil er dem Laird dienen konnte, salutierte Harry. »Mit diesen Belagerern von Localsh habt Ihr kurzen Prozess gemacht, Sir.«
»In der Tat. Aber sie werden sich wieder gegen den König erheben.«
»Hat er neue Feinde?«
»Ein König hat immer Feinde. Alte und neue.« Waryk übergab sein Pferd einem der Knappen, die mit dem Trupp ritten, und der Junge führte es davon, um es für die Nacht festzubinden.
Als Waryk ein Rascheln im Wäldchen hörte, fuhr er blitzschnell herum und zog sein Schwert. Zwischen den Bäumen tauchte ein Reiter auf. »Sir Harry ...« Ein gebieterischer Unterton konnte die Sorge in der Stimme des Mannes nicht ganz überspielen.
»Schon gut«, Matthew, das ist Laird Waryk, ein Getreuer des Königs, der vom Schlachtfeld zurückkehrt.«
»Aye, Laird Waryk.« Sichtlich erleichtert, ritt der Mann näher heran. »Heute Nacht brauchen wir Verstärkung, falls wir einen Feind abwehren müssen.«
»Hattet Ihr Schwierigkeiten?«, fragte Waryk.
»Nein. Aber es gibt immer irgendwelche Probleme, nicht wahr? Ein alter Laird starb und hinterließ eine Tochter ...«
»Nun, heute Nacht bleiben wir hier, und morgen warten wir, bis Ihr Euer Lager abgebrochen habt. Dann reiten wir hinter Euch. Wenn Euch jemand folgt, werden wir's sofort merken. Damit seid Ihr doch einverstanden, Sir Harry?« Keinesfalls wollte Waryk andeuten, er würde es dem alten Mann nicht zutrauen, eine verwaiste Erbin zum König zu geleiten.
»Gewiss, Laird Lion. Die Gefolgsmänner der Lady begleiten uns. Sobald wir Stirling sehen, werden sie umkehren. Und wenn sie an Euch vorbeireiten, werdet Ihr wissen, dass wir die Festung unbeschadet erreicht haben.«
»Gut, damit wäre alles geregelt.«
»Matthew, seht im Süden nach dem Rechten, und ich reite nach Norden.« Während Matthew sein Pferd herumschwang, wandte sich Sir Harry wieder zu Waryk. »Gute Nacht, Laird Lion.«
Nachdem sich der Lichtkreis der Fackel in Sir Harrys Hand entfernt hatte, sah Waryk die Lagerfeuer der Lady und ihrer Eskorte durch das dichte Laub der Bäume. Eine plötzliche Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit, und er trat an den Straßenrand. Eine Hand an einen Eichenstamm gelegt, beobachtete er die schattenhaften Gestalten der Männer im Widerschein der zuckenden Glut.
In der Mitte einer großen Lichtung brannte ein helleres Feuer. Blau und golden, violett und blutrot loderten die Flammen empor. Waryk sah ein Mädchen davor tanzen. Um ihr Gesicht zu erkennen, war er zu weit entfernt. Aber er nahm den betörenden Zauber der Szene wahr. Vielleicht lag es an der späten Stunde, am dünnen Nebel, der die junge Frau wie ein ätherischer Schleier umhüllte. Von flackerndem Licht übergossen, schimmerte ihr silberweißes Kleid in allen Regenbogenfarben. Ihr goldenes Haar schien rötliche Funken zu sprühen. Wie eine Elfe tanzte sie umher, mit der verführerischen Anmut einer keltischen Prinzessin aus alter Zeit, und zog alle Zuschauer in ihren Bann. Und dann sprach sie mit kristallklarer Stimme, und Waryk stellte bald fest, dass sie die Geschichte von St. Columba erzählte.
»Welche Sünde er begangen hatte, weiß niemand. Jedenfalls überquerte er das irische Meer und kam in unser geheiligtes Iona, von Gottes Hand mit Kraft gesegnet. Dort baute er ein großes Kloster und die Leute pilgerten zu ihm. Schon vorher waren Männer gekommen, um von Christus und der Kirche zu berichten. Aber keiner konnte sich mit Columba messen. Er war ein Künstler, der die Schönheit unserer keltischen Tradition bewahrte, ein Gelehrter, und seine Mönche arbeiteten hart und eifrig, um wunderbare Schriftrollen anzufertigen. Aber vor allem war er ein Ritter, und er bewies dem Volk die Macht seines Willens und seines Gottes. Er ritt zum Loch Ness, wo er einem riesigen Drachen gegenübertreten wollte. Schon lange hatte diese elende Kreatur die Menschen geplagt, Kinder gestohlen und verschlungen und viele schöne junge Mädchen. Das wollte Columba nicht länger dulden. Und so forderte er das Ungetüm zum Kampf heraus. Es erhob sich aus den schwarzen Tiefen des Lochs, schüttelte kristallklares Wasser von seinem mächtigen Schädel und spie Columba mit seinem feurigen Atem an. Aber der Ritter hielt seinen großen Schild hoch. Und so lenkte er das Feuer zum Drachen zurück und blendete ihn. Columba zog sein gewaltiges Schwert, erstach ihn, und die Menschen, die viel zu lange gehungert hatten, verspeisten ihren toten Feind.«
Die Arme zum Himmel erhoben, stellte sich die junge Frau auf die Zehenspitzen. Dann neigte sie sich lachend hinab, und ihr Haar umfloss ihre Gestalt wie goldener Regen. Wie bezaubernd sie ist, dachte Waryk, als sie sich wieder aufrichtete. Schön und stolz – und voller Leidenschaft. Ringsum erklang Beifall. Eine Laute ertönte, von einer Harfe, Gelächter und fröhlichen Stimmen begleitet. Zwischen den Bäumen huschten mehrere tanzende Gestalten umher.
Plötzlich verstummte die Musik. »Die Normannen des Königs sind hier!« Obwohl der Mann nicht allzu laut sprach, verstand Waryk die Worte. Er hörte atemloses Flüstern. Danach herrschte tiefe Stille.
Die Zähne zusammengebissen, lehnte er an der Eiche. Aye, David hatte viele Normannen aus England nach Schottland mitgebracht. Waryk kämpfte an der Seite der Normannen. Und er kämpfte gegen die Normannen. Trotzdem irritierte ihn die Bemerkung des Fremden. Am königlichen Hof genoss er viele Vorzüge und er kämpfte in einer Rüstung von bester Qualität. Wie er festgestellt hatte, trugen viele Männer im Gefolge der jungen Erbin lange wollene Gewänder, weit genug geschnitten, um im Kampf genügend Bewegungsfreiheit und durch üppige Falten ausreichenden Schutz zu bieten. Unter Waryks Kettenpanzer verbarg sich ein Schottenrock mit dem Muster seines Clans, für seinen Vater vom besten Wollweber aus der Familie seiner Mutter ersonnen, den Strathearns.
Manche Menschen in der christlichen Welt behaupteten, die Römer hätten die Schotten unterwerfen müssen. So viel Europa den Römern auch verdanken mochte – Straßen, Aquädukte, Gesetze, Literatur und andere Errungenschaften –, Waryk war anderer Meinung. Mit der Schönheit keltischer Juwelen ließ sich nichts vergleichen. Und die Schriftrollen, von irischen und schottischen Mönchen in den letzten Jahrhunderten geschaffen, waren einzigartige Kunstwerke. Trotzdem mussten wir von unseren Feinden lernen, dachte er, und uns ebenso gut bewaffnen wie sie.
Obwohl er unter seinem Überwurf eine normannische Rüstung trug, war er in seinem Herzen ein Schotte. Für einen Platz in dieser Heimat hatte der Vater mit seinem Blut bezahlt. Und Waryk hatte sein eigenes oft genug vergossen.
Eine Zeit lang hielt er Wache. Dann beschloss er zu schlafen. Er musste Kräfte sammeln. Nur Gott allein mochte wissen, was der König als Nächstes plante.
In seinem Traum erschien eine Tänzerin, die sich leichtfüßig im Flammenschein bewegte. Goldblondes Haar umwehte sie wie ein Mantel. Und so sehr er sich auch bemühte, er konnte ihr Gesicht nicht sehen. Er versuchte nach ihr zu greifen. Da verschwand sie im Nebel.
Kapitel 2
Auf einer grauen Stute, von Gefolgsleuten umringt, ritt Mellyora aus dem Wald, blickte ins Tal hinab und betrachtete die Stadt Stirling, wo der König gerade in einer seiner Festungen residierte.
Die Römer waren bis hierher gekommen. Zuvor hatten sich alte Stämme in diesem Gebiet niedergelassen. Im sanften Dämmerlicht bildeten Hügel und Senken, Felder und Gewässer ein schönes Bild. Stolz erhoben sich die Festungsmauern zwischen herbstlich verfärbten Bäumen. In einem Fluss spiegelte sich die sinkende Sonne und ließ die Wellen wie Juwelen glitzern. Schafe weideten auf einer fernen Wiese, von zwei Jungen und ihren Hunden gehütet. Vor den Mauern, nahe dem Ufer, verkauften einige Frauen den Fischfang ihrer Männer. Vom Wind getragen, drang das Klirren der Hammerschläge aus der Werkstatt eines Waffenschmieds den Hang herauf.
Entzückt genoss Mellyora den Anblick der Stadt und der schönen Landschaft. Welch ein Unterschied zu Blue Isle, wo wilde, schäumende Wellen an eine zerklüftete Felsenküste schlugen ... Hier herrschte friedliche Ruhe. Aber flussabwärts entdeckte sie Zelte und Hütten. Ein Wikingerlager. Aufgeregt biss sie in ihre Lippen. Ihr Onkel war in der Nähe. Wenn es Schwierigkeiten gab – er war da.
»Mylady, wir müssen weiterreiten.«
Sie nickte Sir Harry zu, der sie auf Blue Isle abgeholt hatte. Viel zu früh. In tiefer Trauer um den Vater, hatte sie noch nicht geplant, den König aufzusuchen. Adins Tod erschien ihr unbegreiflich. Sie konnte kaum einen klaren Gedanken fassen und etwas anderes empfinden als Verzweiflung. Aber Davids Männer kamen zu ihr und sie musste ihnen wohl oder übel folgen. Um sich den Abschied von der Heimat zu erleichtern, hatte sie auf ihrer eigenen Eskorte bestanden, die nun umkehren würde. Nur die Dienerin Jillian sollte mit ihr reiten. Während Mellyora unter dem Schutz des Königs stand, würden ihre Gefolgsleute Blue Isle bewachen. Sie war die Herrin dieser Insel, und sie hoffte, David würde das anerkennen. Als Erbin ihres Vaters wollte sie dem König Treue schwören und dann aufrichtig und flehend mit ihm sprechen. Sicher war das die beste Strategie.
»Nun verlassen wir dich, Mellyora.«
Sie drehte sich zu Ewan um, der sie mit ernsten grauen Augen ansah und offenbar erwartete, sie würde ihn auffordern, an ihrer Seite zu bleiben. Diese düstere Miene trug er zur Schau, seit die Krieger des Königs hinter Mellyoras Eskorte ritten. Trotz seiner sichtlichen Sorge bat sie ihn nicht um Beistand. Was sie anstrebte, musste sie allein und aus eigener Kraft erreichen. »Bald komme ich wieder nach Hause, Ewan. Ich werde euch alle vermissen.« Lächelnd wandte sie sich zu den anderen Männern von Blue Isle. »Darrin, Peter, Gareth – hütet Blue Isle, so wie ihr mich beschützt habt. Ich vertraue mein Zuhause eurer Obhut an. Vielen Dank für eure Begleitung. Von jetzt an werden mich die Männer des Königs vor allen Gefahren bewahren.«
»Vielleicht sollten wir mit Euch reiten«, bemerkte Ewan.
»Dort vorn liegt die Festung, und ich würde für die Lady sterben, so wie alle Getreuen des Königs«, erwiderte Sir Harry Wakefield nicht unfreundlich. Sich selbst hielt er für eine viel stärkere Eskorte. Immerhin war er ein königlicher Ritter, ein erfahrener Krieger, der zahlreiche Schlachten überlebt hatte. Seinem Clan gehörte auch Ewan an. Er stammte aus einer Wildnis, die man im Süden – von der normannischen Bevölkerung Englands beeinflusst, immer noch als barbarisch betrachtete.
»Mach dir keine Sorgen um mich, Ewan«, bat Mellyora. »Sicher werde ich mich bald zurechtfinden.« Sie liebte ihn. Seit ihrer Kindheit war er ihr bester Freund, aufrichtig und verlässlich. Zudem sah er mit seinem dunkelblonden Haar und den grauen Augen sehr gut aus.
Auch Sir Harry war ein alter Freund. Gemeinsam mit fünf Rittern des Königs beschützte er sie seit der Abreise von Blue Isle. Nun befand sich das Stadttor von Stirling in Sichtweite. Zweifellos würde sie unbeschadet in der Festung eintreffen. »Wenn Ihr mich für eine kleine Weile entschuldigen würdet, Sir Harry ... Ich möchte allein mit Ewan reden, der in meiner Abwesenheit die Insel bewachen wird.«
»Aye, Mylady, natürlich.«
Von Ewan gefolgt, lenkte sie ihr Pferd in den Wald zurück. Ihre Stute drängte sich an seinen Wallach. Zärtlich berührte Mellyora die Wange ihres Freundes. »Glaub mir, du musst nicht um mich bangen.«
»Ich habe keine Angst.«
»Aber du schaust so traurig aus.«
Statt zu antworten, lächelte er nur.
»Ich bin stark«, versicherte sie. »Und ich kann für mich selbst sorgen.«
»Vergiss nicht – David ist der König. Das haben wir dir erklärt und dich gewarnt ...«
»Gewiss, und ich will meinen Lehenseid leisten.«
»Er wird denken, du wärst zu schwach.«
»Dann werde ich ihn vom Gegenteil überzeugen.«
»Sei vorsichtig, wenn du mit ihm sprichst, Mellyora. Fordere ihn nicht heraus. Sonst bringst du dich in Gefahr. Wenn du angegriffen wirst ...«
»Wieso?«
Plötzlich zog er sein Schwert und wollte es an ihre Kehle halten.
Aber sie hatte die Bewegung vorausgeahnt. Mit ihrem eigenen Schwert, das sie in einer schmalen Lederscheide an der Hüfte trug, wehrte sie seinen Stahl ab. »Was wolltest du sagen, Ewan?«, fragte sie leise.
Doch er schüttelte nur den Kopf und senkte den Blick – bedrückt, weil sie ihn übertrumpft hatte.
»Nichts wird mir zustoßen«, beteuerte sie. »Vertrau mir.«
»Aye, und ich werde für dich beten.«
Offensichtlich war er gekränkt, weil sie seinen Angriff, der ihre Schwäche beweisen sollte, so mühelos abgewehrt hatte. Das bedauerte sie.
Nachdem sie festgestellt hatte, dass sie nicht beobachtet wurden, neigte sie sich zu ihm und hauchte einen Kuss auf seine Lippen.
»Mylady MacAdin!«, rief Sir Harry. »Nun müssen wir weiterreiten! Allmählich bricht die Dunkelheit herein!«
Lächelnd richtete sie sich im Sattel auf. »Hab keine Angst um mich, Ewan. Mein Herz gehört für immer dir.«
In seinen grauen Augen lagen alle Gefühle, die er ihr entgegenbrachte. Ehrerbietig ergriff er ihre Hand und küsste sie. »Was immer geschehen mag, ich werde dich immer lieben, Mellyora.« Sein Blick schien auszudrücken, dies sei ein Abschied für immer, und das ertrug sie nicht. Ohne Sir Harrys drängenden Ruf zu beachten, küsste sie Ewans Mund ein letztes Mal. »Bald kehre ich nach Hause zurück, mein Liebster.«
Sie verließen den Wald, und ihre Wege trennten sich. Während Mellyora hinter Sir Harry den Hang hinabritt, erinnerte sie sich an seine Worte. »Mylady, der König möchte Euch noch heute sehen. Er hat Euch viel zu sagen.«
Und ich habe ihm viel zu sagen, dachte sie. Auf den Gedanken, sie würde vielleicht keine Gelegenheit finden, ihm ihre Pläne zu erklären, kam sie gar nicht.
»Diese Heirat habe ich für Euch gewählt, Mellyora«, verkündete der König in entschiedenem Ton, »mit aller Sorgfalt.« Er spürte ihren Widerstand, eine leidenschaftliche Glut, die sie zu verströmen schien, wie sengende, wütende Sonnenstrahlen an einem Hochsommertag.
Im Lauf der Jahre hatte sich David kaum verändert. Er war nur stärker und selbstsicherer geworden. Und er hatte erkannt, dass ein König, der seinen Thron bewahren wollte, die Menschen manipulieren musste. Manchmal verschafften ihm Bündnisse größere Vorteile als die Kampfkraft vieler hundert Krieger. Aufgrund seiner Klugheit und Erfahrung beurteilte er weder Freund noch Feind nach der Herkunft. Gewisse Engländer attackierten im Vollgefühl ihrer Macht seine südlichen Grenzen. Zum Glück hatte er im Volk seiner Frau, einer northumbrischen Erbin, zahlreiche Anhänger gefunden. Für seine Erziehung war Henry I. von England teilweise verantwortlich gewesen. Er hatte ihn unterrichtet, mit mehreren Ländereien betraut und verheiratet. Aber Henry war vor zwei Jahren gestorben, und der Kampf um die Thronfolge hatte die englische Monarchie in ein Chaos gestürzt. Diese Situation stärkte die Macht englischer Aristokraten, die sich in den Streit zwischen Mathilda und Stephen einmischten, um eigene Interessen zu verfolgen. Natürlich sahen die Grenzland-Lords eine besondere Bedrohung in David, der nach Süden vorzurücken suchte.
Und die Wikinger stellten eine weitere Gefahr dar. Niemals hatte er einen Mann verabscheut, nur weil er ein Wikinger war. Sogar das Königshaus der Normandie stammte zum Teil von Wikingern ab. Bis nach Frankreich, England, Irland und Russland waren die Seeräuber vorgedrungen – und nach Schottland. Nun gehörten die furchterregenden Invasionen seit Jahrhunderten der Vergangenheit an. Aber man musste immer noch mit den Angriffen habgieriger Wikinger rechnen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren Davids königliche Vorfahren gezwungen worden, dem Dänen Knut den Lehenseid zu leisten, der fast ganz England beherrscht hatte. 1098 war der norwegische König Magnus III., der Barfüßige genannt, mordend und plündernd durch Orkney und über die Hebriden gezogen, ehe er einen Friedensvertrag mit Davids Bruder geschlossen hatte. Aye, die Wikinger waren gefährlicher als die Grenzland-Lords, und David beabsichtigte nicht, ihnen auch nur einen winzigen Teil seines Landes zu überlassen.
Wegen dieser Bedrohung hatte er Mellyora kurz nach dem Tod ihres Vaters zu sich geholt. Er nahm ihren Lehenseid entgegen, dann erläuterte er seine Pläne für ihre unmittelbare Zukunft. Trotz ihrer Herkunft mütterlicherseits und der Treue ihres Vaters zu Schottland stand eine junge Wikingerin vor David, eine Erbin mit gefährlichen Wünschen – und einer gefährlichen Verwandtschaft. Selbst wenn sie glaubte, sie würde ihm getreulich dienen, konnte sie gegen ihn aufgehetzt werden. Sie war sein Patenkind. Bei ihrer Taufe hatte er an der Seite ihres Vaters gestanden, der kurz zuvor zum Christentum übergetreten war, und sie aufwachsen sehen. Schon vor langer Zeit hatte er ihre Zukunft geplant. In schmerzlicher Trauer um seine Frau hatte Adin sich geweigert, noch einmal zu heiraten und demzufolge keinen männlichen Erben gezeugt – was David begrüßte.
Mellyora zählte zu den reichsten Erbinnen in seinem Land. Zudem war sie jung und schön, gesund und temperamentvoll. Viele Männer hatten den König diskret um ihre Hand gebeten, schon zu Lebzeiten ihres Vaters. Alle wurden abgewiesen. Nur wenige verdienten einen solchen Preis und so viel Macht, die sich mit Liebe zu Schottland, unwandelbarer Treue zum schottischen Haus Canmore und einem gewissen Sinn für den wachsenden Nationalismus vereinen musste. Gezwungenermaßen hatten die schottischen Könige den englischen eine gewisse Lehenstreue gehalten. Doch die Grenzen waren gezogen, und mit Kriegskunst, Diplomatie und Gottes Wille würde Schottland erstarken. Das musste Davids eigenwilliges junges Mündel verstehen lernen. Er war ein guter König, hoch anerkannt für seine Einführung neuer Gesetze, der Belebung des Handels, der Prägung von Münzen und weitere Verdienste. Meistens zeigte er sich barmherzig. Nur in gewissen Situationen kannte er keine Gnade. Und während er das schweigende Mädchen mit dem trotzig erhobenen Kinn musterte, ahnte er, wie schwer es ihm diesmal fallen würde, hart zu bleiben. Wie auch immer – in Mellyoras Verwandtschaft gab es zu viele gefährliche Wikinger.
»Demnächst wird Eure Heirat stattfinden, Mylady«, betonte er höflich, aber unnachgiebig. »Versteht Ihr meine Position?«
Keine Antwort.
Wie eine Statue stand sie da, als wäre sie eine der schönen mythischen Figuren, die ein Künstler für die königliche Halle von Stirling gemeißelt hatte. Ohne ihre Gefühle zu verraten, erwiderte sie Davids Blick mit ihren tiefblauen Augen. Die perfekte marmorne Glätte ihres Gesichts blieb kühl und ausdruckslos.
Offenbar will sie mich bekämpfen, dachte er. Vielleicht nicht hier, nicht jetzt. Erst später. Auf welche Weise?
Bisher hatte sie ihm weder widersprochen noch zugestimmt. Ihre Bitte, er möge ihr erlauben, ihr Erbe selbst zu verwalten, hatte er abgelehnt. Zu seiner Verblüffung war sie bereit gewesen, ihm den Lehenseid zu leisten, in der Erwartung, er würde sie zur Herrin von Blue Isle ernennen. Stattdessen hatte er sie über ihre bevorstehende Hochzeit informiert, was ihr gründlich zu missfallen schien.
Seine Finger umschlossen die Armstützen seines kunstvoll geschnitzten Stuhls. Seit einiger Zeit hatte er Mellyora, die Enkelin eines norwegischen Königs, nicht mehr gesehen. Was dachte sie? Zweifellos kannte sie die Gefahr, die von den Wikingern ausging und die sie oft genug bewiesen. David hatte Verträge mit ihnen geschlossen und er respektierte sie. Auf vielen Inseln im Norden regierten Wikinger-Jarls. Aber Adin hatte sich zu Schottland bekannt. Nur wenige seinesgleichen ordneten sich so bereitwillig in die politische Struktur eines vereinten Schottland unter einem einzigen Königs ein. Seine Verwandten beherrschten immer noch mehrere Inseln vor der schottischen Küste. Jetzt lagerte sein Bruder Daro, der Laird von Skul Island, außerhalb der Stadt Stirling, um mit David zu verhandeln. Und Mellyoras einflussreiche Verwandtschaft aus der Heimat ihres Vaters würde ihr zweifellos beistehen, wenn sie um deren Hilfe bat. Wie auch immer, der König würde seinen Willen durchsetzen.
Zu Mellyoras Vorfahren gehörte auch eine der ältesten gälischen Familien in Schottland. Aufgrund ihrer Verwandtschaft mütterlicherseits müsste sie ihm getreulich dienen. Obwohl er viele Jahre an einem normannischen Hof verbracht hatte, wussten es seine Untertanen zu schätzen, dass seine Mutter einem sächsischen Königshaus entstammte. Väterlicherseits konnte er sein Erbe bis zum großen Kenneth MacAlpin zurückverfolgen. Manche glaubten, die Linie der schottischen Könige würde sogar noch weiter zurückgehen, bis ins alte Ägypten, dann nach Spanien und Irland und von dort nach Schottland. Indem er sein Land zusammenhielt, hatte er die Bedeutung der Blutsbande erkannt und gelernt, wie vorsichtig man mit gemischtem Blut umgehen musste.
Was Mellyoras Herkunft betraf, hatte diese Sorgfalt keine Rolle gespielt. Adin war einfach nach Schottland gekommen, hatte gesehen und gesiegt. Ob seine Braut am Anfang willig gewesen war oder nicht, wusste niemand. Jedenfalls vereinte das gemischte Blut in Mellyoras Adern die besten Eigenschaften ihrer Eltern. Sogar einem König würde eine solche Frau zur Ehre gereichen. Sie besaß einen geschmeidigen wohlgeformten Körper, ein fein gezeichnetes Gesicht mit hohen Wangenknochen, und vollen Lippen. Und sie bewegte sich mit der Anmut eines Engels. In ihren strahlend blauen Augen lag eine geheimnisvolle, fast mythische Macht, als wäre sie von Adins alten nordischen Göttern gezeugt worden. Üppig fiel das lange goldblonde Haar mit dem rötlichen Schimmer auf ihren Rücken hinab, weder geflochten noch von Spangen gebändigt. Zu ihrem einfachen blauen Leinenkleid trug sie kein einziges Schmuckstück. Vielleicht hatte sie geglaubt, mit ihrer schlichten äußeren Erscheinung würde sie ihre Lehenstreue umso deutlicher bekunden. Sie war vor ihn getreten wie früher vor ihren Vater, eine ergebene Tochter, die es für selbstverständlich hielt, Liebe und Loyalität zu geloben. Deshalb verdiente sie Davids Vertrauen.
Trotz der schmucklosen Kleidung wirkte sie aristokratisch. Für eine Frau war sie sehr hoch gewachsen, ein majestätisches Erbe ihres Vaters, aber zierlich gebaut wie die Mutter. Kerzengerade stand sie mit gestrafften Schultern vor ihm. Ihr Gesicht blieb ausdruckslos. Nur die zusammengepressten Lippen verrieten, was sie von Davids Befehl hielt. Und am schlanken Hals pochte ein heftiger Puls.
O ja, sie war wütend. David lächelte. Immerhin tat sie ihr Bestes, um ihren Zorn zu verbergen. Oder sie plante eine Verschwörung gegen ihn. Sein Lächeln erlosch. Dieses unselige Wikingerblut in ihren Adern ... Die Hochzeit musste möglichst bald stattfinden. »Nun, meine Liebe?«
»Ich verstehe Eure Position, Sire.«