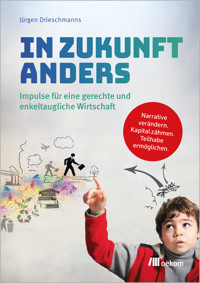
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Klimakrise, soziale Spaltung, wirtschaftliche Instabilität – unsere Zeit ist geprägt von Unsicherheit. Wer verstehen will, warum unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme an ihre Grenzen stoßen und wie eine gerechtere, zukunftstaugliche Ordnung aussehen könnte, findet in diesem Buch fundierte Orientierung. Jürgen Drieschmanns, langjähriger Lehrer für Ethik, Politik und Wirtschaft, verknüpft persönliche Erfahrungen mit analytischer Schärfe. In erzählerischer Form entwickelt er Denkanstöße zu zentralen Fragen: Was macht ein gerechtes Steuersystem aus? Wie legitim ist Eigentum? Und warum kann gesellschaftliche Fairness nur dann Bestand haben, wenn sie global gedacht wird? Eine Einladung und Inspiration für alle, die sich eine lebenswerte Zukunft wünschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Drieschmanns
In Zukunft anders
Impulse für eine gerechte und enkeltaugliche Wirtschaft. Narrative verändern. Kapital zähmen. Teilhabe ermöglichen.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gem. § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHGoethestraße 28, 80336 München+49 89 544184 – [email protected]
Layout und Satz: oekom verlagKorrektorat: Pia DrieschmannsUmschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlagUmschlagabbildung: © Adobe Stock: angiolina; Rückseite © Gerhard MesterDruck: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978‑3‐98726-488-7DOI https://doi.org/10.14512/9783987264887
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Von Wahrnehmungen und Diagnosen
Die Sprache des Kapitalismus
Wetten, dass …?
Die Stiftung »Erde« des großen Unbekannten
Money Makes The World Go Round
Kapitalschaffende und ihre willigen Helfer
Der einseitig gekündigte Generationenvertrag
Die große Ungleichheit oder Wer lebt wie lange und warum?
Das Modell Deutschland oder Der (verhinderte) Wohlstand der (anderen) Nationen
Wer hat, dem wird gegeben oder Sie säen nicht und ernten doch
Eigentum und Eigentümer
Schulden? Schuldig!
Zinsen: Lassen Sie Ihr Kapital hart arbeiten
Gute Zinsen – böse Steuern
Steuern – Staatseinnahmen unter dem Vorbehalt der Gerechtigkeit
Sozialhilfe für Alle? Das Bedingungslose Grundeinkommen
Armut
Kapitalismus
Fazit
Danksagung
Über den Autor
Medienverzeichnis für empfehlenswerte Schriften, Filme und Netzadressen
Vorwort
Jahrelange Erfahrung als Handelslehrer – mit einer fundierten Ausbildung als Bankkaufmann und Betriebswirt – haben mir tiefgreifende Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge verschafft. Dieses ökonomische Verständnis wurde durch mein Nebenfachstudium der Soziologie sowie durch den Unterricht in Politik und Ethik wesentlich erweitert. In unzähligen Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern sowie bei der Erstellung didaktischer Materialien entwickelte sich so ein ganzheitlicher Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft.
Dieses Buch ist bewusst kein wissenschaftliches Werk. Es verbindet meine persönliche Geschichte, meine Herkunft und meine Familie mit theoretischen Überlegungen und praxisnahen Vorschlägen für eine gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft. Der Fokus liegt auf einer Welt, die allen acht Milliarden Menschen eine lebenswerte Zukunft bietet. Einige der hier vorgestellten Ideen mögen radikal erscheinen – doch die Welt begegnet uns zunehmend radikaler. Ökologische Katastrophen, die tiefer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, Kriege und massive Fluchtbewegungen verlangen Antworten. Vielleicht kann dieses Buch Anstöße geben, über solche Antworten nachzudenken.
Einführung
Der Weg in den Hörsaal gleicht einem Spießrutenlauf: Wir passieren lautstark protestierende Kommilitoninnen und Kommilitonen, die uns ausbuhen und schrill pfeifen. Immerhin gelingt es uns, den Hörsaal zu betreten und uns in eine der vielen leeren Reihen zu setzen. In einem früheren Semester waren die Eingänge sogar mit Brettern vernagelt.
Was mich damals in die Vorlesung von Professor Wolfram Engels zog, weiß ich nicht genau. War es die Tatsache, dass er in derselben Textilfabrik im Management tätig war wie mein Großvater?
Mein Großvater arbeitete dort allerdings als Passierer – er fertigte die Webvorlagen an, die als Muster für die Weber dienten. Oder faszinierte mich, dass Engels ein direkter Nachfahre jenes Engels war, der sich mit Karl Marx Theorien austauschte und Schriften verfasste, die die Welt des 20. Jahrhunderts in zwei Lager teilten? Ein Lager wollte über die Produktionsverhältnisse eine klassenlose Gesellschaft erreichen, das andere glaubte an die Kraft des Marktes zur Wohlstandsmehrung für alle. Eines stand fest: Engels war ein entschiedener Vertreter der marktwirtschaftlichen Seite und vertrat seine Thesen mit fast absolutistischer Überzeugung. Genau das trieb die eher links eingestellten Studierenden vor die Türen seiner Vorlesung. Seine marktradikalen Positionen verschafften ihm später den Herausgeberposten der Wirtschaftswoche und den Ludwig‐Erhard‐Preis.
Mein wohl entscheidender Grund, seine Vorlesungen zu besuchen, lag jedoch in meiner eigenen Prägung: Ende der 1960er‐Jahre absolvierte ich eine dreijährige Banklehre – eine Zeit, in der Auszubildende noch Lehrlinge hießen, morgens als Erste kamen und abends als Letzte gingen. Engels war Professor für Bankbetriebslehre, hatte aber, wie er selbst sagte, niemals in einer Bank oder für eine Bank gearbeitet.
Im April 1977 hätte ich mich selbst nicht als »Linken« bezeichnet. Meine Erziehung in einem katholischen Elternhaus und das Aufwachsen in einer erzkonservativen Stadt hatten das verhindert. Doch gerade die Seminare und Vorlesungen eines radikalen Marktwirtschaftlers wie Engels boten einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichten mir, diese Perspektive ungefiltert kennenzulernen, meine eigene Meinung daran zu reiben und sie letztlich zu formen.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Geld führte zwangsläufig zu Fragen rund um Schulden und Wertpapiere. In einer seiner Vorlesungen erklärte Engels ein Recht, das Wetten auf die Zukunft in Form eines Wertpapiers ermöglichte. Dabei galt eine klare Regel: Wer eine Wette abschließt, muss das Geld für eine mögliche Niederlage bereits besitzen, um die Wettschulden begleichen zu können. Diese Position nennt man bis heute »Stillhalter in Geld« oder »Short Call«. Diese frühen Einblicke in die Logik der Finanzmärkte hinterließen einen bleibenden Eindruck und begleiteten mich weit über das Studium hinaus.
Nach dem Studium unterrichtete ich 40 Jahre lang Bankauszubildende an einer kaufmännischen Berufsschule. In dieser Zeit wurden weitere Spekulationsgeschäfte möglich – sogenannte Futures –, bei denen Verluste und Gewinne unbegrenzt sein konnten. Banken vermittelten solche Geschäfte an die Terminbörse allerdings nur, wenn die Bonität der Wettenden geprüft war, um sich selbst vor Verlusten zu schützen.
Ein tragisches Beispiel für eine verlorene Wette ist der Suizid des Ratiopharm‐Inhabers. Er hatte sich während der Übernahmeschlacht zwischen Porsche und VW – einem Machtkampf zwischen zwei Nachfahren von Ferdinand Porsche – mit einer Milliardenwette weit aus dem Fenster gelehnt. Als der Verlust eintrat, sollte letztlich der Staat die Rettung der Arbeitsplätze und damit die Verluste übernehmen. Das Motto: Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen.Die Liberalisierung der Kapitalmärkte, die diese Spekulationen ermöglichte, mag in einer Gesellschaft mit weitreichenden Freiheiten plausibel erscheinen. Doch sie birgt Risiken.
Blicken wir vom »schnöden Mammon« auf die reale Welt, so sehen wir Gefahren, die unser aller Zukunft betreffen: Erderwärmung, Artensterben, Umweltzerstörung. Wir konsumieren, fliegen in den Urlaub, streamen unzählige Daten – alles in der Hoffnung, dass Wissenschaft und Technologie die negativen Folgen unseres Handelns irgendwann ausgleichen werden. Jedes Handeln mit ungewissem Ausgang ist eine Wette auf die Zukunft – und fast alles, was wir tun, ist unsicher in seiner Wirkung. Diese Überlegung führte mich zu meinem zweiten Standbein im Studium: der Spieltheorie. Schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Blasen wir CO₂ in die Luft und wetten darauf, dass künftige Technologien die Erderwärmung wieder auf ein vorindustrielles Maß senken können? Wer gewinnt dabei und wer verliert? Wer ist der »Stillhalter« in dieser globalen Wette? Und wer zahlt, wenn sie verloren geht? Diesen Fragen soll dieses Buch nachgehen. Ich werde keine wirtschafts‐ oder naturwissenschaftlichen Erklärungen liefern – das haben andere bereits hervorragend getan. Das Wissen ist da. Doch wie rechtfertigt die heutige »vorletzte Generation« ihr Handeln? Und was bedeutet das für die »letzte Generation«?
Als Lehrer für Wirtschaft, Politik und Ethik konnte ich meine Haltung in 40 Berufsjahren in unzähligen Diskussionen mit Schülerinnen, Schülern und Freunden – egal ob gleich‐ oder andersdenkend – herausbilden. Und dann gibt es noch jene Bücher, die wachrütteln und auf die ich in den jeweiligen Kapiteln hinweisen werde.
Von Wahrnehmungen und Diagnosen
Wirtschaftspolitische Entscheidungen beruhen oft auf Diagnosen von Fachleuten. Dazu gehören die Kommission für die Steuerschätzung, der Jahresbericht des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (die fünf Weisen) und die vielen Indizes von Wirtschaftsverbänden.
Das Buch Fehldiagnose von Tom Krebs präsentiert einen Ansatz, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt und gleichzeitig eine positive Zukunftsvision aus der aktuellen Misere bietet.
»Dazu muss die Politik die Märchenwelt der selbstregulierenden Märkte hinter sich lassen und das alte Marktdogma durch eine realistische Theorie von Wirtschaft und Gesellschaft ersetzen.« Diese neue Theorie bietet eine Methode zur Analyse einer Gesellschaft im Transformationsprozess, die sich am besten mit dem Begriff »ökonomischer Realismus« umschreiben lässt. Das Ergebnis eines solchen Paradigmenwechsels ist eine Politik, die ökonomische Vernunft und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Dieser Ansatz steht im krassen Widerspruch zum marktliberalen Fundamentalismus mit seinen realitätsfremden Annahmen und gefährlichen Schlussfolgerungen, wie er immer noch die öffentlichen Debatten und die Darstellung in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre dominiert. Insofern lässt sich dieses Buch auch als Versuch lesen, die Grundzüge einer kritischen und gleichzeitig relevanten Wirtschaftswissenschaft zu skizzieren.«
Soweit aus seinem Buch, das aufzeigt, wie die meisten Ökonomen Krisen falsch diagnostizieren, weil sie in einer Märchenwelt leben und an einen realitätsfremden Marktliberalismus glauben. Zum Zweiten erhebt es »den Befund, dass die Fehldiagnose dieser Ökonomen irgendwann von der Regierung übernommen werden und dies zu politischen Fehlentscheidungen führen kann – mit dramatischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen.«
Hermann‐Josef Abs, ein Bankier, kein Bänker, prägte den Satz: »Ich habe mit Prognosen immer gute Erfahrungen: ich habe nie welche abgegeben«. Vielleicht sollte man die Wirtschaftspolitik in manchen Beziehungen genauso handhaben. Es gibt eine jährliche Steuerschätzung einer Kommission, auf deren Basis dann die Bundesregierung den Haushalt erstellt. Wieso nimmt man nicht die Zahlen des letzten Jahres, denn das ist Geld, das ohne Vorbehalt ausgegeben werden kann, es ist ja da!
Im Dezember 2024 war im Wiesbadener Kurier zu lesen:
»Manchmal ist es schwer, all die dunklen Nachrichten des vergangenen Jahres zu verarbeiten. In der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen anderen Orten tobten und toben Kriege, die zerstrittene deutsche Bundesregierung zerbrach, in vielen Ländern verwüsteten Jahrhunderthochwasser das Land, beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt starben Menschen und bei Abstürzen von Passagierflugzeugen gab es zahlreiche Todesfälle. All das bleibt im Gedächtnis. Viel eher als die Milliarden Menschen, die sich tagtäglich friedlich begegneten. Oder die unzähligen Flugzeuge, die sicher landeten. Oder auch die guten Nachrichten, etwa dass die Abholzung im Amazonas zurückging oder Deutschland die Fußball‐EM im eigenen Land feierte.«
Was führt dazu, dass negative Eindrücke eine stärkere und nachhaltigere Wirkung auf unser Gedächtnis haben als positive? Die Wissenschaft nennt das Negativitätseffekt oder Negativitätsdominanz. Die Psychologen Lucas LaFreniere und Michelle Newman zeigten 2020 in einer Studie, dass die Menge der negativen Emotionen in uns Menschen in der Regel unverhältnismäßig hoch ist. »Mehr als 90 Prozent der Sorgen, die sich Menschen täglich machen, seien völlig nutzlos – denn die Probleme, um die sie kreisen, träten niemals ein.« Viele unserer Handlungen folgen den Restinstinkten, die uns die Evolution gelassen hat. Konrad Lorenz hat das ausgiebig beschrieben. Tausende von Jahren waren sie überlebenswichtig. Die Beachtung von Gefahren hat den Menschen immer schon das Leben gerettet. Was ist giftig? Welche Tiere sind gefährlich? Sich das zu merken und sich zu schützen, folgt der Erkenntnis des Negativen. Baumeister und Tierney schreiben in ihrem Buch Die Macht des Schlechten. Nicht mehr schwarzsehen und gut leben:
»Der Effekt (schwarz zu sehen) fördere zudem Stammesdenken, Rassismus, grundlose Ängste und Zorn beispielsweise gegenüber Flüchtlingen, weil sich Geschichten über gefährliche Straftäter unter ihnen eher einprägen als Geschichten über die Friedvollen. Zudem vergifte die Negativitätsdominanz die politische Öffentlichkeit und sorge dafür, dass Demagogen gewählt werden, da diese sich die Ängste und Sorgen der Menschen zunutze machten.«
Und dann spielt der Journalismus noch eine entscheidende Rolle, insbesondere die Boulevardpresse. Negative Schlagzeilen verkaufen sich besser, und wenn es um die Auflagenhöhe oder die Menge an Klicks im Internet geht, sind das die ausschlaggebenden Faktoren. Wirtschaftliche Interessen dominieren das Informationsgeschehen und der Voyeurismus der Leserinnen und Leser und Zuschauenden stellt die passende Gegenseite dar.
Auch hier hilft wieder die Reflexion, das heißt, den Negativitätseffekt zu durchschauen und uns über unsere angeborenen Reaktionen hinwegzusetzen. Dadurch können destruktive Muster durchbrochen und positiver in die Zukunft gesehen werden. »Der rationale Teil unseres Hirns kann dabei helfen, sich von der aus der Zeit gefallenen Fokussierung auf das Negative loszusagen und sich stattdessen Positivem zuzuwenden«, so Baumeister und Tierney.
Die Sprache des Kapitalismus
In vielen gesellschaftlichen Bereichen spielt Sprachkritik eine immer größere Rolle. Spätestens seit dem Buch Die Sprache des Kapitalismus von Simon Sahner und Daniel Stähr ist klar: Auch die Wirtschaft kommt an sprachkritischer Reflexion nicht mehr vorbei. Für Sprachphilosophierende wird Realität erst durch Sprache geschaffen oder mitgeformt. Sprache zu verändern, heißt Realität zu verändern.
Ein Beispiel für verschleiernde Sprache sind Metaphern wie »Preise steigen« oder »explodieren« – als handle es sich um Naturereignisse, nicht um das Ergebnis wirtschaftlicher oder politischer Entscheidungen. Es sind jedoch immer Menschen, die die Entscheidung über Preiserhöhungen treffen. Denken wir an die Inflation in der Coronazeit: Nudeln etwa waren plötzlich gefragter denn je. Was macht ein Unternehmer in so einer Situation – ob Produzent oder Händler? Er testet, ob die Kundschaft bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen. Und wenn das funktioniert, wird der Preis erhöht. Nicht automatisch, sondern ganz bewusst. Das Spiel wird so lange betrieben, bis sich ein Umsatzrückgang einstellt. Die Besteuerung dieses Übergewinns wurde damals auch heftig diskutiert und in manchen Ländern sogar durchgesetzt.
Sahner und Stähr sehen als Lösung, mit Preisobergrenzen zu reagieren. Das mag in einzelnen Fällen funktionieren. Der Wohnungsmarkt mit Mietpreisobergrenzen ist ein Beispiel dafür. Das Verlassen des Marktmechanismus birgt aber die Gefahr, dass es zu Fehllenkungen kommt.
Die Autoren beschreiben Menschen, die durch erfolgreiches Wirtschaften zu Helden geworden sind und medial abgefeiert werden. So war es bei Bill Gates und Steve Jobs. Im ersten Wall‐Street‐Film hält Michael Douglas eine Rede vor der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Eine Rede auf die Gier als Antrieb allen menschlichen Handelns. Doch das, was dieser Börsenhändler im Film erreichen wollte, den kritischen Blick auf die Branche, war dann in der Realität ganz anders: Der skrupellose Held wurde vielfach zu Idolen junger Börsenhändler. Sahner und Stähr relativieren sein Genie mit Thesen der linken Mode‐Ökonomin Mariana Mazzucato, die dargelegt habe,
»[…] dass keines der technischen Bestandteile des iPhones tatsächlich von Apple geschweige denn von Steve Jobs persönlich erfunden wurde. Vielmehr handelt es sich bei allem, was Smartphones so nützlich macht, um staatlich geförderte und innerhalb staatlicher Strukturen entwickelte Neuerungen: der Touchscreen, der Zugang zum Internet oder auch das GPS. Steve Jobs ist kein technischer Visionär, sondern eher ein Marketing‐Genie, das staatlich finanzierte Innovationen in die richtige Kombination gebracht hat und so zum Multimillionär geworden ist.«
Es sind vor allem wirtschaftsliberale Formeln, die auf den Prüfstand gesetzt werden, wie die von Leistungsträgern der Gesellschaft, der unsichtbaren Hand des Marktes oder der Gratismentalität. Schon der Begriff »Arbeitnehmer« ist irreführend, weil sie doch eigentlich ihre Arbeitskraft »geben«. Geht man von einer massiven Transformation aus, die notwendig ist, um die Krisen der Gegenwart und vor allem der Zukunft zu meistern, so ist die Sprache des Kapitalismus ein Hindernis. Formeln wie grünes Wachstum, Technologieoffenheit oder das Konzept der Klimaneutralität täuschen über diese Notwendigkeit hinweg.
Eine noch weitergehende kritische Betrachtung macht Franz Schandl in der Freitag. Er geht von einer Untrennbarkeit von Sprache und Bewusstsein aus. Dabei ist dann die herrschende Sprache die Sprache des Herrschenden.
»In der Sprache exerzieren wir für die bestehende Ordnung. Worte sind Losungsworte und dokumentieren Abhängigkeiten. Wer permanent Losungsworte gebraucht, gibt zu verstehen, dass er einverstanden ist. […] Auf Abweichung wird mit Verwunderung und Sanktion reagiert.«
Menschliches Vermögen wird als Humankapital übersetzt. Und Kapital muss Früchte tragen, schließlich soll etwas verkauft werden. Ich erinnere mich an meinen ersten Schulleiter, der vom »Schülermaterial« an unserer Schule sprach und dabei die Schülerinnen und Schüler meinte. Sprache setzt die Möglichkeiten, zu denken und zu handeln. Wenn es in der Werbung der Sparkasse heißt: »Lassen sie ihr Geld hart arbeiten«, so leugnet diese Metapher die hart arbeitenden Menschen, die die Zinsen erwirtschaften und macht damit Begriffe wie Geld und Zinsen so wunderbar moralisch neutral.
Wetten, dass …?
Wetten nehmen dort zu, wo die Aussicht auf Erfolg im Alltagsleben gering ist. In Gegenden mit höherer Arbeitslosigkeit und vielen prekären Arbeitsverhältnissen führt die Sehnsucht nach einem besseren Leben – und vielleicht mehr Wohlstand – direkt zur nächsten Lotto‐Annahmestelle, ins Wettbüro oder an den heimischen PC zwecks Online‐Wette. Selbst wenn, wie beim staatlichen Zahlenlotto, nur die Hälfte der Einsätze an die Gewinner ausgeschüttet wird, so ist die Hoffnung auf einen persönlichen positiven Ausgang groß.
Würden die Spielenden oder Wettenden neben einem Atomkraftwerk wohnen und es bestünde die gleiche Wahrscheinlichkeit (1:140 Millionen) eines GAUs, so würde jeder sagen »bei so einem kleinen Risiko wird nichts passieren.« Zumal die Aussage »einmal in 1.000 Jahren« oft in unserer Risikobewertung als »in 1.000 Jahren« verstanden wird. Dabei ist das erste Jahr so wahrscheinlich wie das fünfhundertste. Ein positiver Ausgang wird bei gleicher Wahrscheinlichkeit immer anders bewertet als ein negativer.
Anfang der 80er‐Jahre mussten sich alle Lehrerinnen und Lehrer jährlich als TBC‐Vorsorge in einem Schirmbildwagen röntgen lassen. Das Gerät entsprach nicht dem technischen Standard, den es haben sollte. Die dagegen protestierende Gewerkschaft wurde jedoch mit dem Hinweis auf die Kostenbefreiung für den Vorgang beschwichtigt. Zudem hing ein Zettel an der Tür mit der Aufschrift: »Das Risiko, durch diese Strahlung krank zu werden, ist genauso hoch wie die Chance auf einen Lottohauptgewinn.« Naja, dachte ich damals, viele setzen auch wöchentlich auf ihr Lottoglück.
Globale Risiken als Wetteinsatz
Betrachten wir dieses Positiv‐Negativ‐Denken auf einer globaleren Sicht, so müssen wir erkennen, dass der Umgang mit unserer Ressource Erde einem Glücksspiel ähnelt. Wir setzen darauf, dass es schon gut gehen wird oder dass irgendwann jemand schlaue Lösungen für die von uns geschaffenen Probleme haben wird oder dass wir uns geirrt haben und wir gar nicht das Problem sind. Und immer dann, wenn der negative Ausgang der Wette Regionen trifft, sei es in Form von Flutkatastrophen oder Dürren oder Bränden oder Schlammlawinen oder eines erneuten Anstiegs des Meeresspiegels, dann kommt in uns der Gedanke hoch, Glück gehabt zu haben. Was wohnen die auch im Flusstal oder in Dürregebieten. Es ist so etwas wie umgekehrtes Lotto: Alle leben über ihre Verhältnisse und das Schicksal spielt Lottofee. Den Einsatz bezahlen einige wenige – den Gewinn haben sehr viele. Bei so einer Erkenntnis würde sich erst etwas ändern, wenn eine Mehrheit negativ betroffen ist.
Bei den Wetten auf Wertpapieren – die, die in den 70er‐Jahren zulässig waren, – musste ja ein möglicher Verlust in Form von Geld oder Wertpapieren hinterlegt werden und zwar komplett. Bei der Wette auf einen guten Ausgang unserer Lebensweise hinterlegen andere die Sicherheit. Und wenn die Wette verloren geht, ist die Sicherheit nicht mehr da. Das kann auf die ungeborene Generation bezogen werden, deren Lebensgrundlage wir (genauer: eine Milliarde der acht Milliarden Menschen weltweit) verspielen. Schaffen wir es nicht, Ziele einzuhalten, die die Wissenschaftler, zum Beispiel die des Weltklimarates, als zwingend angeben, so wird die Welt für die nächste Generation eine andere sein, und zwar eine mit weniger Möglichkeiten, mehr Beschränkungen und weniger Wohlstand (nach heutiger Lesart). Der Begriff Ökodiktatur wird dann nicht mehr auf politische Parteien bezogen werden, sondern das Ökosystem selbst ist der Diktator. Die Zeiten, in denen Freiheit genutzt werden konnte, um diese Ökodiktatur abzuwenden, wurden verspielt. Wette verloren!
Das Glücksspiel der Atomkraft
Die unglaublichste Absicherung von Risiken ist die Versicherung für Kernkraftwerksunfälle. Die Energieunternehmen hatten damals kein Interesse daran, AKWs zu bauen, da sie wegen der möglichen immensen Schadenssummen als nicht versicherbar galten. Erst als der Staat das Risiko übernommen hatte, gingen die ersten AKWs dann auch ans Netz. Auch hier gilt: Alle wollten billigen Strom und alle haben fest damit gerechnet, dass es keine Unfälle gibt. Die ungelöste Frage der Entsorgung des Atommülls entspricht mal wieder der Position des ungefragten Stillhalters. Die nächsten Generationen müssen die Kosten der verlorenen Wette einlösen. Tausende Generationen zahlen dafür, dass zwei Generationen billigen (weil falsch gerechneten) Atomstrom hatten.
Die Grenzen der Demokratie
Anhand des demokratischen Umgangs mit einer solchen Hochrisikotechnologie lässt sich zudem auch die Grenze der Demokratie veranschaulichen, insbesondere der direkten Demokratie. Hat ein politischer Entscheid unumkehrbare Folgen, so können Nutznießer des Entscheides nicht irreversibel in das Leben anderer und zukünftiger Generationen eingreifen.
Interessant ist, dass sich ausgerechnet die politischen Stimmen für Atomstrom aussprechen, die bei Staatsschulden von einer unerträglichen Last für die nächste Generation reden. Über diese Schulden wird noch zu sprechen sein. Ein zweites Beispiel für eine solche Grenze ist die Gentechnologie, ein drittes jedes menschliche Handeln, das zu Artensterben führt. Alles irreversibel!
Die Psychologie des Wettens
Betrachten wir die Gemeinsamkeit zweier Wetten, das Lottospiel und die Wette um die Zukunft dieser Erde, so stellt sich die Frage: Warum setzt unser Gehirn immer eher auf positive Wettausgänge? Wir hören oft, dass wir das halb leere Glas als halbvoll bezeichnen sollen.
Ein Buch zum Thema Risiko hat mich besonders beeindruckt Der schwarze Schwan vom ehemaligen Optionshändler Nassim Nicholas Taleb. Schwarze Schwäne galten als unmöglich – bis 1697 einer in Australien gesehen wurde. Dieses völlig unerwartete Ereignis steht für Nassim für all das, was für uns nicht vorstellbar, aber theoretisch möglich ist. Nachträglich werden für diese Ausreißer‐Ereignisse vereinfachte Erklärungen gesucht und oft gefunden, aber erst im Nachhinein. Taleb unterstellt Banken und Aktienhändlern eine hohe Verwundbarkeit gegenüber schwarzen Schwänen.
Nach seiner Ansicht gibt es drei entscheidende Missverständnisse:
die Illusion, gegenwärtige Ereignisse zu verstehen,
die retrospektive Verzerrung historischer Ereignisse und
die Überbewertung von Sachinformationen, kombiniert mit einer Überbewertung der intellektuellen Elite.
Taleb sieht es als müßig an, schwarze Schwäne vorhersehen zu wollen. Sie zeichnen sich ja gerade durch ihr unerwartetes Erscheinen aus. Ihm geht es darum, Stabilität und Robustheit gegenüber negativen schwarzen Schwänen zu erreichen. Selbst die Prüfung der EZB hinsichtlich der Krisenanfälligkeit von Banken kann nur die weißen Schwäne berücksichtigen. Taleb glaubt, dass die meisten Menschen fest davon überzeugt seien, es gebe nur weiße Schwäne. Schwarze Schwäne würden ignoriert, weil es angenehmer sei, die Welt als geordnet und verständlich zu betrachten. Er nennt diese Blindheit »platonischer Fehlschluss« und legt dar, dass er zu drei kognitiven Verzerrungen führe:
Narrative Verzerrung: Das nachträgliche Schaffen einer Erzählung, um einem Ereignis einen plausiblen Grund zu verleihen.
Ludische Verzerrung: Der Glaube daran, dass der strukturierte Zufall, wie er in Spielen anzutreffen ist, dem unstrukturierten Zufall im Leben gleicht. Taleb beanstandet die unreflektierte Anwendung von Modellen der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie wie dem Random Walk.
Statistisch‐regressive Verzerrung: Der Glaube, dass sich das Wesen einer Zufallsverteilung aus einer Messreihe erschließen lässt.
Insbesondere vom Glauben an eine Zufallsverteilung leben ja die Anlageberater, die ihren Kunden Charts von Kursverläufen zeigen und erklären, dass daraus genau die Zukunft ablesbar ist. Aber auch das Geschäft mit der Angst spielt bei Wetten mit. Schließt jemand eine Lebensversicherung ab, so wettet er auf seinen vorzeitigen Tod (den er natürlich nicht will), damit die Versicherung mehr auszahlt, als sie bisher an Prämien eingenommen hat. Also folgt der Versicherer sehr gerne der Angst des Versicherungsnehmers und geht von einem frühen Sterbedatum aus und nimmt ordentlich Prämien vom Versicherten. Schließt man jedoch eine Versicherung mit einer lebenslänglichen Rentenzahlung ab, wird eine andere Sterbetafel genommen. Sie weist für jetzt Geborene durchschnittliche Lebenserwartungen auf, bei denen man sich nur ungläubig die Augen reibt: über 100 Jahre als Durchschnitt. Da müssen die Versicherungen während der Ansparphase natürlich hohe Beiträge nehmen, um dieses enorme Risiko zu decken. So argumentieren sie zumindest. Es kommt also darauf an, worauf man wettet.
Eigentlich ist jeder Aktienverkauf an der Börse, der nicht aus Not gemacht wurde, eine Wette. Der Verkäufer wettet, dass der Kurs nicht mehr steigt und mit dieser Aktie kein Gewinn mehr zu machen ist. Der Käufer hingegen geht vom Umgekehrten aus. Die Profi‐Spekulanten platzieren diese Wetten natürlich mittels Termingeschäfte, wobei die real existierenden Aktien weltweit nur einen Bruchteil des Wettgeschäftes ausmachen. Gewinnt der Verkäufer der Aktien die Wette, so hat der Käufer zu viel gezahlt, umgekehrt sind dem Verkäufer Gewinne entgangen. Fällt der Aktienkurs, so hat der Verkäufer die möglichen Verluste einem anderen aufs Auge gedrückt. Bei Kursverlusten liest man gerne in den Börsennachrichten, dass Kapital vernichtet wurde. Das betrifft aber nur die Bewertungsebene der Aktie. Geld wird dabei nie vernichtet, es wechselt nur den Besitzer: vom Verlierer der Wette zum Gewinner.





























