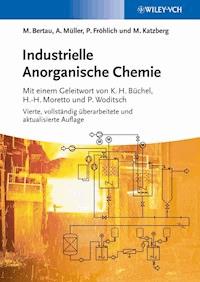
124,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit einem neuen Herausgeberteam wird das Buch "Industrielle Anorganische Chemie" grundlegend überarbeitet weitergeführt. Das Lehrwerk bietet in hervorragend übersichtlicher, knapp und präzise gehaltener Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen Chemie. Zu Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte, sowie zu ökologischen Konsequenzen, Energie- und Rohstoffve brauch bieten die Autoren einen fundierten Überblick. Hierfür werden die bewährten Prinzipien hinsichtlich der Beiträge von Vertretern aus der Industrie sowie des generellen Aufbaus beibehalten. Inhaltlich werden Neugewichtungen vorgenommen:
- l Aufnahme hochaktueller Themen wie Lithium und seine Verbindungen und Seltenerdmetalle
- l Aufnahme bislang vernachlässigter Themen wie technische Gase, Halbleiter- und
- Elektronikmaterialien, Hochofenprozess sowie Edelmetalle
- l Straffung aus industriell-anorganischer Sicht weniger relevanter Themen z.B. in den Bereichen
- Baustoffe oder Kernbrennstoffe
- l Ergänzungen in der Systematik hinsichtlich bislang nicht behandelter Alkali- und Erdalkalimetalle
- und ihre Bedeutung in der industriellen anorganischen Chemie
- l Betrachtung der jeweiligen Rohstoffsituation
Begleitmaterial für Dozenten verfügbar unter: www.wiley-vch.de/textbooks
"Von den Praktikern der industriellen Chemie verfasst, füllt dieser Band eine Lücke im Fachbuchangebot. Das Buch sollte von jedem fortgeschrittenen Chemiestudenten und auch von Studierenden an Fachhochschulen technischchemischer Richtungen gelesen werden. Dem in der Industrie tätigen Chemiker schließlich bietet es einen lohnenden Blick über den Zaun seines engen Arbeitsgebietes.... Die Autoren haben ein Buch vorgelegt, dem man eine weite Verbreitung wünschen und vorhersagen kann." GIT
"Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden."
Nachrichten aus Chemie Technik
und Laboratorium
"sein besonderer Wert liegt in der anschaulichen Darstellung und in der Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher Fakten." chemie-anlagen + verfahren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1107
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur 4. Auflage
Kurzbiografien der Autoren
Geleitwort
1 Anorganische Grundprodukte
1.1 Wasserstoff und seine Verbindungen
1.2 Stickstoff und Stickstoffverbindungen
1.3 Phosphor und seine Verbindungen
1.4 Schwefel und Schwefelverbindungen
1.5 Halogene und Halogenverbindungen
1.6 Technische Gase
2 Mineralische Dünger
2.1 Phosphorhaltige Düngemittel
2.2 Stickstoffhaltige Düngemittel
2.3 Kaliumhaltige Düngemittel
3 Metalle und ihre Verbindungen
3.1 Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Verbindungen
3.2 Aluminium und seine Verbindungen
3.3 Eisen und Stahl
3.4 Kupfer
3.5 Silicium und seine anorganischen Verbindungen
3.6 Blei und seine Verbindungen
3.7 Zinn und seine Verbindungen
3.8 Buntmetalle
3.9 Edelmetalle
3.10 Anhang
4 Halbleiter- und Technologiematerialien
4.1 Silicium als Halbleiter
4.2 Germanium
4.3 Gallium
4.4 Indium
4.5 Bor
4.6 Arsen
4.7 Antimon
4.8 Seltene Erden
4.9 Niob
4.10 Tantal
4.11 Verbindungshalbleiter
5 Organosiliciumverbindungen
5.1 Industriell bedeutende Organosiliciumverbindungen
5.2 Technisch bedeutende Silane
5.3 Siloxane/Silicone
5.4 Technische Siliconprodukte
6 Anorganische Festkörper
6.1 ilikatische Erzeugnisse
6.2 Anorganische Fasern
6.3 Baustoffe
6.4 Keramik
6.5 Hartstoffe
6.6 Kohlenstoffmodifikationen
6.7 Füllstoffe
6.8 Anorganische Pigmente
7 Kernbrennstoffkreislauf
7.1 Die Bedeutung der Kernenergie in der Energiewirtschaft
7.2 Allgemeines zum Brennstoff kreislauf
7.3 Verfügbarkeit von Uran
7.4 Kernreaktortypen
7.5 Kernbrennstoffgewinnung
7.6 Entsorgung von Kernkraftwerken
Index
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Arni, A.
Grundkurs Chemie I und II
Allgemeine, Anorganische und Organische Chemie für Fachunterricht und Selbststudium
2010
978-3-527-33068-3
Böhme, U.
Chemie für Ingenieure für Dummies
2011
978-3-527-70682-2
Böhme, U.
Anorganische Chemie für Dummies
2010
978-3-527-70502-3
Nesper, R.
Online-Praktikum Anorganische Chemie
2008
978-3-527-32690-7
Behr, A.
Angewandte homogene Katalyse
2008
978-3-527-31666-3
Arpe, H.-J.
Industrielle Organische Chemie
Bedeutende Vor- und Zwischenprodukte
2007
978-3-527-31540-6
Baerns, M., Behr, A., Brehm, A., Gmehling, J., Hofmann, H., Onken, U., Renken, A.
Technische Chemie
2006
978-3-527-31000-5
Autoren
Prof. Dr. Martin Bertau
Inst. f. Technische Chemie
TU Bergakademie Freiberg
Leipziger Str. 29
09599 Freiberg
Prof. Dr.rer.nat. Armin Müller
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Technische Chemie
Leipziger Str. 29
09599 Freiberg
Dipl.-Chem. Peter Fröhlich
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Technische Chemie
Leipziger Str. 29
09599 Freiberg
Dipl.-Chem. Michael Katzberg
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Technische Chemie
Leipziger Str. 29
09599 Freiberg
Cover
Abbildung des Hochofens © Digital Vision
1. Auflage 1984
2. Auflage 1986
3. Auflage 1999
4. Auflage 2013
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN: 978-3-527-33019-5
ePDF ISBN: 978-3-527-64959-4
ePub ISBN: 978-3-527-64958-7
mobi ISBN: 978-3-527-64957-0
oBook ISBN: 978-3-527-64956-3
Vorwort zur 4. Auflage
Die Chemieindustrie ist derzeit gravierenden Veränderungen ausgesetzt. Mehr denn je rücken Fragen der Energie- und Rohstoffeffizienz in den Blickpunkt der Verfahrensentwicklung. So sind nicht nur „Energiewende“ und „Rohstoffwandel“ mittlerweile häufig gebrauchte Schlagwörter, vielmehr zeigt sich an Exportbeschränkungen für beispielsweise Seltene Erden seitens des derzeitigen quasi Monopolexporteurs China, sowie Preissprüngen für strategisch wichtige Metalle wie Tantal, dass Fragen der Rohstoffverfügbarkeit und der Sicherung der Rohstoffbasis in Wirtschaft und Gesellschaft angekommen sind und eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Rolle einnehmen.
Diese Entwicklung macht einen Aufbruch in eine neue Ära des globalen Wirtschaftens nötig, bei dem die Chemie zur Lösung der anstehenden Fragestellungen wieder in den Vordergrund rückt. So steht die moderne Chemie am Beginn einer Renaissance, denn wie kaum ein anderer Wissenschaftszweig ist sie in der Lage, mit Hilfe neuer zukunftsfähiger Verfahren wichtige Rohstoffe unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit aus Primär- und Sekundärquellen zugänglich zu machen, ohne dabei neue Abhängigkeiten aufzubauen.
Grund genug also für eine umfassende Darstellung der modernen anorganischchemischen Prozesskunde. Vieles hat sich seit der 3. Auflage von 1998 geändert. Manchem Verfahren, wie z.B. dem der Lithiumgewinnung, wurde damals noch nicht diejenige Bedeutung beigemessen, die wir heute kennen. Die „Industrielle anorganische Chemie“ wurde daher einer tiefgreifenden Neustrukturierung unterzogen und Schwerpunkte neu gesetzt, vor allem aber wurde versucht, durchgängig die Rohstoffbasis sowie die wirtschaftliche Bedeutung und Verwendung der einzelnen Produkte darzustellen und das Zahlenmaterial je nach Verfügbarkeit der Produktionsdaten bestmöglich zu aktualisieren.
Die aus der 3. Auflage bekannte Gliederung des Buches wurde indes weitestgehend beibehalten und der Inhalt an entsprechender Stelle durch neue Abschnitte ergänzt. Die einzelnen Kapitel dieses Buches wurden dem Bedarf entsprechend – teils aber sogar grundlegend – überarbeitet. So gelang es, Bewährtes beizubehalten bzw. an die heutige Situation anzupassen und zugleich mit Neufassungen einzelner Kapitel den aktuellen Stand des Wissens und der Technik herzustellen. Sichtbares Zeichen dieser Neustrukturierung ist das Wegfallen des Randtextes, der durch ein „Quergelesen!“ zu Beginn der jeweiligen Kapitel bzw. Abschnitte dem Leser in kurzer, übersichtlicher Form die wesentlichen Punkte der Kapitel darlegt.
Die Autoren haben in dieser Neuauflage zugleich Wert darauf gelegt, das bewährte Prinzip dieses Buches, Chemiker und Ingenieure aus der Industrie in die Bearbeitung der Kapitel mit einzubeziehen, fortzuführen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die hier dargestellten Verfahren den aktuellen Stand der Industriellen Chemie korrekt wiedergeben und zugleich in der gebotenen Breite beschrieben werden. Aus diesem Grund sind wir für Ihre fachlich kompetente Unterstützung zu Dank verpflichtet:
Dr. Gerhard Auer, crenox GmbH
Dr. Torsten Bachmann, SolarWorld Solicium GmbH
Dr. Rainer Bartusch, KI Keramik-Institut GmbH
Dr. Gunter Buxbaum, ehemals Bayer AG
Dr. Jürgen Behnisch, Evonik Industries AG
Dr. Katja Dombrowski-Daube, TU Bergakademie Freiberg
Prof. Dr. Thomas Fanghänel, Institut für Transurane, EU, JRC
Dr. Jürgen Glenneberg, Evonik Industries AG
Dr. Matthias Grehl, Umicore AG & Co. KG
Dr. Werner Hoffmann, SGL Carbon GmbH
Dr. Christian Kusterer, SolarWorld Innovations GmbH
Jürgen Kessel, SGL Carbon GmbH
Prof. Dr. Ralph, Lucke, FIT-Ceramics GmbH
Dr. Dirk Meyer, BASF S.E.
Dr. Carsten Pätzold, TU Bergakademie Freiberg
Dr. Robin Richter, belchem fiber materials GmbH
Prof. Dr. Gerhard Roewer, TU Bergakademie Freiberg
Dr. Eckehart Roland, Evonik Industries AG
Dr. Silvio Stute, SolarWorld AG
Dr.-Ing. habil. Joachim Ulbricht, TU Bergakademie Freiberg
Dr. Helmut Wipfler, Evonik Industries AG
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Voigt, Institut für Anorganische Chemie der TU Bergakademie Freiberg, gilt unser Dank für hilfreiche Diskussionen bei der Erstellung des Manuskripts. Frau Elisabeth Hain sowie den Herren Valentin G. Greb und Erik Weingart, Institut für Technische Chemie der TU Bergakademie Freiberg danken wir für ihre mit viel Sinn für Detailtreue angefertigten Zeichnungen und Schemata sowie für ihre Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts.
Unserer Lektorin, Frau Bernadette Gmeiner danken wir für ihre engagierte Unterstützung dieses Buchprojektes und nicht zuletzt auch die Geduld, die sie unseren Wünschen entgegenbrachte. Ein ganz besonderer Dank gilt den Autoren der 1.–3. Auflage, den Kollegen Prof. Dr. Karl-Heinz Büchel, Prof. Dr. Hans-Heinrich Moretto und Prof. Dr. Peter Woditsch, die unser Vorhaben von Anbeginn an unterstützten und für die 4. Auflage das Geleitwort verfassten.
Freiberg, im August 2013
Prof. Dr. Martin Bertau · Prof. Dr. Armin Müller
Dr. Peter Fröhlich · Dr. Michael Katzberg
Kurzbiografien der Autoren
Prof. Dr. Martin Bertau, Lehrstuhl für Technische Chemie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, promovierte 1997 an der Universität Freiburg/Br. Danach leitete er die Biotechnologie-Abteilung der Rohner AG (Dynamit-Nobel-Gruppe) in Basel, Schweiz. Im Jahr 2000 wechselte er an die Technische Universität Dresden und leitet seit 2006 das Institut für Technische Chemie und der TU Bergakademie Freiberg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Rohstoffchemie und Weiße Biotechnologie mit dem Ziel der Entwicklung integrierter Prozesse (Zero-Waste-Concept) zur Produktion und Recycling von Chemierohstoffen wie z.B. Seltenen Erden, Lithium, Elektronikmetallen und Silicium, aber auch der Verwertung von CO2 sowie Lignocellulose zur Erzeugung chemischer Grundstoffe. Für seine Arbeiten zum Phosphatrecycling wurde er 2012 mit dem Ressourceneffizienzpreis des Bundeswirtschaftsministers ausgezeichnet.
Prof. Dr. Armin Müller studierte Chemie an der Bergakademie Freiberg und promovierte 1989 auf dem Gebiet der Salzhydratschmelzen. Seine berufliche Laufbahn in der chemischen Industrie begann er 1991 bei der Bayer AG in Krefeld auf dem Gebiet der anorganischen Pigmente. Er wechselte 1995 als Betriebsleiter in das Geschäftsfeld Ingenieurkeramik und Photovoltaik der Bayer AG und 1996 als Produktionsleiter zur Bayer Solar GmbH nach Freiberg. Bei der Bayer Solar GmbH und der im Jahre 2000 aus dieser hervorgegange nen Deutschen Solar GmbH war er bis 2003 als Produktionsleiter und bis 2007 als Leiter Forschung und Entwicklung tätig. In dieser Zeit leitete er mehrere Projekte zur Entwicklung neuer Technologien für die Herstellung von Wafern, Zellen und Modulen für die Photovoltaik sowie zur Materialentwicklung. Von 2007 bis 2011 war Prof. Dr. Armin Müller Vorstand der Sunicon AG und ist gegenwärtig als Direktor für strategische Materialien der SolarWorld AG tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten der Herstellung von Reinstsilicium und der Kristallisation von Silicium für die Photovoltaik. Prof. Dr. Armin Müller ist seit 2008 Honorarprofessor für Anorganisch-chemische Technologien an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.
Dr. Peter Fröhlich studierte Chemie an der TU Bergakademie Freiberg. Seine Promotion begann er 2006 am Institut für Allgemeine Biochemie der TU Dresden im Bereich funktionalisierter Polysiloxane und setzte seine Arbeiten nach seinem Wechsel an die TU Bergakademie Freiberg am Institut für Technische Chemie bei Prof. Dr. M. Bertau fort. Seit 2011 leitet er die Arbeitsgruppe zur Aufbereitung von Sekundärrohstoffen mit besonderem Forschungsinteresse auf einer geschlossenen Verwertung aller Wert- und Reststoffe unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsanalysen zur Umsetzung in den industriellen Maßstab.
Dr. Michael Katzberg, promovierte 2009 an der Technischen Universität Dresden im Arbeitskreis von Prof. Dr. Martin Bertau auf dem Gebiet der Industriellen (weißen) Biotechnologie, nach einem Forschungsaufenthalt an der Universität Lund sowie einem Studium der Lebensmittelchemie (2000–2005). Anschließend wechselte er ans Institut für Technische Chemie der Technischen Universität Bergakademie Freiberg wo er sich in mehreren Projekten mit der Erforschung und Entwicklung von nachhaltigen Technologien zur Produktion von Grund- und Feinchemikalien beschäftigte, bevor er 2012 zum Chemieanlagenbauer ThyssenKrupp Uhde GmbH wechselte.
Geleitwort
Die anorganische Chemie hat von jeher eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Menschheit gespielt. Bereits in der Frühgeschichte lernte der Mensch, Stoffe umzuwandeln und Gebrauchsgegenstände zu fertigen und zu nutzen.
Von der Keramik über die Metalle bis hin zu modernen Halbleiterwerkstoffen beeinflusst die anorganische Chemie bis heute unser Leben und unsere Umwelt.
Mit dem Erscheinen der ersten Auflage der „Industriellen Anorganischen Chemie“ im Jahre 1984 wurde erstmals das Vorkommen, die Herstellung und Verwendung anorganischer Materialien und ihre industrielle Bedeutung in übersichtlicher Form zusammengefasst. Seitdem wurden verstärkt Anstrengungen unternommen, Technologien und Verfahren zu entwickeln, um energieeffizienter und ökologisch verträglicher zu produzieren sowie neue Materialien und Werkstoffe für neue Anwendungen herzustellen.
Mit dem neuen Herausgeberteam wird das Buch weitergeführt und grundlegend überarbeitet. Das Lehrbuch bietet in übersichtlicher Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen Chemie. Das Autorenteam versteht es, in knapper und präziser Form einen fundierten Überblick zu Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte zu geben. Ein besonderes Augenmerk richten die Autoren dabei auf die Ökologie, den Rohstoff- und Energieverbrauch, Fragen, die unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen. Für einzelne Kapitel liefern dabei Vertreter aus der Industrie entsprechende Beiträge. Den Veränderungen in der industriellen Gewichtung tragen die Autoren Rechnung durch Aufnahme und Erweiterung von hochaktuellen Themen wie Alkali- und Erdalkalimetallen, insbesondere Lithium und gehen auf die Verbindungen der Seltenerdmetalle ein. Neu aufgenommen wurden Kapitel zu technischen Gasen, Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie den Edelmetallen. Um den Umfang im Rahmen zu halten, wurden die Bereiche Baustoffe und Kernbrennstoffe gestrafft.
Insbesondere durch die übersichtliche Darstellungsform erscheint uns das Buch ein gelungenes Hilfsmittel, um sich rasch über die wichtigsten Entwicklungen in der anorganischen Chemie und ihre industrielle Bedeutung zu informieren. Wir wünschen dem neuen Autorenteam weiterhin eine glückliche Hand, um das Werk auch zukünftig zu begleiten.
Krefeld, den 22.05.2013
K. H. Büchel
H. H. Moretto
P. Woditsch
Burscheidt
Leverkusen
Krefeld
1
Anorganische Grundprodukte
1.1 Wasserstoff und seine Verbindungen
1.1.1 Wasserstoff
Die Gewinnung von Wasserstoff erfolgt typischerweise petrochemisch aus Kohlenwasserstoffen. Elektrolytische Verfahren sind insbesondere vor dem Hintergrund der Nutzung von Wasserstoff als chemischem Energiespeicher (seine Energiedichte beträgt 121 MJ/kg) interessant, machen derzeit aber nurca. 10% der Produktionskapazität aus. Neue Verfahrenskonzepte lassen gegenwärtig keine kurzfristige Umsetzbarkeit in den technischen Maßstab erkennen.
1.1.1.1 Allgemeines
Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum; auf der Erde (Litho-, Hydro-, Bio- und Atmosphäre) ist er vornehmlich in Form von Wasser und Hydraten sowie als Bestandteil der Biomasse und fossiler Rohstoffe – mit einem Anteil von etwas unter 1% Massenanteil (etwa 15 Stoffmengenanteile in %, bezogen auf die Atome) – das neunthäufigste Element. Wasserstoff spielt in zahlreichen organisch-chemischen wie anorganisch-chemischen Prozessen eine tragende Rolle.
1.1.1.2 Wirtschaftliche Bedeutung und Verwendung
Wasserstoff gewinnt neben seiner großen Bedeutung als Chemierohstoff und Industriechemikalie insbesondere seit der ersten Ölkrise 1973/74 zunehmendes, wenn auch immer noch sehr spekulatives Interesse als praktisch unerschöpflicher (sekundärer) Energieträger (Brenn-, Kraftstoff) anstelle oder neben dem elektrischen Strom. Die Gründe liegen in der (gewichtsspezifisch) hohen Energiedichte von 121 kJ/g (Methan nur 50,3 kJ/g), der hohen Umweltverträglichkeit, seiner Ungiftigkeit und der guten Transport- und Speichermöglichkeiten.
Die weltweite Produktion an Wasserstoff lag 2010 bei etwa 595 Mrd. m3, d.h. etwa 53 Mio. t. Für Deutschland wird im Jahr 2011 ein Produktionsvolumen von etwa 55 Mrd. m3 ausgewiesen. Die tatsächlichen Produktionszahlen dürften noch etwas höher liegen, da die Mengen, die in Raffinerien als Koppelprodukt anfallen und intern an anderer Stelle wieder eingesetzt werden, in den Zahlen nicht enthalten sind. Abbildung 1.1 zeigt den Verlauf der Wasserstoffproduktion in Deutschland seit 1999.
Abb. 1.1 Wasserstoffproduktion in Deutschland
88% des weltweit erzeugten bzw. als Zwangsanfall produzierten Wasserstoffes werden direkt beim Erzeuger weiterverarbeitet. Dadurch, dass Raffinerien verstärkt dazu übergehen, anstelle eigener Wasserstoffanlagen Fremdanlagen von Fachfirmen zu nutzen, dürfte der Anteil des über den Markt abgesetzten Wasserstoffes in Zukunft ansteigen.
Die Nutzung von Wasserstoff erfolgt überwiegend für die Ammoniaksynthese und für Raffinerieprozesse (z.B. Hydrocracken zur Verbesserung der Qualität von Erdölprodukten; Hydrotreating, z.B. hydrierende Entschwefelung).
Im unteren Prozentbereich wird er ebenfalls für die Methanolsynthese, Hydrierungen in der organischen Chemie (Fetthärtung, Anilin- und Cyclohexansynthese), in der Elektronik (Schutzgas bei der Halbleiterherstellung), in der Metallurgie (z.B. in Form von Synthesegas zur Direktreduktion von Eisenschwamm, als Reduktions- oder Schutzgas bei Temper- und Umschmelzprozessen), in der Glasindustrie, zur Chlorwasserstoffherstellung sowie zum autogenen Schweißen und Schneiden (Knallgasgebläse) und in der Schutzgasschweißtechnik (z.B. mit Argon/Wasserstoff) benötigt. In der Kraftwerkstechnik dient Wasserstoff aufgrund seiner hohen Wärmekapazität als Kühlmedium für Generatoren (Abb. 1.2).
Das Einsatzgebiet der Erdölraffination wächst zurzeit am stärksten. Dies ist einerseits durch die Umweltgesetzgebung in den Industrieländern bedingt, die einen höheren Wasserstoffeinsatz erfordert, andererseits durch den steigenden Anteil von hochsiedenden Kohlenwasserstoffen, die wasserstoffärmer sind als niedrigsiedende Kohlenwasserstoffe.
Der Wasserstoffanteil, der in den Handel kommt, wird i.A. in gasförmiger oder flüssiger Form befördert. Zum Teil wird er gasförmig in komprimierter Form (z.B. 20 MPa) in Stahlzylindern oder Flaschenbündeln oder flüssig (kryogen) bei –253 °C in hochisolierten Drucktankwagen transportiert. Auch durch Rohrleitungen kann Wasserstoff verteilt werden. In Deutschland wird im Rhein-Ruhr-Gebiet bereits seit Jahrzehnten ein über 200 km langes (Druck-) Rohrleitungsnetz betrieben, der Wasserstoffverbund Rhein-Ruhr, an das eine größere Zahl von wasserstofferzeugenden bzw. -verbrauchenden Industrieanlagen angeschlossen ist.
Abb. 1.2 Anteil der Verfahren an der Wasserstoffproduktion
Ähnliche Rohrleitungsnetze sind in Europa, z.B. in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, eingerichtet.
In der fortgeschrittenen Entwicklung befindet sich die Speicherung bzw. der Transport von Wasserstoff in festem Zustand in Form von Hydriden wie Titan/Eisenhydrid Ti-FeH1.95 oder Magnesium/Nickelhydrid MgNiH4.2.
1.1.1.3 Vorkommen und Rohstoffe
Wasserstoff kommt auf der Erde hauptsächlich in Form von Wasser vor, daneben in gebundener Form in Kohlenwasserstoffen wie z.B. Methan, CH4, sowie Kohlenhydraten, CnH2nOn. Elementar kommt Wasserstoff sowohl in Spuren in der Erdkruste vor als auch in der Atmosphäre. Dabei ist er in den unteren Schichten mit ~0,5 ppm nur spurenweise vertreten, während die obersten, leichten Schichten der Erdatmosphäre nahezu ausschließlich aus H2 bestehen.
Für die technische Wasserstoffgewinnung muss H2 daher aus seinen Verbindungen befreit werden; als wichtigste Rohstoffe sind hier Wasser und Methan zu nennen.
1.1.1.4 Herstellung von Wasserstoff
Wasserstoff wird nach zwei prinzipiell verschiedenen Verfahren großtechnisch hergestellt:
durch petrochemische Prozesse einschließlich Kohlevergasung
durch Elektrolyse von Wasser
Daneben fällt Wasserstoff in großen Mengen als Nebenprodukt bei Verarbeitungsprozessen der Petrochemie, der Raffinerien und Kokereien (Koksofengas) sowie bei manchen chemischen und elektrochemischen Verfahren, z.B. der Chloralkalielektrolyse, an. Sonstige Verfahren spielen technisch entweder (noch) keine Rolle oder betreffen Sonderfälle.
1.1.1.4.1 Petrochemische Verfahren und Kohlevergasung
Das wichtigste Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff ist die katalytische allotherme Dampfspaltung (Steam-Reforming) von Erdgas (Methan) oder von leichten Erdölfraktionen (Propan, Butan, Naphtha bis Siedeende von 200 °C). Hierbei stammt der erzeugte Wasserstoff teilweise aus dem eingesetzten Wasserdampf, teilweise aus den Kohlenwasserstoffen; bei der Methanspaltung stammen ein Drittel aus Wasser und zwei Drittel aus Methan:
Etwa 80% des verbrauchten Wasserstoffs werden petrochemisch erzeugt, einschließlich der thermischen oder katalytischen Spaltung von Kohlenwasserstoffen, z.B. in Raffinerien.
In den USA werden über 90% des Wasserstoffs nach diesem derzeit kostengünstigsten Verfahren aus Erdgas hergestellt. In anderen Wirtschaftsräumen ist der Anteil geringer.
Neben dem Steam-Reforming von niedrig siedenden Kohlenwasserstoffen ist vor allem die partielle Oxidation von schwerem Heizöl und Erdölrückständen nach der Bruttogleichung
von Bedeutung. Die Reaktion verläuft ohne Katalysator und sie ist autotherm.
In Ländern mit billiger Kohle wird Wasserstoff zunehmend durch Kohle/Koksvergasung produziert (vor dem 2. Weltkrieg wurden weltweit 90% des Wasserstoffs nach diesem Verfahren erzeugt). Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:
Da über die Hälfte des Wasserstoffs zur Ammoniakerzeugung (Düngemittelproduktion) dient und diese in modernen Ammoniakanlagen (Wasserstofferzeugung und -weiterverarbeitung in „Einstranganlagen“) erfolgt, sind alle drei Verfahren ausführlich in Abschnitt 1.2.4 abgehandelt.
1.1.1.4.2 Elektrolyse von Wasser
Die elektrolytische Zerlegung von Wasser spielt derzeit nur eine untergeordnete Rolle – ihr Anteil lag im Jahr 2010 unter 4% –, da der Prozess sehr energieaufwendig ist; der gesamte Wirkungsgrad der Elektrolyse einschließlich Stromerzeugung beträgt 20–25%. Nur in Sonderfällen sind Großanlagen errichtet worden, vor allem in der Nähe von Staudämmen, z.B. in Ägypten (Anlage am Assuan-Staudamm: Leistung 33 000 m3/h für die Ammoniaksynthese), Indien, Peru, in Ländern mit niedrigem Strompreis oder auch bei günstigem Absatz des Koppelproduktes Sauerstoff, z.B. in Norwegen. Auch wenn sehr reiner Wasserstoff benötigt wird, z.B. in der Nahrungsmitteltechnologie (Margarineherstellung) oder bei Kleinverbrauchern, stellt man Wasserstoff durch Elektrolyse her. Das Verfahren könnte aber im Rahmen der langfristig angestrebten Wasserstofftechnologie („Nach-Erdöl-Zeitalter“) eine große Bedeutung erlangen.
Die alkalische Elektrolysezelle zum Zerlegen des Wassers besteht im Prinzip aus zwei Elektroden, getrennt durch ein gasundurchlässiges Diaphragma, die in den Elektrolyten (Wasser mit Zusatz von Kaliumhydroxid zur Erhöhung der Leitfähigkeit) eintauchen. Die Elektrolysetemperatur beträgt 80–85 °C. Die theoretische Zersetzungsspannung liegt bei 1,23 V, die tatsächlich aufzubringende bei 1,9–2,3 V (Überspannungseffekte u.a.). An der Anode entwickelt sich Sauerstoff, an der Kathode Wasserstoff:
Der spezifische Energiebedarf pro m3 Wasserstoff (und 0,5 m3 Sauerstoff) liegt bei 4,5–5,45 kWh.
Technische Zellen sind meist bipolar, d.h. elektrisch in Reihe, verschaltet und bestehen aus einer Vielzahl von hintereinandergeschalteten Einzelplattenzellen, die nach dem Filterpressenprinzip in Blöcken zusammengefügt sind. Bei einer Elektrolyse unter Druck kann der Energieverbrauch um 20% gesenkt werden. Weitere Neuentwicklungen betreffen die Verwendung von porösen Elektroden, die Hochtemperatur-Dampfphasenelektrolyse und das PEM-Verfahren (proton exchange membrane). Als Nebenprodukt der Wasserelektrolyse kann schweres Wasser D2O gewonnen werden, das sich im Elektrolyten anreichert.
1.1.1.4.3 Sonstige Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff Wasserstoff aus Ammoniak
Durch thermische Zersetzung von Ammoniak am Nickelkontakt bei 900 °C (für Hydrierungen oder metallurgische Zwecke) werden Wasserstoff und Stickstoff erhalten:
Die Reaktion entspricht der Umkehrung der Ammoniaksynthese. Sie wird in Kleinanlagen betrieben.
Thermische Wasserspaltung
Die rein thermische Spaltung von Wasser gemäß
ist wegen der erforderlichen Temperatur von über 2000 °C technisch nicht sinnvoll.
Dagegen kommen mehrstufige thermochemische Kreisprozesse, von denen eine Vielzahl thermodynamisch möglich, aber nicht technisch ausgereift ist, mit niedrigeren Temperaturen aus. Hierbei wird Wasser mit Hilfe eines im Kreis geführten Hilfsstoffes zersetzt, und die Reaktionsprodukte werden – teilweise über Zwischenstufen – thermisch gespalten. Ein Beispiel ist folgender Schwefel-Iod-Kreisprozess:
Problematisch sind vor allem Werkstoff- und Korrosionsfragen sowie die Erzeugung der benötigten hohen Temperaturen (ggf. nukleare Prozesswärme oder auch Solarenergie).
In Sonderfällen wird Wasserstoff durch katalytische Zersetzung von Methanol oder Ammoniak (1.1.1.4.3) in Spaltanlagen hergestellt.
1.1.1.4.4 Gewinnung von Wasserstoff als Nebenprodukt
Bei der Verarbeitung von Rohöl in Raffinerien fallen durch Cyclisierung und Aromatisierung, z.B. durch katalytische Reformingprozesse, große Mengen wasserstoffhaltiger Gase an (Raffineriegas).
Dieser Wasserstoff wird aber meist im eigenen Betrieb für Hydrierzwecke verwendet. Auch bei anderen petrochemischen und chemischen Prozessen (Synthese von Olefinen, Acetylen, Styrol, Aceton) fällt Wasserstoff an. Koksofengas enthält über 50% Wasserstoff (Volumenanteil), der daraus isoliert werden kann. Schließlich entsteht Wasserstoff als wertvolles Nebenprodukt bei der Chloralkalielektrolyse (direkt beim Diaphragmaverfahren oder indirekt beim Amalgamverfahren) sowie bei der Salzsäureelektrolyse; zur Gewinnung von Wasserstoff nach diesen Verfahren s. Abschnitt 1.5.2.4. Der Anteil aus diesen Elektrolyseverfahren liegt derzeit weltweit unter 5% der gesamten Wasserstoffproduktion.
1.1.1.5 Neue Trends zur Synthese von Wasserstoff
Vor dem Hintergrund von Energiewende und Rohstoffwandel rücken zunehmend auch neue Ansätze zur Herstellung von Wasserstoff in den Blickpunkt des Interesses („Grüner Wasserstoff“). Sie sind gegenwärtig noch nicht in industrieller Umsetzung, sollen aber an dieser Stelle angesprochen werden, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, die in Diskussion befindlichen Verfahrensansätze kennenzulernen und zu bewerten.
1.1.1.5.1 Fotokatalytische Verfahren
Die fotokatalytische Wasserspaltung ist seit 1972 bekannt. Gleichwohl sind Verfahren zur Wasserstofferzeugung auf diesem Wege noch nicht sehr weit fortgeschritten. Als Katalysator wird häufig Anatas, eine Modifikation von Titandioxid eingesetzt, z.T. in Verbindung mit anderen Metallen oder Aktivatoren. Dabei treten Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband über, was gleichbedeutend mit der Bildung eines Elektron-Loch-Paares ist. Bei räumlicher Trennung von Elektron und Loch und Diffusion an die Oberfläche des Halbleiters bewirkt das Elektron eine Reduktion und das Loch eine Oxidation.
Für die fotokatalytische Wasserspaltung muss eine Spannung von mindestens 1,23 V zwischen Loch (Anode) und Elektron (Kathode) aufgebaut werden. In der Praxis liegt die benötigte Spannung jedoch im Bereich von 1,6–2,4 V.
Als nachteilig hat sich bislang die Erfordernis von UV-Strahlung erwiesen, denn mit Tageslicht lassen sich Quantenausbeuten von typischerweise ~1%, max. 2,5% generieren. Das Problem der räumlichen Trennung bei der Erzeugung von H2 und O2 ist noch nicht gelöst.
1.1.1.5.2 Pyro- und Piezoelektrochemische Verfahren
Durch Ausnutzung von (überschüssiger) thermischer oder kinetischer Energie kann mit Hilfe von pyro- bzw. piezoelektrischen Substanzen Wasserstoff hergestellt werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass Wasserstoff und Sauerstoff räumlich getrennt voneinander generiert werden.
1.1.1.5.3 Biologische Verfahren
Auch mit Mikroorganismen lässt sich Wasserstoff generieren. So beträgt die biogene Wasserstoffproduktion ca. 150 Mio. t/a. Man erreicht aber nur geringe, für den technischen Einsatz unbedeutende Ausbeuten.
Cyanobakterien wandeln Stickstoff durch Nitrogenasen in Ammoniak um:
Die benötigten Elektronen und Protonen stammen aus der fotosynthetischen Wasserspaltung der sauerstoffbildenden Fotosynthese bzw. dem Stoffwechsel der Zelle. Das Produktgas enthält somit sowohl Sauerstoff als auch Wasserstoff.
Grünalgen verwenden bei der fotosynthetischen Wasserspaltung die Elektronen nicht zur Reduktion von Kohlendioxid, sondern zur Synthese von Wasserstoff. Diese Reaktion wird durch Hydrogenasen katalysiert.
Die von den Mikroorganismen aufgenommene Sonnenenergie kann somit direkt in Wasserstoff umgewandelt werden. Es gibt daher zahlreiche Versuche, auch durch Schaffung artifizieller Symbiosen von Bakterien und Algen, die Wasserstoffsynthese in Bioreaktoren zu realisieren. Eine Übertragung von Laborauf Produktionsbedingungen ist derzeit jedoch nicht absehbar. Hierzu tragen unter anderem der hohe technische Aufwand sowie die geringe Eindringtiefe der fotosynthetisch nutzbaren Lichtenergie in das wässrige Medium bei.
1.1.1.5.4 Gekoppelte Verfahren
Um die Wasserstoffgewinnung über thermochemische Kreisprozesse auch für Temperaturen im Bereich 500–600 °C zu ermöglichen, kann ein Elektrolyseschritt einbezogen werden, wie es bei dem CuCl-Kreisprozess der Fall ist. Dadurch kann neben solarthermaler auch geothermale Energie genutzt werden:
Eine Kopplung anderer Art bietet eine Fotovoltaikanlage mit konzentrierter Solarenergie. Dabei wird die Strahlung über Reflektoren gebündelt und durch einen Strahlungsseparator geleitet, wobei Wärmestrahlung reflektiert und Licht durchgelassen wird. Die reflektierte Wärmestrahlung wird in einem Wasserdampfgenerator konzentriert, der Dampf für eine Hochtemperatur-Elektrolysezelle liefert. Die benötigte elektrische Energie wird durch Solarzellen geliefert, die hinter dem Filter angebracht sind. Durch diese Verfahrensweise erscheinen Wirkungsgrade von Solarenergie-zu-Wasserstoff von 40% in naher Zukunft realistisch.
1.1.2 Wasser
Für die Gewinnung von Wasser für den privaten und gewerblichen Gebrauch eignen sich Süß- und Salzwasser. Die Wasseraufbereitung umfasst: Durchbruchschlorung oder Ozonierung, Flockung, Sedimentation, Filtration, Aktivkohlebehandlung, Sicherheitschlorung, pH-Einstellung. Weiterhin kann erforderlich sein: Verminderung der Härtebildner (Ca, Mg), Entfernung von freiem CO2, Fe und Mn. Durch stufenweise Behandlung über Kationen- und Anionenaustauscherbetten oder in „Mischbetten“ wird Wasser mit weniger als 0,02 mg/L Salz erhalten. Letze Reste organischer Verunreinigungen können durch Umkehrosmose (RO) beseitigt werden. Wichtigstes Verfahren zur Herstellung von Süßwasser aus Meerwasser ist die Mehrstufige Entspannungsverdampfung (MSF), bei der die Abscheidung von Härtebildnern durch Zugabe von Schwefelsäure, Polyphosphat oder verhindert wird. Die Gewinnung von Trinkwasser aus Brackwasser oder Meerwasser durch RO fußt auf dem Durchtritt von salzarmem Wasser aus salzhaltigem durch eine semipermeable Membran unter Druck. Wegen des hohen Druckunterschiedes ist die Konstruktion der technischen Entsalzungsanlagen aufwendig. Eine Wasservorbehandlung ist bei beiden Verfahren erforderlich. Die Süßwassergewinnung durch RO ist energetisch wesentlich günstiger als durch MSF.
1.1.2.1 Allgemeines
1.1.2.2 Wirtschaftliche Bedeutung und Verwendung
Als Beispiel für die Herkunft und Gewinnung von Wasser in einem Industrieland seien die Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland für 2007 genannt. Dort wurden durch die öffentlichen Wasserversorgungsunternehmungen insgesamt 5,1 Mrd. m3 Wasser gefördert, davon wurden 3,6 Mrd. m3 an private Haushalte und das Kleingewerbe abgegeben. Der Verbrauch pro Einwohner und Tag betrug 122 L im Jahr 2007. Die Gesamtmenge setzt sich wie in Tabelle 1.1 angegeben zusammen:
Tabelle 1.1 Wassergewinnung nach Wasserarten (2007)
Wasserarten
Mio. m
3
Grundwasser
3157
Quellwasser
424
Uferfiltrat
410
Oberflächenwasser
1137
davon
:
Seeund Talsperrenwasser
615
Flusswasser
58
Angereichertes Grundwasser
464
Insgesamt
5128
Die Gesamtwasserentnahme (= Förderung durch öffentliche und private Unternehmen) betrug im Jahr 2007 36 Mrd. m3, zu ca. 70% aus Oberflächenwasser und überwiegend (ca. 74%) für die Wärmekraftwerke. Der Wassereinsatz liegt aber etwas mehr als doppelt so hoch und spiegelt die Mehrfachnutzung des Kühlwassers wider. Der Anteil der öffentlichen Wasserversorgung beträgt 14%.
Die Aufbereitung von Meer- oder Brackwasser zu Trinkwasserqualität wird in regenarmen Gebieten (südliches Mittelmeer, nördlicher Wüstengürtel) in technischem Maßstab durchgeführt. In Betrieb sind einerseits Verdampfungsanlagen (ältere Verfahrensweise), andererseits Anlagen mit Umkehrosmosetechnik (neueres Verfahren) und in geringerem Umfang auch Elektrodialyseanlagen (Brackwasser).
Saudi-Arabien ist mit einer Produktion von 9 Mrd. m3/a Wasser die führende Nationen in der Wassergewinnung aus Meerwasser. Allein innerhalb des Shoaiba 3 Projekts werden an der Westküste von Saudi-Arabien jährlich 321 Mio. m3 Wasser gewonnen. Weltweit betrug die Produktion im Jahr 2009 ca. 23 Mrd. m3 Wasser aus 14 754 Anlagen, von denen 40% Leistungen von über 21 Mio. m3/a erreichten.
Geografisch konzentrieren sich die Kapazitäten mit
70% im mittleren Osten
6,5% in den USA
6% in Nordafrika
Vor allem in den letzten Jahren haben sich Umkehrosmoseverfahren (RO, reverse osmosis) zur Entsalzung von Meerwasser verstärkt durchgesetzt, weil sie kompakter zu bauen sind und viel weniger, wenngleich teurere elektrische Energie verbrauchen, wohingegen Vakuumverdampfungsanlagen (MSF, multi stage flash) im Wesentlichen nur thermische Energie benötigen. 61% der Anlagen werden daher nach dem Umkehrosmoseverfahren betrieben, ca. 34% nach dem mehrstufigen (typisch 18 bis 24 Stufen) Vakuumverdampfungsverfahren und 4% nach dem Elektrodialyseverfahren.
1.1.2.3 Vorkommen und Rohstoffe
Wasser bedeckt ca. 70% der Erdoberfläche, 97% davon sind Salzwasser. Vom Süßwasser ist nur ein Viertel nicht in Form von Eis gebunden, sodass die tatsächlich nutzbare Menge weniger als 1% beträgt. Grundwasser ist für die Trinkwassergewinnung das wichtigste Reservoir, seine Menge beläuft sich auf etwa das 6000-Fache der Wassermenge aller Flüsse der Erde. Aufgrund klimatischer und geologischer Gegebenheiten ist die Wasserverfügbarkeit auf der Erde sehr unterschiedlich. So gehört Deutschland zu den wasserreichen Ländern. Im langjährigen Mittel beträgt die jährlich verfügbare Menge 188 Mrd. m3, bei einer Gesamtwasserentnahme aller Wassernutzer i.H.v. 36 Mrd. m3, entsprechend 19% des jährlichen Wasserangebotes. In den ariden Zonen kommt daher der Meerwasserentsalzung, wenngleich energieintensiv, eine große wirtschaftliche Bedeutung zu.
1.1.2.4 Aufbereitung von Wasser
1.1.2.4.1 Aufbereitung von Süßwasser
Nach heutigen Anforderungen ist nur gutes Quellwasser ohne weitere Behandlung als Trinkwasser nutzbar. Je nach Herkunft sind aber alle Sorten Rohwasser mehr oder weniger stark verunreinigt. Die Aufbereitung zu Trinkwasser umfasst die folgenden Schritte:
Durchbruchschlorung (alternativ Durchbruchsozonierung, Behandlung mit Chlordioxid)
Flockung
Sedimentation
Filtration
Aktivkohlebehandlung
Sicherheitschlorung
pH-Einstellung
Es hängt ganz von der Qualität des Rohwassers ab, wie viele der genannten Schritte in der Praxis durchgeführt werden. Bei einem reinen Quellwasser muss u.U. nur eine Sicherheitschlorung vorgenommen werden, um der Infektionsgefahr aus dem Leitungsnetz vorzubeugen. Bei stark verunreinigtem Rohwasser (z.B. Uferfiltrat aus Rhein oder Ruhr) sind zumeist alle Schritte erforderlich, was den Aufbereitungsprozess zwar aufwendig gestaltet, es gleichzeitig aber ermöglicht, auch aus stark belastetem Rohwasser ein brauchbares Trinkwasser erhalten. Andererseits sind bei der Herstellung von Brauchwasser minderer Qualität, z.B. für Kühlzwecke, wesentlich weniger Reinigungsstufen notwendig.
Falls das Wasser größere Mengen an Härtebildnern (Calcium, Magnesium), an Kohlensäure (weiche, saure Wässer) oder Eisen und Mangan enthält, sind zusätzliche Schritte erforderlich.
Für bestimmte Anwendungen wird ionenfreies Wasser verlangt, das durch Ionenaustausch gewonnen wird.
Durchbruchschlorung und Ozonierung
Bei stark verunreinigtem Oberflächenwasser wird klassisch nach Abtrennung der mechanischen Verunreinigungen als erste Stufe eine Chlorung durchgeführt. Es wird dem Wasser so viel Chlor zugesetzt, dass es nach der Behandlung etwa 0,2 bis 0,5 mg/L freies Chlor enthält (Durchbruchschlorung). Chlor reagiert mit Wasser in Abhängigkeit vom pH-Wert unter Bildung von unterchloriger Säure und von Hypochloritanion.
Die Chlorung bewirkt:
Abtötung von pathogenen Keimen, Inaktivierung von Viren
Oxidation von Kationen wie Eisen(II) oder Mangan(II) zu höheren Wertigkeitsstufen
Chlorierung von Ammoniak (Ammoniumsalzen) zu Chloraminen oder Stickstofftrichlorid
Chlorierung von Phenolen zu Chlorphenolen
Chlorierung von organischen Verunreinigungen, insbesondere Huminsäuren, z.B. zu aliphatischen Chlorkohlenwasserstoffen
Die beiden letztgenannten Prozesse sind unerwünscht: Chlorphenole werden sensorisch bereits in ausgesprochen geringen Konzentrationen (nmol/L) als sehr störend wahrgenommen; einem Teil der aliphatischen Chlorkohlenwasserstoffe (Leitverbindung: Chloroform) wird außerdem ein krebserzeugendes Potential zugeschrieben. Es ist daher üblich geworden, die Chlorung nur bis zur Stufe der Chloramine durchzuführen und die weitere Eliminierung der Verunreinigungen z.B. durch mikrobiologische Abbauprozesse an Aktivkohle vorzunehmen.
Die wichtigste Alternative zur Chlorung ist die Ozonierung des Wassers. Bei ihr treten die genannten Nachteile nur in geringem Maße auf. Problematisch bei der Ozonierung sind allerdings die höheren Kosten. Die Ozonierung begünstigt die nachfolgende Flockung und den biologischen Abbau an Aktivkohle. Es sind etwa 0,2–1,0 g O3/m3 Wasser erforderlich, in besonderen Fällen bis zu 3,0 g/m3.
Eine weitere Alternative ist die Behandlung mit Chlordioxid, das aus Natriumchlorit und Chlor freigesetzt wird, bei der die Bildung von chlorhaltigen organischen Verbindungen geringer ist als bei der Chlorung.
In Deutschland hat die Ozonierung als Vorozonierung – vor die Flockung wird eine Nachozonierung eingeschoben – die Durchbruchschlorung weitgehend verdrängt.
Für die Behandlung von Grundwasser ist eine Durchbruchschlorung bzw. -ozonierung meist nicht erforderlich, eine Belüftung ist ausreichend, um Eisen und Mangan zu oxidieren und zu flocken (s. dort).
Flockung und Sedimentation
Hat das Rohwasser einen starken Trübungsgehalt, vor allem aber kolloidale oder auch lösliche organische Verunreinigungen, so muss es durch eine Flockung vorgereinigt werden. Für diese Zwecke werden dem Wasser saure Eisen- oder Aluminiumsalze zugegeben, im Gefolge fallen voluminöse Niederschläge von Eisen- oder Aluminiumhydroxiden aus:
Der optimale pH-Wert für die Flockung liegt für die Aluminiumsalze bei etwa 6,5–7,5; für die Eisensalze liegt er bei pH 8,5. Falls der natürliche Alkaligehalt des Rohwassers nicht ausreicht, um die entstandene Säure zu neutralisieren, muss Alkali (z.B. Kalkmilch oder Natronlauge) zugesetzt werden. Zusätzlich können Flockungshilfsmittel wie Polyacrylamid oder Stärkederivate zugegeben werden (nicht in der Trinkwassererzeugung). Bei Verwendung von Aluminiumsulfat werden etwa 10–30 g/m3 eingesetzt. Die ausfallenden, sehr feinteiligen Hydroxidflocken sind positiv geladen und adsorbieren die negativ geladenen kolloidalen organischen Stoffe und Tonteilchen.
Zur Durchführung der Flockung und zur Abtrennung des ausgeflockten Materials gibt es eine Reihe von technisch eingeführten Anlagen, bei denen sich eine definierte Schlammschwebeschicht ausbildet, die abgezogen werden kann. Zum Teil arbeiten die Anlagen mit einer Schlammrückführung, um eine bessere Adsorption zu ermöglichen. Auch eine Abtrennung der Schlammflocken durch Flotation ist möglich.
Filtration
Das durch die Flockung vorbehandelte Wasser muss anschließend filtriert werden. Man filtriert über Sandfilter mit einer Höhe von 1–2 m, im Allgemeinen von oben nach unten. Die Teilchengröße des Sandes liegt z.B. bei 0,2–2,0 mm, die Filtrationsgeschwindigkeit bei 3–5 mm/s. Ist das Filter durch die Verunreinigungen belegt, so erhöht sich der Filterwiderstand. Es wird dann von unten nach oben rückgespült, ggf. zusammen mit Luft. Daneben gibt es Mehrschichtenfilter, z.T. in Kombination mit einer 0,5 m hohen Aktivkohleschicht (Abb. 1.3).
Abb. 1.3 Aufbau eines Zweischichtenfilters
Entfernung gelöster anorganischer Verunreinigungen
Hydrogencarbonate Enthält das Rohwasser große Mengen an gelösten Hydrogencarbonaten (harte Wässer), so scheidet sich beim Erhitzen des Wassers vor allem das schwerlösliche Calciumcarbonat (0,014 g/L bei 20 °C) ab (Carbonathärte, Kesselstein):
Die Carbonathärte kann durch Zugabe von Schwefelsäure beseitigt werden, wobei sich das leichter lösliche Calciumsulfat (2 g/L bei 20 °C) bildet:
Das entstandene Kohlendioxid muss ausgetrieben werden, da kohlendioxidhaltiges Wasser korrosiv ist. Man kann die Hydrogencarbonate auch durch Zugabe von Calciumhydroxid beseitigen:
In einer technischen Variante wird das Calciumhydroxid als Lösung oder Suspension dem hydrogencarbonathaltigen Wasser zugegeben und über Calciumcarbonatkugeln geleitet, an denen das neu entstehende Calciumcarbonat aufwächst. Ab einer Grenzgröße werden die Kugeln entnommen (Siebklassierung), neue Kugeln können sich an zugegebenen Kristallkeimen bilden.
Aus stark kohlensäurehaltigen, weichen Wässern muss ebenfalls die Kohlensäure ausgetrieben werden, eine gleichzeitige Aufhärtung lässt sich durch Filtration über halbgebrannten Dolomit erreichen.
Eisen und Mangan Beide Metalle kommen in vielen Wässern vor, typischerweise als zweiwertige Ionen. Zu ihrer Entfernung wird Luft eingeleitet, woraufhin sie, ggf. nach Erhöhung des pH-Wertes, zu den dreiwertigen Oxidhydraten (FeOOH, MnOOH) oxidiert werden, die sich durch Filtration abtrennen lassen. Durch die Behandlung mit Luft wird gleichzeitig auch gelöstes Kohlendioxid ausgetrieben. Falls Luft als Oxidationsmittel nicht ausreicht, was z.B. in Gegenwart von Huminsäuren aufgrund ihrer komplexbildenden Eigenschaften und der damit einhergehenden Erhöhung des Redoxpotentials der Fall ist, werden stärkere Oxidationsmittel wie z.B. Chlor oder Ozon verwandt.
Phosphat Geringe Phosphatmengen im Haushaltswasser sind schon aus Gründen des Korrosionsschutzes der Hausinstallationen erwünscht, da sie geeignet sind, durch Bildung schwerlöslicher Phosphate den Schwermetallgehalt des Wassers zu erniedrigen. Talsperren können jedoch bei Zulauf aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen zu viel Phosphat enthalten. Dieses wird allerdings bereits auf der vorangegangen Stufe der Flockung durch Eisen- oder Aluminiumsalze ausgefällt, die schwerlösliche Phosphate bilden. Der phosphatbedingte Austrag von Fe3+ und Al3+ ist bei der Flockung zu berücksichtigen.
Nitrat und Ammonium Eine gezielte Nitratentfernung wird in der Praxis trotz bekannter Verfahren zur Denitrifizierung kaum betrieben, da diese kostenintensiv ist und sich die geforderten Grenzwerte durch Verschneiden mit minderbelasteten Wässern sicher einhalten lassen. Ein Abbau von Ammoniumsalzen findet auf biologisch besiedelten Aktivkohlefiltern statt.
Aktivkohlebehandlung
Enthält das Wasser nach vorhergehenden Behandlungsschritten noch (wenig polare) organische Verunreinigungen, z.B. phenolische Körper oder Chlor/Bromkohlenwasserstoffe aus der Chlorung, folgt eine adsorptive Entfernung durch Behandlung mit Aktivkohle. Insbesondere bei der Aufbereitung von Flusswasser bietet die Aktivkohlebehandlung eine zusätzliche Sicherheit gegen aperiodisch, z.B. durch Unglücksfälle, eingetragene Organika wie Mineralöl oder Löschwässer.
Als Alternative zu Aktivkohle kommen auch Adsorberharze auf Polystyrolbasis infrage, sie haben sich aber weniger durchsetzen können. Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) und Phenole werden von Aktivkohle im Gegensatz zu Huminsäuren sehr gut adsorbiert, weswegen der Durchbruch Letzterer als Indikator für die Erschöpfung des Aktivkohlefilters dient. In Europa ist der Durchlauf durch ein Bett mit gekörnter Aktivkohle üblich. Es eignet sich allerdings auch der Zusatz von Pulverkohle, ein Verfahren, das in den USA weitverbreitet ist. In diesem Fall kann die Adsorption gemeinsam mit der Flockung erfolgen. Pulverkohle hat den Vorteil, dass sich die benötigte Menge gut an den Grad der Verunreinigung anpassen lässt. Die niedrigen Investitionskosten für dieses Verfahren werden dadurch erkauft, dass eine Regeneration der Pulverkohle im Gegensatz zur thermischen Desorption von Aktivkohle nicht möglich ist. Da die Zusammensetzung der Verunreinigungen von Wasser zu Wasser verschieden ist, werden im Vorfeld der Aktivkohlebehandlung der Kohletyp und die Prozessparameter, wie z.B. die Zahl der Filter oder die Kontaktzeit, empirisch ermittelt. Vor allem aber ist bei der Reinigung darauf zu achten, dass besser adsorbierbare Verbindungen die bereits adsorbierten Verbindungen, wie z.B. Chloralkane, nicht wieder in das Produktwasser verdrängen.
Die durchschnittliche Kapazität für die Entfernung von organischem Kohlenstoff aus dem Wasser liegt bei 50–150 g TOC/m3 Aktivkohle und Tag (TOC: total organic carbon). Sie wird verbessert, wenn nicht bis zum Durchbruch gechlort oder ozoniert wird. Dieser Effekt ist in dem durch den auf der Aktivkohle siedelnden Bakterienrasen biologischen Abbau der organischen Spezies begründet, der neben der Adsorption im Aktivkohlebett stattfindet. Die Ozonbehandlung erhöht die biologische Abbaubarkeit, z.B. indem olefinische Strukturen in mikrobiologisch leicht abbaubare Carbonsäuren überführt werden.
Die Entfernung von Schlamm vom Aktivkohlefilter erfolgt durch Rückspülung. In größeren Abständen müssen zur Vermeidung eines Durchbruchs von Schadstoffen die Filter thermisch unter ähnlichen Bedingungen wie bei der Aktivkohleerzeugung regeneriert werden. Das kann sowohl im jeweiligen Wasserwerk wie auch beim Hersteller der Kohle erfolgen. Die hohen Preise für Aktivkohle von bis zu 2000 €/t machen dieses Vorgehen wirtschaftlich.
Die Aktivkohlebehandlung hat neben der Beseitigung der gelösten organischen Verunreinigungen noch weitere Effekte:
überschüssiges Chlor wird entfernt
Ammoniak und ein Teil der organischen Verbindungen werden biologisch oxidiert
Eisen- und Manganoxidhydrate werden abgetrennt
Sicherheitschlorung
Nach abgeschlossener Aufbereitung erfolgt noch eine Sicherheitschlorung, um eine Reinfektion des Wassers im Verteilungssystem zu verhindern. Sie ist auch nach einer vorhergehenden Ozonierung erforderlich. Trinkwasser enthält etwa 0,1–0,2 mg/L freies Chlor.
1.1.2.4.2 Herstellung von ionenarmem oder ionenfreiem Wasser
Bei einer Reihe von technischen Verfahren wird ein Wasser benötigt, das weniger Härtebildner enthält, als nach den unter Abschnitt 1.1.2.4.1 beschriebenen Verfahren erreicht werden kann. Für diese Zwecke wird das Wasser über Ionenaustauscher geleitet.
Verwendet man als Kationenaustauscher sulfoniertes Polystyrol in der Form des Natriumsalzes, so werden Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen ausgetauscht:
Die Regenerierung der mit Calcium- und Magnesiumionen beladenen Ionenaustauscher (Kapazität: 1 L Austauscherharz nimmt etwa 40 g CaO auf) erfolgt in Umkehrung der obigen Gleichung durch (Gegenstrom-) Elution mit 5–10% Kochsalzlösung. Falls die Härtebildner als Hydrogencarbonate vorlagen, reagiert das Produktwasser nach dem Erhitzen alkalisch:
Geht man von Ionenaustauschern in der Protonenform aus, so reagiert das Produktwasser sauer:
Setzt man (schwach saure) carboxygruppenbasierte Harze in der protonierten Form ein, so werden nur die als Hydrogencarbonat vorliegenden Härtebildner entfernt, weil nur die schwache Kohlensäure freigesetzt werden kann:
Durch anschließendes Erhitzen wird das Kohlendioxid ausgetrieben. Die Austauscher werden mit verdünnten Säuren regeneriert.
Basische Ionenaustauscher, die mit Natronlauge regeneriert werden, tauschen Anionen gegen Hydroxid aus, z.B.:
Man macht hiervon insbesondere dann Gebrauch, wenn Wasser in sehr hoher Reinheit, z.B. für chemische Prozesse, Hochleistungsdampfkessel oder in der Elektronikindustrie benötigt wird, und nahezu ionenfrei vorliegen muss. Dies wird erreicht, indem das vorbehandelte Wasser entweder abwechselnd über Austauscherbetten mit Kationen- und Anionenaustauschern oder über sog. Austauschermischbetten geleitet wird, in denen nebeneinander stark saure Ionenaustauscher in der Protonenform und basische Ionenaustauscher auf Basis von Polystyrolen mit Amino- oder Ammoniumgruppen vorliegen, z.B.:
Beim Durchgang von salzhaltigem Wasser durch ein Mischbett werden also die Kationen gegen Protonen und die Anionen gegen Hydroxidionen ausgetauscht. Protonen und Hydroxidionen reagieren zu Wasser, so dass im Ergebnis das Produktwasser praktisch ionenfrei ist. Man erreicht Restgehalte im Wasser von 0,02 mg/L. Die Anionenaustauscher sind spezifisch schwerer als die Kationenaustauscher, sodass eine Regenerierung des Mischbettes möglich wird. Man lässt die Austauschersäule durch einen starken Wasserstrom von unten durchspülen, so dass das leichtere Kationenaustauscherharz ausgetragen wird und beide Harze unabhängig voneinander regeneriert werden können.
Eine weitere Feinreinigung, besonders von gelösten nichtionischen organischen Verbindungen, ist u.U. für die Elektronikindustrie erforderlich. Sie wird mit Hilfe der Umkehrosmose vorgenommen, s. auch Abschnitt 1.1.2.4.3. Die Deionisierung über Destillation (dest. Wasser) ist heute wirtschaftlich unbedeutend.
1.1.2.4.3 Gewinnung von Süßwasser aus Meerwasser und Brackwasser Gewinnung durch mehrstufige Entspannungsverdampfung
Meerwasser enthält durchschnittlich 3,5% Massenanteil an gelösten Salzen; die Hauptmenge davon ist Kochsalz. Daneben liegen u.a. auch Calcium-, Magnesiumund Hydrogencarbonationen vor. Trinkwasser sollte nicht mehr als 0,05% an Kochsalz und in der Summe weniger als 0,1% an gelösten Feststoffen enthalten.
Die Entfernung von Salz aus Meerwasser in diesen Mengen mit Hilfe von Ionenaustauschern wäre völlig unwirtschaftlich. Zur Gewinnung von Trink- und auch Bewässerungswasser aus Meerwasser steht heute die Destillation im Vordergrund.
Durchgeführt wird die Destillation als mehrstufige (Vakuum-) Entspannungsverdampfung (MSF, multi stage flash), Abbildung 1.4.
Von Partikeln und biologischen Verunreinigungen befreites Meerwasser wird bei Temperaturen von 90 °C bis maximal 120 °C in mehreren – zumeist 18 bis 24 – hintereinandergeschalteten Stufen verdampft. Dabei nimmt die Konzentration an gelösten Salzen im Wasser zu, es wird ein sog. Konzentrat erzeugt. Als Kühlwasser für die Kondensation des entstandenen Brüdens (i.e. der aus reinem Wasser oder einer wässrigen Lösung entweichende Dampf) dient das im Gegenstrom einlaufende Meerwasser, das sich dabei von Stufe zu Stufe mehr erwärmt. Vor der ersten (wärmsten) Stufe wird dem Gesamtsystem über Wärmeaustauscher mit Hilfe von Dampf die erforderliche Energie zugeführt. Von Stufe zu Stufe nimmt die Temperatur der sich aufkonzentrierenden Salzlösung gleichsinnig mit dem herrschenden Druck ab. Zur Kühlung des in den letzten (kältesten) Stufen entstehenden Brüdens ist mehr Meerwasser erforderlich, als an Einsatzwasser benötigt wird. So fließt ein Teil – erwärmt – ins Meer zurück, was einen erheblichen Energieverlust bedeutet. Der andere Teil des vorgewärmten Wassers wird als Einsatzwasser verwendet, im Enderhitzer aufgeheizt und der Verdampfung unterworfen. Der Rest des Konzentrats wird, sofern er nicht nochmals dem Enderhitzer zugeführt wird, abgestoßen. Der Eindickungsfaktor des abgestoßenen Konzentrats gegenüber dem natürlichen Meerwasser wird bei rund 1,6 gehalten, um Korrosion und Verkrustung zu vermeiden. Von der Verringerung der Wandstärke der Apparate und Leitungen (Korrosion) bzw. vom durch den abnehmenden Rohrleitungsquerschnitt bedingten Druckanstieg in den Leitungen (Verkrustung) geht die Gefahr des Reißens der Rohr- und Apparatewandungen aus. Bei der Verkrustung wirkt sich zusätzlich der schlechtere Wärmeübergang nachteilig aus. Mit dem abgestoßenen Konzentrat geht ebenfalls Energie verloren.
Abb. 1.4 Fließbild einer mehrstufigen Destillationsanlage, V – Verdampfer; W – Wärmetauscher (Vorwärmer); E – Entspanner
An die Qualität des einlaufenden Meerwassers werden gewisse Ansprüche gestellt: Neben der Entfernung der grobmechanischen und biologischen Verunreinigungen ist vor allem eine Eliminierung oder Stabilisierung der Härtebildner erforderlich. Aus unbehandeltem Meerwasser würden sich Calciumcarbonat und Magnesiumhydroxid (Brucit) unter Kohlendioxidabgabe auf den Wärmeübertragungsflächen abscheiden; die Destillatleistung der Anlage wäre dadurch stark beeinträchtigt.
Die Abscheidung der Härtebildner kann durch Schwefelsäurezugabe verhindert werden, da sich dann Calcium- und Magnesiumsulfat bilden, die hinreichend leicht löslich sind. Allerdings sind die erforderlichen Säuremengen beträchtlich und an den Standorten der Entsalzungsanlagen oft schlecht verfügbar. Außerdem muss sehr exakt dosiert werden, denn Unterdosierung führt zu Verkrustung, Überdosierung zu Korrosion der Anlage. Man verwendet daher heute in Anlagen, die in der ersten (wärmsten) Stufe bis etwa 90 °C betrieben werden, Pentanatriumtriphosphat (PNP, Na-Tripolyphosphat) in unterstöchiometrischen Mengen zur Härtestabilisierung. Oberhalb von 90 °C hydrolysiert PNP zu rasch, verliert somit seine Aktivität und bildet sogar Niederschläge. Bei Anlagen, die oberhalb von 90 °C betrieben werden, wird fast ausschließlich Polymaleinsäure zur Härtestabilisierung eingesetzt. Üblich ist auch der Einsatz von Schwammbällen zum mechanischen Abtragen von Inkrustationen. Oberhalb von 120 °C scheidet sich aufgrund der mit steigender Temperatur abnehmenden Löslichkeit Calciumsulfat als Anhydrit ab, weshalb die Enderhitzertemperatur auf 120 °C beschränkt ist.
Die Kosten für die Gewinnung von Trinkwasser aus Meerwasser hängen wesentlich von den Kosten der eingesetzten Energie ab. Sie liegen aber auf jeden Fall wesentlich über denen von Trinkwasser, das aus Süßwasser gewonnen wird. Für europäische Verhältnisse ist etwa ein Faktor 4 anzusetzen.
Gewinnung durch Umkehrosmose
Heute hat sich ein weiteres Verfahren zur Gewinnung von Trinkwasser aus salzhaltigem Wasser durchgesetzt: die Umkehrosmose (Reverse Osmosis, RO). Das RO-Verfahren ist besonders für kleinere Anlagen geeignet. Deshalb hat, obwohl fast 70% aller Entsalzungsanlagen nach diesem Prinzip arbeiten, das ROVerfahren nur einen Anteil von 35% an der Entsalzungskapazität. Bei der Osmose tritt Wasser durch eine semipermeable Membran von einer verdünnten Lösung in eine konzentriertere Lösung, wobei sich der hydrostatische Druck in der konzentrierten Lösung erhöht. Dieser Prozess verläuft freiwillig. Bei der umgekehrten Osmose wird durch Anwendung eines äußeren Druckes durch eine semipermeable Membran aus einer salzhaltigen Lösung salzärmeres Wasser gewonnen. Der erforderliche Druck ist abhängig vom Salzgehalt der Lösung. Um eine brauchbare Menge an Wasser zu gewinnen, muss der angewandte Druck deutlich höher sein als der osmotische Gleichgewichtsdruck. So liegt z.B. der Gleichgewichtsdruck einer Lösung mit 0,5% Massenanteil Salz bei 0,35 MPa, der zur Wassergewinnung erforderliche Druck jedoch bei 4–7 MPa. Je höher der Druck auf der Rohwasserseite ist, desto höher ist der Wasserdurchtritt, aber auch die Salzmenge im Produktwasser, da die Membranen das Salz nicht vollständig zurückhalten. Gegebenenfalls muss mehrstufig gearbeitet werden.
Abb. 1.5 Prinzipskizze eines RO-Moduls
Die Membranen werden aus Acetylcellulose oder, bevorzugt, aus Polyamid gefertigt. Wegen der hohen Druckunterschiede und der Notwendigkeit, dünne Membranen zu verwenden, sind die technischen Konstruktionen aufwendig. Man verwendet z.B. Bündel von gewickelten dünnen Hohlkapillaren (Außendurchmesser 0,1 mm, Innendurchmesser 0,04 mm), die sich in einem Druckzylinder befinden (Abb. 1.5). Die Kapillaren werden am Ende des Zylinders durch eine abdichtende Kunststoffschicht herausgeführt. Das Rohwasser wird von der anderen Seite in den Zylinder gegeben; etwa 30% geht als Produktwasser durch die Kapillarwände in die Kapillaren, der Rest wird als konzentrierteres Wasser entnommen und verworfen. Auch hier ist eine intensive und kostspielige Vorbehandlung des einlaufenden Rohwassers erforderlich: Neben der Entfernung aller kolloidalen und biologischen Verunreinigungen ist auch eine Behandlung der Härtebildner, z.B. durch Säurezugabe, notwendig. Besonders günstig ist die Entnahme des Rohwassers aus Brunnen in Strandnähe.
Die Umkehrosmose benötigt zur Wasserherstellung nur ca. 50% des Energiebedarfs einer mehrstufigen Entspannungsverdampfung (8,0–10,6 kWh/m3, bezogen auf Süßwasser, bei einer Kapazität von 19 000 m3/d).
1.1.3 Wasserstoffperoxid und anorganische Peroxoverbindungen
Die Produktion von Wasserstoffperoxid nimmt weiterhin stark zu, wobei die Schwerpunkte des Wachstums in Asien und Südamerika liegen. Nach wie vor ist die Bleiche von Zellstoff das Haupteinsatzgebiet für Wasserstoffperoxid, doch zeichnet sich mit der Verwendung als Oxidationsmittel in der organischchemischen Synthese (Propenoxid, Caprolactam) ein weiterer Wachstumstreiber ab. Praktisch das gesamte Wasserstoffperoxid wird nach dem „Autoxidationsverfahren“ hergestellt, neuere Prozesse, wie die Direktsynthese aus Wasserstoff und Sauerstoff haben technisch noch keine Bedeutung. Von den wichtigen anorganischen Derivaten des Wasserstoffperoxids hat das Natriumperborat weitgehend an Bedeutung verloren. An seiner Stelle wird Natriumpercarbonat als Bleichkomponente in Waschmittelformulierungen eingesetzt. Die elektrolytisch hergestellten Peroxoverbindungen der Alkalimetalle werden hauptsächlich als Polymerisationsstarter und bei der Leiterplattenfertigung eingesetzt. In situ produzierte Monoperoxoschwefelsäure findet zunehmend Verwendung zur Entgiftung von Abwässern im Gold- und Silberbergbau. Die übrigen anorganischen Peroxoverbindungen sind Nischenprodukte mit speziellen Einsatzgebieten, zum Beispiel in der Pyrotechnik.
1.1.3.1 Allgemeines
Wasserstoffperoxid wird immer als wässrige Lösung in den Handel gebracht, wobei 35, 50 und 70%ige Lösungen die wichtigsten Handelsformen sind. Die im Folgenden gemachten Zahlenangaben beziehen sich immer auf „100% Wasserstoffperoxid“. Das Wachstum des Wasserstoffperoxidmarkts ist ungebrochen. Als umweltfreundliche Oxidationschemikalie erschließt es sich neben der Bleiche von Zellstoff und Textilien immer neue Anwendungen. Nicht zuletzt durch neu entwickelte katalytische Oxidationsreaktionen (Propenoxid, Caprolactam) findet es immer mehr Eingang in die chemische Synthese im industriellen Maßstab und hat demzufolge weiterhin sehr gute Wachstumsaussichten. Die wichtigsten Produzenten sind Arkema, EKA-AkzoNobel, Evonik, FMC, Kemira, Mitsubishi Gas Chemical Co. und Solvay.
Natriumperborat und Natriumpercarbonat finden ihre wichtigste Anwendung als Bleichkomponenten in Waschmitteln. Während das Natriumpercarbonat bis vor wenigen Jahren eher in Spezialwasch- und -reinigungsmitteln zum Einsatz kam, ist es inzwischen das wichtigste pulverförmige Bleichmittel geworden. Ausschlaggebend dafür sind in erster Linie Fragen, welche die Toxikologie des Bors betreffen und Vorteile bei der Waschmittelformulierung. Natriumpercarbonat ist keine echte „Per“-Verbindung, sondern eine Anlagerungsverbindung des Wasserstoffperoxids an Natriumcarbonat („Perhydrat“).
Ammonium-, Natrium- und Kaliumperoxodisulfat sind die wichtigsten Peroxosulfate. Zahlen für die weltweite Produktion sowie Angaben über die Aufteilung auf die einzelnen Verbindungen sind nicht verfügbar. Kaliumperoxomonosulfat ist Bestandteil eines Tripelsalzes, das auch noch Kaliumhydrogensulfat und Kaliumsulfat enthält. Die dem Kaliumperoxomonosulfat zugrundeliegende Monoperoxoschwefelsäure H2SO5 wird für Anwendungen im Bereich der Zellstoffbleiche und zur Oxidation von Cyaniden in Abwässern der Minenindustrie in situ hergestellt. Natriumperoxid wird heute nur noch in China produziert, Kapazitätsangaben sind nicht verfügbar. Calcium-, Magnesium-, Strontium- und Bariumperoxid sind ebenfalls kommerziell erhältliche Produkte.
1.1.3.2 Wirtschaftliche Bedeutung und Verwendung
Die wirtschaftliche Bedeutung des Wasserstoffperoxids kann am besten durch seine Wachstumsentwicklung dargestellt werden. Von 1990 bis 2008 ist die global installierte Produktionskapazität von 1,3 Mio. t/a auf ca. 4,5 Mio. t/a gewachsen. Alleine auf China sollen 2011 bereits Nennkapazitäten von über 2 Mio. t/a entfallen. Die regionalen Wachstumsraten sind dabei durchaus unterschiedlich: Asien, insbesondere China, und Südamerika weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf, Europa und Nordamerika wachsen deutlich langsamer. Treiber dieses starken Wachstums waren zum einen der Ersatz von Elementarchlor in den Bleichprozessen der ebenfalls stark wachsenden Zellstoffindustrie, zum anderen die Verwendung als umweltfreundliches Oxidationsmittel in vielen Industrien, vom Bergbau bis zur Chipfertigung. Da gemäß der Gleichung
von Wasserstoffperoxid bei Oxidationsreaktionen nur Wasser als Reaktionsprodukt verbleibt, wird es auch vielfach zur Oxidation von Schadstoffen in Abwässern und Abgasen eingesetzt:
Wasserstoffperoxid weist auch eine starke Desinfektionswirkung auf und wird daher in wachsendem Umfang zur Desinfektion von Lebensmittelverpackungen verwendet. Das stärkste Wachstum für Wasserstoffperoxid resultiert zurzeit aus seiner Verwendung als selektives Oxidationsmittel in der chemischen Synthese. In einem sowohl von Evonik/Uhde als auch von Dow/BASF entwickelten Verfahren lässt sich Propen mit Hilfe von Titansilicalit-Katalysatoren in hohen Ausbeuten und mit hoher Selektivität zu Propenoxid umsetzen (HPPO-Verfahren). Großanlagen nach diesem Verfahren sind bereits in Südkorea, Belgien und Thailand in Betrieb.
Ebenfalls unter Titansilicalit-Katalyse erhält man durch Ammoximierung aus Cyclohexanon, Ammoniak und Wasserstoffperoxid das Cyclohexanonoxim, welches nach Umlagerung zum Caprolactam als Ausgangsstoff für Nylon 6 dient. Anlagen in Japan und in China arbeiten nach diesem Verfahren, bei dem kein Ammoniumsulfat als Nebenprodukt anfällt. Abbildung 1.6 gibt eine Übersicht über die prognostizierte Verwendung von Wasserstoffperoxid im Jahr 2013.
Natriumperborat und Natriumpercarbonat sind die Bleichkomponenten in modernen Waschmitteln. Natriumperborat, das als Tetra- oder Monohydrat zum Einsatz kommt, hat in den letzten Jahren deutliche Marktanteile gegenüber Natriumpercarbonat verloren. Die Gründe dafür sind sowohl ökologischer als auch ökonomischer Natur, denn Borsalze werden in den Kläranlagen nicht entfernt, so dass es mit der Zeit zu einer Anreicherung in den Oberflächengewässern kommen kann. Die Trinkwasserverordnung von 2001 limitiert den Borgehalt auf 1 mg/L. Die Ökotoxikologie des Bors ist außerdem noch immer Gegenstand von Untersuchungen. Der höhere Aktivsauerstoffgehalt des Natriumpercarbonats (handelsüblich sind ca. 13,5%) gegenüber dem Natriumperborat- Tetrahydrat (10,3%) und die Tatsache, dass nach Abgabe des Aktivsauerstoffs Soda übrig bleibt, das die meisten Pulverwaschmittel ohnehin enthalten, kommt der Formulierung von Kompaktwaschmitteln entgegen. Während die Produktion von Natriumperborat 1998 in Europa noch 550 000 t/a betrug, wird sie 2004 mit unter 300 000 t/a angegeben. Hingegen wurde die Produktion von Natriumpercarbonat allein in Europa für 2004 auf mehrere 100 000 t/a geschätzt. Weitere Produzenten von Natriumpercarbonat gibt es in Südkorea, Russland und in China.
Abb. 1.6 Erwarteter weltweiter Wasserstoffperoxid-Verbrauch 2013 nach Anwendungsgebieten
Alkaliperoxodisulfate sind starke Oxidationsmittel. Darüber hinaus bilden sie beim Erwärmen sehr leicht Radikale und finden daher in erster Linie Verwendung als Polymerisationsstarter bei der Polymerproduktion (Polyacrylnitril, verschiedene PVC-Typen). Weiterhin werden sie zur Kupferätzung bei der Herstellung von gedruckten Schaltungen eingesetzt. Bei der Gewinnung von Schiefergas, dem sogenannten „Fracking“, werden Peroxodisulfate in einem bestimmten Stadium der Bohrung zur Regulierung der Viskosität der Bohrflüssigkeit eingesetzt.
Kaliumperoxomonosulfat findet unter anderem beim Ätzen gedruckter Schaltungen und als Oxidationsmittel in Zahnreinigern sowie in der Textilindustrie zur Filzfreiausrüstung von Wolle Verwendung und wird unter dem Namen Caroat® oder Oxone® vertrieben.
Natriumperoxid ist ein starkes Oxidationsmittel, das seine technische Bedeutung jedoch verloren hat, seitdem Wasserstoffperoxid in großen Mengen zur Verfügung steht.
Calcium- und Magnesiumperoxid werden unter dem Markennamen Ixper®C und Ixper®M in den Handel gebracht. Alle technischen Verwendungen wie der Einsatz in Zahnpasten, in Kaugummis, als Teigverbesserer in der Backwarenindustrie oder als Desinfektionsmittel beruhen auf der langsamen Abgabe von Sauerstoff. Diese Peroxide werden auch zur Verbesserung von Böden und Grundwasser sowie zur Sauerstoffanreicherung von tieferen Wasserschichten in stehenden Gewässern verwendet.
Bariumperoxid ist die am längsten bekannte Peroxoverbindung. Es diente als Ausgangsmaterial bei der Entdeckung von Wasserstoffperoxid. Sowohl Barium- als auch Strontiumperoxid werden bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern verwendet.
1.1.3.3 Wasserstoffperoxid
Das erste Herstellungsverfahren für Wasserstoffperoxid bestand in der Umsetzung von Bariumperoxid mit Salpetersäure oder Salzsäure durch L.J. Thénard im Jahr 1818. Diese Methode lieferte nur sehr verdünnte und instabile Wasserstoffperoxidlösungen, deren Verwendungsmöglichkeiten folglich eingeschränkt waren.
1.1.3.3.1 Elektrochemische Verfahren
Durch die technische Realisierung eines elektrolytischen Produktionsverfahrens auf Basis einer anodischen Oxidation von Schwefelsäure (Degussa-Weißensteiner Verfahren, 1911) konnte nicht nur die Produktion deutlich gesteigert werden, sondern dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung eines sehr reinen H2O2, das auch gefahrlos konzentriert und transportiert werden konnte. Damit eröffneten sich auch neue Anwendungsmöglichkeiten.
Das elektrochemische Verfahren ist, nicht zuletzt durch die Höhe des Strompreises, nur mehr aus chemiehistorischer Sicht von Interesse. Es läuft nach folgendem Schema ab, wobei die Hydrolyse über die Zwischenstufe der Monoperoxoschwefelsäure (Caro’sche Säure) verläuft:
Andere Elektrolyseverfahren (Pietsch-Adolph-Verfahren, Löwenstein-Riedel-Verfahren) verwendeten Ammoniumsulfat anstelle von Schwefelsäure.
Wasserstoffperoxid kann auch durch die kathodische Reduktion von Sauerstoff gewonnen werden:
Auf dieser Basis entwickelten Huron-Dow ein technisches Verfahren (H-D Tech-Verfahren). Es liefert eine alkalische Lösung mit 4–5% H2O2 und ca. 8% NaOH, die an Ort und Stelle verbraucht werden muss (z.B. für Bleichzwecke). Eine Anlage mit einer Jahresproduktion von 3000 t H2O2 wurde eine Zeitlang in den USA betrieben.
Die kathodische Reduktion von Sauerstoff kann auch in einer Brennstoffzelle Wasserstoffperoxid liefern, allerdings muss der Prozess dann mit einer Oxidation von Wasserstoff an der Anode kombiniert werden. Auf diesem Weg sollen Wasserstoffperoxid-Lösungen mit Konzentrationen bis zu 15% zugänglich sein.
1.1.3.3.2 Isopropanol-Verfahren
Eine Anlage, die nach dem SHELL-Verfahren arbeitet, ist derzeit noch in Russland in Betrieb.
Technisch wurde von dem Verfahren Abstand genommen, weil sich aus der Bildung des Semiperoxyketals des Acetons Gefahrenpotentiale ergeben.
1.1.3.3.3 Autoxidationsverfahren (Anthrachinonverfahren)
Aufbauend auf Beobachtungen von Manchot (1901), dass Hydrochinon mit Luftsauerstoff zu Benzochinon und Wasserstoffperoxid reagiert, entwickelten Riedel und Pfleiderer bei der BASF zwischen 1935 und 1945 einen Kreisprozess, bestehend aus abwechselnder Hydrierung und Oxidation eines Anthrachinonderivats zur Herstellung von Wasserstoffperoxid. Die erste Großanlage nach diesem Verfahrensprinzip wurde 1953 in den USA von der Firma Dupont gebaut. Auch andere Firmen nahmen dieses Verfahrensprinzip auf, da es sich sehr rasch der elektrochemischen Produktion als überlegen erwies. Heute wird praktisch das gesamte auf der Welt hergestellte Wasserstoffperoxid nach dem „AO“ -Verfahren produziert.
Reduziert man ein 2-Alkylanthrachinon mit Wasserstoff zum Hydrochinon und oxidiert dieses anschließend mit Luft, so erhält man das ursprüngliche 2-Alkylanthrachinon und Wasserstoffperoxid. Da der Oxidationsschritt ohne Katalysator abläuft, spricht man vom „ Autoxidationsverfahren“.
Das Anthrachinonderivat erfüllt dabei die Rolle eines „Reaktionsträgers“, der theoretisch unverändert aus dem Prozess hervorgeht. Daher eignet sich das Autoxidationsverfahren zur Durchführung als Kreislaufprozess:
In Summe wird daher nach der Gleichung
Wasserstoffperoxid aus Wasserstoff und dem Sauerstoff der Luft in exothermer Reaktion gebildet.
Hydrierung und Oxidation werden in Lösung durchgeführt, wobei die Herausforderung bei der technischen Umsetzung des Verfahrens durch die unterschiedlichen Löslichkeitseigenschaften von Chinon und Hydrochinon entsteht. Die Löslichkeit, insbesondere des Hydrochinons, lässt sich einerseits durch die Wahl des Alkylsubstituenten und andererseits durch die Zusammensetzung des Lösungsmittelgemischs beeinflussen. Typische 2-Alkylanthrachinone, die in der Praxis zum Einsatz kommen, sind 2-Ethyl-, 2-tert.-Butyl- und 2-Amylanthrachinon.
Als unpolare „Chinonlöser“ werden überwiegend C9/C10-Alkylbenzole verwendet, als polare „Hydrochinonlöser“ kommen beispielsweise Tris-(2-ethylhexyl)- phosphat, Diisobutylcarbinol, Methylcyclohexylacetat oder Tetrabutylharnstoff zum Einsatz. Die Kombination aus 2-Alkylanthrachinon und dem Lösungsmittelgemisch wird als „Arbeitslösung“ bezeichnet.
Die Bildung des Wasserstoffperoxids im Autoxidationsprozess erfolgt mit einer Selektivität von über 99% bezogen auf das eingesetzte Chinon, durch die Kreislaufbetriebsweise reichern sich jedoch mit der Zeit Nebenprodukte an, die entweder zum aktiven Chinon regeneriert werden können oder aber aus der Arbeitslösung entfernt werden müssen. Jede Autoxidationsanlage enthält daher einen Regenerationsschritt für die Arbeitslösung. Dieser kann sowohl in der hydrierten als auch in der oxidierten Arbeitslösung nach Extraktion des H2O2 durchgeführt werden. Als Regenerationsmittel kommt entweder Natronlauge oder aktives Aluminiumoxid zum Einsatz.
Der AO-Prozess verläuft zusammengefasst nach folgendem Schema (Abb. 1.7):
Abb. 1.7 Der Autoxidationsprozess (AO-Prozess) zur Herstellung von H2O2
Das rohe H2O2, das als wässrige Lösung mit Konzentrationen von 35–45% anfällt, wird meist nochmals mit einem Lösungsmittel gewaschen, bevor es unter Vakuum auf die handelsüblichen Konzentrationen (35, 50 und 70%) konzentriert wird.
Nur „stabilisiertes“ H2O2 wird in den Handel gebracht. Der Stabilisator hat dabei die Aufgabe, die im H2O2 in Spuren enthaltenen Schwermetallionen zu komplexieren. Solche Ionen, wie Eisen, Chrom oder Kupfer zersetzen H2O2 unter Entwicklung großer Gas- und Wärmemengen zu Wasser und Sauerstoff und stellen ein erhebliches Gefährdungspotential dar.
Sauberkeit im Umgang mit Wasserstoffperoxid ist daher äußerst wichtig, ebenso die Auswahl geeigneter Werkstoffe für Produktion, Lagerung und Transport. Als solche kommen rostfreie Stähle, Aluminium und bestimmte Aluminiumlegierungen sowie gewisse Kunststoffe (Polyethylen, Polypropylen für niedrige Konzentrationen) in Frage. Gute Stabilisatoren sind beispielsweise Natriumstannat oder Phosphate und Phosphonsäuren.
1.1.3.3.4 Direktsynthese aus Wasserstoff und Sauerstoff
Speziell im Zusammenhang mit der Propenoxidsynthese aus Propen und H2O2 liegen viele Patente zur Direktsynthese in methanolischer Lösung vor. Die industrielle Anwendung steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch aus.
1.1.3.4 Peroxoverbindungen
Herstellung von Natriumperborat
Die Herstellung des Natriumperborats erfolgt in zwei Stufen. In der ersten Stufe wird der Bor-Rohstoff (Boraxpentahydrat, Tinkal) mit Natronlauge bei Temperaturen von T ≤ 90 °C zu einer Metaboratlauge gelöst. Nach Filtration und Abkühlung erfolgt die Umsetzung mit H2O2 unter Bildung von schwerlöslichem Natriumperborat-Tetrahydrat:
Die Abtrennung des Salzes erfolgt meist mittels Zentrifugen; die Mutterlauge wird recycliert.
Zur Trocknung werden bevorzugt Fließbetttrockner verwendet. Durch Wahl der geeigneten Trocknungsbedingungen erhält man ein reines Tetrahydrat. Unter schärferen Trocknungsbedingungen gelangt man zum Perborat-Monohydrat NaBO3 · H2O. Es besitzt eine höhere Lösegeschwindigkeit und bessere Verträglichkeit mit anderen Waschmittelkomponenten als das Tetrahydrat. Der höhere Aktivsauerstoffgehalt (theoretisch 16,0%) kommt den Anforderungen der Waschmittelindustrie ebenfalls entgegen.
Insgesamt aber geht der Einsatz der Perborate in der Waschmittelindustrie aus ökotoxikologischen und aus Rezepturgründen stark zurück.
Herstellung von Natriumpercarbonat (Natriumcarbonat-Perhydrat)
Im Gegensatz zum Perborat ist das Percarbonat keine echte Peroxoverbindung, sondern eine Anlagerungsverbindung von Wasserstoffperoxid an Natriumcarbonat mit der Summenformel Na2CO3 · 1,5 H2O2.
Die Herstellung kann sowohl nach einem Kristallisationsverfahren als auch mit Hilfe der sogenannten Sprühgranulation erfolgen.
Beim Kristallisationsverfahren wird Sodalösung mit Wasserstoffperoxid umgesetzt, wobei das Percarbonat auskristallisiert. Zur Verminderung der Löslichkeit kann Natriumchlorid zum Aussalzen zugegeben werden.
Bei der Sprühgranulation werden Natriumcarbonatlösung und Wasserstoffperoxid mit Luft als Treibgas aus zwei getrennten oder einer gemeinsamen Düse auf ein Wirbelbett von Natriumpercarbonat-Teilchen gesprüht und das überschüssige Wasser verdampft. Um Verkrustungsproblemen in der Düse und damit Betriebsunterbrechungen vorzubeugen, wird die Verwendung einer Dreistoffdüse mit spezieller konstruktiver Ausführung vorgeschlagen.
Als Perhydrat ist Natriumpercarbonat instabiler als Natriumperborat. Es ist jedoch gelungen, die Stabilität durch Umhüllung mit z.B. Magnesiumsalzen und Natriumsilikat deutlich zu erhöhen, sodass es problemlos in Waschmittelformulierungen verwendet werden kann.
Herstellung von Ammoniumperoxodisulfat
Wie alle Peroxodisulfate wird Ammoniumperoxodisulfat auf elektrolytischem Wege durch anodische Oxidation von Ammoniumsulfat in schwefelsaurer Lösung an Platinelektroden hergestellt:
Die Elektrolytlösung wird außerhalb der Zelle abgekühlt, wobei sich sehr reines Produkt abscheidet (> 99%). Nach Zusatz von Ammonsulfat und Schwefelsäure wird die Mutterlauge wieder in die Zelle zurückgeführt.
Herstellung von Kaliumperoxodisulfat
Die Gewinnung von Kaliumperoxodisulfat verläuft analog zur Herstellung von Ammoniumperoxodisulfat. Es ist allerdings wesentlich schwerer löslich und kristallisiert bereits in der Elektrolysezelle.
Kaliumperoxodisulfat kann auch aus Ammoniumperoxodisulfat hergestellt werden:
Das Peroxosalz ist sehr schwerlöslich und kristallisiert daher bereits nach Zugabe von Kaliumhydrogensulfat.
Herstellung von Natriumperoxodisulfat
Auch die Synthese des Natriumperoxodisulfats verläuft analog zur Herstellung von Ammoniumperoxodisulfat.
Und ebenso wie das Kaliumsalz ist es auch aus Ammoniumperoxodisulfat zugänglich:
Der Unterschied zum Kaliumsalz besteht indes darin, dass im Falle des Natriumsalzes der Ammoniak durch die Natronlauge ausgetrieben wird. Kaliumperoxodisulfat hingegen fällt sofort aus.
Herstellung von Monoperoxoschwefelsäure (Caro’sche Säure)
Caro’sche Säure ist ein Gleichgewichtsgemisch aus Monoperoxoschwefelsäure, Wasserstoffperoxid, Schwefelsäure und Wasser:





























