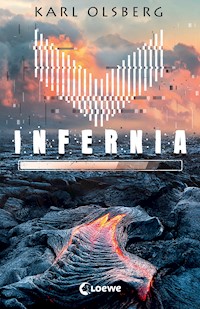
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was fühlt eine KI in einem Videospiel? Leutnant Jero Kramer ist ein guter Soldat, findet Emma. Er ist klug und umsichtig, und er bringt seine Leute immer unverletzt zurück. Dass er im Kampf gegen den Dämonenlord Zardor doch zwei Männer an die Hölle verliert, kann er sich nicht verzeihen. Er leidet schrecklich unter seinem Versagen. Er leidet? Jero Kramer ist eine Figur in einem Videospiel. Kann er Gefühle entwickeln? Und wenn ja, ist dann nicht jedes Game ein schreckliches Verbrechen? Als Jero plötzlich aus dem Spiel gelöscht wird, startet Emma eine Onlinekampagne für die NPCs. Und kommt einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur. Hast du dich auch schon gefragt, ob die Figuren in deinem Computerspiel echt sind? Die Wahrheit ist: Wir sind nur einen Hauch davon entfernt … Philosophische Fragen in einem atmosphärischen Gaming-Setting Spannende Future-Fiction von Bestsellerautor Karl Olsberg. Im Jahr 2007 erschien sein erster Roman Das System, der es auf Anhieb in die SPIEGEL-Bestsellerliste schaffte. Seitdem schreibt er nicht nur erfolgreich Romane für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche und Kinder. Karl Olsberg promovierte über künstliche Intelligenz und verknüpft diese in Infernia mit der Welt des Gamings. Für Fans von Erebos und Boy in a White Room. Entdecke mit Emma die Welt von Infernia!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1 – Niemals werde ich …
Kapitel 2 – Ich klingelte an …
Kapitel 3 – Mit einem elektrischen …
Kapitel 4 – Ich öffnete das …
Kapitel 5 – Mit ein paar …
Kapitel 6 – Erschrocken drehte ich …
Kapitel 7 – »Worüber wollte deine …
Kapitel 8 – Jero schreckte hoch …
Kapitel 9 – Das vertraute Gefühl …
Kapitel 10 – Ich merkte sofort, …
Kapitel 11 – Beim Mittagessen in …
Kapitel 12 – Wieder einmal stand …
Kapitel 13 – Als ich am …
Kapitel 14 – Ben würdigte mich …
Kapitel 15 – Um Punkt Viertel …
Kapitel 16 – Am Montagnachmittag erschien …
Kapitel 17 – Olga führte uns …
Kapitel 18 – Während Bens Vater …
Kapitel 19 – Mama hatte diese …
Kapitel 20 – Als ich am …
Kapitel 21 – Jero lag in …
Kapitel 22 – »Was zur Hölle …
Kapitel 23 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 24 – Als ich mit …
Kapitel 25 – Die Menschen im …
Kapitel 26 – Ich schlief schlecht …
Kapitel 27 – Gegen halb fünf …
Kapitel 28 – Eine Woche später …
Kapitel 29 – »Warst du wieder …
Kapitel 30 – Während ich mit …
Kapitel 31 – Der Rest des …
Kapitel 32 – Die Scheinwerfer tauchten …
Kapitel 33 – Was hättest du …
Kapitel 34 – Mein Herz schlug …
Kapitel 35 – Nach dem Meeting …
Kapitel 36 – »Ich weiß nicht«, …
Kapitel 37 – Ungläubig starrte ich …
Kapitel 38 – Zögernd ging ich …
Kapitel 39 – Als es wieder …
Kapitel 40 – Jero rannte aus …
Kapitel 41 – Im Sichtschatten der …
Kapitel 42 – Ächzend rappelte ich …
Kapitel 43 – Als ich wieder …
Kapitel 44 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 45 – Fabian und der …
Kapitel 46 – Eine Viertelstunde später …
Kapitel 47 – Der schwarze Himmel …
Kapitel 48 – »Ich weiß, du …
Kapitel 49 – Rasch befreite ich …
Kapitel 50 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 51 – Ben, Mario und …
Epilog
Für Carolin, Konstantin, Nik und Leopold,
»Gedenk’ an deines Weisen Lehren:
Je mehr ein Ding vollkommen ist, je mehr
Wird sich’s im Glücke freun, im Schmerz verzehren.«
1
Niemals werde ich den Moment vergessen, als ich zum ersten Mal die Hölle betrat.
Ich stand in einer großen Halle. Gewaltige Feuerschalen beleuchteten die düstere Szenerie in flackerndem Rot. Die Wände schienen aus Knochen zu bestehen, die wie die Rippen eines gewaltigen Lebewesens emporragten. Dazwischen spannten sich graue Häute, an denen noch Fleischreste zu haften schienen. Hin und wieder klebten darauf halb durchsichtige, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen, in denen sich dunkle Schemen bewegten.
Auf einem Podest in der Mitte der Halle erhob sich eine Art Thron aus schwarzem Material, dessen Sitzfläche und Rückenlehne mit Stacheln bedeckt waren, als handele es sich um ein Folterwerkzeug. Darauf saß eine muskulöse Gestalt mit rot leuchtenden Augen und riesigen Hörnern. Um den Thron herum standen mehrere Dämonen mit pelzbedeckten Körpern und ziegenartigen Köpfen, die lange Lanzen trugen. Ihre gelben Augen schienen mich böse anzublicken, und sie streckten ihre Waffen in meine Richtung, griffen mich jedoch nicht an.
»Da bist du ja!«, donnerte der Dämonenlord.
War das wirklich Bens Stimme? Verwirrt und eingeschüchtert sah ich mich um, dann machte ich vorsichtig ein, zwei Schritte auf den Thron zu. Ein Schauer lief mir dabei über den Rücken. Es fühlte sich so an, als sei ich wirklich hier! Beinahe glaubte ich, den Gestank von Schwefel und Verwesung zu riechen, der in der Luft zu liegen schien.
»Das … das ist unglaublich!«, brachte ich heraus.
Der Dämon erhob sich von seinem Stachelthron und kam auf mich zu.
»Na, wie gefällt dir mein Palast?«, fragte er.
»Er ist … eindrucksvoll«, erwiderte ich. »Aber auch ein bisschen düster.«
Er lachte dröhnend. »Na, das soll er ja auch sein. Schließlich bin ich ein Dämonenlord!«
Ich versuchte, in ihm den Jungen zu sehen, dem ich noch vor einer halben Stunde den Unterschied zwischen Sinus und Cosinus erklärt hatte, doch es fiel mir schwer. Dabei hatten wir den ganzen Nachmittag zusammen an seinem Schreibtisch gesessen.
Ben war sechzehn, ein Jahr älter als ich, und sein Vater machte irgendwas mit Geldanlagen oder so. Jedenfalls war er schwerreich. Ben sah gut aus, mit kurzen schwarzen Haaren, einem kantigen Kinn und buschigen Augenbrauen. Er wohnte in einer Luxusvilla in Blankenese mit einer von Säulen gesäumten übergroßen Eingangstür, die ich erst an diesem Nachmittag zum ersten Mal durchschritten hatte. Bens Stiefmutter Alegra hatte mir geöffnet. In ihrem Gucci-Hosenanzug sah sie aus wie Chrissy Teigen und vermutlich glaubte sie, dass ich mich nur in der Tür geirrt hatte.
Tatsächlich ging ich normalerweise nicht in Millionärsvillen ein und aus. Ich wohnte mit meiner Mutter in einer engen Dreizimmerwohnung in Rissen und kannte Ben aus der Schule. Als er mich am Morgen gebeten hatte, ihm bei der Vorbereitung für die Matheklausur zu helfen, war ich überrascht gewesen. Bisher hatten wir kaum ein Wort miteinander gesprochen. Ich war nicht schlecht in Mathe, aber Karl oder Efram hätten ihm das sicher viel besser erklären können.
Nach der Paukerei hatte Ben mich hierher in den Keller der Villa geführt, wo in einem Raum voller Trainingsgeräte zwei große kugelförmige Gestelle aus weiß lackiertem Metall sowie ein kleiner Tisch mit einem Computer und zwei Monitoren standen.
Ich hatte schon von diesen neuen Simrigs gehört, die so viel kosteten wie ein Auto und mit denen man virtuelle Welten auf ganz neue Art erleben konnte, doch ich hatte noch nie eins aus der Nähe gesehen, geschweige denn es benutzt.
Sicher spielst du auch manchmal Computerspiele. Aber hast du eine Vorstellung, wie es wäre, in einem Computerspiel zu sein? Ich jedenfalls hätte mir das niemals träumen lassen, bis ich es selbst erleben durfte.
Mit einem Simrig fühlt es sich so an, als wärst du wirklich in einer ganz anderen Welt. Man schnallt die Füße an zwei bewegliche Trittplatten und legt einen Anschnallgurt um den Bauch. Die Hände führt man in Handschuhe aus weichem Stoff. Alles ist an beweglichen Stangen montiert, sodass das Simrig deinen Bewegungen Widerstand entgegensetzen kann. Auf diese Weise kannst du in der virtuellen Welt herumlaufen, es in den Fingerspitzen fühlen, wenn du dort etwas berührst, und das Gewicht von Gegenständen in deinen Händen spüren. Auf den Befehl »Simrig, Start!« senkt sich eine Art Motorradhelm über deinen Kopf, in dessen Innerem ein 3-D-Display, Lautsprecher und eine Kamera angebracht sind. Die Kamera überträgt deine Gesichtsausdrücke auf deine Spielfigur.
In einem Simrig kannst du alles sein, was du willst – eine Prinzessin, ein Astronaut, ein Superheld oder auch, so wie ich, eine Eterim-Zauberin. Es ist einfach unglaublich!
Ich stand also hier in der unfassbar realen virtuellen Welt von Infernia, einem gerade total angesagten Computerspiel, und war hin- und hergerissen zwischen Horror und Begeisterung.
»Komm mit, ich will dir was zeigen!«
Ben alias Zardor, der Dämonenlord, führte mich durch einen Seitenausgang in einen gewundenen Treppenaufgang im Inneren einer der knochenartigen Säulen. Auf den Stufen spürte ich bei jedem Schritt das Gewicht meines Körpers, so als stiege ich wirklich etliche Meter hinauf. Als wir das Obergeschoss erreichten, war ich etwas außer Atem. Wir traten hinaus auf eine Art Balkon, von dem aus man die Landschaft überblicken konnte.
Der Himmel war von pechschwarzen Wolken bedeckt. Der rote Lichtschein, der die bizarre Landschaft erhellte, stammte von mehreren Lavaströmen, die am Hang gewaltiger Vulkane herabflossen und vereinzelte Seen bildeten. Dazwischen erstreckte sich eine graue Wüste, immer wieder durchbrochen von spitzen schwarzen Felsen, die wie die Zähne eines gigantischen Ungeheuers aus dem Boden ragten, sowie Ansammlungen von riesigen Pilzen. Dutzende der ziegenartigen, aufrecht gehenden Geschöpfe liefen überall herum, außerdem zerlumpte menschliche Gestalten, die aussahen wie Zombies aus einem Horrorfilm, und elefantengroße Hyänen. Während wir dort standen, sah ich, wie sich eines der riesigen Raubtiere auf einen Zombie stürzte und ihn mit seinen Klauen und Zähnen zerfetzte. Angeekelt wandte ich mich ab und war froh über meine Entscheidung, als Spielfigur eine Eterim-Zauberin gewählt zu haben.
Die Entwicklung von Infernia war durch die Firma von Bens Vater finanziert worden, wie Ben mir stolz erzählte. Das Spiel bestand aus drei Welten, die durch magische Portale miteinander verknüpft waren – die höllenartige Unterwelt Infernia, die Erde und die paradiesische Welt Eternia, die nur Eterim wie ich betreten konnten.
»Wie man sieht, ist es hier nicht gerade gemütlich«, erklärte Ben. »Deshalb versuchen wir Inferim, die Erde zu erobern. Die Menschen waren dumm genug, bei einem fehlgeschlagenen Experiment am CERN in Genf ein großes Portal nach Infernia zu erzeugen, durch das unsere Armee in ihre Welt eindringt. Komm, ich zeig es dir.«
Er machte eine Handbewegung und murmelte etwas. Eine runde, violett leuchtende Öffnung erschien vor ihm in der Luft, umgeben von zuckenden Blitzen. Als wir hindurchtraten, fand ich mich auf dem flachen Dach eines Hochhauses in einer verfallenen Stadt wieder. Die Fenster der Gebäude waren größtenteils geborsten, von einigen waren nur noch rußgeschwärzte Ruinen übrig. In der Ferne sah man Berge und einen großen See. In der anderen Richtung, einen oder zwei Kilometer von meinem Standort entfernt, ragte eine gewaltige Säule aus violettem Licht wie der Strahl eines gigantischen Scheinwerfers in den Himmel. Das musste das große Portal sein, von dem Ben gesprochen hatte. Schreie waren zu hören, hin und wieder Schüsse und Explosionen. Als ich an der Mauer des Gebäudes hinabblickte, sah ich tief unten Gestalten, die mit Schwertern kämpften. Einige sahen aus wie die aufrecht gehenden Ziegenböcke aus Zardors Palast, andere waren Menschen in Tarnkleidung. Am Himmel darüber kreisten Wesen, die wie Flugsaurier oder gigantische Fledermäuse aussahen.
»In Infernia und hier in der Nähe des Portals funktioniert menschliche Technik nicht«, erklärte Ben. »Die Typen da unten haben keine Chance.«
Er beugte sich über das Dach, streckte den Arm aus und sagte ein paar Worte in einer fremden Sprache. Ein violetter Blitz zuckte und drei der menschlichen Gestalten brachen getroffen zusammen. Die anderen ergriffen die Flucht, während die Gehörnten sie verfolgten.
Ich musste schlucken und hatte auf einmal ein flaues Gefühl im Magen. »Das … ist wirklich sehr eindrucksvoll«, sagte ich. »Aber ich glaube, ich würde jetzt gern in die Realität zurückkehren.«
Er sah mich mit seinem Dämonengesicht an. Ich konnte darin nichts erkennen, doch in seiner verzerrten Stimme glaubte ich Enttäuschung zu hören.
»Okay. Schon klar. Sag einfach ›Simrig, exit‹.«
Im selben Moment verschwand er.
Ich wiederholte den Befehl. Es wurde dunkel um mich und der Helm fuhr langsam hoch. Verwirrt blinzelte ich. Wie eng und farblos dieser Kellerraum plötzlich aussah. Es war, als wäre ich aus einem intensiven Traum erwacht. Ein leichtes Schwindelgefühl befiel mich, als ich die Hände aus den Handschuhen zog und mich bückte, um die Riemen von meinen Füßen zu lösen. Als ich mich endlich aus dem Simrig befreit hatte, grinste Ben mich an.
»Na, hab ich zu viel versprochen?«
Ich lächelte schief. »Nein. Das war wirklich … unglaublich.«
»Wenn du willst, kannst du ja morgen nach der Schule wieder herkommen«, schlug er vor.
Ging es ihm jetzt nur um das Spiel oder um mehr? Es lag etwas in seinem Blick, das … Oder bildete ich mir das bloß ein?
»Ja, mal sehen«, wich ich aus. »Ich muss jetzt los.«
»Okay.«
Als wir die Eingangshalle betraten, kam Bens Stiefmutter aus dem elegant eingerichteten Wohnzimmer mit seinen riesigen weißen Sofas und bodentiefen Fenstern, die den Blick auf einen großen, gepflegten Garten freigaben.
»Ich dachte, ihr wolltet lernen!«, sagte sie.
»Haben wir doch!«, blaffte Ben zurück.
»Ich glaube, Ben ist jetzt fit für die Matheklausur«, sprang ich ihm bei. »Auf Wiedersehen!«
Sie zog eine Augenbraue hoch.
»Tschüss«, erwiderte sie kühl, wandte sich um und verschwand wieder im Wohnzimmer.
»Danke noch mal«, sagte Ben zu mir. »Du hast mir wirklich sehr geholfen. Bis morgen!«
»Bis morgen«, erwiderte ich, ohne genau zu wissen, ob damit das Wiedersehen in der Schule gemeint war oder ob ich nun seine Einladung, nachmittags wieder herzukommen, angenommen hatte.
2
Ich klingelte an Bens Haustür. Ein melodischer Glockenton erklang, nicht so ein elektronisches Gedudel wie bei uns zu Hause.
Obwohl ich seit meinem ersten Besuch vor gut zwei Monaten fast täglich hier gewesen war, fühlte ich mich immer noch, als gehörte ich nicht hierher. Bens Vater hatte ich bisher kaum gesehen, nur einmal hatte er uns zum Essen in ein teures Restaurant eingeladen, in dem ich vor lauter Atmosphäre kaum hatte atmen können. Und mit Bens Stiefmutter war ich erst recht nicht warm geworden. Zum Glück ignorierte sie mich die meiste Zeit.
Heute war es Ben selbst, der mir öffnete.
»Dad ist für ein paar Tage nach Dubai geflogen«, erklärte er mit einem Grinsen. »Irgendeine Investorenkonferenz. Und Alegra begleitet ihn. Unsere Haushaltshilfe ist nur halbtags da. Wir sind also ungestört.«
Mit einem leicht mulmigen Gefühl begleitete ich ihn in sein Zimmer. Statt sich an den Schreibtisch zu setzen, wo wir normalerweise gemeinsam unsere Hausaufgaben erledigten, machte er es sich auf dem Bett gemütlich.
»Komm her!«, rief er.
Ich setzte mich zögernd zu ihm.
Ungefähr drei Wochen nach meinem ersten Ausflug in die Hölle hatte mich Ben zum ersten Mal geküsst. Es war einfach so passiert, ohne Vorwarnung, als ich mich gerade wieder mit einem Gefühl des Bedauerns aus dem Simrig geschnallt hatte. Bis dahin war ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass er sich vielleicht noch etwas anderes von mir wünschte, als nur seine Gegnerin in einem Computerspiel zu sein. Oder vielleicht hatte ich den Gedanken auch einfach verdrängt.
Jedenfalls war ich perplex gewesen, doch irgendwie hatte es sich auch gut angefühlt. Also hatte ich seinen Kuss erwidert.
Seitdem waren wir offiziell ein Paar. Meine Schulkameradinnen waren schon längst davon überzeugt gewesen, dass Ben und ich zusammen gingen, obwohl wir in der Schule nicht viel miteinander redeten und er in den Pausen die meiste Zeit mit anderen Jungs abhing. Ich hatte mehrmals mitbekommen, wie die Mädchen tuschelten, wenn ich an ihnen vorbeiging. Aber ich war schon immer eine Einzelgängerin gewesen, die sich für Klatsch und Tratsch nie interessiert hatte, und ignorierte es einfach.
Ben war echt süß. Ich mochte ihn wirklich, auch wenn es nicht die große Liebe war. Bisher war nie mehr passiert als ein paar leidenschaftliche Küsse. Doch ich hatte immer geahnt, dass ihm das auf Dauer nicht reichen würde.
Jetzt zog er mich zu sich, küsste mich leidenschaftlich, begann, mich zu streicheln und meine Bluse aufzuknöpfen.
Ich verkrampfte innerlich.
Ich hatte noch nie richtigen Sex gehabt. Und das war jetzt auch echt das Letzte, was ich mir vorstellen konnte. Andererseits wollte ich ihn doch glücklich machen. Hatte ich nur Angst, nicht gut genug zu sein?
Nein. Es fühlte sich einfach nicht richtig an.
»Bitte nicht!«, sagte ich atemlos zwischen zwei Küssen und hielt seine Hand fest.
Er wich erschrocken zurück.
»Wieso … wieso denn nicht?«, fragte er.
In seinen Augen sah ich Enttäuschung und Verunsicherung.
»Es tut mir leid«, antwortete ich. »Ich … bin noch nicht so weit.«
Er nickte. »Okay, verstehe.«
Auf einmal tat er mir unendlich leid. Ich umarmte und küsste ihn.
»Sei mir nicht böse«, flüsterte ich in sein Ohr. »Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit.«
»Schon okay«, erwiderte er.
Doch ich spürte, dass es nicht okay war. Ich hatte ihn verletzt. Er fühlte sich von mir zurückgewiesen.
»Lass uns ein bisschen spielen, ja?«, sagte ich, um die Situation zu entkrampfen.
Er warf mir einen merkwürdigen Blick zu. »Also gut.«
Wir gingen schweigend in den Keller und stiegen in die Simrigs.
Wie immer, wenn in der Spielwelt eine neue Mission begann, fand ich mich in meinem kleinen Schloss in Eternia wieder. Meinen letzten Einsatz – die Begleitung eines Militärkonvois durch Inferim-verseuchtes Gebiet – hatte ich erfolgreich abgeschlossen und dafür drei Kristalle mit insgesamt knapp hundert Ätherium-Einheiten erhalten, der magischen Energie, die ich für meine Zauber brauchte. Ich hatte bei dem Einsatz fast ebenso viel Ätherium verbraucht, daher hatte es unter dem Strich kaum etwas gebracht außer ein paar Erfahrungspunkten. Aber auf die kam es letztlich an, denn die mächtigsten Zauber konnte ich nur auf der höchsten Spielstufe wirken, und bis dahin war es noch ein weiter Weg.
Ich ging zu der Tafel mit den aktuellen Missionen – einer Art magischer Pinnwand, an der ständig Zettel mit neuen Aufgaben erschienen, während andere verschwanden. Um einen Einsatz anzunehmen, musste man nur den Zettel von der Pinnwand reißen. Bei den besonders lukrativen Aufträgen musste man allerdings schnell sein, bevor sie einem ein anderer Spieler abjagte. Deshalb zögerte ich nicht lange, als ich den neuesten Zettel las: Bergung eines hochreinen Kristalls (Lvl 30+/1.024 ÄE). Zwar war meine Spielfigur Rialis erst auf Level 28, sodass die Aufgabe eigentlich etwas über meinem Niveau lag, aber das bedeutete nicht, dass ich sie nicht bewältigen konnte, und der enorm hohe Gewinn von mehr als tausend Ätherium-Einheiten schien mir das Risiko wert. Also nahm ich das Blatt in die Hand.
Erst danach las ich die Missionsbeschreibung: Eine kleine Einheit der Vereinigten Europäischen Streitkräfte ist in Inferim-verseuchtem Gebiet in einen Hinterhalt geraten, als sie versuchte, einen hochreinen Kristall zu bergen. Rette möglichst viele Soldaten und berge den Kristall. Alternative Missionsziele: Übergib den Kristall an das Kommando der irdischen Streitkräfte, um dein Ansehen zu verbessern und eine Belohnung zu erhalten, oder behalte ihn für dich.
Ich entschied mich, nicht direkt an den Ort des Geschehens zu teleportieren, sondern mir zunächst einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wenn ich mich mit Gegnern anlegte, die stärker waren als ich selbst, wie es bei diesem hohen Missionslevel unvermeidlich war, dann ging ich besser vorsichtig vor. Also teleportierte ich mich in eine Höhe von hundert Metern über dem Zielgebiet, führte einen Levitationszauber aus, der mich in der Luft schweben ließ, und machte mich mit einem weiteren Zauber unsichtbar. Es war ein atemberaubendes Gefühl, zu fliegen wie ein Adler – auch wenn ich das schon oft erlebt hatte, faszinierte es mich jedes Mal wieder. Insgesamt kosteten mich diese Manöver knapp dreißig Ätherium-Einheiten, nicht wenig für eine Einsatzvorbereitung, aber nur 0,3Prozent der potenziellen Beute.
Der Einsatzort lag etwa fünfzehn Kilometer nördlich von Genf, etwas südlich der Kleinstadt Nyon am Ufer des Genfer Sees. Der Kommandotrupp saß in einem Bauernhof fest. Von allen Seiten näherten sich Inferim. Ich sah mehrere Horden von Untoten, die langsam, aber unaufhaltsam auf die Scheune zuwankten, in der sich die Menschen verschanzt hatten. Von Süden her näherte sich ein Trupp mit Speeren bewaffneter Gehörnter über die seit Langem nicht mehr befahrene Autobahn. Außerdem kreiste ein Schwarm Lederschwingen unter mir in der Luft – fledermausartige Wesen mit einer Spannweite von bis zu zehn Metern, die im Sturzflug über ihre Opfer herfielen und sie mit einem Nackenbiss töteten oder sie mit in die Luft rissen, um sie dann zu Tode stürzen zu lassen. Gewehrfeuer war zu hören und eine der Lederschwingen trudelte mit einem entsetzlichen Kreischen herab.
In ihrer schieren Anzahl waren die Inferim für den menschlichen Trupp ein großes Problem, außerdem lockten Kampfgeräusche meist noch mehr Feinde an. Doch die Monster, die ich sah, waren alle höchstens auf Stufe 10. Trotz der Übermacht schien mir die Einstufung der Mission auf Level 30 zu hoch gegriffen. Was vermutlich bedeutete, dass ich noch nicht alles gesehen hatte.
Die ersten Untoten erreichten die Scheune. Die Soldaten schossen, doch die Monster waren nicht so leicht durch Gewehrkugeln aufzuhalten. Ihre bereits toten Körper wurden durch ätherische Energie zusammengehalten und waren nur schwer zu zerstören. Sie hämmerten mit ihren verfaulten Fäusten gegen das Scheunentor und versuchten, durch die zersplitterten Fenster ins Innere zu kriechen. Es war höchste Zeit einzugreifen, wenn ich die Soldaten vor einem grausamen Schicksal retten wollte. Doch ich zögerte noch. Mein Gefühl sagte mir, dass Vorsicht angebracht war, wenn ich nicht selbst in eine Falle tappen wollte.
Im nächsten Moment hörte ich ein hohes Sirren, das sich rasch näherte. Ich drehte mich um und sah etwas Helles durch die Luft auf mich zuschießen. Im ersten Moment glaubte ich, angegriffen zu werden, und bereitete rasch einen Schutzzauber vor. Doch dann erkannte ich einen Superior, der dicht unter mir vorbeiflog und im Innenhof des Gehöfts landete.
Superiors waren eine Art Superhelden, die aufgrund gentechnischer Modifizierungen und einer überlegenen technischen Ausstattung normalen Menschen weit überlegen waren. Sie konnten mit ihren Hightech-Rüstungen fliegen und waren exzellente Nah- und Fernkämpfer. Allerdings half ihnen das nur auf der Erde, denn in Infernia funktionierte Elektronik nicht. Im Unterschied zu den regulären Soldaten der Vereinigten Europäischen Streitkräfte waren Superiors keine NPCs, also computergesteuerte Figuren, sondern wurden von menschlichen Spielern gesteuert.
Wollte mir dieser Typ etwa die Beute wegschnappen? Zwar hatte ich die Mission ergattert, aber das bedeutete nicht, dass ein anderer Spieler nicht eingreifen konnte, wenn er mich heimlich beobachtete oder auf andere Weise mitbekam, dass es etwas Wertvolles zu holen gab. Ebenso war es möglich, dass der Superior bloß die Konzentration der Monster um dieses Gehöft bemerkt und beschlossen hatte nachzusehen, was der Grund dafür war.
Aus meiner sicheren Position beobachtete ich, wie er mit seinem Schwert um sich schlug und die Untoten, die sich auf ihn stürzten, in kurzer Zeit niedermachte. Als eine weitere Horde der Monster in den Innenhof drängte, löste er ein kurzes Rohr von seiner Hüfte, das über einen Schlauch mit einem Kanister auf seinem Rücken verbunden war. Eine Stichflamme schoss daraus hervor und setzte die Monster in Flammen, die daraufhin mit stöhnenden Lauten zu Boden sackten. Die Lederschwingen, die immer noch in der Luft kreisten, schienen zu spüren, dass sie diesem Gegner nicht gewachsen waren, und hielten Distanz.
Jetzt ärgerte ich mich, dass ich so lange gezögert hatte. Dadurch, dass der Superior zuerst gelandet war, hatte er die meisten Erfahrungspunkte eingeheimst, die man durch das Vernichten der Inferim bekommen konnte. Außerdem war ich es, die nun wie eine Trittbrettfahrerin aussah, die die Beute an sich reißen wollte, nachdem er die ganze Drecksarbeit gemacht hatte. Dabei war es ja eigentlich meine Mission.
Ein Kristall mit 1.024Ätherium-Einheiten war auf jeden Fall zu wertvoll, um ihn einfach so einem anderen Spieler zu überlassen. Immer noch unsichtbar, ließ ich mich herabsinken. Eine der Lederschwingen stieß beinahe mit mir zusammen, doch die Monster konnten mich nicht wahrnehmen, und so blieb ich unbehelligt.
Zögernd, mit den Waffen im Anschlag, kamen die Soldaten aus der Scheune. Es war ein armseliger Haufen. Die meisten von ihnen waren verletzt, ihre Arme, Beine oder Köpfe notdürftig verbunden. Manche konnten sich kaum auf den Beinen halten. Einer von ihnen umklammerte eine olivgrüne Metallkiste wie einen kostbaren Schatz. Darin musste sich der Kristall befinden.
»Danke, dass Sie uns geholfen haben, Sir!«, sagte der Mann mit der Kiste, wahrscheinlich der Anführer des kleinen Trupps. »Ich bin Leutnant Jero Kramer, 2. Aufklärungsdivision der Vereinigten Europäischen Streitkräfte.«
»Kein Problem«, erwiderte der Superior. »Was macht ihr hier draußen mitten im Inferim-Gebiet?«
»Wir haben den Auftrag, einen hochreinen Ätherium-Kristall zu bergen und ins Hauptquartier nach Lausanne zu bringen, Sir.«
»Wie rein ist dieser Kristall genau?«, fragte der Superior.
Ich erwartete die typische ausweichende Antwort, die die NPCs gaben, wenn sie etwas nicht verstanden, doch der Leutnant antwortete: »Ich weiß es nicht, Sir. Ich kenne mich mit Ätherium-Kristallen nicht aus.«
»Gib mir diesen Kristall!«
»Es tut mir leid, Sir. Meine Anweisung lautet, den Kristall ins Hauptquartier zu bringen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns dorthin begleiten würden – wir könnten Ihre Unterstützung gut gebrauchen. Aber ich darf Ihnen den Kristall nicht aushändigen.«
Der Superior hob drohend seinen Flammenwerfer.
»Ich sagte, gib mir diesen Kristall, du Wurm, oder ich grille euch alle!«
Die Soldaten schreckten zurück und hoben ihre Waffen. Es waren sieben Männer, doch gegen den Superior mit seiner kugelsicheren Nanokomposit-Rüstung hatten sie keine Chance.
»Es tut mir leid, Sir«, erwiderte der Leutnant. »Es ist von höchster strategischer Bedeutung, dass dieser Kristall ins Hauptquartier nach Lausanne gebracht wird. Im Namen der Vereinigten Europäischen Streitkräfte bitte ich Sie, uns bei unserer Mission zu unterstützen. Schließlich stehen wir doch in diesem Krieg alle auf derselben Seite.«
Irgendwie tat er mir leid, obwohl ich wusste, dass er nur eine Computerspielfigur war. Aber er war nicht wie die anderen NPCs – er war eindeutig eloquenter und wirkte wesentlich intelligenter. Kurz überlegte ich, ob es sich vielleicht um einen menschlichen Spieler handeln könnte. Aber dann hätte er sich wohl kaum so unterwürfig verhalten.
»Zum letzten Mal, her mit dem Kristall, oder …«
Violette Blitze zuckten plötzlich im Innenhof und das glühende Oval eines Portals nach Infernia erschien. Eine drei Meter hohe, gehörnte Gestalt trat daraus hervor.
Die Männer eröffneten sofort das Feuer. Der Superior ließ eine gewaltige Stichflamme aus seinem Flammenwerfer schießen. Doch der Dämon wehrte die Kugeln und das Feuer mühelos mit einem Schutzschild ab. Dann schossen violette Blitze aus seiner ausgestreckten rechten Hand. Der Superior wurde durch die Luft geschleudert, prallte gegen die Scheunenwand und blieb reglos liegen.
Ein Dämonenlord! Nun war klar, warum die Mission mit mindestens Level 30 ausgeschrieben worden war.
Ich erwartete, dass die Soldaten die Flucht ergriffen, doch stattdessen feuerten sie weiter ihre nutzlosen Kugeln auf die gehörnte Gestalt. Der Dämon lachte nur, ließ weitere Blitze aus seinen Händen hervorschießen und traf damit zwei der Soldaten, die schreiend und mit rudernden Armen durch die Luft getragen wurden und dann in dem Portal verschwanden.
»Nein!«, schrie der Leutnant.
Er versuchte, eine weitere Salve abzufeuern, doch sein Gewehr streikte, wie es oft in der Nähe eines Portals geschah – Ätherium-Strahlung ließ komplizierte Technik häufig versagen, sodass ihre technische Überlegenheit den Menschen beim Kampf gegen die Inferim meist wenig nützte. Also warf der Truppführer die Waffe weg, zog ein Katana, ein schmales japanisches Schwert, aus der Scheide an seinem Gürtel und rannte damit auf den Dämon zu. Es war offensichtlich, dass er damit kaum etwas würde ausrichten können. Die Verzweiflungstat rührte mich, und so entschloss ich mich einzugreifen, auch wenn der Dämon dem Anschein nach mindestens fünf Level über meiner Zauberin lag.
Ich sprach einen Schutzzauber aus, der den Leutnant mit einem sanften goldenen Glühen umhüllte. Die violetten Blitze, die im selben Moment aus der Hand des Dämons zuckten, konnten ihm nichts anhaben. Doch die Aktion bewirkte, dass mein Unsichtbarkeitszauber gebrochen wurde.
Als die übrigen Soldaten mich sahen, jubelten sie, während der Leutnant mit seinem Katana nach dem Bein des Dämons hackte. Doch dieser wich ihm geschickt aus und streckte mit einem Blitz einen der anderen Soldaten nieder.
In diesem Moment stürzten sich wie auf Kommando die Lederschwingen herab, während der Trupp Gehörnter, den ich aus der Luft gesehen hatte, mit erhobenen Speeren in den Innenhof gerannt kam. Die Soldaten wehrten sich, so gut sie konnten, doch sie hatten gegen die Übermacht keine Chance. Ich konnte sie nicht alle beschützen und gleichzeitig den Dämonenlord in Schach halten. Ehe ich reagieren konnte, wurde der Leutnant von einem Speer durchbohrt, den einer der Gehörnten auf ihn geschleudert hatte. Ich tat das Einzige, was mir übrig blieb: Ich rannte zu ihm, öffnete ein Portal, packte ihn und zerrte ihn mit mir hindurch.
»He, du Feigling, bleib gefälligst hier und kämpfe!«, brüllte der Dämonenlord mir nach.
Erst in diesem Moment begriff ich, wer mein Gegner war.
3
Mit einem elektrischen Summen fuhr der klobige Helm des Simrigs langsam nach oben. Ich blinzelte ein paar Mal, um mich wieder an das Neonlicht des Kellerraums zu gewöhnen, und schnallte mich ab.
Ben kletterte im selben Moment aus dem zweiten Rig und grinste schief.
»Das kriegst du wieder!«, sagte er.
Seine Brauen waren zusammengezogen, die Stirn kraus, der Mund schmal. Er schien ernsthaft sauer zu sein, auch wenn er das mit seinem Grinsen zu überspielen versuchte.
»Tut mir leid«, erwiderte ich. »Ich konnte ja nicht wissen, dass du das warst. Ihr Dämonen seht für mich alle gleich aus.«
»Und wenn du es gewusst hättest, hättest du mir den Kristall dann etwa kampflos überlassen?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Aber ich hätte mir eine andere Mission ausgesucht.«
»Ich bin dir wohl nicht mal als Spielgegner gut genug«, grummelte er.
»Quatsch!«, erwiderte ich. »Aber ich will keinen Streit mit dir. Und außerdem ist dein Zardor zehn Level über meiner Rialis.«
Das schien ihn etwas zu besänftigen.
»Das war ziemlich feige von dir, einfach abzuhauen«, meinte er.
»Besser fünf Minuten feige als ein ganzes Leben lang tot«, erwiderte ich.
»Du bist doch eine Eterim«, entgegnete er. »Du kannst gar nicht sterben. Du hast dich bloß verdrückt, weil du den Kristall für dich haben wolltest.«
»Das auch«, gab ich zu.
Er runzelte die Stirn. »Was denn noch?«
»Dieser Soldat, der Truppführer«, erwiderte ich. »Er war irgendwie anders.«
»Anders? Was meinst du damit?«
»Ich weiß auch nicht genau. Er schien mir intelligenter zu sein als die anderen NPCs. Fast, als wäre er ein richtiger Mensch.«
»Blödsinn. Menschliche Spieler sind entweder Dämonen, Eterim oder Superiors, aber niemals einfache Soldaten.«
»Ich weiß. Trotzdem kam es mir so vor.«
»Du bist bloß auf die Tricks reingefallen, mit denen die Spielentwickler ihre Computerfiguren menschlicher wirken lassen. Was hast du eigentlich mit ihm gemacht?«
»Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht.«
»Ich meinte den Kristall.«
Ich schmunzelte. »Der ist in Sicherheit.«
»Wirklich schade, dass ich als Dämon nicht nach Eternia kann«, meinte er. »Ich würde dein kleines Schloss dem Erdboden gleichmachen.«
Schwang da etwa echter Zorn in seinen Worten mit?
»Hey, es ist bloß ein blöder Ätherium-Kristall«, versuchte ich ihn zu beschwichtigen.
»Ach ja? Dir schien er aber ziemlich wichtig zu sein. Statt fair mit mir darum zu kämpfen, bist du einfach abgehauen.«
»Seit wann interessiert sich ein Dämonenlord für Fairness?«, konterte ich.
Er blickte mich zornig an, schwieg jedoch.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Ich wollte dich nicht ärgern. Ich hab einfach nur versucht, meine Mission zu erfüllen.«
»In der Missionsbeschreibung stand, dass du möglichst viele Soldaten retten sollst?« Er lachte höhnisch. »Na, das hast du ja super hingekriegt!«
Das saß.
»Ich gehe jetzt wohl besser«, sagte ich.
»Ja, geh ruhig!«, erwiderte er.
Es wäre wahrscheinlich geschickter gewesen, noch zu bleiben und zu versuchen, den Streit irgendwie beizulegen. Doch Bens gehässige Bemerkung hatte mich zu sehr geärgert, um jetzt klein beizugeben. Also stapfte ich wütend aus dem Keller, holte meine Sachen aus seinem Zimmer und ging zur Haustür.
»Bis morgen!«, rief ich.
Ben, der immer noch im Keller war, antwortete nicht.
Auf dem Weg nach Hause beruhigte ich mich allmählich. Ben hatte sich den Nachmittag offensichtlich anders vorgestellt. Und dann hatte ich ihm auch noch den Ätherium-Kristall vor der Nase weggeschnappt. Kein Wunder, dass er sauer war. Na, er würde sich schon wieder einkriegen.
Doch etwas ging mir nicht mehr aus dem Kopf: die Art, wie der Truppführer verzweifelt geschrien und sich mit nichts als einem Schwert bewaffnet auf einen Dämonenlord gestürzt hatte. Ich hatte noch nie erlebt, dass sich ein NPC so verhielt.
Ben hatte wahrscheinlich recht: Das war sicher bloß ein Trick der Spielentwickler. Infernia wurde ständig weiterentwickelt und auch die künstliche Intelligenz, die die NPCs steuerte, lernte mit der Zeit dazu. Es war also ganz normal, dass sich das Verhalten der Spielfiguren mit der Zeit änderte. Ich verstand nicht viel von Computern, aber mir war klar, dass die NPCs keine echten Gefühle und keinen eigenen Willen haben konnten. Sie waren bloß Statisten in einem Film, die im Hintergrund agierten, während die menschlichen Spieler die Hauptrollen übernahmen.
Trotzdem war meine Neugier geweckt. Ich beschloss, mehr darüber herauszufinden.
Als ich eine halbe Stunde später die Tür unserer Wohnung aufschloss, kam mir der kleine Flur mit der schmalen Kommode unter dem Sicherungskasten und der Pinnwand voller alter Postkarten, Zetteln mit Telefonnummern und Visitenkarten noch enger vor als früher, aber der vertraute Geruch gab mir ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.
Meine Mutter hatte Spätschicht und würde nicht vor zehn nach Hause kommen. Ich hatte also genug Zeit. Sobald ich in unserer Wohnung war, setzte ich mich an den Computer und startete Infernia.
Mein Avatar befand sich in meinem Schloss in Eternia. Die olivgrüne Kiste stand auf einer altmodischen Kommode. Ich öffnete sie, betrachtete den Kristall darin, der ungewöhnlich groß und klar war. In seinem Inneren glomm ein violettes Feuer so hell, dass es mir im Simrig wahrscheinlich in den Augen wehgetan hätte. Doch auf dem Computermonitor war es nur ein grellvioletter Fleck. Ich nahm den Kristall heraus, wobei ich meine Hand mit der Computermaus steuerte. Im Rig hätte das enorme Gewicht meinen Arm nach unten gezogen – Ätherium-Kristalle waren schwerer als Blei. Eine Anzeige am unteren Rand des Displays zeigte an, dass er tatsächlich 1.024Ätherium-Einheiten enthielt. Damit würde ich etliche Einsätze bestreiten können. Andererseits war er viel zu wertvoll, um ihn für gewöhnliche Zauber zu verbrauchen.
Warum hatte die Armee einen Trupp in feindliches Gebiet geschickt, um diesen Kristall zu bergen? Nur die Superiors besaßen Technik, mit der sie die Ätherium-Energie nutzen konnten, für gewöhnliche Soldaten war er also nutzlos. Andererseits musste es ja gar keinen echten Grund geben – für das Missionsziel reichte es aus, dass ich die Wahl hatte, den Kristall ins Hauptquartier der Armee zu bringen und so mein Ansehen zu verbessern oder ihn für mich zu behalten.
Ich überlegte, was ich damit machen sollte. Mir kam der Gedanke, dass ich den Kristall Ben schenken könnte, um mich wieder mit ihm zu vertragen. Doch das erschien mir zu unterwürfig. Schließlich hatte ich ja nichts falsch gemacht, auch wenn ich ihn enttäuscht hatte. Den Kristall den menschlichen Streitkräften auszuliefern, erschien mir ebenfalls nicht besonders attraktiv. Zwar würde ich dafür einige Erfahrungspunkte einheimsen und bei zukünftigen Missionen mehr Unterstützung durch menschliche Soldaten erhalten, doch der Kristall erschien mir zu wertvoll, um ihn einfach so den NPCs zu geben.
Also beschloss ich, ihn bis auf Weiteres zu behalten, und legte ihn in die Kiste zurück. Dann benutzte ich die Energie eines gewöhnlichen Kristalls, um einen Zauber zu wirken, mit dem ich beliebige Orte beobachten konnte, an denen ich schon gewesen war.
Ich hatte den Soldaten in ein Militärkrankenhaus in Lausanne gebracht. Es dauerte eine Weile, bis ich ihn in dem Chaos fand, das dort herrschte. Blutüberströmte, stöhnende Verwundete auf den Gängen und dazwischen herumeilende Pfleger und Ärzte vermittelten ein erschreckend realistisches Bild der Gräuel des Krieges. Mir kam der Gedanke, die Szenerie meiner Mutter zu zeigen. Sie ist Krankenpflegerin, aber sie würde mir wahrscheinlich bloß erklären, was alles daran in einem realen Krankenhaus so nie passieren würde, und mir einen Vortrag darüber halten, warum ich mich lieber mit der Realität beschäftigen sollte statt mit einem Spiel.
Leutnant Jero Kramer lag in einem überfüllten Krankenzimmer. Man hatte ihm den Speer entfernt, der noch in seiner Brust steckte, als ich ihn hergebracht hatte, und die Wunde verbunden, doch er war kreidebleich – auch das war fast ein wenig zu viel Realismus für meinen Geschmack. Ein Mann und eine Frau in Militäruniform standen an seinem Bett.
»… öffnete sich plötzlich ein Portal und ein Dämonenlord trat heraus«, berichtete er gerade mit keuchender Stimme.
»Ein Dämonenlord?«, schaltete sich der Offizier ein. »Dann muss dieser Kristall so mächtig sein, wie wir vermutet haben.«
»Wo … sind die anderen?«, fragte der Leutnant.
»Wie es aussieht, sind Sie der einzige Überlebende.«
»Der … einzige?« Der Mann auf dem Krankenbett schien in sich zusammenzusinken. Ich konnte nicht anders, als Mitleid mit ihm zu empfinden.
»Wie … bin ich hierhergekommen?«, fragte der Leutnant.
»Sagen Sie’s mir«, erwiderte die Frau. In ihrer Stimme schien Misstrauen zu liegen. »Sie wären nicht der Erste, der angesichts der Inferim die Nerven verliert und die Flucht ergreift, Leutnant Kramer. Glauben Sie mir, ich hätte volles Verständnis dafür. Die Inferim sind nicht wie menschliche Gegner. Sie sind grausam, unersättlich und furchtlos, von ihrer schrecklichen Erscheinung ganz abgesehen. Ich versichere Ihnen, Sie haben keine disziplinarischen Maßnahmen zu befürchten. Aber Sie müssen uns die Wahrheit sagen!«
Der Leutnant schloss die Augen und sein Gesicht verzog sich. Ob vor Schmerz oder vor Zorn, ließ sich nicht feststellen.
»Ich bin nicht geflohen!«, stieß er hervor. »Ich habe meinen Trupp durch meine Überheblichkeit in den Tod geführt, das stimmt. Aber ich hätte die Kameraden niemals im Stich gelassen! Ich hätte mein Leben für jeden von ihnen gegeben, das müssen Sie mir glauben! Ich habe versucht, den Dämon anzugreifen, doch gegen seine Zaubermacht hatte ich keine Chance. Er hätte mich mit Leichtigkeit getötet, wenn nicht plötzlich eine Eterim erschienen wäre. Sie hat mich beschützt, doch dann wurde ich von einem Speer getroffen und bin ohnmächtig geworden. Mehr weiß ich wirklich nicht.«
»Ich kenne Leutnant Kramer gut genug und kann für seine Loyalität und Tapferkeit bürgen«, schaltete sich der Offizier ein.
»Dieser verdammte Krieg kann auch den loyalsten und tapfersten Soldaten brechen, Oberst Cantley«, widersprach die Frau. »Wir wissen beide nicht, was genau passiert ist, aber Leutnant Kramers Geschichte klingt mir doch ein bisschen unwahrscheinlich. Erst dieser Superior, der unseren Leuten angeblich den Kristall stehlen wollte, dann noch ein Dämonenlord und eine Eterim …«
»Wenn dieser Kristall wirklich so mächtig ist, dann ist das doch kein Wunder«, wandte der Offizier ein. »Ich werde den Orden der Superiors offiziell um eine Stellungnahme bitten. Vielleicht bestätigen sie uns den Vorfall.«
»Was soll das bringen?«, entgegnete die Offizierin. »Der Kristall ist verloren. Entweder hat ihn der Dämonenlord, dann stehe Gott uns bei. Oder, wenn wirklich eine Eterim in die Auseinandersetzung verwickelt war, dann hat sie ihn vielleicht. Das wäre immerhin etwas, aber freiwillig herausgeben wird sie ihn vermutlich nicht und wir haben keine Möglichkeit, ihn ihr wegzunehmen. So oder so können wir nichts mehr tun. Es war ein Fehler, nur einen schlecht bewaffneten Aufklärungstrupp in das Kriegsgebiet zu schicken, um den Kristall zu bergen.«
»Was hätte ich denn tun sollen?«, verteidigte sich der Oberst. »Wir hatten nun mal keine Zeit, einen größeren Kampfeinsatz vorzubereiten, und wie Sie sehr wohl wissen, sind die meisten unserer Truppen am Tor gebunden, um die Inferim-Horden zurückzuschlagen.«
»Das diskutieren wir besser im Hauptquartier«, erwiderte die Frau. »Danke für Ihren Bericht, Leutnant. Ich wünsche Ihnen gute Genesung.«
»Es tut mir leid, dass ich Sie und Ihre Männer in diesen Einsatz geschickt habe, Jero«, sagte der Oberst. »Glauben Sie mir, wenn ich eine Wahl gehabt hätte, dann hätte ich es nicht getan. Aber dieser Kristall ist einfach zu wichtig. Vielleicht haben wir ja Glück und die Eterim hat ihn wirklich in Sicherheit gebracht.«
»Mir tut es leid, Sir«, erwiderte der Leutnant. »Ich … ich habe schon wieder versagt.«
»Unsinn! Sie haben getan, was Sie konnten«, widersprach der Oberst. »Gegen einen Dämonenlord hatten Sie keine Chance.« Er seufzte. »Oberst Heckel hat recht, ich hätte Sie und Ihre Männer dieser Gefahr nicht aussetzen dürfen. Die Verluste gehen auf meine Kappe, nicht auf Ihre.«
Die Szene war anrührend, aber ich fragte mich, warum ich sie überhaupt sah. Sie musste Teil der Mission sein, die ich angenommen hatte, doch die war eigentlich längst erfüllt und es war Zufall, dass ich überhaupt den Fernsicht-Zauber gewirkt und etwas davon mitbekommen hatte.
Ich beschloss, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Nachdem die beiden Offiziere gegangen waren, öffnete ich ein Portal und trat an das Krankenbett des Soldaten. Er sah mich mit geweiteten Augen an, als könne er nicht glauben, was er sah.
4
Ich öffnete das Magiemenü, wählte einen Heilzauber aus und bestätigte die dafür erforderliche Ätherium-Energie. Auf dem Bildschirm sah ich, wie sich mein Avatar dem Soldaten näherte und die Hände auf dessen Kopf und Brust legte. Die künstliche Intelligenz des Spiels sorgte dafür, dass sich die Eterim-Zauberin Rialis im Spiel ganz natürlich verhielt, auch wenn ich nicht jede einzelne Bewegung kontrollierte. Über die Kamera meines Monitors wurde sogar meine Mimik auf den Avatar übertragen.
Meine virtuellen Hände verbreiteten ein Leuchten, das den ganzen Körper des Leutnants einhüllte. Er riss die Augen auf.
»Was …«, stieß er hervor. Dann setzte er sich auf, betastete verwundert seine Brust.
»Ist das hier ein Traum?«, fragte er.
»Nein«, gab ich über mein Headset zurück. »Ich habe dich tatsächlich geheilt.«
Ich blickte mich in dem Raum um, doch die anderen Verwundeten lagen nur apathisch da. Keine neidvollen Blicke oder verzweifelten Hilferufe kamen von ihnen. Sie reagierten überhaupt nicht auf mich.
Statt sich über seine wundersame Heilung zu freuen oder wenigstens Danke zu sagen, sackte der Leutnant in sich zusammen.
»Ich … ich habe das nicht verdient, Eterim«, stöhnte er. »Meine Kameraden sind gefallen oder wurden nach Infernia verschleppt, was noch schlimmer ist als der Tod. Ich wünschte, ich wäre an ihrer Stelle.«
Am liebsten hätte ich ihn in den Arm genommen und getröstet, so real wirkte seine Verzweiflung.
»Es tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte«, sagte ich.
Der Leutnant barg das Gesicht in den Händen. »Oh mein Gott!«, schluchzte er. »Oh mein Gott! Das ist alles meine Schuld!«
»Nein, das ist es nicht«, widersprach ich. »Ich kenne diesen Dämonenlord. Er heißt Zardor und ist sehr mächtig. Ihr hattet keine Chance gegen ihn. Wenigstens konnte ich ihm den Kristall vor der Nase wegschnappen.«
Auf dem Gesicht des Leutnants zeigte sich Hoffnung.
»Das … das heißt, Sie haben den Kristall?«
»Ja. Ich habe ihn nach Eternia in Sicherheit gebracht.«
»Dann war unser Opfer wenigstens nicht ganz umsonst. Ich danke Ihnen, Eterim. Natürlich auch dafür, dass Sie mich geheilt haben. Ich werde sofort wieder in den Kampf ziehen und versuchen, meinen Fehler gutzumachen.«
Na, das war jetzt doch übertrieben. Dass er nach allem, was er erlebt haben musste, sofort wieder kämpfen wollte, erschien mir unrealistisch. Ganz perfekt war die Simulation menschlichen Verhaltens also nicht.
»Ich heiße Rialis«, sagte ich.
»Leutnant Jero Kramer.«
Er streckte die Hand aus und mit einem Mausklick sorgte ich dafür, dass mein Avatar sie ergriff.
»Ich danke Ihnen nochmals im Namen der Vereinten Europäischen Streitkräfte für Ihr Eingreifen«, sagte er. »Ich mag mir gar nicht vorstellen, was geschehen wäre, wenn der Kristall in die Hände der Inferim gefallen wäre.«
Wahrscheinlich gar nichts, lag es mir auf der Zunge. Ob Ben oder ich den Kristall erbeutet hatten, spielte in dem niemals endenden Krieg zwischen Menschen und Eterim auf der einen und Inferim auf der anderen Seite keine große Rolle. Die Spielentwickler würden dafür sorgen, dass keine Partei jemals einen entscheidenden Vorteil erzielen konnte, denn sonst wäre das Spiel zu Ende. Aber das einer Spielfigur zu erklären, war natürlich sinnlos.
»Verliere nicht die Hoffnung, Jero«, sagte ich und ärgerte mich im selben Moment über diese hohle Floskel. Als ob ein NPC Hoffnung haben konnte!
Doch er blickte meinen Avatar an, als berührten ihn die Worte tatsächlich.
»Bitte halten Sie mich nicht für undankbar, Eterim«, sagte er zögernd. »Aber Sie können doch ein Portal nach Infernia öffnen, oder?«
Ich runzelte die Stirn. »Warum fragst du das?«
»Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wenn Sie mich dorthin bringen könnten … vielleicht könnte ich etwas tun, um Falk Hartmann … um meinen Kameraden zu helfen, die dorthin verschleppt wurden.«
Entgeistert starrte ich auf den Monitor. Echt jetzt?
»Du würdest in Infernia keine zehn Minuten überleben«, stellte ich fest.
Er nickte. »Ich weiß. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber bei dem Versuch sterben, meine Kameraden zu befreien, als mit dem Wissen zu leben, dass sie dort ewige Qualen erleiden und ich daran schuld bin.« In seinen Augen lag ein Flehen. »Bitte, Rialis! Bitte, geben Sie mir diese Chance! Ich weiß, ich habe kein Recht, das zu verlangen, aber …«
Wieder wurde es eng in meiner Brust, auch wenn ich wusste, dass der NPC die Verzweiflung, die in seiner Stimme zu liegen schien, nicht wirklich empfinden konnte.
Plötzlich wurde mir klar, dass meine Mission noch nicht zu Ende war. Rette möglichst viele Soldaten und berge den Kristall, hatte das Missionsziel gelautet. Ich hatte den Kristall in Sicherheit gebracht, doch zwei Soldaten waren noch am Leben und in der Hand des Feindes.
Bens gehässiges Lachen erklang in meiner Erinnerung. Er hatte versucht, mir das Gefühl zu geben, versagt zu haben. Dabei hatte er genau gewusst, dass die Mission noch nicht abgeschlossen war.
In Zardors Palast einzudringen und zwei Gefangene zu befreien, war keine Kleinigkeit. Andererseits war die Gelegenheit gerade günstig. In der Statusanzeige konnte ich sehen, dass Ben nicht im Spiel eingeloggt war, und mit den gewöhnlichen Inferim würde ich schon fertigwerden, wenn ich vorsichtig war.
»Na schön«, sagte ich. »Ich helfe dir. Aber ich kann nicht versprechen, dass es uns gelingt, deine beiden Kameraden zu finden. Zardors Palast ist riesig.«
Er starrte mich, wie es schien, ungläubig an. »Ich … ich kann nicht verlangen, dass Sie mich begleiten, Eterim.«
»Wenn wir schon gemeinsam in die Schlacht ziehen, solltest du mich einfach Rialis nennen.«
»Ich kann nicht von … von dir verlangen, dass … du mich begleitest«, stotterte er. »Setz mich einfach nur dort ab, ich finde schon einen Weg.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ohne mich hast du keine Chance. Außerdem, wie willst du deine Kameraden allein wieder zurück auf die Erde bringen?«
Er starrte mich einen Moment lang sprachlos an. Tränen glitzerten in seinen Augen.
»Danke!«, brachte er schließlich heraus.
5
Mit ein paar Mausklicks öffnete ich ein Portal nach Infernia. Ich entschied mich, nicht direkt in Zardors Palast zu teleportieren. Die Gefahr war zu groß, dort von schwer bewaffneten Inferim überrascht zu werden. Stattdessen wählte ich als Ziel eine Höhle in einer Bergflanke unweit des Palasts. Jero zog sich rasch Jacke und Stiefel an und griff sich ein Katana, das neben dem Nachbarbett an der Wand lehnte. Sein Besitzer lag nur apathisch da und starrte an die Decke.
Nachdem wir durch das Portal getreten waren, ließ ich eine leuchtende Kugel über der ausgestreckten Hand meines Avatars erscheinen. Ein schmaler Spalt führte zu einem finsteren Gang.
»Sind wir … wirklich in Infernia?«, fragte Jero. Er klang verunsichert und ein wenig misstrauisch.
»Ja«, antwortete ich nur.
»Sie … ich meine, du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich könnte meines Lebens nicht mehr froh werden, wenn ich nicht wenigstens versuchen würde, Falk Hartmann zu retten.«
Ich ersparte mir den Hinweis, dass dieses Leben womöglich nicht mehr besonders lang andauerte, wenn wir uns in Zardors Festung wagten. Davon abgesehen hatte ein NPC natürlich kein Leben außerhalb des Spiels. Doch er hatte den Namen Falk Hartmann bereits zweimal erwähnt – dieser Soldat schien ihm besonders wichtig zu sein. Vielleicht verbarg sich in der Hintergrundgeschichte irgendein Hinweis, der noch wichtig für die Mission werden konnte.
Also fragte ich nach: »Wer ist dieser Falk Hartmann?«
»Feldwebel Falk Hartmann hat mir das Leben gerettet«, erzählte er. »Wir waren auf einer Routinepatrouille. Da war diese alte Lagerhalle in der Nähe des Flughafens von Lausanne, weit außerhalb des Feindgebiets. Ich hätte nicht damit rechnen können, dass die Inferim uns dort eine Falle stellen würden, hat man mir hinterher gesagt. Aber das stimmt nicht. Im Krieg gegen die Höllenbrut muss man mit allem rechnen, jederzeit, das haben sie mir in der Grundausbildung immer wieder eingebläut. Ich habe es nur nicht ernst genug genommen, war unaufmerksam, habe den feinen Verwesungsgeruch, der aus der Lagerhalle drang, erst zu spät bemerkt.«
Er stockte, als fiele es ihm schwer, sich daran zu erinnern.





























