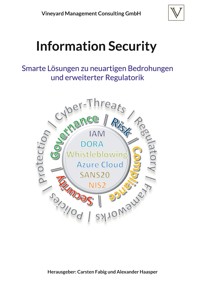Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neue Technologien veränderten und verändern weiter die Welt - und das in den letzten Dekaden mit stetig wachsender Reichweite und Dynamik. Umso mehr braucht es für eine erfolgreiche Anwendung neuer Technologien in Unternehmen aus Sicht der Herausgeber eine ganzheitliche Beratung und Begleitung der Veränderungen. So können entsprechend smarte Lösungen entstehen. Nur für die jeweilige Organisation maßgeschneiderte Ansätze bzgl. der Vorgehensweise, Design und Umsetzungsbegleitung der Lösung werden beste Aussichten auf Erfolg haben und damit die Nachhaltigkeit in der jeweiligen Unternehmung entsprechend unterstützen. Nachdem nun zuletzt maßgeblich über mehr als ein Jahrzehnt die Cloud-und-Cyber-Lösungen Einzug in die Unternehmen gehalten haben und deren Integration quer über alle Branchen weiter voranschreitet, stehen nun seit gut zwei Jahren die ersten wirklich in der bereiten Unternehmenspraxis nutzbaren KI-Lösungen und Plattformen zur Verfügung. Mit der abzusehenden weiteren Praxistauglichkeit von Quanten-Computing in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich der Trend zu mehr und nahezu absolut verlässlicher KI auch im Bereich höchst komplexer Optimierungsprobleme noch weiter verstärken bzw. solche Lösungen in der Breite erst ermöglichen. Das Buch bietet in verschiedenen Artikeln ein Überblick über smarte Lösungen zu neuen Technologien, u.a. bei der Umsetzung von KI-Vorhaben, der Nutzung von ChatGPT im Unternehmen, der Einführung von DevSecOps oder Verhaltensbiometrie, die Nutzung von Cloud-Services oder die Besonderheiten von Regulatorik bei den aktuellen Herausforderungen im Energiesektor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vineyard Management Consulting GmbH
Die Vineyard Management Consulting ist eine erfahrene Managementberatung mit dem Fokus auf:
der Begleitung von Veränderungen
dem Management von Komplexität
der Optimierung von Projekten
der Vernetzung von Menschen
In zahlreichen, globalen Projekten in den Branchen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automobilsektor sowie Information Technology haben wir stetig unsere Expertise und Kompetenz ausgebaut. Jeder unserer Managementberater hat erwiesene Berufs- und Projekterfahrung (mindestens 10 Jahre) und entwickelt sich kontinuierlich weiter. In der erfolgreichen Umsetzung unserer Projekte legen wir Wert auf soziales Gespür, interkulturelle Besonderheiten und wertschätzende, zielgerichtete Kommunikation.
Unsere Kernkompetenzen sind
Transformation Management umfasst in unseren Projekten die Strategie-definition, Umsetzungsplanung und vor allem die Etablierung von nachhaltigen Veränderungen im Unternehmensumfeld
Complexity Management bedeutet für unsere Management Berater die Fähigkeit, komplexe Strukturen, Prozesse und IT-Systeme zu analysieren, zu bewerten und zu verändern (z.B. bei der Herstellung der IT-Compliance im Bereich der Information Security gem. ISO27001, SANS20, BAIT).
People Management ist für unsere Berater eine oftmals implizit in Projekten geforderte Kompetenz – die Weiterentwicklung von Menschen und Gruppen im Sinne eines werteorientierten Coachings
Projektmanagement sind für uns die wesentlichen Schlüsselkompetenzen für das nachhaltige und zielgerichtete Umsetzen von größeren Vorhaben im Unternehmen.
Dazu bedarf es sowohl langjähriger Erfahrungen und klassischer Standard-Techniken (z.B. PMI, GPMA oder Prince2) als auch der frühzeitigen Vernetzung von branchenspezifischem Wissen, Deliverables und Menschen.
Vorwort der Herausgeber
Neue Technologien veränderten und verändern weiter die Welt - und das in den letzten Dekaden mit stetig wachsender Reichweite und Dynamik. Umso mehr braucht es für eine erfolgreiche Anwendung neuer Technologien in Unternehmen aus Sicht der Herausgeber eine ganzheitliche Beratung und Begleitung der Veränderungen. So können entsprechend smarte Lösungen entstehen. Nur für die jeweilige Organisation maßgeschneiderte Ansätze bzgl. der Vorgehensweise, Design und Umsetzungsbegleitung der Lösung werden beste Aussichten auf Erfolg haben und damit die Nachhaltigkeit in der jeweiligen Unternehmung entsprechend unterstützen.
Nachdem nun zuletzt maßgeblich über mehr als ein Jahrzehnt die Cloud-und-Cyber-Lösungen Einzug in die Unternehmen gehalten haben und deren Integration quer über alle Branchen weiter voranschreitet, stehen nun seit gut zwei Jahren die ersten wirklich in der bereiten Unternehmenspraxis nutzbaren KI-Lösungen und Plattformen zur Verfügung. Mit der abzusehenden weiteren Praxistauglichkeit von Quanten-Computing in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich der Trend zu mehr und nahezu absolut verlässlicher KI auch im Bereich höchst komplexer Optimierungsprobleme noch weiter verstärken bzw. solche Lösungen in der Breite erst ermöglichen.
In diesem Buch startet der erste Beitrag direkt mit dem Thema „Planung, Gestaltung und Integration von KI-Vorhaben“. Dabei wird ausgehend vom 9-Phasen Managementmodell TOGAF® und den Besonderheiten von KI-Vorhaben ein ganzheitliches Vorgehensmodell für die Integration neuer Produkte und Services abgeleitet, welches eine nahtlose Integration in die Unternehmensarchitektur unterstützt. Ein an den Anforderungen ausgerichteter Gesamtansatz, Komponentenorientierung „Composable Architecture“ und die Auswahl geeigneter Lernverfahren für spezifische Aufgabenstellungen stehen dabei im Mittelpunkt der vorgestellten Lösungsansätze.
Der nächste Beitrag geht auf den Einsatz von Conversational Agents in Unternehmen ein. Diese haben bereits lange vor ChatGPT&Co angefangen mit ELIZA (1966) eine recht lange Geschichte, entfalten aber jetzt mit den Möglichkeiten der generativen KI und LLM (Large Language Models) erst ihre volle Wirkung bzw. Nutzugsmöglichkeiten und täuschend echte Umsetzung, die vom Menschen kaum noch zu unterscheiden ist. Hierzu werden die erforderlichen Lernprozesse sowie der Umgang mit generellen Risiken zum Einsatz solcher Agents im Unternehmen genauer beleuchtet.
„DevSecOps“ ist ein Trend, der DevOps konsequent im Rahmen einer integrierten und möglichst automatisierten Fortsetzung weiter für IT-Security fortschreibt. Dazu werden in diesem Beitrag die entsprechenden Erweiterungen des Modells vorgestellt und eine exemplarische Umsetzung mit ihrem Nutzen für die Organisation vorgestellt.
„Verhaltensbiometrie in der Finanzsicherheit“ ist ein Beitrag, der den Einsatz von KI mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen bzw. Risiken im Rahmen der Authentifizierung von Benutzern und Erkennung von Anomalien im Verhalten bei Finanztransaktionen mit den jeweiligen Anwendungen genauer unter die Lupe nimmt.
Der aktuelle Stand zur Einführung von Cloud-Lösungen und ein Überblick über die Lösungen der im Markt führenden großen drei Anbieter sowie die typischen Herausforderungen und Risiken bei der Einführung stehen im Mittelpunkt des Beitrags zu smarten Cloud-Lösungen.
Abschließend geht es um den im großen Umwälzungsprozess zu erneuerbaren Energien befindlichen Energiesektor. Dazu werden die besonderen physikalischen und regulatorischen Anforderungen betrachtet mit ihren maßgeblichen Implikationen auf die IT-Anwendungslandschaft und ihren spezifischen Handlungsfeldern zu neuen Technologien. Diese ergeben sich für diese Unternehmen aufgrund der größtenteils als kritisch einzustufenden Infrastruktur und stark datengetriebenen neuen Welt. Die gesamte Umsetzung der typischen Digitalisierungsstrategien im Energiesektor ist vor diesem Hintergrund besonders umfangreich, oftmals nur KI-basiert zu lösen, damit hochkomplex und somit mit den bisherigen Mitteln insb. bezüglich Know-how, bisherigen Dienstleistern und Mitarbeitern allein nicht zu stemmen.
Zusammenfassend ist es nach unserer Einschätzung wichtiger als jemals zuvor für alle Unternehmen, den Überblick über die Möglichkeiten der neuen Technologien, den Fokus bei der Anwendung und die damit einhergehenden Risiken nicht zu verlieren. Erfolgsversprechend sind maßgeschneiderte smarte Lösungen, die helfen, in dynamischen Märkten den nachhaltigen Erfolg dauerhaft zu ermöglichen und auch entsprechend skalierbar, integrierbar und beherrschbar bleiben.
Wir danken allen Autoren für ihre jeweiligen Beiträge und wünschen Ihnen interessante Impulse und neue Ideen bei der Lektüre! Wir freuen uns auf Feedback und Anregungen. Nehmen Sie bei weiterem Interesse sehr gern Kontakt mit uns auf!
Hofheim/Taunus, November 2024
Carsten Fabig Alexander HaasperManaging Director and Management Consultants of Vineyard Management Consulting GmbH
Inhaltsverzeichnis
I. Planung, Gestaltung und Integration von KI-Vorhaben
1 Besonderheiten bei der Entwicklung von KI-Produkten und Services
2 Lösungsansätze zur Planung, Gestaltung und Integration
3 Vorgehensmodell und Rahmenwerk
Vita: Holger Laukamp
II. ChatGPT & Co - Conversational Agents in der Unternehmenspraxis
1 Allgemeine Funktionsweise von Conversational Agents
2 Chronologie von Conversational Agents - Von ELIZA bis ChatGPT
3 Einsatzgebiete von Conversational Agents im Unternehmenskontext
4 Risiken und Risikoreduktion beim Einsatz
5 Ausblick
Vita: Laura Beckervordersandforth
III. Integration von DevSecOps in Unternehmensstrukturen, vorhandene Technologien und Prozesse
1 DevSecOps-Methodik
2 DevSecOps in der Praxis
3 Fallbeispiel CI/CD-Pipeline
4 Ausblick
Vita: Dominik Stens
IV. Verhaltensbiometrie in der Finanzsicherheit: Ein neurowissenschaftlicher Ansatz
1 Einführung in die Verhaltensbiometrie
2 Neurowissenschaftliche Grundlagen
3 Anwendung in Bereich Finanzdienstleistungen
4 Herausforderungen und ethische Aspekte
5 Internationale Unterschiede bei der Implementierung von Verhaltensbiometrie
6 Zukunftsperspektiven und Innovationen
7 Einführung von Verhaltensbiometrie in der Finanzindustrie: Fallbeispiele und Entwicklungen
Vita: Laura Dinis
V. Cloud-Plattformen für die Industrie
1 Arten von Cloud Lösungen
2 Die größten Cloud Anbieter in Deutschland
3 Cloud Einsatz in der deutschen Industrie
4 Cloud Einführung in der deutschen Finanzindustrie
5 Die transformative Wirkung der Cloud
Vita: Mihail Petkov
Vita: Yoan Petrov
VI. Spannungsfeld Regulatorik in der Energiewirtschaft
1 Aktuelle Herausforderungen in der Energiewirtschaft
2 Regulatorische Anforderungen für den EVU-Sektor
3 Kritische Handlungsfelder für Energieversorger
Vita: Carsten Fabig
Vita: Olaf Remmler
VIII. Literatur
Disclaimer:
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autoren noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.
In diesem Buch werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.
Vineyard Management Consulting setzt sich für die Gleichbehandlung aller Geschlechter ein. Soweit in unseren Artikeln das generische Maskulin verwendet wird, geschieht dies ausschließlich aus Gründen der Vereinfachung der Lesbarkeit. Eine Wertung ist hiermit ausdrücklich nicht verbunden.
I. Planung, Gestaltung und Integration von KI-Vorhaben
Der Begriff "Künstliche Intelligenz“ (KI) bezeichnet einen Teilbereich der Informatik. Die Nachahmung menschlicher kognitiver Fähigkeiten erfolgt durch die Erkennung und Sortierung von Informationen aus den Eingabedaten. Diese Intelligenz kann auf programmierten Prozessen basieren oder durch maschinelles Lernen erzeugt werden [1].
Es wird prognostiziert, dass Unternehmen in den kommenden Jahren eine verstärkte Fokussierung auf KI-Technologien aufweisen werden, um eine Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, datengestützte Entscheidungsfindungen sowie die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu erreichen.
Die Fortschritte im Bereich der KI-Technologie zielen darauf ab, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Wachstumschancen zu identifizieren. [2] In einer aktuellen Studie, dem sogenannten Impact Radar 2024, postuliert das Marktforschungsunternehmen Gartner eine "Produktivitätsrevolution" auf Basis von GenAI, welche die Arbeitswelt von Unternehmen grundlegend verändern könnte. [3]
Die Vorhaben zur Einführung oder Umsetzung von Künstlicher Intelligenz (KI) sind jedoch in der Regel von hoher Komplexität geprägt, erfordern interdisziplinäre Teams und stellen für viele Unternehmen derzeit noch Neuland oder zumindest keine einstudierte Praxis dar. Die Herausforderungen, die sich aus den Eigenschaften von KI-basierten Ideen ergeben, sind vielfältig. Technische und organisatorische Herausforderungen treffen aufeinander, wobei zudem Unklarheiten in der Vorgehensweise von der Idee bis zum Betrieb bestehen. [4]
Die Leistungsfähigkeit der technischen Systemlandschaft, die zu verwendende Datenqualität, die Modellentwicklung für die KI sowie eine zukünftige Skalierbarkeit lassen sich im Vorfeld oft nur schwer abschätzen, was verlässliche Aussagen über Sicherheit, Zuverlässigkeit und letztlich den Mehrwert erschwert. Des Weiteren sind die Integration der KI in die bestehende IT-Landschaft und damit in die Geschäftsprozesse, der Datenschutz einschließlich der Sicherheitsanforderungen sowie grundsätzliche ethische Fragen zu klären.
Die erfolgreiche Umsetzung von KI-Projekten, insbesondere in anspruchsvollen Anwendungsbereichen wie dem Bankenumfeld, der industriellen Produktion oder der Energiewirtschaft, stellt Unternehmen vor eine Herausforderung. Es ergibt sich die Frage, wie Unternehmen KI-Projekte in diesen Bereichen zum Erfolg führen können. Die effektive und effiziente Integration KI-basierter Logiken in bestehende oder neue Anwendungen erfordert ein systematisches Vorgehen. Die gängigen Vorgehens-modelle im Projektmanagement und im Engineering von innovativen Anwendungen sind für die Bewältigung komplexer technischer Systeme konzipiert. Der Einsatz von KI und ML bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich, auf die ein dediziertes Vorgehensmodell explizit eingehen sollte. [5]
Die folgenden Überlegungen verfolgen das Ziel, Vorhaben zur Einführung von Künstlicher Intelligenz in einer systematischen Weise besser planbar, gestaltbar und integrierbar zu machen.
Zur Erarbeitung einer Systematik wird zunächst ein Überblick über die Besonderheiten von KI-Vorhaben gegeben, aus denen Anforderungen an die Initiierung und Steuerung abgeleitet werden. Im Anschluss werden Lösungsansätze vorgestellt, welche als Grundlage zum Management dienen können. Abschließend erfolgt die Ableitung eines Gesamtrahmenwerks:
Abb. 1: Methodik zur Problemlösung
1 Besonderheiten bei der Entwicklung von KI-Produkten und Services
Die Entwicklung komplexer technischer Systeme erfolgt unter Zuhilfenahme von Vorgehensmodellen, welche ihren Ursprung in der Softwareentwicklung finden und auf Basis von Erfahrungen und Erkenntnissen eine Ergänzung bzw. Weiterentwicklung erfahren haben. Als Beispiele können das Wasserfallmodell, das V-Modell sowie Scrum genannt werden. In Abhängigkeit von den organisationalen Rahmenbedingungen im Unternehmen sowie dem spezifischen Anwendungskontext kann und sollte eine situative Auswahl und Anpassung der genannten Vorgehens-modelle erfolgen.
Bei der Auswahl einer geeigneten Methodik und Vorgehensweise für die Entwicklung von KI-basierten Produkten und Dienstleistungen sind drei Besonderheiten zu beachten, die in den Projekten Berücksichtigung finden sollten:
1. Systemischer Ansatz für die Initiierung und Steuerung
Die Entwicklung und Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) stellt ein komplexes Unterfangen dar, dessen Bewältigung über die reine technische Umsetzung, hinausgeht. In diesem Kontext erweist sich ein systemischer Ansatz als vorteilhaft, da er die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Komponenten und Akteuren adäquat berücksichtigt.
2. Agilität: Lernen durch iterative Prozesse und Verbesserungen
Häufig werden in Entwicklungsprojekten High-Level-Architekturen eines Systems beschrieben, ohne dass funktionale Aspekte durch prototypische Implementierungen getestet werden müssen. Dies wird durch Modellierung auf der Basis von physikalischen Modellen, Erfahrungswerten und Simulationen ermöglicht. Bei KI-Verfahren ist es jedoch aus folgenden Gründen schwieriger eine Zielarchitektur theoretisch oder aus Erfahrungswerten abzuschätzen:
Komplexität der KI-Modelle
: Moderne KI-Modelle, insbesondere Deep-Learning-Modelle, sind komplexe und nichtlineare Systeme. Ihre genaue Funktionsweise muss erst erprobt werden, was eine genaue Vorhersage der Leistung erschwert.
Datenabhängigkeit
: Die Leistung eines KI-Modells hängt stark von der Qualität und Quantität der Daten ab. Bereits kleine Änderungen in den Daten können zu signifikanten Unterschieden in den Ergebnissen führen.
Überanpassung
(Overfitting): Ein Modell kann sich zu stark an die Trainingsdaten anpassen und dadurch bei neuen, unbekannten Daten schlecht abschneiden.
Die genannten Aspekte können durch einen iterativen Ansatz, der zumindest im Entwicklungszyklus verankert werden sollte, gemanagt werden.
3. Datenbereitstellung und Maschine Learning Modellauswahl
KI-basierte Verfahren sind auf qualitativ hochwertigen Input angewiesen, um ihr eigenes Verhalten daraus zu lernen. Die Qualität der Ergebnisse ist unter anderem von der Qualität der Trainingsdaten für den vorgesehenen Anwendungsfall abhängig, wobei der Aufwand für die Datenerfassung und -bereitstellung bei KI-Projekten auf bis zu 80 Prozent geschätzt wird. [6]
In diesem Zusammenhang ergibt sich die Herausforderung, dass die bei der Entwicklung benötigten Daten möglichst bereits aus realen Daten der Anwendung oder des Systems stammen sollten, welches jedoch noch nicht fertiggestellt ist bzw. (oft im Greenfield) entwickelt werden soll. Als potenzielle Lösungsstrategien können folgende Optionen in Erwägung gezogen werden: [7]
Simulationen
: Daten werden durch Simulationen des technischen Systems gewonnen.
Messkampagnen
: Die Daten werden unter kontrollierten Bedingungen in dedizierten Messkampagnen und Versuchsreihen erzeugt, möglicherweise unter Bedingungen, die sich geringfügig vom Anwendungsfall unterscheiden (Laborbedingungen).
Gestaffelte Umsetzung
: Die Daten werden durch ein bereits bestehendes technisches System generiert, in das die KI integriert werden soll.
Externe Datenquellen
: Daten von externen Anbietern werden verwendet.
Datenquellen, v.a. deren Aktualität und Qualität müssen sowohl für die Entwicklung als auch für den zukünftigen Betrieb bereits während der Systementwicklung von Beginn an Berücksichtigung finden, was einen gemanagten Prozess erfordert. Im Rahmen eines Modellauswahlprozesses für maschinelles Lernen ist es von entscheidender Bedeutung, dasjenige Modell zu identifizieren, welches sich für die vorliegende Aufgabe am besten eignet. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass die Genauigkeit eines Modells zwar ein wesentlicher Aspekt ist, jedoch nicht der einzige. Von gleicher Relevanz sind die Eignung und die Einschränkungen des Modells für die spezifischen Anforderungen.
2 Lösungsansätze zur Planung, Gestaltung und Integration
Governance Framework und Composable Architecture
Die Kombination von Ansätzen, die sich durch effektive Governance-Prozesse sowie Flexibilität in der Entwicklung und Innovation auszeichnen, kann für KI-Projekte eine bedeutende Synergie darstellen. In diesem Kontext bietet der Managementprozess von TOGAF® mit seinen neun Phasen einen strukturierten Rahmen, innerhalb dessen KI-Initiativen nahtlos in die gesamte Unternehmensarchitektur eingebettet werden können:
Abb. 2: TOGAF® Architecture Development Method [8]
Die vier Enterprise-Architect-Bereiche (Vision, Business, Information System, Technology) werden innerhalb des Lifecycles bzw. im Durchlauf durch die Phasen entwickelt (vgl. nachfolgende Tabelle). Dadurch entsteht ein ausgewogenes Gesamtbild, das die Umsetzung unternehmerischer Innovationen systematisch und über diverse Perspektiven ermöglicht. Die Methode eignet sich auch zur Zusammenführung von parallellaufenden KI-Projekten zu einem gemeinsamen Target Operating Model, während gleichzeitig unternehmensspezifische Architektur-Repositories angereichert werden, die als Basis für künftige Vorhaben dienen können.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Einsatz von KI als Teil des Lösungsansatzes und nicht als Teil einer Anforderung zu verstehen ist. Darüber hinaus kann sich während des Durchlaufens der Phasen die Notwendigkeit ergeben, weitere Systeme oder Anwendungen hinzuzufügen. Ebenso können Bausteine wegfallen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Es ist daher üblich, dass der erste Architekturentwurf in der Regel nicht endgültig ist und im Laufe der Zeit verfeinert und aktualisiert wird.
Bei der Entscheidung für den Einsatz KI-basierter Services und Produkte ist in der Folge ebenfalls zu berücksichtigen, dass zukünftig auch Anforderungen aus gesetzlichen Regulierungen zu erfüllen sind. Insbesondere sind Dokumentationspflichten zu beachten, die sich aus konzeptionellen Entscheidungen bezüglich Verfahren zur Sicherstellung der Datenhoheit, Datenverwaltung, Datenerfassung und Datenaufbereitung sowie der Einführung eines Risikomanagementsystems ableiten.
Phase 1: Preliminary Phase
Zieldefinition
› Identifizierung der konkreten Geschäftsziele, die mit KI erreicht werden sollen. › Bewertung des potenziellen ROI und der Risiken.
Scope-Definition
› Abgrenzung des Projekts: Welche Bereiche der Organisation sind betroffen? › Definition der Projektgrenzen und -ausnahmen.
Ressourcenplanung
› Identifizierung der benötigten Ressourcen (Personal, Daten, Infrastruktur). › Erstellung eines groben Zeitplans.
Phase 2 Architecture Vision
KI-Strategie
› Entwicklung einer langfristigen KI-Strategie, die die Geschäftsziele unterstützt. › Definition der Rolle von KI innerhalb der Organisation.
Architekturprinzipien
› Festlegung von grundlegenden Prinzipien für die KI-Architektur (z.B. Skalierbarkeit, Robustheit, ethische Aspekte).
Zukunftsbild
› Erstellung eines Zukunftsbilds, das die gewünschte zukünftige IT-Landschaft mit KI beschreibt.
Phase 3 Business Architecture
Geschäftsprozessmodellierung
› Identifizierung der Geschäftsprozesse, die von KI beeinflusst werden. › Modellierung der zukünftigen Prozesse mit KI.
Organisations-design
› Anpassung der Organisationsstruktur an die Anforderungen der KI. › Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten für KI-Projekte.
Datenstrategie
› Entwicklung einer umfassenden Datenstrategie, einschließlich Datenbeschaffung, -bereinigung und -verwaltung.
Phase 4 Information Systems Architecture
Datenmodell
› Erstellung eines detaillierten Datenmodells für die KI-Anwendung. › Definition der Datenqualität und -integrität.
Anwendungslandschaft
› Gestaltung der Anwendungslandschaft, einschließlich der Integration von KI-Komponenten in bestehende Systeme.
Schnittstellen
› Definition der Schnittstellen zwischen KI-Komponenten und anderen Systemen.
Phase 5 Technology Architecture
Infrastrukturplanung
› Planung der erforderlichen IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Cloud). › Auswahl geeigneter Technologien für KI-Workloads.
Netzwerkdesign
› Gestaltung des Netzwerks für den effizienten Datenfluss und die Kommunikation zwischen KI-Komponenten.
Sicherheit
› Entwicklung eines umfassenden Sicherheitskonzepts für KI-Anwendungen.
Phase 6 Solution Architecture
KI-Modellentwicklung
› Auswahl geeigneter Algorithmen und Modelle. › Entwicklung und Training von KI-Modellen.
Modellbereitstellung
› Bereitstellung der Modelle in einer produktiven Umgebung.
Monitoring und Wartung
› Einrichtung von Monitoring-Systemen zur Überwachung der Modellleistung.
Phase 7 Architecture Migration Planning
Migrationsplan
› Erstellung eines detaillierten Migrationsplans für die Umstellung auf die neue Architektur. › Identifizierung von Abhängigkeiten und Risiken.
Phasenweise Umsetzung
› Aufteilung der Migration in kleinere Phasen.
Phase 8 Implementation Governance
Projektmanagement
› Steuerung des Projekts nach den üblichen Projektmanagement-Methoden. › Überwachung des Fortschritts und der Einhaltung des Budgets.
Risiko- management
› Identifizierung und Management von Projektrisiken.
Qualitäts- management
› Sicherstellung der Qualität der KI-Lösung.
Phase 9 Architecture Change Management
Änderungs-management
› Einrichtung eines Prozesses zur Verwaltung von Änderungen an der Architektur. › Bewertung von Auswirkungen von Änderungen.
Kontinuierliche Verbesserung
› Implementierung eines Prozesses zur kontinuierlichen Verbesserung der Architektur.
Tab. 1: Leitfragen zur Anwendung des ADM-Prozesses in KI-Projekten
Composable Architecture Ansatz für KI-Vorhaben
Der Ansatz einer Composable Architecture ermöglicht hingegen die agile Entwicklung und Skalierung von KI-Modellen. Grundsätzlich werden im Rahmen einer Composable Architecture die Prinzipien der Modularität und Flexibilität nicht nur auf KI-Projekte, sondern auf die gesamte IT-Landschaft angewendet. Dieser Ansatz wird in zunehmend dynamischen Märkten zu einem immer wichtigeren Faktor für den Erfolg von Digitalisierungsprojekten.
Composable KI bezieht sich auf den Aufbau von KI-Systemen aus verschiedenen austauschbaren und wiederverwendbaren Komponenten, die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen, u.a.: [9]
Anpassungsfähigkeit
: Durch die flexible Kombination verschiedener Module ist eine effiziente Erfüllung spezifischer Anforderungen möglich.
Skalierbarkeit
: Systeme können leicht skaliert werden, indem einzelne Module hinzugefügt oder aktualisiert werden, ohne dass das gesamte System neu entworfen werden muss. Dies erleichtert, KI-Anwendungen in für verschiedene Geschäftszwecke zu entwickeln und zu erweitern.
Kostenersparnis
: Die Wiederverwendung bestehender Module und die spezifische Kombination verschiedener Komponenten können Entwicklungs- und Implementierungskosten reduzieren.
Risikominimierung
: Modular aufgebaute Systeme erleichtern das Testen und Optimieren einzelner Komponenten und reduzieren damit das Risiko von Fehlern im Gesamtsystem. Fehlerhafte Module können schnell identifiziert und ausgetauscht werden, ohne andere Teile des Systems zu beeinträchtigen.
Die Integration des Composable-Ansatzes in das TOGAF-Rahmenwerk sollte ganzheitlich erfolgen, um eine anpassungsfähige Unternehmensarchitektur zu schaffen. Es empfiehlt sich, bei der Integration des Composable-Ansatzes in das TOGAF-Rahmenwerk mindestens die folgenden Phasen zu berücksichtigen:
Phase A: Definition der Architekturvision:
Die Grundlagen der Composable Architecture können als Grundprinzipien in die Architekturvision integriert werden, um eine frühzeitige Ausrichtung auf Flexibilität und Skalierbarkeit zu fördern.
Identifikation und Beschreibung der Capabilities (Geschäftsfähigkeiten) sowie der zu erwartenden Building Blocks (Bausteine zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen), die durch modulare Realisierung unterstützt werden sollen.
Phase B: Business Architecture
Es ist empfehlenswert, die Capabilities, (Geschäfts-)Prozesse und Architecture Building Blocks möglichst als modulare Einheiten zu modellieren.
Die Schnittstellen sollten klar definiert werden, um eine lose Kopplung zu gewährleisten.
Phase C: Informationssystem-Architektur:
Die Entwicklung von Daten- und Anwendungsarchitekturen sollten auf modularen Komponenten basieren.
Die Nutzung von Application Programming Interfaces (APIs) und Microservices gewährleistet die Integration und Wiederverwendbarkeit der Komponenten.
Phase D: Technologiearchitektur
Bei der Implementierung der technologischen Infrastruktur sollte darauf geachtet werden, dass die Nutzung modularer und wiederverwendbarer Komponenten unterstützt wird. Dies kann Lösungen, die auf Cloud-basierten Technologien basieren, sowie den Einsatz von Container-Technologien umfassen.
Phase F: Erstellung eines Migrationsplans
Es sollte angestrebt werden, die Migration von bestehenden monolithischen Systemen zu einer modularen Architektur zu planen.
Es ist empfehlenswert, Migrationspfade zu definieren, welche eine schrittweise Umstellung ermöglichen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Agilität im Entwicklungsprozess
Der Ansatz der Composable Architecture zielt darauf ab, dass zu erstellende KI-Produkt in einer modularen Struktur mit diversen Komponenten und spezifischen, abgegrenzten Funktionalitäten zu realisieren. Die dafür notwendige Komponentenspezifikation lässt sich im ersten Schritt aus den Zielen und Anforderungen an das Gesamtsystem ableiten. Dies kann beispielsweise anhand einer zu erstellenden Capability, eines zu lösenden Problems oder eines innovativen Service aus Sicht des Geschäftsmodells erfolgen.
Zur Konkretisierung der Zielsetzung sowie zur Ableitung von Anforderungen können die folgenden Leitfragen herangezogen werden:
Welche Probleme sollen gelöst werden?
Welcher Nutzen soll geschaffen werden?
Welche Aufgaben sollen erfüllt werden?
Welche Erwartungen werden Stakeholder (wie Kunden oder Mitarbeiter) haben?
Was ist der Ausgangszustand?
Was kennzeichnet den gewünschten Endzustand?
Die funktionale Dekomposition stellt im nächsten Schritt ein geeignetes Instrument zur Identifikation von Composables in Form zukünftiger Systemmodule dar [10]. Hierbei werden die zuvor aufgenommen Zielsetzungen in weniger komplexe Teilprobleme, -funktionen oder -systeme zerlegt.
Obgleich es in der funktionalen Dekomposition keine strikt vorgegebenen Ebenen gibt, da die Anzahl und Art der Ebenen in hohem Maße von dem zu erstellenden Gesamtsystem und den Anforderungen abhängig sind, lassen sich doch einige allgemeine Prinzipien und Ebenen identifizieren, die in der Praxis zum Einsatz kommen können.
Die Hauptebene:
Diese Ebene umfasst die Hauptfunktionen bzw. -module des Systems. Sie stellt die oberste Abstraktionsebene dar und definiert die grundlegenden Komponenten sowie deren Hauptaufgaben.
Beispiel: Zahlungsabwicklung sicherstellen
Die Zwischenebene:
Auf dieser Ebene erfolgt eine weitere, spezifischere Zerlegung der Hauptfunktionen in Teilfunktionen. Diese Ebene erlaubt eine detailliertere Betrachtung derjenigen Aufgaben und Prozesse, die zur Erfüllung der zuvor definierten Hauptfunktionen erforderlich sind.
Beispiele: Zahlungsinformation erfassen, Zahlung bestätigen
Die Detailebene:
Diese Ebene umfasst die detailliertesten Prozesse. Auf dieser Ebene erfolgt die detaillierte Beschreibung der spezifischen Implementierungsdetails sowie der kleinsten funktionalen Einheiten.
Beispiele: Kreditkartendaten eingeben, Zahlungsoptionen auswählen, Zahlung autorisieren, Bestätigung senden
Die genannten Ebenen zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, sodass sie sich an die jeweilige Komplexität des Systems sowie die spezifischen Anforderungen anpassen lassen. Der Ansatz besteht darin, das System schrittweise in immer kleinere und handhabbarere Teile zu zerlegen, bis jede Funktion klar definiert und verständlich ist bzw. als eigenständige Komponente betrachtet werden kann, die unabhängig von anderen Komponenten funktioniert.