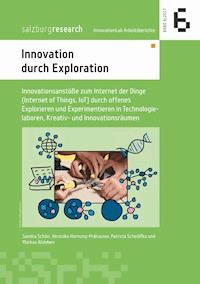
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: InnovationLab Arbeitsberichte
- Sprache: Deutsch
Innovationsentwicklung und -management haben in den letzten Jahren mit den Innovations- und Kreativräumen viele neue Impulse bekommen. Solche Räume erlauben kreativ über mögliche Innovationen nachzudenken und konkret daran zu arbeiten. Auch das Internet der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT) mit seinen neuen Technologien, z. B. Sensoren, Beacons, Smartphone-Applikationen, birgt zahlreiche Innovationen und Innovationschancen. Da lohnt es sich genauer hinzusehen, wie Innovationsräume und die dort eingesetzten Formate und Werkzeuge dazu beitragen, IoT-Innovationen zu entwickeln. In diesem sechsten Band der Reihe "InnovationLab Arbeitsberichte" der Salzburg Research Forschungsgesellschaft werden die Ergebnisse von Recherchen über, Besuchen bei und Interviews mit Verantwortlichen über IoT-Labore und Kreativräume, Fablabs, Makerspaces und Hackathons zusammengetragen. Exploration, also das konkrete Erkunden und Ausprobieren der IoT-Technologie erscheint dabei als wesentliches Prinzip aller Aktivitäten: Die Kernidee liegt darin, das Internet der Dinge und seine Werkzeuge selbst in die Hand zu nehmen, um neuartige Ideen und Lösungen zu entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Das „Internet der Dinge“ wird heutzutage als sogenannter „Treiber“ zur Hervorbringung von Innovationen gehandelt. Es soll das Hervorbringen gänzlich neuer Produkte und Dienstleistungen, aber auch schrittweise Verbesserungen in Prozessen und Abläufen bringen. Von Seiten der angewandten Innovationsforschung waren wir neugierig und stellen uns die Fragen:
Wie können in einem neuen, sich rasch verbreitenden Technologiegebiet, dem sogenannten „Internet der Dinge“, Ideen und Innovation entwickelt werden? Wie gut und systematisch wird dazu in all den Kreativ- und Innovationsräume bzw. in den Technologielaboren gearbeitet? Wie können diese Ideen potentiellen Nutzerinnen und Lead-Usern auch mit Hilfe von physischen Prototypen „be-greifbar“ gemacht werden?
Bei den Recherchen in zwei Forschungsprojekten der Salzburg Research Forschungsgesellschaft haben wir Technologiewerkstätten, Prototyp-Labs und Kreativräume besucht, Expertinnen und Experten interviewt und im Web recherchiert, welche Räume, Tools und Methoden in diesen Innovationsräumen zum Einsatz kommen.
„Exploration“ heißt aus unser Sicht das Zauberwort: Es geht darum, etwas auszuprobieren – und d. h. ganz praktisch mit den neuen Technologien selbst aktiv und sensorisch ganzheitlich zu arbeiten und deren innewohnende Logik und Eigenschaften zu erfassen Das dabei gewonnene Wissen und Können fördert ungewöhnliche Kombinationen und Sichtweisen und ermöglicht dadurch Innovation. Wenn Sie nun also in diesem Band blättern und lesen, dann vergessen Sie nicht: Die Kernidee liegt darin, das Internet der Dinge und seine Werkzeuge dann tatsächlich auch selbst in Hand zu nehmen.
Ganz herzlich möchten wir uns bei den vielen Innovationsräumen bedanken, die uns vielfach ergänzende Angaben schickten. Unser besonderer Dank gilt unseren Partnern im Labs4SME-Projekt für die Unterstützung, inbesondere Michael Kohlegger und dem Team von ECIPA Scarl.
Viel Vergnügen beim Lesen und viele gute Einsichten wünschen wir Ihnen dabei!
Dr. Sandra Schön M.A. und Dr. Mag. Veronika Hornung-Prähauser
InnovationLab | Salzburg Research Forschungsgesellschaft
Salzburg, im Oktober 2017
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Das Internet der Dinge als Innovationstreiber
Das Internet der Dinge: Neue Technologien, neue Produkte, Dienstleistungen und Prozesse
Innovationsentwicklung und das Internet der Dinge
Innovationsräume sowie Technologielabore als Räume für Innovationsentwicklung
Fragestellung und Vorgehen
Hintergrund
IoT-Innovation durch Exploration in Innovationsräumen
IoT-Labore und Makerspaces: Innovationsräume rund um das Internet der Dinge
Innovation durch Exploration: Systematisch „Ungewissheit“ reduzieren und Potenziale erkennen
Beispiele für und Formen von Typologien von Innovationsräumen im Feld von IoT
Beispiele und Formen von Innovationsräumen im Feld von IoT
Typologisierungen von Innovationsräumen im Feld von IoT
IoT-Innovationsräume: Ausgewählte Räume
Überblick
Happylab Salzburg
FabLab der Technischen Universität Graz
Privacy & Sustainable Computing Lab (WU Wien)
IoT Demo Lab der Salzburg Research
Makerspace der Werkstätte Wattens
PoPlab (Italien)
JOSEPHS – Innovationslabor in Nürnberg
IoT-Innovationsräume: Ausgewählte Formate
Überblick
Global Service Jam
Hackathon des Palfinger Digitalisation Lab (Wien 2017)
Jugend hackt (Berlin 2016)
Bosch IoT Business Model Builder (Bilgeri et al. 2015)
Ideation
Vorbereitung
Evaluation
Werkzeuge und Anregungen für das Explorieren mit IoT
Werkzeuge zur Exploration mit IoT
Anregungen für Projekte für IoT-Anfänger/innen
Zur Gestaltung von Formaten zur IoT-Exploration für Einsteiger/innen
Branchenfokus: Auswahl des Themas und der Teilnehmer/innen
Phase 1: Neugier wecken – Umsetzungsbeispiele – Präsentation von Kuriosem und Neuem – Den Grundstein für ein IoT-Verständnis legen
Phase 2: Exploration – IoT selbst ausprobieren und ins Gespräch kommen
Phase 3: Ideen-Entwicklung
Phase 4: Prototyping
Ausblick
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Das Internet der Dinge als Innovationstreiber
Technologietrends durchdringen und beeinflussen unser Alltagsleben immer stärker. Ein wesentlicher Trend ist das Internet der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT) bei dem Sensoren, Mikroprozessoren und Aktoren über das Internet mit digitalen Services und Plattformen verbunden werden. Dies ermöglicht neuartige Szenarien der Echtzeitüberwachung, Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse und vorausschauendes Handeln durch Integration von künstlicher Intelligenz und Big Data. Das Internet der Dinge ermöglicht somit neuartige Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.
Das Internet der Dinge wird vor allem in Hinblick auf Flexibilität und -effizienzsteigerungen in der industriellen Produktion sowie industrienahen Dienstleistungen („Industrie 4.0“) diskutiert. Zahlreiche Innovationen und Innovationschancen für die herstellende Industrie sind somit mit dem Internet der Dinge verbunden: Zum Beispiel können Maschinen Informationen über ihren Status mit anderen Maschinen austauschen und so Ausfallzeiten verringert, Wartezeiten verkürzt und die Produktion menschengerechter geplant werden (Spath u.a., 2013).
Neben der Eignung für industrielle Produktion kann das IoT auch im persönlichen Alltag von Menschen Mehrwert durch die Verknüpfung von physischen Gegenständen mit seinen persönlichen Verhaltens- und Kommunikationsweisen bringen. Während sich solche neuen Dienste beispielsweise bereits im persönlichen Gesundheits- oder Einrichtungsbereich (smarte Uhren und Schuhe kombiniert mit persönlicher App zum Beobachten der Fitness und Gesundheit; Smart Home-Lösungen etc.) in der frühen Innovationsphase befinden, werden laufend weitere Anwendungsbereiche für diese Technik gesucht. Es wird prognostiziert, dass in nur drei Jahren die Anzahl solch verbundene Dinge auf mehr als 20 Milliarden anwachsen wird (Gartner, 2017). Auf welche Weise mit dem Internet der Dinge neue Technologien vor allem Dienstleistungen in Kombination mit Produkten entstehen, wird im folgenden Abschnitt skizziert.
Das Internet der Dinge: Neue Technologien, neue Produkte, Dienstleistungen und Prozesse
Mit dem Internet der Dinge sind nicht allein physische Produkte, z. B. intelligente Kühlschränke denkbar, sondern es werden auch zahlreiche digitale Dienstleistungen möglich, z. B. eben der automatisch initiierte Online-Versand von fehlenden Produkten im Kühlschrank. Fleisch u. a. (2014) haben diese unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen anschaulich dargestellt und beschrieben (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Wertschöpfungsstufen einer Anwendung im Internet der Dinge. Quelle: Fleisch u. a., 2014, Abb. 4, S. 7 (eigene, adaptierte Darstellung)
Unter Bezugnahme auf Fleisch u. a. (2014) lassen sich so folgende Wertschöpfungsstufen identifizieren:
Ebene 1: Das physische Ding bietet einen direkten Nutzen an den Endverbraucher. Um das Beispiel mit dem Kühlschrank aufzugreifen: Er kühlt zum Beispiel Lebensmittel und sorgt so für frische, unverdorbene Nahrung.
Ebene 2: Der Sensor bzw. Aktuator wird dem physischen Produkt hinzugefügt, also ein kleiner Computer. Der erkennt dann z. B. ob das Eierfach im Kühlschrank voll ist – oder nicht.
Ebene 3: Mit Konnektivität erhalten die Sensoren Zugang zum Internet. Verifizierte Nutzer/innen können so auf den Sensor zugreifen und seinen Status abfragen.
Ebene 4: Mit Hilfe von vorausschauender Analysen (Predictive Analytics) werden die entstehenden Daten gesammelt und ausgewertet. So ist es eventuell sinnvoll, nicht erst beim leeren Eierfach neue Eier einzukaufen – sondern je nach Familiengröße oder besonderen Angeboten schon früher.
Ebene 5: Digitale Dienstleistungen können nun auf den bisherigen Ebenen aufbauen, die ohne IoT nicht denkbar sind. Im Falle des Kühlschranks könnte so nun ein Service angeboten werden, dass den Kühlschrankbesitzer/innen eine Nachricht schickt, wenn das Eierfach leer ist und gerade der Bauernmarkt besucht wird. Oder ein Supermarktservice legt zum Online-Einkauf automatisch Eier hinzu, usw.
Einzelne dieser Aspekte sind jedoch nicht an althergebrachte Methoden gebunden, sondern sind selbst neuartig und erlauben viel Spielraum für neue Entwicklungen. So gibt es im Bereich der Analytics von IoT-Daten riesige Herausforderungen und damit auch Option für neuartige Methoden (z. B. Haight, 2015). Zum einen sind die gesammelten Daten u. a. Streaming-Daten, umfangreich (Big Data), kaum strukturiert oder auch neuartig (z. B. Fotos von Überwachungsanlagen). Dann können die Daten auch mit unterschiedlichen Auswertungsmethoden – von traditionellen Auswertungsmethoden über neuartige Verfahren (z. B. Maschinenlernen), für beschreibende oder auch vorhersagende Analysen eingesetzt werden (vgl. u. a. auch Schön u. a., 2016). Insbesondere durch IoT hat sich der Ruf nach professionellen Ausbildungen im Bereich von Data Analytics intensiviert
Die Technologie beeinflusst über die Produktion und Dienstleistungen hinaus auch weitreichend Prozesse, z. B. die Logistik oder auch bestehende Geschäftsmodelle selbst.
Fleisch, Weinberger und Wortmann (2014) zeigen so in einem Bosch-IoT-Lab-Whitepaper auf, dass und wie das Internet uns seine unterschiedlichen Technologien jeweils auch die digitalen Geschäftsmodellmuster beeinflusst (siehe Abbildung 2). Das Fragezeichen in der Darstellung zeigt zudem auf, dass hier aktuell noch nicht klar ist, wie genau die (neuen digitalen) Businessmodelle aussehen, die durch IoT entwickelt werden.
Abbildung 2: Internet- Wellen und daraus neu entstandene digitale Geschäftsmodellmuster. Quelle: Fleisch u. a., 2014, S. 3 (eigene Darstellung)
Innovationsentwicklung und das Internet der Dinge
Das Internet der Dinge ist ein Innovationstreiber. Da ist es naheliegend, dass sich auch Innovationsentwicklungsmethoden und -räume mit dem Themenfeld auseinandersetzen bzw. entsprechende eigene Methodiken entwickeln, um die Innovationsentwicklung im Themenfeld zu unterstützen.
Die persönliche, individuelle Perspektive der Endnutzer/innen kommt bei der Fokussierung auf Einsatz von IoT nur für Industrieeffekte zu kurz. Dabei haben die eingesetzten, langsam bekannt werdenden Technologien ein Potential, das sich in Zukunft die „Dinge“ an individuellen, mitunter sehr persönlichen Vorlieben einzelner Menschen orientieren. Der gesellschaftliche Trend zu Individualisierung und Flexibilisierung stößt auf neue technologische Möglichkeiten und eröffnet dadurch Innovationschancen.
Neben der technischen Realisierbarkeit (Feasiblity) und betriebswirtschaftlicher Tragfähigkeit (Viability) rückt immer mehr das Benutzererlebnis und das damit verbundene Verlangen dieses Produkt oder jene Dienstleistungen zu konsumieren (Desirability) und somit kundenzentrierte Innovation zu ermöglichen (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Innovationsentwicklung als Überlappung von Erwünschtheit, Realisierbarkeit und betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit (Modell des Design Thinking). Quelle: nach Brown, 2009
Innovationsräume sowie Technologielabore als Räume für Innovationsentwicklung
Innovationsentwicklung und -management haben in den letzten Jahren mit den sog. „Innovations-“ oder „Kreativräumen“ sowie „Technologielabs“ oder „Livings Labs“ aller Art viele neue Impulse bekommen. Solche praxisorientierten aber auch virtuellen Räume sollen- in einem gesicherten Rahmen-Freiräume bieten, kreativ über mögliche Innovationen nachzudenken, Wissen dazu mit anderen Interessierten auszutauschen und ggf. auch konkret an Ideen zu arbeiten und beginnen im Kleinen umzusetzen.





























