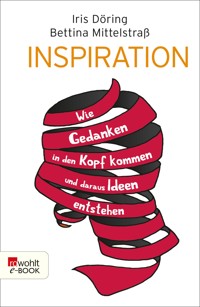
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Inspiration - der Begriff ist allgegenwärtig. Keiner, der nicht schon einmal gesagt hätte, dieses oder jenes inspiriere ihn – oder ihm fehle die Inspiration. Welche Erklärungsversuche bieten Philosophie, Psychologie oder moderne Neurowissenschaften an? Kann man Inspiration gezielt herbeirufen und nutzbar machen? Und wenn ja, wie bringt man die Quelle für Innovationen und künstlerisches Schaffen zum Sprudeln? Ohne die Bereitschaft für sinnliche, bewusste Wahrnehmung kann die Außenwelt nicht in das Denken einfließen. Meist wirkt ja eine ganze Symphonie von Eindrücken im Alltag auf uns ein, das meiste davon wird automatisch von uns ausgeblendet. Die gezielte Überwindung dieser Filtermechanismen ist aber entscheidend, wenn es darum geht, Eindrücke zu gewinnen, die als Quelle der Inspiration dienen können. Im Unterschied zwischen Sehen und Betrachten wird das ebenso deutlich wie in der psychologisch so unterschiedlichen Bedeutung von Suchen und Finden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Fähigkeit zu einer «tiefen Beobachtung», «fokussierten Wahrnehmung» und besonders der Tagtraum. Ein Wechselspiel von zielgerichteter Aufmerksamkeit und einem von jeglichen Zielen losgelösten Denken ist die Basis, um Impulse, Beobachtungen und Erfahrungen in neue Zusammenhänge zu stellen und so Ideen und Erkenntnisse zu entwickeln – um «inspiriert» zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Iris Döring • Bettina Mittelstraß
Inspiration
Wie Gedanken in den Kopf kommen und daraus Ideen entstehen
Über dieses Buch
Inspiration – der Begriff ist allgegenwärtig. Keiner, der nicht schon einmal gesagt hätte, dieses oder jenes inspiriere ihn – oder ihm fehle die Inspiration. Welche Erklärungsversuche bieten Philosophie, Psychologie oder moderne Neurowissenschaften an? Kann man Inspiration gezielt herbeirufen und nutzbar machen? Und wenn ja, wie bringt man die Quelle für Innovationen und künstlerisches Schaffen zum Sprudeln? Ohne die Bereitschaft für sinnliche, bewusste Wahrnehmung kann die Außenwelt nicht in das Denken einfließen. Meist wirkt ja eine ganze Symphonie von Eindrücken im Alltag auf uns ein, das meiste davon wird automatisch von uns ausgeblendet. Die gezielte Überwindung dieser Filtermechanismen ist aber entscheidend, wenn es darum geht, Eindrücke zu gewinnen, die als Quelle der Inspiration dienen können. Im Unterschied zwischen Sehen und Betrachten wird das ebenso deutlich wie in der psychologisch so unterschiedlichen Bedeutung von Suchen und Finden.
Eine wichtige Rolle spielen dabei die Fähigkeit zu einer «tiefen Beobachtung», «fokussierten Wahrnehmung» sowie besonders der Tagtraum. Ein Wechselspiel von zielgerichteter Aufmerksamkeit und einem von jeglichen Zielen losgelösten Denken ist die Basis, um Impulse, Beobachtungen und Erfahrungen in neue Zusammenhänge zu stellen und so Ideen und Erkenntnisse zu entwickeln – um «inspiriert» zu sein.
Vita
Bettina Mittelstraß arbeitet als Wissenschaftsjournalistin und Hörfunkjournalistin vor allem für Deutschlandfunk und den Bayrischen Rundfunk sowie für Publikationen wissenschaftlicher Institutionen wie den DAAD, die Leibnizgesellschaft und deren Institute oder Hochschulen. Sie verfügt außerdem über langjährige Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation im Print- und Online-Bereich.
Iris Döring arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Gestalterin in der Werbe- und Kommunikationsbranche. Für sie ist klar: Ideen entstehen dort, wo Menschen neugierig und offen sind. Seit vielen Jahren untersucht sie die Arbeitsmethoden von Kreativarbeitern und gibt ihr Wissen in Workshops an inspirationshungrige Menschen weiter.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Bernd Gottwald
Umschlaggestaltung ZERO Media Agentur, München
Umschlagabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-57191-4
Hinweis: Die Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ermutigung
Inspiration ist ein vielversprechendes Wort. Es verheißt das Ende einer Suche, an deren Anfang man sich vermutlich leer gefühlt hat, einfallslos, ratlos, gehemmt, blockiert wie vor einer Wand ohne Aussicht auf Auswege. Und jetzt?
Inspiration. Ist der verheißungsvolle Zustand einmal eingetroffen, gleichen sich die Beschreibungen. Das Ende der Ausweglosigkeit geht plötzlich über in euphorische Schaffens- und Gestaltungskraft. Mut, Befreiung, Erregung, Bestärkung, Freude, Begeisterung herrschen vor, ein «Selbstläuferprogramm» wird gestartet, zielsicher, beflügelt, frei, unbekümmert, stark, beschwingt, wie von sich selbst fremdgesteuert, entgrenzt und voller Energie fühlen sich die Menschen, die wir im Vorfeld dieses Buches nach ihren Erfahrungen mit Inspiration befragt haben. Inspiriert sein sei ein Finden, nicht ein Suchen, schrieb uns einer der Befragten zurück. Und dieses Finden sei ein rarer Glückstreffer.
Es gibt dieses Glück – tausendfach beschrieben in der Kulturgeschichte. Ein schweifender und damit unvollständiger Blick in die Geschichte des Begriffs zeigt, dass die Idee der Inspiration durch Jahrtausende Geltung hat und dabei immer dem Wandel unterliegt. Inspiration kommt als eine essenzielle Grundvoraussetzung für das schöpferische Tun in Frage und wird zugleich immer wieder in Frage gestellt. Als Quelle für den Gestaltungsprozess wird sie bei Göttern oder ausschließlich bei dem einen Gott verortet, auf Bergen, im Himmel, im Dickicht, in der Vergangenheit, in der Erinnerung, in der Tradition, in der intellektuellen Auseinandersetzung, im Handwerk, in der Arbeit. Die Bereiche, in denen diese Debatten stattfanden, sind vorwiegend Theologie, Wissenschaft und Kunst, allen voran die Dichtkunst – nicht aber lebensweltliche Gefilde. Es sind Literaten, Musiker, bildende Künstler, Wissenschaftler, Gottesfürchtige, alle Dichtenden oder Denkenden, die seit der Antike für sich an- oder in Anspruch nehmen, an der Startposition ihres Schaffens jenseits der Grenzen des Alltäglichen den «Einfall» haben zu können oder zu dürfen – dort, wo das Außergewöhnliche oder eben das Göttliche vermutet wird. Wichtig scheint zu sein, dass Menschen von einem dort den entscheidenden Impuls für die eigene Gestaltungskraft empfangen: Inspiration.Wie fühlen Sie sich, wenn Sie inspiriert sind?«Ich fühle mich, nachdem ich alle Ideen aufgeschrieben oder auch gleich umgesetzt habe, sehr leicht, und eine schöne Zufriedenheit entsteht.»RENÉ TALMON L’ARMÉE, GOLDSCHMIED
In den glitzernden Schaufenstern der Moderne findet man das Etikett «Inspiration» aber nur noch irgendwo zwischen Sehnsucht und Lifestyle: als vergangene Aura, transportiert mit der neuesten Duftkreation, als windiger Hauch von Frische, wo eigentlich der Schweiß das Sagen hat, abgetaucht in der Kaffeetasse oder entsorgt als schmückender Aufdruck auf einer Sonderedition Klopapier: Inspiration am A…
Auch Künstler distanzieren sich heute vom Begriff der Inspiration. An die exponierte Stelle dessen, was unter dem Stichwort Inspiration debattiert wurde, treten andere Begriffe: Intuition etwa oder Imagination. Sie bezeichnen nur konsequent einen sich eher ausschließlich im Subjekt vollziehenden Vorgang. Intervention von außen steht in den Begriffsdefinitionen nicht im Fokus, auch wenn die Interaktion mit der Umgebung letztlich für keinen Denkprozess ausgeklammert werden kann.«Inspiration? – Wer oder was soll aber in diesem Moment ‹begeistern› – den Geist einhauchen? – Solange die Götter noch nicht im Exil waren, sollte es ihre Aufgabe sein – solange eine christliche Heilswirklichkeit angezielt war, besorgten dies die Engel, Propheten, Apostel und Visionäre – solange die Drogenkultur des 20. Jahrhunderts berauschte, war das keine Frage – aber heute in einer entspiritualisierten designhaften-eventmodischen Postmoderne ist die Frage überflüssig – vielleicht finden wir die Initialzündung des Gestaltungsprozesses im Phänomen der Imagination …»BERT GERRESHEIM, BILDHAUER(Gerresheim, B. [Juli 2016], Auszug aus einem Brief an J. Mittelstraß)
Nach 1945 scheint außerdem ein neues Konzept breitbeinig Karriere zu machen – die «Kreativität», in den 1920er Jahren ins Feld geführt von dem Psychologen Graham Wallas. Kreativität für jedermann heißt die Devise in einer Welt, die nach den Kriegserfahrungen in jeder Hinsicht auf Neuerungen, auf Innovationen setzen muss und auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer «Schaffenden» angewiesen ist. Kreativ zu sein avanciert zu einer erlernbaren Kompetenz. Unzählige Methoden für das kreative Denken und Handeln werden entwickelt, die auf einer Abfolge klar identifizierbarer Phasen basieren, welche sich heute im Internet wiederum blitzschnell für den Hausgebrauch recherchieren lassen. Kreativität definiert das Gabler Wirtschaftslexikon online als «die Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe, in phantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln», und referiert dann den Einsatz von Techniken, die zum kreativen Produkt führen, das seinerseits «gleichzeitig neu und angemessen, nützlich oder wertvoll für die Lösung eines Problems» ist.[1] Der Kreationsprozess als planbarer Denkprozess wird Kriterien von Effizienz unterworfen. Was herauskommt, muss vorhersagbar und später evaluierbar sein, die Interaktion mit der Umgebung tritt auch hier eher in den Hintergrund.
Inspiration ist in den neuen Kontexten ein offenbar zu schwammiger und aufgeladener Begriff. Außerdem ist er bei genauem Hinsehen mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Irgendwie muss man nämlich immer warten, bis Etwas passiert.
Dieses Etwas und die Wucht, mit der Es auftritt, scheint jeder mindestens einmal im Leben empfunden zu haben. Der Zustand bleibt unvergessen – mehr noch, man will ihn wieder haben. Aber wie? Wie genau kommt man von der erlebten Leere zur unerwarteten Fülle? Was ist diese Inspiration? Und warum kann man ihrer nicht unmittelbar habhaft werden, genau dann, wenn man sie braucht? Muss das sein, diese lästige Warterei?
Warten scheint zur Inspiration dazuzugehören. Immerhin, das Warten kann und sollte man – wie im Verlauf der Lektüre dieses Buches unter «Inspirationsquellen» beschrieben – füllen: mit (einsamen) Wanderschaften oder (trostloser) Langeweile wie der antike Dichter Ovid, mit (Menschen-)Beobachtungen wie Marcel Proust, mit (starren) Blicken wie der Maler vor der leeren Leinwand. Inspirierende Vorlagen für solche Warterei finden Sie im Kapitel «Ein Quentchen Genialität».
Auch Schlaf hilft, wenn gar nichts mehr geht. Aber in Zeiten, in denen der Mittagsschlaf abgeschafft wurde, die bequeme Couch aus den Großraumbüros flog und die allgegenwärtige Kontrolle der Schaffensprozesse erstes Gebot ist, wird nicht mehr «sinnlos» gewartet, werden keine Löcher mehr in die Luft gestarrt. Es ist weder angesagt noch angemessen, Eingebungen und Ideen im Müßiggang oder in magischen Momenten zu suchen. Arbeitsstress ist en vogue, abwartendes Empfangen dagegen scheint fast ein Zeichen für Versagen zu sein. Unter dem Stichwort «Scheinstress» veröffentlichte «Die Zeit» am 4. August 2016 einen kleinen Artikel zum Zeitgeist von Fritz Habekuss mit dem Titel «Im Chor der Erschöpften. Nur wer ausgebrannt ist (oder so tut), gilt etwas». Das Seufzen, Jammern und «Erschöpfttun» sind in Mode gekommen, Begeisterung oder Enthusiasmus sind geradezu befremdlich und suspekt, gelten gerne als blind oder naiv. Begeistert bei der Arbeit? Der hat doch keine Ahnung!
Nimmt man das kollektive Jammern nach fehlender Inspiration – «Mir fällt doch eh nichts ein!» – ernst, dann muss man zunächst einmal anmerken: Inspiration ist nicht nur Dichtern und Denkern vorbehalten, wie es vielleicht der kulturgeschichtliche Streifzug im Kapitel «Ein Quentchen Genialität» suggeriert. Auch jeder andere Tätige kann den Zustand erfahren, von dem durch Jahrhunderte hinweg die Rede war, es war einfach nur noch nicht von jedermann die Rede. Wenn sich Künstler oder Wissenschaftler gegen die Uninspirierten abgrenzen, ist das allenfalls der Selbstinszenierung oder einem Nimbus geschuldet, der sie als Kreierende umgibt. Aber ob aus inspiriertem Gestaltungsdrang am Ende Kunst oder Wissenschaft entsteht, ist eine ganz andere Frage, die hier nicht zur Debatte steht. Über die Kreationen und Ergebnisse «inspirierter» Arbeit möge die Gesellschaft urteilen. Davon losgelöst spricht nichts dagegen, jedem Menschen Schaffenskraft zu unterstellen und die Verwendung des Begriffs Inspiration zu demokratisieren. Das versucht dieses Buch, das Sie in der Hand halten.
Was Sie darin finden werden, lässt sich als Ermutigung beschreiben: die Ermutigung, Inspiration in Alltag und Arbeitsleben zu integrieren. Was Sie auch finden werden, ist die Behauptung, dass das geht, wenn Sie zugleich erfahren haben, wieso – und zwar ohne Überhöhungen, Mystik, Götter und Brimborium. Nur geht es nicht gänzlich ohne grundlegende Bereitschaft, aktiv zu werden. Selbst ein gemütliches Ambiente zu schaffen bedarf, wie jeder weiß, auch ein wenig Arbeit. Einrichtungsprofis können vielleicht Vorschläge machen, aber was «gemütlich» ist, muss am Ende aus einem endlosen Katalog der Möglichkeiten jeder selbst entscheiden – und dann entlang der eigenen Bedürfnisse zusammenstellen.
Auf der Suche nach Ihrem persönlichen Ambiente für mögliche Inspiration kann dieses Buch also nützlich sein. Das erste Kapitel bietet Einblicke in die psychologischen Grundlagen und versucht mit Rückendeckung der modernen Hirnforschung eine Antwort darauf zu geben, wie Inspiration eigentlich funktioniert und welch entscheidende Rolle die Wahrnehmung, der Tagtraum und die Erinnerung dabei spielen. Auch eine Aufforderung, das Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft zurückzugewinnen, können Sie hier entdecken, verbunden mit einigen Vorschlägen zum «wie» – unter dem Titel «Musenküsse für den Eigenbedarf». Streifzüge durch die beliebtesten «Inspirationsquellen im Test» erweitern die Recherche zur Inspiration. Und schließlich plaudert das Buch aus dem Nähkästchen vieler Inspirationsempfänger, zeigt das viele tausend Jahre alte und noch immer große Bedürfnis nach einer Antwort auf die Frage, wie das Neue in die Welt kommt, und bietet ausgewählte Einblicke in die religions- und literaturtheoretischen Überlegungen, die sich mit dem Begriff Inspiration verbinden. Abschließend finden Sie Überlegungen zum Wert eines alten Konzepts für eine moderne Welt, die nach dem Neuen, dem Innovativen, ruft.
So tritt das Buch insgesamt mit dem Wunsch an, dem Begriff der Inspiration auf der Grundlage seiner alten Wertschätzung auch eine neue und moderne zu verleihen – auch wenn es und vielleicht gerade weil es eine Verallgemeinerung der vielen möglichen Beschreibungen nicht geben kann. Der Wortschatz für das Inspirationserlebnis ist immer individuell und zugleich kulturell geprägt. Wir können heute statt der Einhauchungen von Gott und Göttinnen die Erkenntnisse der Psychologie zu Hilfe nehmen und deren Begrifflichkeit zugrunde legen, wir können das Phänomen aber auch weiterhin als Inspiration bezeichnen und ihm eine moderne, eine breitere Bedeutung verpassen. Die Bedeutung von Begriffen verändert sich immer im Zuge ihrer Verwendung – solange man sich bewusst ist oder gut begründet, was man tut. Wie die neuen Ideen in den Kopf kommen, beschäftigt die Neugier und den Wissensdurst ohne abschließendes Ergebnis, und das Rätseln geht weiter. Aber ein bisschen mehr erhellen kann man das außergewöhnliche Geschehen vielleicht doch.
Hilfreich für dieses Vorhaben sind eben die modernen Erkenntnisse aus Psychologie und Hirnforschung. Wenn jeder denkende und schaffende Mensch theoretisch inspiriert sein kann – ob er daraus Kunst oder Wissenschaft schafft oder nicht –, muss das Gehirn an sich die Möglichkeit besitzen, solche Zustände zu erfahren oder zu erzeugen. Es sind die Psychologie und die Neurowissenschaft, die sich heute auch dem Thema widmen, wie Einfälle zustande kommen, und die daher wertvolle Hinweise geben können, um zu verstehen, was unter dem Zustand «Inspiration» eigentlich passieren muss oder passiert. Und es sieht so aus, als müsse es eher darum gehen, Begeisterung und Enthusiasmus, Muße und Müßiggang – die «lange Weile» – zu rehabilitieren und in diesem Sinne Inspiration möglich zu machen, sprich, die Bedingungen zu schaffen, unter denen Inspiration erfahren werden kann.
Wir plädieren für mehr Aufnahmebereitschaft, für mehr Mut, den verlässlichen Pfaden auch mal den Rücken zu kehren, für mehr Empfänglichkeit als Sendungsbewusstsein, für weniger Kontrolle und mehr Bereitschaft für Überraschungen, Begeisterung und Enthusiasmus. Ob sie sich ein Leben ohne Inspiration vorstellen könnten, haben wir in die Runde gefragt. Nein, war die einhellige Antwort, schrecklich, eintönig, tödlich, voller Wiederholungen, langweilig, trostlos, wie im Koma, leer und lieblos hieß es da, und am schönsten hat uns diese Antwort gefallen: «Ein Leben ohne Inspiration wäre die Lebensform eines Aktenordners.»
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre.
Iris Döring und Bettina Mittelstraß
Wie funktioniert Inspiration?
Wahrnehmung oder «Ich sehe was, was du nicht siehst»
Sind Sie schon einmal mit einem gut gelaunten Kind durch einen Supermarkt gelaufen? Dann könnten Sie eine Situation wie die folgende erlebt haben:
Erwachsener: Wo steht denn hier das Waschmittel? Komm mit … hier lang.
Kind: Schau mal, siehst du dahinten die Frau? Die hat aber schöne lange Haare.
Erwachsener: Kann sein. Los! Wir müssen in diese Richtung.
Kind: Wie lange dauert es, bis die Haare so lang sind?
Erwachsener: Na, du stellst Fragen, keine Ahnung. Nicht trödeln.
Kind: Oh – warte mal, das Zeug hier in der bunten Dose, was ist das? Kann man das essen?
Erwachsener: Was weiß ich. Da steht das Waschpulver!
Kind: Da ist ein Osterhase auf dem Regal! Der ist süß.
Erwachsener: Jetzt komm mit zur Kasse. Ich will hier schnell wieder raus.
Kind: Warum müssen wir denn schon gehen? Ich will noch gucken.
Erwachsener: Hier gibt es doch nichts zu sehen.
Zwei Menschen befinden sich in derselben Situation, nehmen jedoch völlig unterschiedliche Dinge wahr, wie kann das sein?
In dem oben beschriebenen Szenario bewegen sich die beiden in der gleichen Umgebung: Während einer von ihnen jedoch offen und neugierig völlig unterschiedliche Dinge entdeckt, geht die andere Person mit zielgerichtetem Blick durchs Geschehen und ist für Nebensächlichkeiten scheinbar blind. Mit dem Beispiel geht nicht die Behauptung einher, Kinder seien grundsätzlich offener als Erwachsene. Das ist nicht der Fall. Dennoch sind wir als Erwachsene die meiste Zeit genauso unterwegs wie die erwachsene Person in der Szene – was nicht verwundert. Die meisten Menschen sind in einem eng getakteten Alltag ständig damit beschäftigt, etwas Bestimmtes zu erledigen, Termine zu halten oder schlicht von A nach B zu gelangen. Das Kind hingegen hat offensichtlich Muße und lässt sich von den Reizen der Umgebung ansprechen. Es verfügt über eine Form von Wahrnehmung, die die gesamte Umgebung erfasst. Unser Erwachsener hingegen hat eine eingeschränkte Sicht auf die Dinge, die von klaren Zielvorgaben dominiert wird. Offener Blick contra Zielfernrohr.
Warum sieht also das Kind im Beispiel oben so viel mehr als sein Begleiter? Oder anders gefragt: Warum übersieht der Erwachsene die allermeisten Dinge, die sich in dem Supermarkt befinden? Wie kommt es, dass von den vielen Informationen und Reizen, die uns ständig umgeben, nur die allerwenigsten wirklich wahrgenommen werden und in das Bewusstsein vordringen? Und welche Faktoren sind es, die dafür verantwortlich sind, dass manche Dinge ausgeblendet werden, während andere direkt ins Auge springen oder auf eine andere Art die Aufmerksamkeit erregen?
Antworten auf diese Fragen sind begehrt. Die «Aufmerksamkeit» als Forschungsthema beschäftigt Psychologen, Neurowissenschaftler, Pädagogen und Philosophen, aber auch Werbefachleute und andere Experten. Um es vorwegzunehmen: Es gibt viele unterschiedliche Theorien darüber, wie Menschen die Welt sehen und begreifen und wie etwas in das Bewusstsein und damit in das verarbeitende Denken vordringt. Was dabei aber genau im Kopf geschieht, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Auf den folgenden Seiten werden einige wichtige Überlegungen zur Erklärung der menschlichen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit genauer beleuchtet. Denn ohne dass sich Eindrücke in den eigenen Gedanken manifestieren – ohne «bewusste» Wahrnehmung –, ist Inspiration nicht möglich. Anders ausgedrückt: Was ich nicht im Kopf habe, kann ich auch nicht denkend verarbeiten. Und in den Kopf muss «es» erst mal rein.Der unsichtbare GorillaEines der berühmtesten Experimente zur Selektivität der Aufmerksamkeit ist der «unsichtbare Gorilla» – ein Versuch, den die beiden Psychologen Christopher Chabris und Daniel Simons Ende der 1990er Jahre durchführten. Die Wissenschaftler zeigten ihren Probanden einen 70 Sekunden dauernden Film, in dem sich eine Mannschaft in weißen Trikots und eine in schwarzer Sportbekleidung gegenseitig Basketbälle zuwerfen. Die Aufgabe bestand darin, die Ballwechsel nur einer Mannschaft zu zählen, die der Gegenmannschaft jedoch dabei zu ignorieren – eine Tätigkeit, die höchste Konzentration erfordert. Etwa gegen Mitte des Filmes läuft ein Gorilla (in Wahrheit eine als Riesenaffe verkleidete Person) auf das Spielfeld, bleibt kurz stehen, schaut in die Kamera und verlässt das Feld dann zur anderen Seite. Erstaunlicherweise gaben rund 50 Prozent der Versuchspersonen später an, nichts Besonderes in dem Film bemerkt zu haben. Obwohl der Gorilla etwa neun Sekunden lang im Bild zu sehen war, war er für die Hälfte der Zuschauer unsichtbar. Ihr Blick war durch die Zählaufgabe so sehr auf ein bestimmtes Detail fixiert, dass selbst der Gorilla keine Chance auf Aufmerksamkeit hatte.(vgl. Chabris, C., Simons, D. [1999], Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events, in: Perception 28, S. 1059–1074)
Filter gegen Flimmern im Kopf
Nur wenig von dem, was um uns herum passiert, nehmen wir bewusst wahr – und man kann sagen: zum Glück! Stellen Sie sich folgende Alltagssituation vor: Sie stehen an einer Verkehrskreuzung und wollen eine stark befahrene Straße sicher überqueren. Neben Ihnen befindet sich eine lärmende Baustelle, auf der anderen Seite eine Gruppe ebenfalls laut diskutierender Touristen, es naht ein heranfahrendes Polizeiauto, überall flimmern Leuchtreklamen an den Gebäuden, Menschen bevölkern die Gehsteige, Fahrzeuge parken oder starten, Wind geht und lässt die Blätter der Bäume rauschen und treibt leere Plastiktüten vor Ihre Füße, Sie riechen frischen Teer, Backwaren, Frittierfett, Parfüm. Nähme man all das gleichberechtigt wahr, würde eine solche Situation die meisten Menschen überfordern – wären da nicht die feinen Filter, die es ermöglichen, relevante von unwichtigen Informationen zu trennen.
Was ist relevant? Was ist unwichtig? Für die beschriebene Situation ist vermutlich das relevant, was wir an Informationen benötigen, um die Kreuzung ohne Schaden zu überqueren (Verkehr, Polizeiauto). Für jeden Menschen gibt es darüber hinaus Eindrücke, die interessant erscheinen (etwa fremdsprachige Menschen) und daher die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Andere Reize werden ganz einfach ausgeblendet (zum Beispiel der Wind, die Plastiktüten). Würden wir uns auf diese für die Situation als irrelevant eingestuften, ignorierten Reize konzentrieren, wäre es an sich kein Problem, jene Reizquellen im selben Ausmaß zu erfahren wie alle anderen. Aber in der beschriebenen alltäglichen Situation werden sie in das allgemeine Grundrauschen eingefügt, das uns umgibt. Wir blenden aus und können das Ausgeblendete später in der Regel auch nicht mehr spontan erinnern.
Aber ist es nicht theoretisch doch möglich, alles gleichzeitig und mit der gleichen Intensität zu erfahren? Immerhin hören die Ohren ja ständig mit, und auch das Auge unterbricht den Sehvorgang nicht, solange es geöffnet ist.
Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: Das menschliche Gehirn kann nur eine begrenzte Menge von Reizen und Informationen gleichzeitig verarbeiten. Wäre unser Kopf ein Computer, würde man sagen: Das Gehirn hat einen limitierten Arbeitsspeicher. Wissenschaftler sprechen von einem Engpass in der Verarbeitung, einem sogenannten «Bottleneck» (dt. Flaschenhals), der die Auswahl oder Selektion von Informationen notwendig macht.[2] Das wird deutlich, wenn zwei Sinneseindrücke gleichzeitig verarbeitet werden sollen. Versuchen Sie zum Beispiel mal, während Sie diesen Text lesen, gleichzeitig einem Gespräch zu folgen oder den Nachrichten im Radio zu lauschen. Es wird Ihnen kaum möglich sein.
Im täglichen Leben ist es ohne Zweifel hilfreich und notwendig, dass diese Filtermechanismen unermüdlich arbeiten und uns von Nebensächlichem und vermeintlich Irrelevantem abschotten. Sie bieten einen wertvollen Schutz vor Überforderung und helfen uns, uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade tun möchten. Dem inspirierenden Blick, der Sicht auf das Neue, stehen diese Wächter der eigenen Wahrnehmung hingegen oft im Weg. Denn sie verhindern, dass dieses Neue überhaupt zu uns vordringt.«Die unerhörte Menge dessen, was man zwischendurch sieht und sehen muss, obwohl man es nicht sehen will, soll man übersehen oder überwölben oder ausblenden; die Selektionsseher schweigen sich darüber aus, wie man technisch mit dem Überangebot umgeht. Sie erkennen nicht, dass ihre selbstgewisse Maxime gerade das ausschließt, was sich ersatzweise (und mit Gewinn) erblicken lässt.»WILHELM GENAZINO, SCHRIFTSTELLER(Genazino, W. [2008], Das einmal Gesehene ist das immer Gesehene, in: Hamilton, A., Sillem, P. [Hg.], Die fünf Sinne. Von unserer Wahrnehmung der Welt. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, S. 111–112)
Alarm!
Nach welchen Kriterien wählt der Kopf aus, was ihm relevant erscheint und welche Informationen ausgeblendet werden? Dafür sind verschiedene Faktoren entscheidend. Zunächst ist da die Intensität eines Reizes. Sie hat häufig einen großen Einfluss darauf, ob wir eine Reizquelle bemerken oder nicht. Besonders im visuellen Bereich gibt es wahre Marktschreier unter den Reizen. Ein Preisschildchen für ein Sonderangebot zieht in der Regel durch seine knallfarbige Aufmachung den Blick auf sich und macht gegenüber weniger bunten Artgenossen das Rennen. Ein buntes und großes Plakat transportiert seine Botschaft wirksamer als eine dezente Hinweistafel. Beim Riechen ist dieses Phänomen besonders ausgeprägt. Gerüche werden häufig gar nicht bewusst wahrgenommen, es sei denn, sie sind besonders intensiv (frischer Kaffee), ungewohnt oder funktionieren wie ein Alarmsignal (zum Beispiel Brandgeruch). Auch beim Hören gilt oft die Devise: Je lauter es schallt, desto eher wird es gehört (man denke an die Radiowerbung, das Martinshorn oder eine Autohupe). Aber nicht immer ist das, was sich unserer Wahrnehmung in den Vordergrund drängt, das eigentlich Interessante. Oft bleiben Dinge unbemerkt, die einen zweiten Blick lohnen würden.
Einfluss auf die Aufmerksamkeit hat nicht nur die Vehemenz, mit der eine Information auf die Sinne trifft. Eine Rolle spielt auch die Art und Weise, wie wir unsere Umwelt interpretieren und aus der Wahrnehmung ein inneres Bild formen. Denn der Eindruck, den ein Mensch von seiner Umgebung hat, ist keine schlichte Kopie der äußeren Begebenheiten. Es geht vielmehr um das Erkennen von Mustern – also um eine Art Abgleich der äußeren Welt mit inneren Vorstellungen und Gedankenspuren, die im Kopf bereits vorhanden sind. Wie ist das zu verstehen? Ein Beispiel: Häuser können in ihrer Form, Gestalt und Größe sehr unterschiedlich sein, und trotzdem wird es Ihnen mühelos möglich sein, ein beliebig abstrakt geformtes Gebilde als Haus zu identifizieren. Es ist völlig egal, ob es sich dabei um eine archaische Grashütte, einen modernen Bungalow, einen futuristischen Wolkenkratzer oder einen Supermarkt handelt: Sie werden in allem ohne Mühe ein Haus erkennen. Verantwortlich dafür ist etwas, was Psychologen als «interne Repräsentationen» bezeichnen. Diese internen Repräsentationen sind Gedankenspuren, die wichtige Merkmale und Eigenschaften von Dingen bündeln und ein Erkennen möglich machen.[3] Um beim Beispiel des Hauses zu bleiben: Hier nimmt der Betrachter Komponenten wie Fenster, Dach oder Wände nicht als einzelne, eigenständige Gegenstände wahr, sondern als Teile eines Dinges, das sie als «Haus» erkennen und benennen können. Der Gestaltpsychologe Christian von Ehrenfels beschreibt diese Form des Wahrnehmens als «übersummativ»: Der Eindruck, der beim Betrachter entsteht, ist also mehr als die Summe der Dinge, es entsteht etwas Neues, Ganzes, eine sogenannte «Gestalt». Ehrenfels macht diese Erkenntnis am Hören von musikalischen Harmonien fest. Wir hören nicht die einzelnen Töne, sondern durch die Kombination von Klängen entsteht ein eigenes Klangbild, das beim Hörer eigene Assoziationen weckt. Er stellt fest: «Hierbei ist es bemerkenswert, dass die Gestaltqualität sich mitunter so sehr in den Vordergrund drängt, d.h. unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, dass es schwerfällt, ihre Grundlage in die Elemente aufzulösen.»[4] Man könnte auch sagen: Oft sehen wir vor lauter Wald die Bäume nicht.
Während die Leistungsfähigkeit und Sensibilität der Sinnesorgane darüber entscheiden, welche Reize und Informationen aus der Umwelt überhaupt über bestimmte Rezeptoren aufgenommen werden (so kann das menschliche Auge beispielsweise nur einen begrenzten Teil der Lichtwellen wirklich sehen), entscheidet die innere Welt über die qualitative Bewertung unserer Eindrücke. Sehen Ihre Augen also Wände, eine Tür, Fenster, ein Dach usw., so entsteht erst durch die mentale Verarbeitung daraus der Eindruck «Haus».
Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch nicht, dass Dinge, die keiner internen Repräsentation entsprechen, nicht wahrgenommen werden können. Zweifelsohne können Sie zum Beispiel eine Topinambur-Knolle oder einen Plattenwärmetauscher in Augenschein nehmen, jedoch nicht unbedingt erkennen und benennen. Ein Beispiel aus dem Leben gegriffen: Ein Dreijähriger begeistert sich für die Cartoonfigur «Spongebob», eine Art gelb gelöchertes Schwammtier, und jubelt: «Ein sprechender Käse!» Er hat offenbar noch nie einen Schwamm gesehen, Käse hingegen schon oft auf dem Teller gehabt. Ihm fehlt die interne Repräsentation von «Schwamm», und das kann zu einer völlig anderen Beurteilung des Gesehenen führen.
Noch wahrscheinlicher als eine Fehlinterpretation aber wird sein, dass für einen Menschen das, was er nicht kennt, ganz einfach nicht auf dem eigenen Radar erscheint, auch wenn es ihm öfter begegnet. Das unbekannte Gemüse wird nicht in Ihrem Einkaufskorb landen, auch wenn Sie es immer wieder einmal in der Auslage Ihres Supermarktes angeboten bekommen. Erst ein zufälliger Kontakt damit – etwa im Rahmen einer Einladung zum Abendessen: «Oh, wie köstlich! Das ist Topinambur?» – wird Ihnen das Lebensmittel näherbringen. Sie legen eine Gedächtnisspur an, können sich später an die Knollen erinnern und werden sie beim nächsten Einkauf vermutlich auch erkennen. Vielleicht inspiriert Sie das Abendessen sogar dazu, selbst einmal etwas damit zu kochen. Der Grundstein wäre gelegt.
Ein Gegenstand, ein Bild oder Musik kann bei einem Menschen Interesse oder Neugier, bei einem anderen Desinteresse oder einfach Abneigung hervorrufen. Die einzelnen Komponenten – bei Musik zum Beispiel die unterschiedlichen Klänge der Instrumente – beachtet der Laie eher nicht. Was ein Mensch sieht, hört, riecht oder taktil fühlt, ist immer eine Komposition aus vielen einzelnen Sinneswahrnehmungen und Empfindungen, die stark von jenen ganz persönlichen inneren Bildern beeinflusst werden, die für eine Beurteilung und ein Erkennen unerlässlich sind.
Wie weit diese «interne Revision» geht, lässt sich am Sehsinn verdeutlichen. Während die «Rohdaten» eines visuellen Eindrucks von den Nervenzellen des Auges geliefert werden, erhält die primäre Sehrinde – jener Teil der Großhirnrinde, der für die visuelle Wahrnehmung zuständig ist – geschätzte 90 Prozent ihrer Informationen aus dem Gehirn und nicht von der Netzhaut.[5] Erst die Verbindung von sinnlicher Empfindung und subjektiver Innenschau, der sogenannten «Introspektion», lässt schlüssige Wahrnehmungsinhalte entstehen.[6]
Genau das ist für die Inspiration von großer Bedeutung. Es besagt, dass Dinge, von denen ein inneres Bild besteht und die wir somit decodieren können, viel eher erkannt und wahrgenommen werden als solche, von denen wir keine Spuren im Gedächtnis haben. Oder andersherum: Was wir nicht kennen, ignorieren wir gerne mal.
Noch ein Beispiel gefällig? Sie sind auf einer Party, und um Sie herum schwirren Gruppen von Menschen in schicker Kleidung und mit Smalltalk beschäftigt. Was tun Sie? Vermutlich das, was die meisten Leute tun würden: Sie lassen den Blick schweifen, suchen ein bekanntes Gesicht. Ergibt es sich dann, dass Sie einen Bekannten oder eine Kollegin erspähen, werden Sie sich freuen und das Gespräch suchen. Die anderen Gäste werden Ihre Aufmerksamkeit vermutlich erst dann erlangen, wenn sie etwas sehr Ungewöhnliches tun – sehr ausgefallene Kleidung tragen oder besonders laut lachen – oder wenn sie von sich aus mit Ihnen in direkten Kontakt treten. Was bedeutet das? Sie werden auf dieser Party vermutlich nicht viel Neues erleben, Sie konzentrieren sich auf diejenigen Leute, die Sie bereits kennen, und versuchen, sich auf möglichst vertrautem Terrain zu bewegen. Das Unbekannte hingegen wird eher ausgeblendet.
Inspiration verlangt jedoch nach Ihrer Neugier und danach, vermeintlich Vertrautes genau zu betrachten, um neue Aspekte darin zu entdecken. Das Neue ist da und umgibt Sie ständig, Sie müssen diese Begegnung allerdings auch suchen.«Die Conception des Genies ist eine willenlose leidende Empfängniss, sie kommt ihm beim angestrengtesten Suchen gerade nicht, sondern ganz unvermuthet wie vom Himmel gefallen, auf Reisen, im Theater, im Gespräch, überall wo es sie am wenigsten erwartet und immer plötzlich und momentan.»EDUARD VON HARTMANN, PHILOSOPH(von Hartmann, E. [1869/1989], Philosophie des Unbewußten. Versuch einer Weltanschauung. Hildesheim: Georg Olms Verlag, S. 217)
Antennen auf Empfang!
Die gute Nachricht zuerst: Es ist jederzeit möglich, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt zu richten und so die inneren Filter zu umgehen. Aber: Es handelt sich dann um einen willentlichen, bewusst gesteuerten Akt.
Begeben wir uns noch einmal zurück zu der Party, die im vorangegangenen Kapitel als Beispiel diente: Sie plaudern nun also locker mit einer Bekannten. Trotz Musik, Sprechgeräuschen und dem Klingen von Gläsern können Sie dem Gespräch mühelos folgen, denn Ihr Gehirn blendet alles andere so weit wie nötig aus. Sie können sich also ganz entspannt auf die Erzählung Ihres Gegenübers konzentrieren. Plötzlich nehmen Sie im Stimmengewirr aus einiger Entfernung den Namen eines neuen Arbeitskollegen wahr. Dort wird anscheinend gerade über diesen Typen getratscht. Das könnte für Sie interessant sein. Sie sperren die Ohren auf, um ja nichts zu verpassen. Erst der fragende Blick Ihrer Gesprächspartnerin holt Sie in die Situation zurück, wenn sie sagt: «Ich habe dich gerade etwas gefragt, hörst du mir überhaupt zu?» Darauf können Sie nur mit einer entschuldigenden Miene erwidern: «Ich war gerade woanders, kannst du es bitte noch mal sagen?»«Das Gehirn als Ganzes registriert jedoch sehr viel mehr von dem was ist, ohne dass wir das bemerken, und es erinnert sich an diese Ereignisse, ohne dass wir je in der Lage wären, diese Erinnerungen ins Bewusstsein zu heben. Denn nur solche Inhalte können bewusst abgerufen werden, die zum Zeitpunkt des Erlebens mit Aufmerksamkeit belegt und bewusst erfahren wurden.»WOLF SINGER, HIRNFORSCHER(Singer, W. [2008], Der 7. Sinn, in: Hamilton, A., Sillem, P. [Hg.], Die fünf Sinne, S. 115)
Was hier passiert, beschreibt der Kognitionswissenschaftler Colin Cherry als «Cocktailparty-Phänomen».[7] Cherry erforschte in den 1950er Jahren das Hören unter schwierigen akustischen Bedingungen. Dabei stellte er fest, dass es nicht zwangsläufig die stärksten Signale sind (hier im Beispiel die klare und gut hörbare Stimme einer gegenüber stehenden Person), auf die sich die Aufmerksamkeit richtet. In einem lauten Gewirr von Geräuschen kann das Hören auch auf relevant erscheinende Dinge fokussiert werden, die deutlich leiser oder undeutlicher zu hören sind. Kognitionswissenschaftler sehen hierin den Beweis, dass es offensichtlich in der Umgebung viele Informationen gibt, die niederschwellig registriert, jedoch nicht bewusst verarbeitet werden. Anders wäre es im vorhin beschriebenen Beispiel nicht möglich gewesen, bei der weiter entfernten Nennung des Namens eines Kollegen überhaupt hellhörig zu werden.
Wir können unsere Aufmerksamkeit demnach gezielt auf einen selbstgewählten Punkt lenken. Um sich inspirieren zu lassen, ist das enorm wichtig. Wie oft passiert es, dass wir etwas potenziell Faszinierendes übersehen, weil die Wahrnehmung auf das Vordergründige gerichtet ist? Wie oft bewegen wir uns in einer Art Autopilot-Modus, ohne die Umgebung genauer zu betrachten? Wer sich Zeit nimmt, die Umgebung jenseits des Vordergrunds zu betrachten und zu beobachten, wird erstaunt sein, wie viel Interessantes und Inspirierendes es zu entdecken gibt.«Turn and face the strange»DAVID BOWIE (AUS DEM SONG «CHANGES»)





























