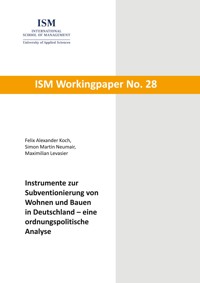
Instrumente zur Subventionierung von Wohnen und Bauen in Deutschland - eine ordnungspolitische Analyse E-Book
Felix Alexander Koch
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Deutschland hat, besonders in urbanen Räumen, mit zunehmender Wohnraumknappheit zu kämpfen. Ursachen sind steigende Baukosten, Zinsen, demografischer Wandel, Migration und ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Sozialwohnungen nehmen ab, während die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt. Dies macht staatliche Förderungsmaßnahmen erforderlich, die sich in Subjektförderung (z. B. Wohngeld, Eigentumsförderung durch KfW-Kredite) und Objektförderung (z. B. sozialer Wohnungsbau, Modernisierung) gliedern lassen. Während Subjektförderung einkommensschwache Haushalte entlastet und flexibel ist, schafft sie keinen neuen Wohnraum. Objektförderung dagegen wirkt langfristiger, ist aber finanziell unterdimensioniert und bürokratisch anspruchsvoll. Ordnungspolitisch sinnvoll ist ein Gleichgewicht beider Förderarten, ergänzt um stabile Rahmenbedingungen und neue Ansätze wie serielle Bauweise, Nachverdichtung und eine Stärkung gemeinnütziger Wohnformen. Ziel ist es, mehr bezahlbaren Wohnraum nicht nur für Geringverdiener, sondern auch die oft vergessene Mittelschicht zu schaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Problemstellung und Methoden
Eckdaten der deutschen Wohnungswirtschaft
2.1 Wohnungsangebot
2.2 Wohnungsnachfrage
2.3 Wirkungsgefüge des Wohnraummangels
Staatliche Eingriffe in den deutschen Wohnungsmarkt
3.1 Subjektförderung
3.1.1 Wohngeldbeihilfe
3.1.2 Förderung der Eigentumsbildung
3.1.3 Ordnungspolitische Wirkungsanalyse
3.2 Objektförderung
3.2.1 Sozialer Wohnungsbau
3.2.2 Modernisierung
3.2.3 Ordnungspolitische Wirkungsanalyse
Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Baugenehmigungen und Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden 2009 bis 2023
Abbildung 2:
Bautätigkeit von Wohnungen nach Gebäudeart 2005 bis 2022
Abbildung 3:
Eigentümergruppen von Wohnungen im Jahr 2022
Abbildung 4
:
Sozioökonomische Zusammenhänge und Abhängigkeiten des Immobilienmarktes
Abbildung 5:
Häuserpreisindex, Preisindices für neu erstellte und bestehende Wohnimmobilien sowie Bauland 2000 bis 2023
Abbildung 6:
Übersicht bestehender und ehemaliger KfW-Förderungen für Wohnen und Bauen
Abbildung 7
:
Übersicht der Wohnraumförderung in Bayern
Abbildung 8
:
Übersicht bestehender und ehemaliger KfW-Förderungen für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
Abkürzungsverzeichnis
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
EStG
Einkommenssteuergesetz
GdW
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
StMB
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr
1 Problemstellung und Methoden
Wohnen und Bauen sind von zentraler gesellschaftlicher und politischer Bedeutung. Nach dem UN-Sozialpakt hat jeder Mensch das Recht auf angemessenen Wohnraum. Auch wenn dieser dort nicht explizit als eigenständiger Begriff auftaucht, ist er doch Teil des allgemeinen Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard. Wörtlich heißt es: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen“1. Das Wort „Unterbringung“ umfasst in diesem Zusammenhang den Zugang zu sicherem, ausreichendem und menschenwürdigem Wohnraum, was auch Aspekte wie Sicherheit der Wohnverhältnisse sowie Angemessenheit und Erschwinglichkeit von Wohnraum miteinschließt und damit klarstellt, dass es sich um mehr als nur ein Dach über dem Kopf handelt.
Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle Bevölkerungsgruppen und die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung sind daher grundlegende Aufgaben der öffentlichen Hand.2 In den letzten Jahren hat sich die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt, insbesondere in Großstädten sowie umliegenden Regionen, jedoch zunehmend verschärft. Die Bundesregierung und verschiedene politische Akteure versuchen, mit staatlichen Maßnahmen in diesen Markt einzugreifen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen sowie bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Fraglich jedoch ist, ob diese Instrumente ausreichen, um die Situation am Wohnungsmarkt zu verbessern oder vielmehr ein Umdenken in der Politik erforderlich ist.
Hauptgrund für die Wohnraumknappheit ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die gestiegene Nachfrage und das mangelnde Angebot machen es für einkommensschwache Haushalte zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die nachgelagerten Folgen der Corona-Pandemie, der Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sowie die gestiegenen Baukosten und Zinsen verschärfen diese Situation. Die Folge ist ein stagnierender Neubau von bezahlbarem Wohnraum, sodass es erforderlich ist, neuen Ansätzen nachzugehen, mit denen sich diesem Problem entgegenwirken lässt.
In dieser Arbeit wird analysiert, welchen Herausforderungen sich die Politik angesichts der prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt aktuell und in den kommenden Jahren stellen muss, welche Maßnahmen zur Verbesserung beitragen und wie sich diese ordnungspolitisch bewerten lassen.
Zur Bearbeitung dieser Problemstellung werden zum einen Sekundärdaten wie Fachliteratur und Internetquellen aus dem nationalen und internationalen Forschungsumfeld herangezogen. Die Arbeit stützt sich zum anderen auf die Methoden qualitativer empirischer Sozialforschung. Der Forschende eignet sich damit über einzelne Akteure innerhalb eines Themengebietes Wissen an. Dabei stellen die Akteure bzw. Experten kein einzelnes Individuum dar, sondern dienen als Repräsentanten einer spezifischen Gruppe, Institution oder Organisation. Der empirische Teil der Arbeit basiert daher auf leitfadengestützten Experteninterviews. Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte anhand des in der qualitativen Sozialforschung gültigen theoretischen Samplings, bei dem die Experten nicht aufgrund ihrer statistischen Repräsentativität, sondern auf Basis inhaltlich-theoretischer Vorüberlegungen gewählt werden, um das Wissen des Forschenden zu erweitern. Hierfür wurden Vertreter politischer Parteien, von Wohnungsbauunternehmen und Mieterverbänden ausgesucht, um eine objektive Faktenbasis zu schaffen.3
Die Auswahl der in dieser Arbeit befragten Experten begründet sich wie folgt:
Zwei
Abgeordnete des Bayerischen Landtags
geben Einblicke in den politischen Diskurs sowie Erwartungen an die Politik (vgl. Interview 1 und 4).
Vertreter der Münchener Wohnungsbauunternehmen
GWG sowie GdW zeigen Handlungsempfehlungen an die Politik auf (vgl. Interview 2 und 5).
Die
Geschäftsführerin des deutschen Mieterbundes
erläutert die Wirksamkeit ausgewählter politischer Maßnahmen zur Unterstützung des Wohnens (vgl. Interview 3).
Die Experteninterviews wurden anhand der Analysemethode nach Mayring ausgewertet.4 Mit Einverständnis der Interviewpartner wurden die Gespräche unter Beibehaltung der Kernaussage der Interviews aufgenommenen, gekürzt bzw. nicht vollständig transkribiert. Die theoretische und inhaltliche Überlegung ermöglicht eine Struktur durch Bildung von Kategorien. Diese werden mit Überschriften versehen, die den groben Inhalt der Textstellen betiteln. Hintergrund ist die bessere Übersicht der Inhalte sowie eine Vergleichbarkeit der Aussagen.
Die genauen Inhalte der Interviews sowie detaillierte Informationen zu den Interviewpartnern finden sich in der Online-Version dieses Working Papers unter: https://ism.de/forschung/forschungsaktivitaeten.
1 Artikel 11 Absatz 1 UN-Sozialpakt
2 vgl. Thomsen et. al 2020: 461
3 vgl. Truschkat et. al 2011: 354
4 vgl. Mayring & Fenzl 2019: 633
2 Eckdaten der deutschen Wohnungswirtschaft
Seit Jahren ist Wohnen ein zentrales Thema in Deutschland. In diesem Zusammenhang ist von hohen Mieten, gestiegenen Wohnungspreisen und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Wohneigentum die Rede. Die Wohnsituation der Bevölkerung wirkt sich unmittelbar auf ihre Lebensqualität aus, wobei es innerhalb Deutschlands erhebliche Unterschiede gibt.5
2.1 Wohnungsangebot
Im europaweiten Vergleich ist die Bundesrepublik einer der bedeutendsten Wohnmärkte. Dieser ist aufgrund eines Mieteranteils von 53,5 Prozent (2022) ein Mietermarkt.6 Jedoch weist nicht jede Region Deutschlands einen ausgebildeten Mietwohnungsmarkt auf.7 Die Eigentümerstrukturen klaffen weit auseinander und sind stellenweise sehr unterschiedlich. Insbesondere Metropolregionen, wie z. B. Berlin, Frankfurt am Main oder München, weisen mit 26,33 und 24 Prozent eine sehr niedrige Eigentümer- und damit hohe Mieterquote auf.8
Abbildung 1: Baugenehmigungen und Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden 2009 bis 2023Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis 2024b & 2024c
Seit der Wirtschaftskrise 2009 ist die Bautätigkeit am Wohnungsmarkt stark angestiegen. Im Jahr 2023 betrug die Anzahl an Fertigstellungen 294.399 Wohneinheiten und die Anzahl an Baugenehmigungen 259.639 Wohneinheiten. Im Verhältnis zu 2009 entspricht dies einem Anstieg von ca. 85 und 46 Prozent. Allerdings waren die Baufertigstellungen im Jahr 2021 und die Baugenehmigungen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr erstmals seit 2009 rückläufig (vgl. Abbildung 1





























