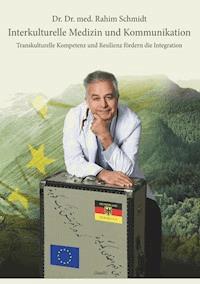
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Würden Sie in der Arzt-Patient-Beziehung oder sonst im Alltag bei einem deutschen nach Befinden seiner Familie fragen? Dies wäre für den betroffenen eine soziale Kontrolle und womöglich Mangel an fachliche Kompetenz. Und genau das ist für einen Iraner Zeichen einer wertschätzenden und fachlichen Kompetenz. Dadurch können Sie den Kontakt professionell strukturieren, Komplikationen verringern und Ressourcen schonen. Braucht die kulturelle Vielfalt NUR eine abendländische Medizin? Was ist „richtiges“ Fachwissen für den Arzt? Ist der Patient EIN Fall oder ein Individuum mit seiner soziokulturellen und emotionalen Biographie? Wo bleibt mein ICH und meine psychosomatischen Beschwerden angesichts meiner Gruppenzugehörigkeit? Niemand ist dem Menschen so nah wie der Arzt seines Vertrauens. Nirgendwo sonst kann der Unterschied zwischen Verstehen und Nichtverstehen so gefährlich sein. Helmut Schmidt hatte mal gesagt: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“. Der Meinung bin ich nicht und sage deshalb als Arzt: Dieses Buch liefert fundierte Anregungen für ein neues Bewusstsein und ist eine wichtige Grundlage für eine ressourcen-orientierte transkulturelle Kommunikation in unserer pluralistischen Gesellschaft, die sich durch kulturelle, religiöse und weltanschauliche Vielfalt auszeichnet. Das Buch ist für Mediziner, Therapeuten, Pflegepersonal, Sozialverbände und Pädagogen geschrieben und richtet sich außerdem an alle, die sich für Gesundheit in der Einwanderungsgesellschaft und am Fragenkomplex Migranten interessieren. Es behandelt migrationsspezifische Aspekte in der Arzt-Patient-Beziehung mit vielen Fallbeispielen, Prävention, Rehabilitation, Pflege, Demenz, Hospiz, Sterbebegleitung und Religion, Trauma-Behandlung bei Folteropfern und Flüchtlingen, Beschneidung, Suizid, traditionelle Heiler und Psychosomatik; außerdem Medizin für wohnungslose Menschen, Armut und Gesundheit, Ethik, Chancen und Risiken binationaler Paare und ihren Kindern. Autor: Dr. Dr. med. Rahim Schmidt, Hausarzt, Naturwissenschaftler, Landtagsabgeordneter a. D., 2.Vorsitzender des Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland", Arzt für wohnungslose Menschen und Flüchtlinge, Forschungspreisträger des deutschen Hausärzteverbandes RLP 2011. Aktiv als Dozent im Universitätsklinikum Marburg und Lehrbeauftragter in Mainz für Studierende der Medizin. Empfohlen: Prof. Dr. Erika Baum, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender, Deutscher Hausärzteverband e.V.; Prof. Dr. Susanne Schröter Ethnologin und FFGI; Julia Klöckner, Stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU; Dr. habil Hamid Peseschkian WIAP.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glück
Sterne werden geboren aus Urseele,
Zeit und Raum verschmelzen,
zu Perlen der Sehnsucht,
in unbekanntem Land aus Rosen.
Das Morgenlicht im Blick
zerstreut der Blumenregen
Rosen und Lavendel
über das blaue Meer.
Im Mondlicht
umspannt die Zeit
Glück und Leid
unter der Haut
der Nacht.
Stilles Leben
aus Mensch und gepflügter Erde
neigt sich seinem Ende
in Güte und ruhigem Geist
auf Landstraße
der Ewigkeit zu (Rahim).
Dieses Buch ist meinem Sohn Taban Sebastian gewidmet.
Nasimi aserbaidschanischer Dichter und Philosoph (1369–1417) preist das Mensch-Sein in den Himmel:
Beide Welten passen in mich, aber in diese Welt passe ich nicht. Ich bin die Essenz ohne Ort, in die Existenz passe ich nicht.
Inhalt
Vorwort
Interkulturelle Medizin, Geschichte und soziokulturelle Einflüsse
Der Hintergrund
1.1 Warum dieses Buch?
1.2 Was behandelt die interkulturelle Medizin?
Menschen mit Migrationshintergrund (MMH) in Deutschland
2.1 Vom Gastgeber zum Migranten
2.2 Regionalspezifische Erkrankungen
2.3 Migrationsspezifische Erkrankungen, Gastroenterologie
Lebenswelt und Sozialisation der Kulturen
3.1 Soziokulturelle Einflüsse am Beispiel Iran
3.2 Orient: Patientenrolle, Betreuungsbedürfnisse und Erwartungen
3.3 Okzident: Patientenrolle, Betreuungsbedürfnisse und Erwartungen
Gesundheitssysteme
4.1 Beispiel Ägypten
4.2 Beispiel Türkei
4.3 Arzt-Patienten-Beziehung, (Aber-)Glaube und traditionelle Heiler
Exkurs: Bin ich gesund oder krank?
Schlussfolgerung
Kommunikation und Kultur
Kommunikation in der medizinischen Versorgung
Kommunikationsgrundlagen
2.1 Das Kommunikationsquadrat
2.2 Kommunikationsformen
Kulturelle Unterschiede
3.1 Der »Kultur-Eisberg«
3.2 Kulturdimensionen nach Edward Hall
3.3 Kulturdimensionen nach Geert Hofstede
3.4 Kulturstandards nach A. Thomas
Konflikte und deren Ursachen
4.1 Konfliktstile
4.2 Konfliktformen
4.3 Erkenntnisse aus den obigen Ausführungen
Migration und Gesundheit
Der Gesundheitszustand von Menschen mit Migrationshintergrund (MMH)
1.1 Prävention
1.2 Kindergesundheit
1.3 Somatische Erkrankungen, Drogenmissbrauch und Suizid
1.4 Infektionskrankheiten
1.5 Psychische Gesundheit bei Spätaussiedlern in Deutschland
1.6 Erklärungsmodelle zum Gesundheitszustand von MMH
Interkulturelle Psychosomatik
2.1. Schmerzsymptome
2.2 Kulturell bedingte psychosomatische Erkrankungen
Ärztlicher Beruf
3.1 Arzt-Patienten-Beziehung
3.2 Interkulturelle Arzt-Patienten-Kommunikation
3.3 Fallbeispiele
Plädoyer für den Hausarzt
Familien als Flüchtlinge
5.1 Migration, Sozialstatus, Bildung und Gesundheit
Armut und Gesundheit,Medizin der wohnungslosen Menschen
6.1 Menschen ohne Papiere, Ambulanz ohne Grenzen, Mainz
6.2 Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem
Sozialpolitik, Integration und Gesundheit
7.1 Integrationskonzepte der politischen Parteien
Pflege
8.1 Patienten und Pflegende mit Migrationshintergrund
8.2 Pflege und Migration
8.3 Die Rolle der Familie
8.4 Wünsche an das Pflegepersonal
8.5 Kultursensibles Pflege-Assessment
8.6 Handlungsfelder zur Verbesserung der Pflege von MMH
8.7 Kulturspezifische Angebote/Services
8.8 Ausbau der Pflegeleistungen
Rehabilitation
Spezielle Themen der MMH und sonstige Perspektiven
Familiensysteme
Binationale Ehen, Chancen, Anpassungsstörungen der Kinder
2.1 Eheschließungen/Scheidungen und Kinder aus binationalen Ehen
2.2 Spezielle Probleme binationaler Ehen
2.3 Mehrsprachigkeit der Kinder
Resilienz erkennen, integrieren und fördern
Forensische Medizin, Sucht
4.1 Suchtproblematik
Altenheim und Geriatrie
Sterben in der Fremde
6.1 Der Tod und seine Bewertung im Koran
6.2 Der Umgang mit den Toten – Bestattung, Obduktion und Trauer in der Türkei
6.3 Palliative Versorgung der MMH allgemein
6.4 Kulturelle Unterschiede, Glaube, Sterbehilfe und Selbstmord
Beschneidung
Gewalt in der Ehe
Folter und Trauma
9.1 Fallbeispiele
Ethik
Stiftung Prof. Nossrat Peseschkian, Geschichten, Positive Psychotherapie
Ausblick
12.1 Medizinische Ausbildung
12.2 Interkulturelle Medizin als Chance für das Gesundheitssystem
12.3 Fachkräfte und Ärzte für die Zukunft
12.4 Prävention
12.5 Mentoren-Ausbildung, Gesundheitsmediatoren
12.6 Dolmetscher-Ausbildung
12.7 Interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen
12.8 Medizintourismus
Fazit
Medienecho:
Verzeichnisse
15.1 Literaturquellen
Danksagung
Der Autor von »Interkulturelle Medizin«
Vorwort
Woran hapert es bei der Erklärung des aktuellen Weltgeschehens? Die Illusion der Singularität in unserer Welt ist Teil der globalen Herausforderung. Wo bleibt mein »Ich« angesichts der Vielfalt? Diese Illusion der Singularität stützt sich auf die Annahme, ein Mensch sei nicht als Individuum mit vielen Zugehörigkeiten zu betrachten, sondern als ein Mitglied einer Gruppe, die ihm eine Identität gibt.
Die Zunahme an psychischen und somatischen Erkrankungen und auch die Hilflosigkeit des Helfersystems besteht darin, die Vielfalt nicht anzunehmen, sondern Konzepte anzubieten, mit deren Hilfe die Menschen in Gruppen eingeteilt werden.
Das Besondere an diesem Buch ist der Versuch des Autors, die »Mehrschichtigkeit der Thematik« hervorzuheben. Herr Schmidt ist nicht nur autobiographisch nicht einer einzelnen Nation zuzuordnen, sondern auch in seiner Berufung als Arzt und Politiker verkörpert er die Vielfalt. Daher ist sein Blick in Kontakt mit seinen Patienten und dem Gesundheitssystem der Vielfalt mit seinen vielfältigen Lösungsansätzen. Das Buch von Herrn Schmidt ist also der ganzheitlichen Medizin gewidmet.
Frau Dr. med. Solmaz Golsabahi-Broclawski
Medizinisches Institut für transkulturelle Kompetenz
(www.mitk.eu)
Erklärung des Autors:
Ich habe mich bei der Fertigstellung des Manuskripts im Sinne einer guten und gerechten Patientenversorgung nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, alle Quellen exakt zu belegen und Faktenfehler zu vermeiden. Dafür habe ich auch die entsprechenden Autorinnen und Autoren kontaktiert, soweit dies möglich war. Falls es trotzdem Mängel gibt, so sind diese nicht wissentlich entstanden und ich bitte bereits im Voraus um Entschuldigung. Bitte informieren Sie mich bei Bedarf, damit etwaige Fehler bei einer späteren Ausgabe korrigiert werden können. Das gleiche gilt für die Links und deren Inhalte aus dem Internet. Vielen Dank!
I. Interkulturelle Medizin, Geschichte und soziokulturelle Einflüsse
Zusammenfassung Buchteil I
Im ersten Buchteil wird in den Gegenstand der interkulturellen Medizin eingeführt. Dafür wird der Begriff vom Menschen mit Migrationshintergrund (MMH) erläutert. Durch die Vorstellung von konkreten religions- und migrationsspezifischen Erkrankungen wird der Begriff des MMH konkret und die daraus erwachsenen Probleme in der Arzt-Patienten-Beziehung werden nachvollziehbar. Einige der soziokulturellen Einflüsse werden für bestimmte Länder (Ägypten, Türkei, Iran) konkret ausgeführt.
1. Der Hintergrund
1.1 Warum dieses Buch?
In Deutschland leben aktuell etwa 17 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (MMH). Sie sind aus den unterschiedlichsten Gründen gekommen, leben und arbeiten hier. Teilweise haben sie sich so weit mit der BRD identifiziert, dass sie sich einbürgern ließen und ihre eigene Nationalität aufgegeben haben. Ihre kulturellen Einstellungen haben sie mit in dieses Land gebracht, teilweise bewahrt und teilweise an die neuen Lebensumstände angepasst. Aber auch die einheimische Bevölkerung wird durch die Zuwanderung und deren Kultur, Sprache, Kleidung, Musik, Religion, Weltanschauungen und das Essen beeinflusst und bereichert.
Dieses Buch gibt zum ersten Mal mit praktischen Fallbeispielen aus verschiedenen Fachgebieten einen ganzheitlichen Überblick über das Thema und beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Medizin, interkulturelle Kommunikation und Kompetenz als Voraussetzung zu einer besseren medizinischen Versorgung und zur gelungenen Integration. Welche Rolle spielen die MMH im Gesundheitswesen? Mit welchen Herausforderungen müssen sie und alle anderen Akteure zurechtkommen? Wie hat sich unser Gesundheitssystem an diese Menschen und neue Betreuungsbedürfnisse angepasst? Und was kann noch verbessert werden, um die medizinische Versorgung und die Therapiequalität bei allen Menschen in Deutschland zu verbessern? Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die interkulturelle Kommunikation um Menschen mit Migrationshintergrund und deren Gesundheit in der medizinischen Versorgung mit den folgenden Punkten gelegt:
Wie setzt sich die Bevölkerung in Deutschland zusammen?
Welchen Gesundheitsrisiken sind MMH ausgesetzt?
Welche Zugangsbarrieren stehen zwischen MMH und dem deutschen Gesundheitssystem?
Wie beeinflussen die Kulturunterschiede die Erwartungen und das Verhalten der Patienten?
Welche Rolle spielt die Kommunikation und transkulturelle Kompetenz bei der Arzt-Patienten-Beziehung?
Wie ist die Versorgung in den einzelnen medizinischen Bereichen?
Welche Rolle spielen die Bildungs- und Sozialpolitik, Religion und andere Weltanschauungen bei der Integration?
Welche Möglichkeiten bestehen, um die Gesundheitsversorgung der MMH zu verbessern?
Wie ist z. B. die medizinische Versorgung in der Türkei, in Ägypten und im Iran?
Wie werden die MMH in verschiedenen medizinischen Abteilungen untergebracht, wie z. B. in Hospizen, Pflegeheimen und in der Gerontopsychiatrie?
Welche Standpunkte gibt es in verschiedenen Kulturen zu Organspende, Sterben und Tod am Beispiel Islam?
Wie arbeiten die traditionellen Heiler aus der Türkei hier in Deutschland?
Dieses Buch soll den Lesern aus den verschiedensten Bereichen der medizinischen Versorgung nicht nur Fakten über die MMH vermitteln, sondern auch helfen, über die eigenen Vorurteile und Werte nachzudenken und die Bedeutung der Sprache und Kommunikation zu erkennen und diese professionell einzusetzen. Die Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und neue Erkenntnisse in der Praxis zum Nutzen der Patienten mit Migrationshintergrund einzusetzen, ist ein Anfang, um die Beziehung zum Patienten und die Qualität der Therapie zu verbessern. Wichtig ist es, hier nicht stehenzubleiben, sondern durch einen »Kultur«-bewussten Umgang mit den Patienten Erfahrungen zu sammeln, die nicht nur dem Patienten helfen, sondern auch die eigene Haltung beeinflussen.
Auch wenn hier überwiegend die spezifischen Fragestellungen der Interkulturalität angesprochen werden, so dürfen wir die Leistungen und vorhandene Ressourcen der MMH in der heutigen globalisierten Welt nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Gerade die Gastarbeiter der ersten Generation, v. a. aus der Türkei, haben fern von eigenen Familien und Kindern oft ohne Schulausbildung Großartiges beim Aufbau von Deutschland geleistet. Das Gesundheitssystem sollte sich heute uneingeschränkt um all diese Menschen, deren Kinder und Enkelkinder kümmern. Leider wird das Thema Migration/Integration in Deutschland in der Regel von negativen und nicht wertschätzenden Debatten begleitet.
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herkunftsländer und -kulturen von Patienten und deren Geschichten und Lebensrealitäten muss gesagt werden, dass es nicht die Kultur gibt. Vielmehr geht es hier darum, auch wenn von »Orient« und »Okzident« als Herkunftsprototyp gesprochen wird, ein Bewusstsein und eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen Kulturen und deren Sozialisationen herbeizuführen. Es wird auf genderspezifische Formulierungen verzichtet.
1.2 Was behandelt die interkulturelle Medizin?
Das richtige Wissen ist zentrale Voraussetzung für einen guten Mediziner. Was aber ist »richtiges« Wissen? In der Regel denkt man zuerst an das Fachwissen und die Erfahrungen, die ein Arzt im Laufe seiner Ausbildung und im Berufsleben in Bezug auf Erkrankungen erlangt hat. Der Patient wird als »Fall« betrachtet. Erst auf den zweiten Blick rückt der Patient als »Mensch« mit seinen Erwartungen und Betreuungsbedürfnissen in den Fokus.
Aus unseren Erfahrungen im Alltag wissen wir aber, dass jeder Mensch anders ist, auch wenn man ein ähnliches Aussehen hat oder ähnliches Verhalten an den Tag legt. Selbst eine Mutter wird nicht behaupten, dass alle ihre Kinder gleich sind, sondern dass diese sich z. B. in Essgewohnheiten, Lernbereitschaft, Zukunftswünschen und im Krankheitsfall deutlich unterscheiden (was insbesondere zu Diskussionen über Essen, Schule und Ausbildung führt). Um jedem Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung gerecht zu werden, muss es entsprechend seinem Charakter behandelt und begleitet werden. Seine vorhandenen Ressourcen müssen also individuell gefördert werden.
Wie sieht ein Arzt seinen Patienten? Sieht er ihn als »Fall«, wird er ihn gleich behandeln wie andere, ähnlich gelagerte »Fälle«. Sieht er ihn als Menschen, wird er Unterschiede machen und auf die speziellen Bedürfnisse eingehen, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Interkulturelle Medizin zielt darauf, den Patienten als Ganzes zu sehen, mit seinem kulturellen und religiösen Hintergrund, seiner Familie und seinen Erfahrungen aus seinem Lebensumfeld. Dies gelingt nur mit einer offen-empathischen Grundhaltung, die dem Patienten in seiner Individualität und seiner soziokulturellen und emotionalen Biographie begegnet.
Interkulturelle Medizin erwartet nicht das umfassende Wissen über kulturelle Besonderheiten und religiöse Einstellungen einer bestimmten ethnischen Gruppe, sondern lediglich die Bereitschaft, sich mit diesen Themen im Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung auseinanderzusetzen und diese Erfahrungen in die Therapie einfließen zu lassen. Gleiche Symptome können je nach Lebenshintergrund des Patienten eine andere Vorgehensweise bei der Behandlung erfordern.
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
IMMANUEL KANT (1724–1804), DEUTSCHER PHILOSOPH
Interkulturelle Medizin ist nur mit interkultureller Kompetenz optimal umzusetzen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet, dass wir uns u. a. unserer Wertevorstellungen und Normen bewusst werden und diese dann, ohne Bewertungen, in eine Beziehung zu den Wertevorstellungen und Normen der anderen setzen. Erst dann können wir die Differenzen erkennen und gemeinsame Lösungen anstreben. Wie wichtig interkulturelle Kompetenz ist, hat man in der Wirtschaft schon lange erkannt. Manager werden auf Kurse geschickt, um bei Gesprächen mit ausländischen Geschäftspartnern nicht in »Fettnäpfchen« zu treten und somit ein vielversprechendes Projekt scheitern zu lassen. Interkulturelle Kompetenz ist nicht angeboren, sondern erlernbar! Sie hilft, sich kulturelle Unterschiede bewusst zu machen und ermöglicht eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die das Vertrauen bzw. den Therapieerfolg fördert und die Kosten im Gesundheitssystem u. a. durch Vermeidung von Doppeluntersuchungen bzw. falschen Therapien verringert.
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
FRANZ KAFKA (1883–1924), DEUTSCHSPRACHIGER SCHRIFTSTELLER
Das Bewusstsein wird in der Begegnung von verschiedenen Kulturen über soziokulturelle, ethisch-moralische und religiöse Prägungen in der interkulturellen Kommunikation gestärkt. Der kompetente transkulturelle Umgang im Gesundheitswesen verbessert die gemeinsame Arbeit aller Beteiligten. Medizinisch fördert dies die Compliance und autonome Heilungsprozesse bei den Patienten. Dieses facettenreiche Thema erfordert über sektorale Grenzen hinweg eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, was am Ende zu einer qualitativen Verbesserung der medizinischen Versorgung aus einer Hand führen kann.
2. Menschen mit Migrationshintergrund (MMH) in Deutschland
In diesem Buch stehen die Patienten mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt der Betrachtung. Auch hier denkt man bei Migranten zunächst an die Türken als größte Gruppe in der deutschen Bevölkerungsstatistik, weil auch dafür die Datenlage mit Quellenangaben gut verwertbar ist.
Nach den Erfahrungen von vielen Kolleginnen und Kollegen ist aber die Gastarbeitergeneration, seien es Griechen, Italiener, Portugiesen oder Spanier, was die Ressourcen oder die besondere Problematik in den Stationen der medizinischen Versorgung betrifft, untereinander mehr oder weniger vergleichbar. Hier hat die Politik über entscheidende Jahre nichts zur gelungenen Integration unternommen. Deshalb sehen wir heute die Folgen dieses Nichthandelns in vielen Bereichen. Es wäre höchste Zeit, gerade sie nicht zu vergessen und zu unterstützen. Allgemein versteht man unter »Migrant« jeden Menschen, der seinen Wohnsitz dauerhaft wechselt, was aber keinen Rückschluss auf die Ethnie oder Religionszugehörigkeit/Weltanschauung zulässt.
In Deutschland hat etwa jeder fünfte Einwohner Migrationshintergrund. Genaue Zahlen sind aufgrund der Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre und des ungeklärten Aufenthaltsstatus vieler Asylbewerber nicht vorhanden. In den offiziellen Statistiken sind die so genannten »illegalen« Einwanderer – man sollte hier eigentlich den Begriff »illegalisiert« verwenden – nicht erfasst. Es wird geschätzt, dass etwa eine halbe bis 1,5 Millionen Menschen ohne Personendokumente in Deutschland leben. Diese Menschen haben nicht nur einen schlechten Zugang zum Gesundheitssystem, sie werden auch in den Studien über Migration und Gesundheit nicht berücksichtigt.1
2.1 Vom Gastgeber zum Migranten
Migration gibt es in Deutschland nicht erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dennoch soll hier nur auf die Migrationsbewegungen seit Kriegsende kurz eingegangen werden. Es lassen sich deutlich einzelne Migrationsphasen unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Ursachen haben und bestimmte Bevölkerungsgruppen betrafen. Nach der Besatzung von Deutschland gab es eine Bevölkerungsmigration von Ost nach West. Insbesondere junge Erwachsene verließen das Gebiet. Erst nach dem Mauerbau von 1961 wurden die Auswanderungen fast völlig unterdrückt. Zu diesem Zeitpunkt waren über zwei Millionen Menschen von Ost nach West gekommen.2
Deutschland benötigte zum Wiederaufbau Arbeitskräfte, so wurden durch Anwerbeabkommen mit einigen Ländern »Gastarbeiter« aus Italien, der Türkei, Jugoslawien, Portugal, Marokko, Griechenland und Spanien zunächst für eine bestimmte Zeit nach Deutschland geholt. Integration war zu der Zeit von Anfang an weder geplant, noch wurde sie gefördert. Bis Mitte der 1970er-Jahre kamen überwiegend junge und kräftige Männer, ohne Familienangehörige, die bestimmte Gesundheitskriterien erfüllen mussten. Sie hatten kaum Kontakte zur einheimischen Bevölkerung und wohnten unter sich.3 Es gab keinerlei Forschung auf dem Gebiet der Migration, die heute vielleicht als Basis für die medizinische Versorgung oder Integrationspolitik dienen könnte. In die Deutsche Demokratische Republik (DDR) kamen überwiegend Menschen aus Kuba, Angola, Vietnam und Mosambik. Die Gesundheitsuntersuchungen nahmen keine Rücksicht auf kulturelle Besonderheiten. Bis zu drei peinliche Untersuchungen mussten die Bewerber über sich ergehen lassen. Gruppenweise mussten die Kandidaten vor die Ärzte treten. Der Blutdruck wurde gemessen, Blut- und Urinproben genommen, körperliche Übungen mussten vorgeführt werden. Der Körper wurde nach Operationsnarben abgesucht, Genitalien wurden abgetastet.4 Gerade Männer aus ländlichen Regionen, von denen manche vielleicht noch nie bei einem Arzt waren, haben trotz finanzieller Not die Untersuchungen wegen der mangelhaften Kultursensibilität in der Arzt-Patienten-Beziehung abgebrochen.
Abb. 1: Gesundheitsuntersuchung junger Gastarbeiter (Quelle: „Jean Mohr / DOMiD-Archiv, Köln“)
Die größte Gruppe von ausländischen Gastarbeitern in der BRD waren die Türken. Das erste Anwerbeabkommen sah kein dauerhaftes Bleiberecht vor. Dies änderte sich mit dem zweiten Abkommen 1964. Die Wirtschaft hatte erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, ständig neue Arbeitskräfte anzulernen. Die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu den Gastarbeitern änderte sich im Laufe der Zeit mit der zunehmenden Zahl von Interesse und Toleranz zu einem »Ärgernis«. Die Türken spürten ihrerseits immer deutlicher ihre Isolation und Fremdheit, was bei vielen auch zu seelischen Erkrankungen führte.5
Die »Gastarbeiter« waren nun keine Gäste mehr, sondern Ausländer. Sie durften bleiben und ihre Familienangehörigen ebenfalls ins Land holen. Ihre Lebens- und Arbeitssituation hatte sich dadurch aber nur unwesentlich verbessert. Vielmehr stieg mit steigender Überfremdungsangst seitens der deutschen Bevölkerung auch die Fremdenfeindlichkeit, die sich bis heute sowohl durch offene Übergriffe als auch durch Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt zeigt. Der Begriff »Ausländer« ist negativ besetzt und behindert teilweise die Integrationsbemühungen aller Betroffenen. Neben dem Begriff »Ausländer« werden auch gerne Gruppierungen benannt, wie z. B. »die Araber« oder »die Muslime«. Dieses Schubladendenken verhindert den Blick auf den einzelnen Menschen, seinen kulturellen Hintergrund und seine religiösen Ansichten.
Spätaussiedler, d. h. deutsche Volkszugehörige aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten, stellen eine weitere große Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund dar. Seit 1950 sind über 4,5 Millionen Aussiedler einschließlich ihrer Familien in die BRD gekommen, wobei die Zuwanderung seit 1990 stark rückläufig ist (2012 lediglich 1817 Personen).6
Mittlerweile wird, zumindest von öffentlicher Seite, nicht mehr von Ausländern in Deutschland gesprochen, sondern von Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, v. a. aber von Muslimen. Dies ist aber für die Mehrheit von Muslimen, die sich als liberale bzw. Kultur-Muslime verstehen, ein ernsthaftes Problem, da sie zum einen sich nicht auf ihre Religion reduzieren lassen möchten und zum anderen den Glauben in der heutigen Zeit als soziales Engagement verstehen. Das Wort Migrationshintergrund ist weitgehend neutral, wird aber im Alltag unterschiedlich interpretiert. Nach der gängigen Definition können auch Deutsche einen Migrationshintergrund haben, z. B. wenn sie Kinder von Spätaussiedlern sind.
Türkisch-Deutsche Medizinergesellschaft
Nach dem Krieg herrschte in Deutschland ein Mangel an Ärzten. Aus diesem Grund warb man im Ausland um Mediziner. In den kommenden Jahren wuchs die Zahl der angeworbenen Ärzte auf etwa 11.000, wobei über 2.000 aus der Türkei kamen. 1970 wurde die Türkisch-Deutsche Medizinergesellschaft e. V. (TDM) in Wiesbaden gegründet. Eines ihrer Ziele war es, die berufliche Integration in Deutschland zu erleichtern.7
2.2 Regionalspezifische Erkrankungen
Es lassen sich eine Reihe von genetisch bedingten Erkrankungen ermitteln, die, abhängig von der Region, besonders häufig auftreten. Es ist also wichtig, dass gerade die Hausärzte bei manchen Patienten und Erkrankungen einen besonderen Blick für die regionalspezifischen Erkrankungen bei MMH haben und dazu Aufklärung betreiben. Insbesondere Ernährungsgewohnheiten, Stoffwechselstörungen, nahrungsmittelinduzierte gastrointestinale Beschwerden, Allergien und Unverträglichkeiten wie z. B. Laktose- und Fruktoseintoleranz in Asien sind wichtige Themen der Ernährungsmedizin, v. a. beim Hausarzt.
Auch in Zukunft sollte die Pharmakologie bei der Produktion von Präparaten verstärkt ein Augenmerk z. B. auf billige Bestandteile wie Laktose richten, denn durch entstandene Unverträglichkeiten können die Wirkung und Dosis vieler Medikamente erheblich reduziert werden. Wir wissen außerdem, dass der Stoffwechsel häufig nicht nur geschlechts- und altersspezifisch ist, sondern auch ethnisch unterschiedlich im Organismus abläuft. Die Initialdosierung mancher Medikamente wie z. B. Risperidon kann dabei erheblich variieren.
Bluterkrankungen (Sichelzellenanämie, Thalassämie)
Durch Veränderungen des roten Blutfarbstoffs kommt es zu einer chronischen Blutarmut, was den Menschen einen gewissen Schutz vor Malariaerkrankungen bietet. Die Sichelzellenanämie hat ihre größte Verbreitung in den Malariagebieten Afrikas und Asiens (bis zu 40 % der Bevölkerung). Die Häufigkeit nimmt mit dem Abstand zum Äquator stark ab.8
Familiäres Mittelmeerfieber (FMF)
Hierbei handelt es sich um eine Krankheit, die sich in unklaren Fieberschüben äußert, die über Stunden oder auch Wochen immer wieder auftreten.9 Besonders häufig tritt die genetische Mutation primär bei Bevölkerungsgruppen des Mittelmeerraumes auf, aber auch bei Juden, anatolischen Türken und Armeniern.
Morbus Gaucher
Bei dieser Erbkrankheit handelt es sich um eine Fettstoffwechselstörung, die auf einen Enzymmangel zurückzuführen ist. Nicht abgebaute Fettstoffe reichern sich in den Fresszellen des Körpers an, die zu dicken Speicherzellen anschwellen (Gaucher-Zellen). Diese wiederum sammeln sich z. B. in der Milz oder Leber an und führen zu unterschiedlichen Beschwerden. Türkische und jüdische Bevölkerungsgruppen sind hiervon besonders stark betroffen.10
Multiple Sklerose (MS)
Man schätzt, dass über zwei Millionen Menschen an MS erkrankt sind, wobei die Häufigkeit geographisch stark schwankt. Auf den Orkney-Inseln kommt diese Krankheit z. B. deutlich häufiger vor als in Japan. Bei Schwarzafrikanern war diese Krankheit bis vor 30 Jahren unbekannt, und die Zahl der Neuerkrankungen liegt immer noch deutlich unter der Zahl bei Weißen.11
Fehlbildungen
Verwandtschaftsehen sind je nach Kulturkreis mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptiert. Auch in Deutschland ist eine Ehe zwischen Cousin und Cousine erlaubt. Allerdings erhöht sich das Risiko für Kinder aus diesen Ehen, Fehlbildungen aufzuweisen. Liegt das Risiko bei nicht verwandten Paaren bei 3 % bis 5 %, so ist es bei einer Ehe zwischen Cousin und Cousine doppelt so hoch. Verwandtschaftsehen sind im türkischen und iranischen Kulturkreis (21–25 %), aber auch insgesamt im Nahen Osten traditionell stark verbreitet und werden über Generationen praktiziert. Ebenso kann man dies bei speziellen Enklaven wie den Amischen in den USA beobachten. Im südlichen Indien und in einigen Regionen Pakistans beträgt der Anteil von Verwandtschaftsehen 50 % bis 60 %.
Die Ursache für die Zunahme von Erkrankungen und Fehlbildungen liegt in den krankhaften Mutationen von rezessiven Genen.12 Viertausend solcher Gene sind bereits bekannt, und man schätzt, dass jeder Mensch ein bis vier solcher Gene aufweist. Wenn zwei rezessive Gene zusammentreffen, wird eine Krankheit sichtbar (z. B. Sichelzellenanämie). Daher erhöht sich das Risiko bei dominanten Erbkrankheiten nicht, da diese sich auf jeden Fall durchsetzen. Mit zunehmender Einwanderung wird das Thema Heiraten zwischen Verwandten und Heiraten mit Minderjährigen akuter.
2.3 Migrationsspezifische Erkrankungen, Gastroenterologie
Dr. med. Irene Schmidt
Es gibt bei Migranten genetisch und epidemiologisch bedingte Häufungen von Erkrankungen, die einen besonderen Ansatz im Bereich der Diagnostik und Therapie erfordern. Die Kenntnisse und Erfahrungen durch Hausärzte in diesem Bereich sind für die medizinische Versorgung von MMH enorm wichtig. Exemplarisch sollen im Folgenden drei Erkrankungen kurz vorgestellt werden.
Laktoseintoleranz
Diese Krankheit ist durch einen angeborenen Enzymmangel bedingt. Durch das Enzym Laktase wird der Zweifachzucker in seine Bestandteile Glukose und Galaktose zerlegt. Bei einem Enzymmangel gelangt der Zweifachzucker Laktose in den Dünndarm und wird dort von Bakterien zersetzt, es entstehen Darmgase (Wasserstoff und Kohlendioxid) sowie kurzkettige Fettsäuren. Die Beschwerden sind Blähungen, Bauchschmerzen und ggf. auch Diarrhöen und Sodbrennen. Andere Beschwerden wie Migräne und Müdigkeit können ebenfalls auftreten.
Die Ausprägung des Enzymmangels ist regional sehr unterschiedlich. Es besteht ein starkes Nord-Süd-Gefälle:13
Skandinavien: 3–8 % der Bevölkerung
Deutschland: 13–14 %
Mittelmeerraum: 70 %
Afrika (Äquatorialzone): 98 %
Wichtig ist hier anzumerken, dass Laktose nicht nur in Milchprodukten enthalten ist, sondern häufig industriell zugesetzt wird, wie in Backwaren, Fertigprodukten und einigen anderen Produkten. Migranten können insbesondere durch die ungewohnte Ernährung im Immigrationsland bei bestehendem Enzymmangel erhebliche Beschwerden bekommen, was man jedoch gut diagnostizieren und therapieren kann.
Helicobacter-pylori-Infektion
Die Helicobacter-pylori-Infektion führt zu Entzündungen der Magenschleimhaut (Gastritis), bis hin zur Entstehung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, und sie erhöht das Risiko für Magenkrebs und Magenlymphom. 50 % der Menschen weltweit sind mit Helicobacter pylori infiziert, wobei nur ein Teil der Patienten dadurch Beschwerden und oben genannte Komplikationen bekommt. Dabei besteht ein auffälliges Gefälle zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern, wobei hier die höhere Zahl von Geschwistern in den Entwicklungsländern die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion erhöht.
In der Therapie der durch Helicobacter pylori bedingten Magenerkrankungen werden Antibiotika eingesetzt, wobei auf die hohe Resistenz gegen Clarithromycin (20 % in Süd- und Osteuropa) zu achten ist und primär andere Antibiotikaschemata bei diesen Patienten eingesetzt werden sollten (bismuthaltige Quadrupeltherapie).14 Ein anderes Beispiel für Besonderheiten in der Resistenzlage ist die Infektion mit Lamblien: Diese wird in Europa vor allem mit Metronidazol behandelt, bei Patienten oder Infizierten aus dem indischen Subkontinent bestehen hierfür jedoch Resistenzen.15
Lebersteatose
Die durch metabolische Faktoren wie Übergewicht, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörung insbesondere in Industrieländern mit steigender Inzidenz auftretende Fettlebererkrankung (NAFLD) kann bei einigen Fällen zu einer Leberentzündung, der so genannten nicht alkoholischen Steatohepatitis, führen und konsekutiv im Verlauf das Risiko für Leberzirrhose und Leberkrebs erhöhen.
Ein interessanter Aspekt aus der Gentechnik-Forschung zeigt, dass beim Vorhandensein von oben genannten metabolischen Risikofaktoren das Risiko, ein NAFLD zu entwickeln, steigt. Das Protein MBOAT17 aktiviert Phospholipide und beeinflusst hierdurch auch den Arachnidonsäurestoffwechsel in den Leberzellen. Durch einen Gendefekt wird dieses Protein reduziert, exprimiert und erhöht dadurch das Risiko für eine Leberverfettung und im Verlauf auch für eine Entzündung und Fibrose der Leber. Dieser Gendefekt wird zu 67 % bei der hispanischen Bevölkerung und zu 83 % bei Kaukasiern festgestellt.
In Zukunft werden solche Gendefekte in bestimmten Ethnien im Hinblick auf die Risikostratifizierung eine vermehrte Rolle spielen. Auch wenn es in diesem speziellen Fall noch keine Empfehlung in den Leitlinien für diese Gruppe gibt, ist die Kenntnis der Prävalenz für den behandelnden Arzt im Einzelfall wichtig, um die Kontrolle und Einstellung des Risikoprofils ggf. strenger im Auge zu behalten.16
3. Lebenswelt und Sozialisation der Kulturen
3.1 Soziokulturelle Einflüsse am Beispiel Iran
Da es nicht »die Kultur« gibt, ist das Ziel des Buches und des Autors, zusammenhängende Anregungen zum Nachdenken und zum ärztlichen Handeln zu liefern. Es wird deshalb auch kein Anspruch auf Vollständigkeit der Beiträge erhoben. Die Entwicklungsgeschichte der Ethnien und deren Kulturen haben viele verschiedene Verhaltensweisen hervorgebracht, die es im interkulturellen Miteinander zu verstehen gilt. Häufig findet man die grundsätzliche Unterscheidung zwischen familiären, kollektivistischen und individualistischen Kulturen. Ihre grundsätzlich andere Vorstellung der Bedeutung der eigenen Person und der Gemeinschaft bringt im gesellschaftlichen Zusammenleben, aber auch in der Arzt-Patienten-Beziehung, sehr unterschiedliche Verhaltensweisen mit sich.
Die Familien-Gesellschaften sind z. B. u. a. in arabischen Ländern und insgesamt in Gesellschaften mit einer schwachen Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme und des Individualrechts verbreitet. Daher sind die Menschen stärker auf gegenseitige Unterstützung angewiesen.
Die folgende Tabelle stellt die grundsätzlich unterschiedlichen Selbstkonzepte der individualistisch bzw. kollektivistisch geprägten Gesellschaften vor:
Tab. 1: Independentes und interdependentes Selbstkonzept (Quelle: Ghilan, 2014; vgl. Asendorpf, 2004: S. 438.)
Wichtige Unterschiede in den Kulturen betreffen v. a. Wertvorstellungen, Normen und Sozialisationsformen. Deshalb spielen auch diese Faktoren bei der Migration/Integration und bei der Entwicklung von pädagogischpolitischen Konzepten eine wichtige Rolle.
In individualistisch geprägten Gesellschaften stehen Unabhängigkeit, Autonomie, Unterscheidbarkeit, individueller Erfolg und Respekt vor staatlichen Organen im Vordergrund. Schuldgefühle entstehen bei Verletzung von Prinzipien und Gesetzesübertretung.
Bei kollektivistischen Gesellschaften ist das Eingebunden-Sein, aber auch das Funktionieren in (groß-)familiären Strukturen von Bedeutung. Hier sind wichtige Werte Harmonie, Loyalität, starke soziale Netzwerke, Respekt gegenüber Älteren und Traditionen, feste Regeln bei der Erziehung und Orientierung im sozialen Bereich. Als Kehrseite gelten vermehrte Abhängigkeit, Hierarchiebildung und Statusdenken. Scham- und Schuldgefühle entstehen bei der Verletzung moralischer Normen.
Während in der individualistischen Kultur das Individuum im Mittelpunkt steht, befinden sich in der kollektivistischen Gesellschaft die Gruppe und deren Interessen im Mittelpunkt, was häufig in den individualistischen Aufnahmegesellschaften ein Zwangsverhalten mit psychosomatischen Beschwerden bedingen kann. Dies kann zu inneren Spannungen und Zerrissenheit zwischen den unterschiedlichen Wertesystemen, Normen und festen Regeln führen (zu Hause versus »draußen« und in der Schule) und auch eine Zweideutigkeit in der Sprache bewirken.
Während in der individualistischen Kultur und Erziehung (z. B. Teile von Europa, Amerika) Emotionen nach außen gerichtet und daher für Außenstehende leicht erkennbar sind, bleiben Emotionen bei Menschen aus dem asiatischen Raum (z. B. Japanern, Iranern und Chinesen) jederzeit kontrolliert und sind daher keinesfalls leicht zu erkennen bzw. zu verstehen. Die Kinder lernen bereits in der Kleinkindphase, negative Emotionen in ihren sozialen Beziehungen zu regulieren. Problematisch kann es werden, wenn negative Emotionen wie Wut, Ärger oder Ekel nach innen gekehrt werden. Denn wenn Ärger, Frust, Wut und Feindseligkeit nach innen gerichtet werden, können diese als Stressoren z. B. die koronare Herzkrankheit begünstigen.
An dieser Stelle sei auf die Promotionsarbeit von Donya A. Ghilan verwiesen (Ghilan, D., 2014, S. 1–70), die am Beispiel der in Deutschland lebenden Iraner untersucht hat, wie sich der Ausdruck von Ärger im Vergleich mit Deutschen unterscheidet und wie sich dieser Ausdruck im Verlauf einer Integration ändert. Bei Iranern wird das Leben im sozialen Miteinander ebenfalls kollektivistisch reguliert: Werte wie aberu (Ehre, Gesicht wahren), adab (Benehmen gegenüber einem höheren Status), ehteram (Respekt), gozasht (Verzeihung) und Unterdrückung von Ärger haben eine wichtige Funktion und führen auch bei Iranern zu vermehrtem, nach innen gerichtetem Ärger.
Bei Iranern werden Frustration und Wut verstärkt auf der partnerschaftlichen Beziehungsebene ausgedrückt, was zu partnerschaftlichen Belastungen führt. Bei zunehmender Integration wird, wie Ghilan zeigt, sowohl der nach innen als auch der nach außen gerichtete Ärger reduziert. Deshalb ist die Regulierung von Wut und Frustration in der Gesundheitspräventionsarbeit besonders wichtig. Hier sind insbesondere die Kompetenzen der versorgenden Hausärzte im Hinblick auf die psychosomatischen Beschwerden gefragt. Aber auch im gesellschaftlichen Zusammenleben sind das Verständnis und die Anpassung auf dieser emotionalen Basis enorm wichtig, um stressfreie Kommunikationsabläufe zu garantieren.
Auch der Umgang mit offener und direkt ausgesprochener Kritik kann bei einem Menschen aus kollektivistischen Gesellschaften aufgrund der oben genannten Wertvorstellung und Prägung rasch zu Kränkungen führen. Dies kann im Aufnahmeland, also in der individualistischen Gesellschaft, das Zusammenleben erschweren und im Beruf zu Stress führen.
Bei der Begegnung zwischen Deutschen und Iranern kann das iranische Kommunikationsverhalten »Taarof«, in dem höflichkeitsbedingt Angebote gemacht werden, die meist aber nicht ernst gemeint sind, zu starken Irritationen und Stress führen. Wenn man z. B. ein Kompliment wegen einer neu gekauften Jacke macht, wird diese aus Höflichkeit einem zum Geschenk angeboten.
Alle Menschen, die in andere Kulturkreise einwandern, sollten deshalb durch Selbstreflexion an den eigenen Emotionen arbeiten, um mit den entstehenden Widersprüchen zwischen Herkunfts- und Aufnahmekultur besser umgehen zu können.
Familiäre Begegnungen mit gemeinsamem Essen stehen in kollektivistischen Kulturen in der Freizeit stark im Vordergrund: Hier ein weiteres Stück Torte von der Gastgeberin abzulehnen, wäre unhöflich und kann als persönliche Ablehnung interpretiert werden. Im Bereich der Präventionsmedizin sollte über solche Rituale, z. B. beim Bestehen von Übergewicht, kultursensibel gesprochen werden. Interessant in diesem Zusammenhang wäre es, die psychosomatischen bzw. gesundheitlichen Aspekte der emotionalen Anpassungsprozesse der Menschen mit Migrationshintergrund in den Aufnahmekulturen durch gezielte Forschungen und Auswertung vorhandener Daten weiter zu untersuchen. Ebenso wichtig wäre es, zu untersuchen, welche Rolle die unterdrückten und widersprüchlichen Emotionen in der Pathogenese verschiedener Erkrankungen bei MMH spielen.
3.2 Orient: Patientenrolle, Betreuungsbedürfnisse und Erwartungen
Es sollen hier zur vereinfachten Orientierung einige allgemeine Anregungen angesprochen werden. Die Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis leben häufig in verstärkt abhängigen Beziehungen und genießen eine wirbezogene Erziehung bzw. Identität. Deshalb ist das Verhalten im Sozialen stark an der Einhaltung von Familientraditionen und an Gruppenharmonie orientiert. Dies gibt Sicherheit und Verpflichtung zugleich und kann den Angehörigen der Familie mentalen Schutz bieten. Die Verantwortung für die Familie liegt bei den Ältesten, in der Regel beim Vater als Familienoberhaupt. Im Erkrankungsfall hört man bei den Betroffenen öfter, dass die Menschen wehleidig sind und die Beschwerden manchmal demonstrativ und übertrieben kommuniziert werden. Hintergrund für dieses erlernte Verhalten ist, dass die sozialen Versorgungssysteme in den jeweiligen Herkunftsländern nicht für jeden zugänglich sind und hier die entsprechenden Erfahrungen fehlen. Deshalb erwartet man Hilfe, Heilung und Unterstützung insbesondere von der Familie und der weiteren Verwandtschaft.
Durch die emotionale Zuwendung von Familie und Angehörigen im Krankheitsfall werden die Heilungsprozesse beschleunigt. Probleme werden zum Teil in der Familie besprochen, oft aber eher verschwiegen und teilweise tabuisiert. MMH sind im Alltag mit ihren Gedanken, bedingt durch den Anpassungsdruck hinsichtlich der gesellschaftlichen Anforderungen in Deutschland, oft zwischen Vergangenheit und Zukunft hin- und hergerissen. Sie denken deduktiv (vom Allgemeinen zum Besonderen), indirekt und holistisch (ganzheitlich) und vernetzen sich auf sozialer Ebene tendenziell horizontal. Umschreibungen, Andeutungen und indirekte Formulierungen im sozialen Miteinander spielen eine wichtige Rolle.





























