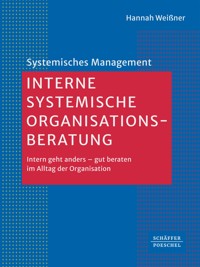
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Im Gegensatz zur externen Beratung, bei der Berater:innen nach ihrem Auftrag das System verlassen können, müssen interne Berater:innen dauerhaft mit den Menschen und Strukturen ihrer Organisation zusammenarbeiten. Der Kontext der Organisationszugehörigkeit verändert Arbeitsweisen, Bedeutungen und Leitplanken der systemischen Beratung fundamental und erfordert besondere Fähigkeiten und Strategien. Interne Berater:innen müssen in komplexen Kontexten agieren, multiple Aufträge balancieren und können sich nicht einfach zurückziehen, wenn die Bedingungen im System nicht passen. Trotz aller Herausforderungen bietet die interne Beratung auch einzigartige Möglichkeiten. Der tiefe und kontinuierliche Zugang zu Kolleg:innen und Prozessen erlaubt es internen Berater:innen, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Zudem ermöglicht das Verständnis der spezifischen Funktionsweisen der eigenen Organisation eine präzisere und effektivere Beratung. Das Buch plädiert für ein Verständnis der internen Beratung als eigenständiges Anwendungs- und Professionsfeld. Interne und externe Beratung können und sollten sich ergänzen, wobei jede ihre spezifischen Stärken und Perspektiven einbringt. Mit einem pragmatischen und realitätsnahen Ansatz richtet sich dieses Buch an interne Berater:innen, die Unterstützung und Anregungen für ihre tägliche Arbeit suchen, sowie an alle, die das Anwendungsfeld der internen systemischen Beratung besser kennenlernen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Einführung in ein Spannungsfeld: Interne und externe Beratung2 Gut beraten im Alltag der Organisation2.1 Rolle und Kontext als interne Berater:in2.2 Welche Verantwortung habe ich (nicht)?2.3 Aufträge annehmen und ablehnen2.4 Zusammenarbeit mit Externen2.5 Ich werde dafür bezahlt, Projektionsfläche zu sein?!2.6 »Bist du jetzt eine von denen da oben?«2.7 Anschlussfähig sein und dabei immer wieder etwas Neues machen2.8 Mutig sein und sich selbst ernst nehmen2.9 Was es heißt, auch nach dem Einsatz noch intern da zu sein2.10 Welchen Mehrwert biete ich eigentlich? – Selbstzweifel2.11 Selbstfürsorge2.12 Tetralemma – Wenn ich nicht weiterweiß2.13 Demut vor dem System – für mehr Gelassenheit3 Typische Themen in Organisationen3.1 Wer entscheidet was?3.2 »Mehr desselben«3.3 Gelernte Resignation3.4 Angst vor Widerstand, Konflikten oder Reibung3.5 Du bist, was du misst! – Softthemen messen3.6 Pendelbewegungen in der Organisation3.7 Resilienz3.8 Mehrdeutigkeit und Ambiguitätstoleranz3.9 Doppelaufgabe Beraten und Befähigen3.10 Unterstützung durch die Unternehmensleitung?!3.11 Was macht nachhaltige Veränderung aus?4 Was mich beschäftigt4.1 Haltungsveränderung bei Menschen als Ziel von Interventionen?4.2 Veränderung braucht eine fachliche Verankerung 4.3 Widerstand gibt es gar nicht?4.4 Wie wichtig ist die Art der Kommunikation?4.5 Wie schädlich ist Feedback?5 Wissen-schafft Sicherheit6 Und was sagen die Externen?7 AbschlussQuellen und LiteraturDanksagungDie AutorinBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Reihe Systemisches Management
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6273-0
Bestell-Nr. 12061-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6274-7
Bestell-Nr. 12061-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6275-4
Bestell-Nr. 12061-0150
Hannah Weißner
Interne systemische Organisationsberatung
1. Auflage, September 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Elke Renz, Stutensee
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Ich habe berufsbegleitend systemische Beratung studiert. Dies hat zur Folge, dass man sofort den Praxisbezug bekommt und das Gelesene oft direkt ausprobieren und/oder live erleben kann. Dabei wurde ich ziemlich schnell auf einen Punkt aufmerksam: Mein Eindruck war, dass viele Ausbilder:innen und Dozent:innen für Beratung externe Berater:innen waren – möglicherweise ohne berufliche Erfahrung als Angestellte innerhalb einer zu beratenden Organisation. Und: dass dies sich auch auf die Ausbildung auswirkte! Eigentlich wurde ich aus – sinngemäß – der folgenden oder einer ähnlichen Perspektive ausgebildet: Ich werde angefragt, komme von außen, berate professionell systemisch, gehe wieder und das System ist schon zum gewünschten Besseren entwickelt oder wird dies über kurz oder lang sein. Und wenn ich es gut gemacht habe, werde ich beim nächsten Mal wieder angefragt ...
Aber heute weiß ich: Es besteht ein bedeutsamer Unterschied beim täglichen Arbeiten und Beraten. Es ist von Bedeutung, ob ich von innen oder außen komme, intern oder extern bin. Intern geht anders!
Zwei eindrückliche Erlebnisse hatte ich immer wieder. Zum einen bei Vorträgen, Stellungnahmen oder Interventionsvorschlägen von »Externen«. Oft dachte ich mir hier: »Ja, aber habt ihr das mal als Interne gemacht?« oder »Wenn ich als interne Berater:in nur Aufträge unter diesen Bedingungen annehme, habe ich keine Aufträge mehr!«. Ich muss schließlich mit den Menschen danach wieder in der Kantine zusammensitzen oder in Projekten zusammenarbeiten. Und der Vorstand, dem gegenüber ich hier »wertschätzend respektlos« den Auftrag ablehnen soll, entscheidet über meinen Arbeitsvertrag.
Und zum anderen hatte ich in meiner täglichen Arbeit während des Studiums vor allem auch Momente, in denen ich dachte: »Davon habt ihr in euren Interventionstipps aber nichts geschrieben ... Diese Bedingungen wurden leider nicht erwähnt«.
Als interne Beraterin stehe ich in komplexen Kontexten, habe qua Rolle grundsätzlich multiple Aufträge und kann das System nach einem Auftrag nicht verlassen. Genauso wenig kann ich im Zweifelsfall sagen, »das System war halt noch nicht so weit«. Denn ich arbeite auch weiterhin in genau diesem System und bin darauf angewiesen, wieder engagiert und – vor allem – akzeptiert zu werden. Mein Ruf spricht sich nicht nur theoretisch unter meinen Beratungskunden herum, sondern tatsächlich und unglaublich schnell.
Vieles, was reflektiert und geschrieben wurde und in Ausbildungen über die Grundsätze des systemischen Arbeitens gesagt wird, ist meinem Erachten nach absolut richtig. Gleichzeitig finde ich, dass in der Ausbildung und der Literatur zum Thema systemische Beratung etwas fehlt: die Erfahrung und das Wissen, wie die (systemische) Theorie in der Praxis als interne Berater:in1innerhalb der eigenen Organisation übersetzt werden kann. Der Kontext der Organisationszugehörigkeit verändert Arbeitsweisen, Bedeutungen und Leitplanken der systemischen Beratung. Manchmal hat man den Eindruck, interne Beratung wird eher wie ein Problemfall der Beratung behandelt statt wie ein eigenes Anwendungsfeld, mit eigenem Kontext, der eine bestimmte Form von Ableitungen der Theorie bedarf. Aber genau das ist, meines Erachtens, notwendig, um den wunderbaren Möglichkeiten und natürlich auch Herausforderungen der internen Beratung gerecht zu werden. Interne Beratung kann genauso systemisch sein wie Beratung von extern. Es fehlt meines Erachtens jedoch bisher der Blick auf die interne Umsetzung des systemischen Beratungsansatzes in der Literatur und oft auch Ausbildung. Ich möchte damit beginnen, diese Lücke zu schließen. Dabei ist es mir ein Anliegen, möglichst realitätsnah, pragmatisch und umsetzbar zu sein. Dieses Buch kann also sowohl als Hilfestellung oder Anregung für das alltägliche Arbeiten als Berater:in innerhalb der Organisation gelesen werden, als auch von Menschen, die daran interessiert sind, dieses Anwendungsfeld der systemischen Theorie und Beratung besser kennenzulernen und zu verstehen.
Es könnte so anmuten, als würde dieses Buch eine Frontstellung gegen externe Beratung und Berater:innen beinhalten. Das soll es jedoch nicht sein, genauso wenig wie auf den folgenden Seiten die systemische Beratung neu erklärt werden soll. Es geht weder darum, interne und externe Beratung gegeneinander aufzustellen, noch darum, das systemische Rad neu zu erfinden. Ich möchte noch einmal verdeutlichen, was eigentlich sowieso bekannt ist: Es macht einen Unterschied, aus welcher Perspektive beraten wird!
Im besten Falle können sich interne und externe Berater:innen wunderbar ergänzen und zusammenarbeiten. Ich sehe intern und extern nicht als ein Entweder-oder, sondern als zwei Spielarten der systemischen Beratung mit eigenen Bedingungen und Bedeutungen. Da bisher die beiden Bereiche jedoch oft als einer betrachtet wurden, beschreibe ich immer wieder explizit den Unterschied.
1 In diesem Buch wird die Gender-Schreibweise mit dem Doppelpunkt verwendet. Gegenderte Begriffe wie z. B. Berater:in meinen also alle Geschlechter. Dies gilt auch, wenn ein Adjektiv wie »intern« oder »extern« vorangestellt und (als Leseerleichterung) nicht mit Doppelpunkt versehen ist.
1 Einführung in ein Spannungsfeld: Interne und externe Beratung
Es gibt sehr viel Literatur über Beratung und auch systemische Beratung. Bevor ich also einsteige in Beschreibungen, konkrete Hilfestellungen und Überlegungen für interne Organisationsberater:innen, ist es notwendig und hilfreich, hier als erstes eine Ab- bzw. Eingrenzung vorzunehmen. Zum einen, über wen dieses Buch spricht. Zum anderen, weshalb ich es für notwendig halte, dass gerade ich bzw. eine Interne über das Thema schreibt.
Über wen spreche ich also? Explizit schreibe ich vor allem über Prozessberater:innen, die sich im Feld der Organisationsentwicklung, von Change Management, Transformationsbegleitung und so weiter bewegen – mit dem kleinen methodischen Doppelpunkt: systemisch. Dieser Zusatz kommt daher, dass es der Beratungsansatz ist, dem ich selbst folge und den ich zu beurteilen wage. Es geht also vor allem um diejenigen, die im Grunde intern genau die gleiche Arbeit machen, wie auch externe systemische Organisationsberater:innen. Zusätzlich haben die internen systemischen Organisationsberater:innen die Möglichkeit, durch ihr Insiderwissen, ihren Radar für die Organisation und ihr Wissen über Trends und Methoden auch selbst aktiv Themen zu treiben. Ich meine aber, dass der Auftrag dafür innerhalb der unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Ich selbst habe die Diskussion darum, wie viele proaktive Themen einzubringen gewünscht, beauftragt und erlaubt ist, immer wieder geführt. Zum einen ist es durch die vielen Berührungspunkte mit der Organisation naheliegend, solche Themen zu erkennen, das Radar schlägt sowieso an, zum anderen treibt die Identifikation mit der Organisation innerlich an, einmal erkannte Themen voranbringen zu wollen. Aber gerade, weil dies immer ein Aushandeln um diese spezifische Aufgabe in der Organisation erfordert, ist es nicht der Kern meiner Betrachtungen.
Mit internen Berater:innen meine ich alle jene, die in der gleichen Organisation zu einem Großteil ihrer formulierten Arbeitsaufgabe Prozessberatung betreiben, in der sie auch angestellt sind. In einigen größeren Organisationen gibt es auch Beratungseinheiten, die zu Gesellschaften der Organisation gehören, aber nicht unter gleichen Firmierungen laufen. Es gibt dafür unterschiedliche betriebliche Konstrukte. Auch diese Berater:innen stehen je nach Nähe und Auftragsvolumen in der Mutterorganisation in einer Art internem Kontext und können daher sicherlich ebenfalls mögliche Entwicklungen antizipieren, haben aber vermutlich auch Spezifika, die ich in meinen Ausführungen hier nicht abdecken werde. Mir geht es um den beraterischen Alltag innerhalb der Organisation sowie typische organisationsinterne Muster, denen man begegnet. Es geht mir um den Kontext, der die Beratungsarbeit als interne spezifisch macht. Und darum, was die »Lehre« oder die »Profession« der systemischen Beratung im Kontext der internen Beratung bedeutet.
Fachexpert:innen aus sogenannten Governance- bzw. Corporate-Funktionen (z. B. Finance, Human Resources, Quality Management, Corporate Communication etc.) bewegen sich, neben den ihnen eigenen Rollenspezifika und Zielkonflikten zu den anderen betrieblichen Fachbereichen, sicherlich auch immer wieder in ähnlichen Bedingungen und Kontexten, wie ich aus jahrelanger eigener Erfahrung weiß. Aber ich sehe dennoch andere Schwerpunkte bzw. Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit. Diese Fachexpert:innen sind in ihren »Beratungsleistungen«, wenn man es so nennen möchte, inhaltlich sehr gebunden und spezifisch beauftragt – im Gegensatz zur Aufgabe der Prozessberatung. Weiter sind sie oft gesetzlichen Rahmenbedingungen unterworfen, die zu Zielkonflikten mit dem Unternehmen führen können, während sie gleichzeitig den Auftrag haben, Ziele und Regeln für andere Bereiche aufzustellen und einzufordern, ohne dafür disziplinarische Möglichkeiten zu haben. Vor allem aber haben sie einen anderen Auftrag im Unternehmen als jemand mit der Rolle einer Organisations- und Prozessberater:in. Je nach Person und Aufgabe innerhalb der Governance- und Corporate-Funktionen ist der Anteil an klassischer oder systemischer Beratungsarbeit unterschiedlich. Mit dieser Eingrenzung der Rolle der Organisationsberatung unterscheide ich mich bewusst von der bisherigen Literatur zum Thema (vgl. Krizanits 2011 und Krejci/Walser 2023). Bestimmt können auch Menschen in diesen Funktionen an vielen Punkten mitgehen und ihre Beratungsfähigkeiten in der Organisation erweitern. Sie sind aber nicht mein primärer Beobachtungsgegenstand, da dies ebenfalls ein unterschiedlich gelagerter Kontext für Beratung ist und seit langem eine übliche Rolle in Organisationen.
Es ist schade, dass bisher in der Fachliteratur so wenig über das Thema der internen systemischen Organisationsberatung nachgedacht wurde. Es gibt im deutschsprachigen Raum bisher nur ein nennenswertes Buch überhaupt zum Thema der internen Beratung (Krizanits 2011), was angesichts der Fülle an Beratungsliteratur schon verwunderlich ist. Andererseits ist das, was man hier über interne Beratung liest, vor allem aus der Perspektive von Personen geschrieben, die wahrscheinlich selbst nicht oder nur selten als interne Berater:innen arbeiten und bisweilen auch nie gearbeitet haben, solche aber häufig ausbilden (vgl. Krejci/Walser 2023). Wie der Titel dieses Kapitels schon sagt, bewegen wir uns hier in einem Spannungsfeld.
Im englischsprachigen Raum findet sich immerhin mehr Literatur zur internen Beratung. Die Unterscheidung wird häufiger gemacht; die besonderen Umstände der internen Beratung werden erkannt und benannt. Aber auch diese Literatur ist hauptsächlich bereits älter und nicht von internen Berater:innen geschrieben worden (vgl. Weiss 2003; Phillips et al. 2015). Scott und Barnes jedoch gehen in ihrem Werk auf viele wichtige Punkte ein; sie verarbeiten insgesamt 100 Interviews mit internen Berater:innen im weitesten Sinne und kommen damit einer internen Perspektive noch am nächsten (vgl. Scott/Barnes 2000).
Was man über interne Beratung liest (und lernt), stammt somit zum überwiegenden Teil aus der Beobachtung externer Berater:innen, die sich zuweilen in bewusster oder unbewusster Konkurrenz zu ihren internen Kolleg:innen empfinden. In den beiden Interviews, die Bestandteil dieses Buches sind, klingt dieser Aspekt erkennbar durch. Externe Berater:innen haben nur einen zeitlich sowie räumlich begrenzten und zweckgebundenen Zugang und damit beschränkte Beobachtungsmöglichkeiten im System, in dem sich die internen dagegen alltäglich bewegen. Trotzdem begegnen einem unter Berater:innen immer wieder einige Mythen über den Unterschied zwischen externer und interner Beratung, die sich hartnäckig halten und schon fast zu Stereotypen geronnen sind.
Ich wähle dabei ganz bewusst den Begriff des Mythos. Nach dem Spektrum Lexikon der Psychologie beispielsweise definiert sich dieser so: »Überlieferte Dichtung, Sage, Erzählung aus der Vorzeit eines Volkes, die sich häufig auf Götter, Dämonen, die Entstehung der Welt und des Menschen bezieht. Der Mythos wird im Gegensatz zu Märchen für wahr gehalten und bietet damit ein geschlossenes Weltbild, das handlungsleitend wirkt« (Spektrum Lexikon der Psychologie: Mythos). Die Mythen, die über interne Beratung sowie interne Berater:innen existieren, werden – noch immer in der Überzeugung, dass sie wahr sind – sowohl in der Literatur, aber auch in aktuellen Aussagen externer Berater:innen weiter gepflegt. Auch diese Mythen tauchen in den genannten beiden Interviews auf. Darauf sei jetzt schon hingewiesen. Und man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie auch handlungsleitend wirken – ob im alltäglichen Umgang und/oder der Ausbildung von Berater:innen. In der Fachliteratur haben sie jedenfalls ihren Niederschlag gefunden (vgl. Krejci/Walser 2023).
Einige sehr verbreitete und hartnäckige Annahmen, Narrative und Mythen möchte ich daher direkt zu Beginn dieses Buches aufgreifen und mich auch kurz damit auseinandersetzen.
Betriebsblindheit
Vermutlich ist der Vorwurf der »Betriebsblindheit« mit der erste, der erhoben wird, wenn an interne Beratung gedacht oder über sie aus externer Perspektive gesprochen wird. Betriebsblindheit meint dann wohl eine spezifisch eingeschränkte Wahrnehmung, was die Themen innerhalb eines Unternehmens betrifft. So, als blende der/die interne Berater:in (un)bewusst spezifische Teile des Ganzen aus oder habe blinde Flecken.
Ohne den späteren Ausführungen vorgreifen zu wollen, sei dazu kurz gesagt: Sicherlich ist es für Interne ratsam, immer mal wieder einen inneren Abstand zu schaffen, um auf das System zu blicken. Gleichzeitig gilt das für Externe ebenso. Auch sie können in dem beschriebenen Sinn betriebsblind werden und/oder vertrauten Routinen folgen, z. B. in Hypothesen, warum wohl Systeme auf eine bestimmte Art reagieren und so weiter.
Es ist kein Spezifikum interner Beratung, dass ich immer wieder darauf zu achten habe, woher meine Annahmen rühren, aus welchen Eindrücken ich meine Hypothesen ableite. Es handelt sich hier um eine systemische Grundkompetenz. Denn eines der häufigsten Phänomene in der Beratung ist ja, dass man sich plötzlich dabei ertappt, etwas in das Klientensystem zu projizieren oder anderes nicht zu bemerken.
Trotzdem hält sich der Mythos der Betriebsblindheit der internen Beratung hartnäckig. So als gäbe es dieses Phänomen für externe Berater:innen nicht oder nur ganz selten. Vielleicht hat das etwas mit den Zugangsmöglichkeiten der externen Beratung zu tun. Externe Beratung hat immer nur diesen Zugang von außen. »Der Externe agiert nicht deshalb als Berater, weil das die einzig mögliche Rolle für einen Organisationsexperten ist, sondern weil es die einzig mögliche Rolle des Externen ist« (Wabnegg 2008).
Der hohe Wert des Anfangs
Von Externen wird, in scheinbarem Unterschied zu Internen, oft dem Anfang eines Prozesses ein sehr hoher Wert beigemessen. Er soll tiefgreifend, überraschend, knallig oder was auch immer sein, nach dem Motto: »Ein guter Anfang ist mindestens die halbe Miete«.
Fraglos ist eine saubere Auftragsklärung als Beginn, wie man sehen wird, immer und damit auch in der internen Beratung grundlegend – hier liegt aber kein Unterschied. Es ist aber Folgendes zu beobachten: Die unterschiedliche Verweildauer im Klientensystem verschiebt mitunter die Interpunktion, die innerhalb eines Prozesses gemacht werden kann. Der Begriff der Interpunktion bezeichnet die Einschätzung, welche Interaktionen logisch und zeitlich gut aufeinanderpassen oder zusammengehören. Wenn Externe nur eine Zeitspanne von beispielsweise einem halben Jahr Zeit haben, in der Organisation zu wirken, müssen sie notgedrungen eine andere Taktung haben und einen anderen Fokus legen, als wenn ich intern ein Jahr Zeit habe oder gar über noch längere Zeit immer wieder aktiv werden kann. Als Interne kann ich auch an mehreren relevanten Stellen gleichzeitig wirken, im Gegensatz zu einem auch räumlich begrenzten Auftrag. Unterschiedliche Rahmenbedingungen formen unterschiedliche Möglichkeiten und Fokussierungen. Im Verlauf der nächsten Kapitel werde ich darstellen, wie man intern die nötige Distanz wahrt und nach Professionalität strebt (vgl. Krizanits 2011: 62).
»Der Prophet im eigenen Land« und Vertrauen
Direkt nach dem Mythos der angeblichen Betriebsblindheit wird gerne der des »Propheten im eigenen Land« angeführt, dem man nicht glaubt oder vertraut. Je nach Auslegung soll damit ausgedrückt werden, dass den Äußerungen der Internen nicht geglaubt oder ihre Impulse in der Organisation nicht angenommen würden. Oder Interne erhielten schwerer einen Zugang zu Managementebenen. Sie könnten schlechter bestimmte Rahmenbedingungen einfordern (vgl. dazu ebenfalls Aussagen der Interviews am Ende dieses Buches, vgl. Krizanits 2011: 60 f.). Gleichzeitig ist es jedoch so, dass Interne häufig einen Vertrauensvorschuss erhalten, da sie Mitglieder der Organisation sind (vgl. Krizanits 2011: 61) und, wie später (Kap. 2.1) noch gezeigt wird, immer schon einen gemeinsamen Auftrag mitbringen. Natürlich stößt man auch als Interne:r immer wieder mal auf taube Ohren, so dass es sich anfühlt, als würde einem gerade als Interne:r nicht geglaubt. Das hat unter Umständen auch etwas mit dem Zeitpunkt zu tun, wann etwas ausgesprochen wird. Interne sind bisweilen früher dran, Dinge zu erkennen oder zu benennen. Also zu einem Zeitpunkt, da diese noch nicht unbedingt durch die Organisation selbst erkannt wurden. Um hier Gehör zu finden, bedarf es immer viel Fingerspitzengefühl – egal von wem. Es ist also nicht ein Problem der Internen, dass man ihnen nicht glaubt, sondern sie stehen durch ihr Wissen häufiger in einem Kontext, in dem sie einen Bedarf vor ihren Auftraggeber:innen erkennen. Wenn Externe jedoch im Unternehmen auftauchen, sind sie schon beauftragt worden, weil die Organisation mittlerweile selbst einen Bedarf erkannt hat.
Interne können nicht irritieren und sind abhängig
Es ist eine der Grundannahmen in der Beratung, dass ich anschlussfähig an das Klientensystem sein muss, damit ich mich als Berater:in ankoppeln kann, Muster kennenlernen, vertraute Kultur erleben kann und so weiter. Und dass ich dadurch das Klientensystem, wenn nötig und hilfreich, methodisch »irritieren« kann. Also bisher Vertrautes gezielt verwirren, perturbieren kann, um im besten Fall neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Auch mal mutig oder frech.
Es ist gerade dieses Ankoppeln, das Internen häufig sogar leichter als Externen fällt. Dies wird zwar häufig noch anerkannt, dann aber werden gerne fehlende Irritationsmöglichkeiten unterstellt, weil – natürlich! – Abhängigkeit da sei.
Aber »Irritation muss nicht Provokation sein; sie hat stattgefunden, wenn Reflexion einsetzt und neue Kommunikationsanschlüsse entstehen« (Krizanits 2011: 61). Man muss, um professionell zu beraten, nicht notwendigerweise den Schneid haben, besonders barsch gegenüber seinem Vorstand aufzutreten. Das kann man übrigens auch als Externe:r nicht unbedingt – zumal die Gefahr, dann einen Auftrag zu verlieren oder nicht zu erhalten, für Externe bei zu viel »Irritation« genauso besteht, wie für Interne das Risiko, ihren Einfluss zu verlieren. Wenn man schon von Abhängigkeit als spürbarer Rahmenbedingung von Beratung sprechen will, dann ist dies ein Kontext, unter dem Interne wie Externe arbeiten, mit den jeweils spezifischen Konnotationen.
Beratung muss aus allen Kontexten heraus auf die Ausgewogenheit von Provokation, Irritation und Anschlussfähigkeit achten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Phänomen ›Abhängigkeit‹ aus der externen Perspektive relevanter erscheint, als es sich in der Unternehmenswirklichkeit auswirkt. Wenn mir als Interner mal etwas daneben geht, verliere ich nicht direkt meinen Job. Aufgrund einer fehlgeschlagenen Moderation wird mir niemand kündigen, eher bekomme ich noch einmal eine Chance. Als Externe kann es mir passieren, dass ich danach eben nicht mehr gebucht werden. Trotzdem scheint es, als kokettierten manche Externe gerne mit dem Etikett ihrer scheinbaren Unabhängigkeit vom System, während sie eigentlich auch existenziell davon abhängig sind, Aufträge zu erhalten. Mit steigendem Erfolg und wachsender Kundenmenge mag es so sein, dass ich als Externe unabhängiger von einzelnen Kunden werde, aber auch als Interne werde ich mit guter Arbeit immer freier, da meiner Person Kompetenz und Fachwissen unterstellt wird und meine Aussagen oder auch »Prophezeiungen«, um hier nochmal den Bogen zu schlagen, damit mehr Gewicht bekommen.
Intern zu sein widerspricht der Zugehörigkeit zur Beraterprofession oder der professionellen Arbeit
Im Grunde ist das vermutlich der Mythos, der eine Art Grundstein legt für erlebte, gefühlte und in der Literatur beschriebene Spannungen zwischen externer und interner Beratungsarbeit. Ich habe ihn hier trotzdem ans Ende meiner Aufzählung gesetzt, da ich hoffe, dass bis hierher schon deutlich wurde, dass dieser Mythos tatsächlich ein Märchen ist. Interne Beratung ist ein spezifischer Kontext von Beratung, aber sicher kein Hinderungsgrund professionell zu arbeiten!
Es entstehen keine zusätzlichen oder unlösbaren Probleme oder Paradoxien allein dadurch, dass ich intern berate. Vielmehr entstehen diese Mythen und Narrative meines Erachtens durch fehlendes Wissen und Verständnis dafür, dass die systemischen Theoreme oder Grundsätze in der internen Welt einfach auf andere Art als gedacht umgesetzt werden können und müssen. Eben weil sich der Kontext verändert. Die Unschärfe in der Unterscheidung zwischen Prozessberatung und Governance/Corporate Funktionen kann dafür ein Beispiel sein. Dass etwa Entscheidungen nicht von den Experten getroffen werden, sondern von der Hierarchie, ist kein Problem der internen Beratung, wie es zuweilen dargestellt wird (vgl. Krejci/Walser 2023: 32), sondern Alltag in jedem Unternehmen, für sehr viele Angestellte und übrigens auch für externe Berater:innen. Denn zumindest nach meinem Verständnis treffen auch externe Berater:innen nicht die Entscheidungen in Veränderungsprozessen, sondern die Auftraggebenden.
Systemische Suchtberatung ist ebenfalls etwas anderes als systemische Familienberatung, aber deshalb widerspricht der eine Kontext nicht der Professionalität des anderen. Wenn ich jedoch die Bedeutung der systemischen Theorie für den Kontext Beratung von »extern« eins zu eins auf den Kontext Beratung von »intern« umlege, dann mag es mir so erscheinen, als entstünden da unlösbare Probleme und im Grunde selbstgenerierte Grenzen.
Einige Missverständnisse und Mythen entstehen daraus, dass aus einer anderen Perspektive abgeleitet wird, die interne Beratung hätte an sich Schwierigkeiten – wo es im Grunde um einen anderen Kontext geht. Die Gefahr dabei ist, dass diese Mythen am Ende handlungsleitend werden oder zu hinderlichen Selbst- und/oder Fremdbildern geraten.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Die eben skizzierten Zusammenhänge machen deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Reflexion der Rahmenbedingungen von interner Beratung bewegt. Sie wird aus der externen Perspektive nur undeutlich wahrgenommen und in einer Art beurteilt, die ihren Besonderheiten nicht gerecht wird.
Alles, was nun folgt, soll dagegen eine praktische Hilfestellung sein, eben diesen speziellen Kontext für die systemische Organisationsberatung näher zu betrachten, ihn in seiner Bedeutung für die Arbeit besser zu verstehen. Ich werde Erfahrungen einbringen und Hypothesen zu organisationalen Themen aus einer internen systemischen Perspektive für alle Interessierten anbieten.
2 Gut beraten im Alltag der Organisation
2.1 Rolle und Kontext als interne Berater:in
Beginnen möchte ich mit dem Thema »Rolle und Kontext als interne Berater:in«. Warum? Ich arbeite seit mehreren Jahren in einem Global Player, einem Konzern, der weltweit agiert, fest angestellt als Change Managerin in der Personal- und Organisationsentwicklung. Ich bin also schon qua Arbeitsvertrag in multiplen Rollen unterwegs, z. B. als interne Berater:in, Trainer:in, Coach und so weiter. Um nicht immer alle aufzählen zu müssen, beschränke ich mich auf die Bezeichnung Berater:in. Als interne Berater:in gehört es zu meinem Alltag, in unserem Unternehmen in komplexen Auftragsverhältnissen zu arbeiten und zu beraten. Genau zu reflektieren, in welchem Kontext und welcher Rolle ich mich gerade bewege, ist daher eine selbstverständliche, alltägliche Aufgabe und verschafft mir eine verlässliche, professionelle Grundlage für die Arbeit. Das mag übertrieben oder auch etwas theoretisch anmuten! Aber im Zweifelsfall – wenn ich unsicher oder ratlos bin, was meine Möglichkeiten oder Positionen in einer Beratung sein könnten – ist es genau diese Grundlage, die mir wieder Halt und Orientierung gibt. Starten wir also mit einem Blick auf dieses Fundament.
Schon auf den ersten Blick öffnet sich eine Art Dilemma. Klassischerweise wird in der Beratungsliteratur von zwei Systemen gesprochen: Dem beratenden oder Beratungssystem und dem zu beratenden bzw. Klientensystem. Dabei, so ist die quasi dogmatische Annahme, ist es für eine erfolgreiche Beratung äußerst hilfreich – wenn nicht gar Voraussetzung! –, wenn die Beraterin oder der Berater nicht Teil des zu beratenden Systems ist. Dahinter steht die systemische Kernaussage, dass es eine gedankliche Trennung bzw. Bewusstheit über den Unterschied zwischen mir und dem System, das ich berate, geben sollte.
Ich bin aber Angestellte unseres Unternehmens, also intern, und damit automatisch Teil des zu beratenden Systems. Kann ich also gar keine wirklich gute Beraterin sein?
Meine Hypothese: Es ist nicht so, dass die Beratungsliteratur hier im Kern unrecht hat. Aber meine Erfahrung ist, als Interne sollte man den Begriff »Systemzugehörigkeit« zwar ernst, aber nicht zu wörtlich nehmen. Natürlich muss ich mir immer wieder klar machen, dass ich in meiner Rolle als Beraterin während des Beratungsprozesses Beobachtungen mache und dass mir Phänomene auffallen, deren Bedeutung ich aus meiner ganz subjektiven Erfahrung heraus interpretiere. Natürlich muss ich mir selbst klar machen, weshalb ich meinen Wahrnehmungen jeweils bestimmte Bedeutungen beimesse. Warum ich etwas wie interpretiere. Die systemische Kernaussage zur größtmöglichen Distanz zum System bleibt natürlich wichtig. Das heißt für mich aber nicht, dass ich nur als jemand, der oder die nicht organisationszugehörig ist, professionell beraten könnte. Ich muss mir aber immer wieder Rechenschaft über die damit verbundenen Implikationen ablegen. Um die gedankliche Trennung und damit Bewusstheit dieser Implikationen zu erreichen, brauche ich gerade das Wissen um meine eigenen Zugehörigkeiten und Zuschreibungen.
Die Person
Fangen wir mit der internen Beraterin oder dem Berater als Person an. Es klingt vielleicht banal, soll aber trotzdem hier nicht unterschlagen werden: Eine interne Berater:in ist zuerst einmal eine Person mit einer subjektiven, in sich plausiblen Perspektive auf sich und andere. Dies bedeutet, auch sie kann – ganz menschlich – nicht so einfach aus der eigenen Haut heraus und reagiert in Sekundenbruchteilen auf die Impulse aus ihrem eigenen Inneren. Also vor allem auf die eigenen Wahrnehmungen und Gedanken, Muster, Routinen, Angewohnheiten und Erfahrungen. Das klingt vielleicht etwas beschränkend, ist aber auch zugleich das Wertvollste, das für die Arbeit als Beraterin oder Berater zur Verfügung steht.
Die Rolle und Funktion in der Organisation
Als Interne:r ist man Teil des Unternehmens oder der Organisation, in der man arbeitet. Man hat unterschrieben, die eigene Arbeitskraft und sein Schaffen in einem festgelegten Zeitrahmen zum Wohl dieser Organisation einzubringen und sich daran zu beteiligen, das Überleben dieses Systems zu sichern. Dafür erhält man in der Regel ein Gehalt und Urlaubstage zuzüglich dem, was man sonst noch aushandeln konnte. Im Gegenzug hat man ebenfalls unterschrieben, sich an Betriebsvereinbarungen und Regelungen in der Organisation zu halten.
Damit ist im Zweifelsfall mein erster Auftrag immer, das Überleben der Organisation zu sichern bzw. zu fördern. Und das ist auch der Auftrag aller anderen in dieser Organisation, mit denen ich möglicherweise in einer Beratung zu tun habe. Diese Verpflichtung und den daraus resultierenden Auftrag kann ich allen immer unterstellen und als Basis nutzen. Unterschiedlich ist jedoch, welche Bedeutung die Einzelnen diesem Auftrag geben und wie sie sich seine Erfüllung vorstellen.
Um es einmal stark vereinfacht und skizzenhaft zu beschreiben: Alle Organisationen müssen sich irgendwie organisieren, um gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben erfüllen zu können und zu überleben. Klassischerweise tun Organisationen dies, indem sie unterschiedliche Bereiche, Abteilungen und Teams begründen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben und Zwecke innerhalb der Organisation erfüllen – immer mit dem Auftrag, das Überleben der Gesamtorganisation zu sichern: Die Entwicklung entwickelt die Produkte, die Produktion produziert sie, die Logistik liefert sie, der Vertrieb unterhält den Kontakt zu den Kunden und holt die Aufträge, Finanzen kümmert sich darum, das Geld zu verwalten, der Einkauf kauft ein, was alle zum Arbeiten brauchen und das Personalwesen sorgt dafür, dass die Menschen in der Organisation gut angebunden sind. All diese Bereiche bilden für sich wieder eigene Subsysteme, die nach ihren eigenen Regeln funktionieren, ihre eigene Kultur haben, auf sich selbst reagieren – und das meist ohne es zu merken.Und vor allem folgen sie ihrer eigenen oder der vorgegebenen Idee zum Erfüllen ihres Auftrages zum Überleben der Organisation.
In irgendeinem Bereich ist man auch als interne Berater:in selbst verortet, hat also eine Chefin oder einen Chef mit Zielen, eine Abteilung, der man angehört und vielleicht auch ein Team mit einem spezifischen Auftrag, um das Überleben der Organisation zu sichern.
Das heißt: Als interne Berater:in ist man Angestellte:r einer Organisation mit Arbeitsvertrag und zudem zugeordnet bzw. eingeordnet in eine Hierarchie mit Vorgesetzten und einer Abteilung mit eigenen Zielen und Regeln. Eine der Aufgaben innerhalb der Organisation ist es, andere in der Organisation zu beraten. So steht es im Vertrag oder der Aufgabenbeschreibung.
Werfen wir zur besseren Abgrenzung einen kurzen Blick auf außerhalb des Unternehmens: Im Rahmen meiner Tätigkeit arbeite ich immer wieder mit Berater:innen zusammen, die wir zusätzlich für bestimmte Aufgabenstellungen verpflichten und die von außen kommen, also keine Unternehmensangehörige sind, sondern eben Externe. Wenn ich nun auf eine dieser externen Berater:innen blicke und ebenfalls eher skizzenhaft darstelle, dann treffe ich hier möglicherweise eine Person, die als Selbständige oder als Angestellte einer Beratungsfirma arbeitet, im besten Fall ebenfalls systemisch ausgebildet. Sie wird von uns beauftragt, in einem konkreten, zeitlich befristeten Kontext allein oder in Kooperation mit uns tätig zu werden. Natürlich geschieht ihre Beauftragung ebenfalls im Rahmen des Globalauftrags, für das erfolgreiche Weiterbestehen des Unternehmens zu arbeiten, nur wird dies stillschweigend vorausgesetzt, aber nicht expressis verbis kommuniziert. Als Externe erfüllt sie qua Rolle die oben beschriebene Kernvoraussetzung der möglichst weitgehenden Unabhängigkeit vom Auftraggeber. Sie muss sich – zumindest, wenn sie nur für einen einzigen Auftrag engagiert wurde – wenig Gedanken über Verflechtungen mit dem Unternehmen machen, kann sich möglicherweise stark auf Erfolgskriterien und Prozesssteuerung konzentrieren, muss dafür natürlich auf Anschlussfähigkeit achten, also gewährleisten, dass sie so weit in der Logik der Organisation agiert, dass sie angenommen wird – und sie geht im Regelfall nach der Beauftragung wieder.
Ich als Interne bleibe im Unternehmen. Für mich selbst beispielsweise heißt die kontinuierliche Aufgabe dabei »Change Management«. Das steht zum einen in meinem Arbeitsvertrag und dafür bekomme ich Geld. Zum anderen steht es nochmal genauer ausgeführt in meiner Aufgabenbeschreibung. Das sagt erstens aus, dass ich nicht einfach (aus welchen Gründen auch immer) aufhören könnte, Veränderungsprojekte zu beraten und zu begleiten, und zweitens, wie eben schon ausgeführt, dass ein Ziel dabei immer sein muss, das Überleben des Unternehmens zu sichern oder zumindest nicht zu gefährden. Egal welchen Beratungsauftrag ich in der Organisation annehme, diese Rahmensetzung, diesen Unternehmensauftrag habe ich immer mit im Gepäck – das ist mein Job. Genauso haben auch alle meine Gegenüber – um es noch einmal zu betonen – diesen Auftrag, der sich natürlich je nach Bereich und Abteilung unterschiedlich darstellen kann. Dadurch also, dass ich ein Teil der Organisation bin, habe ich bei jeder Beratung einen vorgegebenen Auftragsrahmen.
Ich denke, vielleicht führt unter anderem dieser Bedingungszusammenhang zu der Annahme, intern könne man nicht gut oder nur schlechter als Externe beraten.
Aber ich möchte hier darauf aufmerksam machen, dass ich dadurch lediglich EINEN Auftrag habe, jedoch nicht meinen einzigen. In jedem einzelnen Beratungsprozess habe ich, wie jede Berater:in, Aufträge für den spezifischen Beratungsprozess: Moderation, Coaching der Führungskräfte etc. Und, genauso wichtig: Ich habe mit meinen Auftraggeber:innen im Prozess einen gemeinsamen Auftrag für die Organisation. Wir alle als vertragliche Mitglieder derselben Organisation sollen und wollen deren Überleben sichern. Dieser Auftrag ist also nicht etwa ein Widerspruch zu einem guten Beratungsprozess, sondern ein gemeinsames Ziel. Besinne ich mich darauf, habe ich immer eine gemeinsame Arbeitsbasis, die ich nicht erst schaffen muss. Nur durch meine Zugehörigkeit zur selben Organisation habe ich einen gemeinsamen Ausgangspunkt und eine Arbeitsbeziehung, die ich nicht erst neu aufbauen muss. Immer wieder wird man sehen, wie wertvoll dies auch für einen Vertrauensaufbau ist.
Gleichzeitig kann ich »ganz normal« beratend agieren: also die neugierig-naiven Fragen stellen, die man nur als Fremde stellen kann. Oder eben verstehen wollen, worum es eigentlich geht. Denn eine Abteilung oder ein Team im Unternehmen, mit der oder dem ich nicht täglich zu tun habe, ist als mein Gegenüber auch ein für mich fremder Teil eines anderen (Sub-)Systems mit spezifischen Abläufen und Regeln, eigener Kultur und Logik, die ich versuchen muss, zu verstehen.
Klingt eigentlich ganz vertraut, denn – was uns die systemische Arbeit immer wieder ins Stammbuch schreibt – »bleibe stets neugierig auf das System!« ist eine wichtige Grundvoraussetzung für erfolgreiches und hilfreiches Arbeiten. Warum scheint interne Beratung dann trotzdem häufig einen »schlechten Ruf« zu haben? Wieso kommen Externe bisweilen auf die Idee, sie könnten es besser als die Internen oder dieser Beratungskontext sei in der Ausbildung nicht der Rede wert?
Beispiele aus dem internen Alltag
Die täglich bereitstehende Falle, in die ich als Interne:r tappen kann, ist die Neugier zu vergessen und der Vorstellung zu erliegen, man kenne den Laden meist doch recht gut. Und von vielen Leuten hat man auch schon mal gehört oder sogar von den Problemen, um die es da geht. Die Kultur kennt man ja sowieso selbst und weiß genau, was des Pudels Kern eigentlich ist und warum »die« was immer noch nicht auf die Kette bekommen haben.
Ja, natürlich kommt man im Unternehmen herum und kennt den Laden nach einiger Zeit als Interne. Zumindest hat man das Gefühl. Denn natürlich kenne ich nie den »ganzen Laden«, sondern ausschließlich unterschiedliche Systemebenen und -teile. Ich kenne meine Abteilung und verstehe deren Logik sehr gut. Ich kenne im besten Fall die Organisation als Gesamtsystem und übergreifend. Aber die »fremde« Logik, die Ausgestaltung des individuellen Auftrags jedes (Projekt-)Teams oder jeder Abteilung im Konzern kenne ich natürlich erstmal nicht.
Was ich über die entsprechenden Abteilungen oder Projekte zu wissen meine, hilft mir im ersten Schritt nicht weiter. Es hilft mir nicht dabei, dieses andere System zu verstehen. Denn dafür muss ich erst einmal hinhören, was das System z. B. von sich selbst denkt und nach welcher Logik dort die Welt konstruiert und wahrgenommen wird.
Intern zu sein heißt dabei auch, sehr sensibel für organisationstypische Muster zu sein. Man muss nicht erst die Broschüren und den Internetauftritt der Organisation lesen, um Kulturartefakte des Systems zu sammeln. Man »kennt« im oben beschriebenen Sinn das System bereits. Man lernt die verschiedenen Subsysteme mit der Zeit – wenn auch im systemischen Sinn selektiv – kennen, kann sie übereinanderlegen, Verbindungen herstellen, gezielt danach fragen.





























