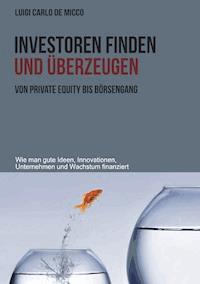
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der neuen, komplett überarbeiteten Auflage von Investoren finden und überzeugen geht es nicht nur um die Finanzierung von Ideen, Startups und Unternehmenswachstum. Vielmehr führt der Autor den Leser anhand vieler Beispiele aus seinen unternehmerischen Erfahrungen und als Berater von Investoren durch die Kriterien, die Investoren bei Investments anlegen und wie sich Kapitalsucher vorbereiten sollten. Es geht also nicht nur um technische Themen, wie Investitionsformen und Businesspläne, sondern um die richtige Strategie bei Wachstumsplänen. De Micco bezeichnet den erfolgversprechendsten Ansatz als FIRST MOVER. Damit beschreibt er Konzepte, Ideen oder Produkte, die durch ihre Innovationskraft und idealerweise Einzigartigkeit das Potential beinhalten, die Welt zu verändern, um dann irgendwann zum Global Player zu werden. Als Vorbilder nennt der Autor Unternehmerponiere, wie Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, John Pierpont Morgan und Henry Ford und erklärt deren Erfolgsgeschichten, von denen man lernen kann. Investoren finden und überzeugen ist das praktische Buch eines unkonventionellen, erfahrenen Unternehmers, der selbst als einer der Internetpioniere in den 2000ern sein Unternehmen von einer kleinen, visionären Softwarebude innerhalb von nur 2 Jahren zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelte. De Micco verstand es, sich und seine Unternehmen durch Freundschaften und Partnerschaften mit First-Mover-Persönlichkeiten, wie Bill Gates, Steve Balmer oder Steve Jobs als First Mover zu positionieren und zum richtigen Zeitpunkt in der großen Liga mitzuspielen. Investoren finden und überzeugen ist ein motivierendes Buch in der jetzt zweiten, komplett überarbeiteten Auflage, das nicht nur für Startups interessant ist, sondern jeden Unternehmer und Erfinder anspricht, der wachsen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Susanne Eckl, Klaus Peter Stoll, Serap Kus, Irina Gutendorff, Christoph Genz, Britta Wilke, Daniela Hildebrandt, Martin Schwan, Dr. Bernd Kiel, Karl-Heinz Killeit und
Felice Giovanni De Micco.
I. Inhalt
Inhalt
„Shit happens“
Wäre es so einfach, dann würden es wohl alle machen
Machen Sie sich auf was gefasst
Wen nehmen Sie mit?
Trennen Sie sich von allem, was Sie belastet
Wachstum rechtzeitig kontrollieren
Die Lösung: Prozessdenken
First Mover
Unternehmer, die die Welt veränderten
Andrew Carnegie
John D. Rockefeller
John Pierpont Morgan
Henry Ford
Die First Mover von heute
Gründung und Management eines Start-ups
Start-ups
The next big thing
Ein Start-up gründen
Der Markt
Kanäle
Kundenbeziehung(en)
Einnahmequellen
Schlüsselressourcen
Kostenstruktur
Erfolg
Erfolgreiche Start-ups in Europa
Private Equity Investments
Finanzierung von Start-ups
Unterschiedliche Finanzierungsformen
Die Auswahl der richtigen Finanzierung
Das Unternehmen
Die Unternehmer
Das Produkt
Das Businessmodell
Finanzierungsarten
Innenfinanzierung
Außenfinanzierung
Eigenkapitalfinanzierung
Haftungsqualität des Kapitals
Eigenkapital
Fremdkapital
Fazit für die Finanzierungsstrategie
Investitionspartner
Eigenkapitalfinanzierung
Inkubatoren/Acceleratoren
Business Angels
Venture Capital
Corporate Venture Capital
Crowd-Finanzierung
Crowdfunding
Crowdinvesting
Peer-to-Peer-Lending und Crowdsourcing
Rahmenbedingungen zur Crowd-Finanzierung
Trendiges Produkt
Klare Ziele
Der Idee ein Gesicht geben
Den Funding-Prozess planen
Alles oder Nichts
Fremdkapitalfinanzierung
Fremdkapitalfinanzierung durch Kredite
öffentliche Förderprogramme
Investoren
Finanzierung durch Investoren
Finanzierungsrunde A
Finanzierungsrunde B
Finanzierungsrunde C und D
Investition, Monitoring und Exit
Venture-Capital-Fonds
Was ist eigentlich Private Equity?
Aufbau eines Venture Capital-Fonds
Unterschiedliche Businessmodelle von VC-Fonds
Venture Capital - das Basismodell
Going-Private-Investoren
Mezzanine-Investoren
Buy-out-Investoren
Turnaround- und “Spezialsituationen”
Business angels und Seed-Investoren
Wie man Investoren überzeugt
Finanzierung von Unternehmen und Ideen
Bereit für den nächsten Schritt?
Wie ticken Investoren?
Das Investoren-Dilemma
Investoren-Coaching
Gemeinsame Ziele
Branche und Businessmodell
Terminplan
Finanzierungsplan
Jeder Investor ist anders
Das System “Investor”
Businessplan - die Fakten
Der Businessplan als Instrument zur Strategieentwicklung
Aus anderer Perspektive denken
Investoreninformation und Verhandlungsbasis für eine Beteiligung
Bewertungs- und Vertragsgrundlage
Gesamtstrategie
Kommunikation mit Investoren
Ins Gespräch mit Kapitalgebern kommen
Fachmessen und Konferenzen
Querdenken und bei jeder möglichen Gelegenheit präsentieren
Wettbewerbe und Pitches
Den richtigen Investor ansprechen
Investment-Fact-Sheet statt Businessplan
Das erste Telefongespräch
Die Präsentation vor dem Investor
Nichts als die reine Wahrheit
Realisten gesucht!
Manager gibt es viele - „Leader“ gesucht!
Manager funktionieren anders
Eine flüssige Präsentation
Die Gestaltung Ihres Vortrags
Präsentation im Team
Tipps aus der Praxis
Das Closing
Der große Tag - und das Danach…
Vertrag unterschrieben, Geld überwiesen und jetzt?
Der Schlüssel: ein guter CFO
Vorsicht! Manager-Parasiten!
Entscheidungen treffen
Exit-Strategien
Exitstrategie nach Branchen
Welche Exitstrategie verfolgen?
Trade Sale
Verkauf an einen anderen Private-Equity-Fonds
Rückkauf
Liquidation
IPO / Börsengang
Der Gang an die Börse
Motive für einen Börsengang
Finanzierungseffekte der Börsennotierung
Die Investoren bei Public Companies
Wachstum durch Akquisitionen
Bonitätssteigerung
Imageeffekte und erhöhter Bekanntheitsgrad
Höhere strategische Flexibilität
Permanente Unternehmensbewertung
Ein attraktiverer Arbeitgeber
Voraussetzungen für den Börsengang
Anforderungen des Kapitalmarktes
Erträge und Gewinne
Innovationskraft und Kreativität
Nachvollziehbare, umsetzbare Konzepte
Unterschiedliche Rechnungslegungen
Publizität und Transparenz
Kapitalmarktkommunikation
Rechtliche Voraussetzung
Die Alternative: Reverse-Merger
Das Prinzip
Die Umsetzung
Aktionsplan zum Reverse-Merger: Generalversammlung und Aktienplatzierung
Analyse des Going-Public-Unternehmens
Unternehmensbewertung
Kommunikationsstrategie
Research und Akquisition des börsennotierten Unternehmens
Vorbereitung der Generalversammlung
Beschlussfassungen zum Reverse-Merger
Investoren-Roadshow, Aktienplatzierung
Die Vorteile des Reverse-Mergers
Die Risiken
Die Kosten einer Börsenplatzierung
Private-Placement-Plattformen
Ausblick
Anhang
Vortrag aus dem Jahre 2000
Quellenangaben
Webseiten
II. „Shit happens“
Natürlich machen Investoren Fehler. Sie haben schlechte Tage oder zum falschen Zeitpunkt andere Dinge im Kopf. Deren Gedanken drehen sich nicht um sogenannte „Fehlinvestments“, die als zu hoch eingeschätzt wurden, sondern um echte Gelegenheiten, die sie vollkommen unterschätzt haben.
Ich erinnere mich gut an ein Meeting wenige Monate nach dem Börsengang meines damaligen, eigenen IT-Unternehmens und daran, dass die Kassen gut gefüllt waren und sich mein Unternehmen in einer Motivations- und Schaffensphase befand, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte.
Ich saß an einem späten Abend ziemlich erschöpft in Palo Alto, im berühmten Silicon Valley, wo viele Technologien dieser Welt ihren Ursprung fanden und finden. Ich sprach mit Managern der SAP, um eine strategische Partnerschaft in den USA zu konkretisieren. Es gab dort ein Café (offensichtlich das einzige in Kalifornien), wo man den Gästen noch gestattete, vor dem Lokal zu einem vorzüglichen Cappuccino Zigarren zu rauchen.
Da gesellten sich zwei Venture-Kapitalisten hinzu, die ich kannte. Sie erzählten mit zunehmend erregter Stimme von einer neuen, genialen technologisch und strategisch alles in den Schatten stellenden Suchmaschinen-Technologie. Für diese wurden dringend zwei Millionen US-Dollar benötigt, um in die nächste Wachstumsphase und die aktive Vermarktung des einmaligen Vertriebskonzepts einsteigen zu können.
Man bot mir tatsächlich zwischen meinem Cappuccino und meiner Zigarre an, die ich mit schlechtem Gewissen und möglichst unauffällig genoss, um den strafenden und verachtenden Blicken der vorbeilaufenden, radikal nichtrauchenden Kalifornierin zu entgehen, als Ko-Investor einzusteigen.
Zu dieser Zeit gab es die Suchmaschine „Yahoo“, die schon damals jeder kannte, und eine weitere erfolgreiche Suchmaschine, „Alta Vista“, die später von HP übernommen wurde, und tausend weitere kleinere Suchmaschinen-Unternehmen, die versuchten, ein Stück vom Kuchen zu bekommen.
Da ich in meinem Unternehmen nicht der Techniker, sondern vielmehr der Stratege war, sagten mir die euphorisch vorgetragenen technischen Erklärungen meiner Gesprächspartner wenig. Ich hatte an diesem Abend noch andere Termine wahrzunehmen. Also verkürzte ich das Gespräch abrupt mit der Gegenfrage: „For what to hell the world needs one more search engine?“ („Wozu zur Hölle braucht die Welt noch eine weitere Suchmaschine?“)
Die jungen Herren zogen sich siegesgewiss zurück, nicht, ohne mich mit einem zutiefst verachtenden Blick auf meine in der geschlossenen Hand verborgenen Zigarre zu strafen. Sie sahen in mir wohl den mutlosen Traditionalisten, dem eine Chance entgehen würde. Nur wenige Jahre später ging dieses Unternehmen unter dem Markennamen „Google“ an die amerikanische Börse und legte einen der erfolgreichsten Börsengänge in der Geschichte der Informationstechnologie aufs Parkett.
Ich habe beim Börsengang von Google überschlagen, was uns ein Zwei-Millionen-US-Dollar-Investment, was dem Anteil von etwa fünf Prozent an der damaligen "Softwarebude" entsprach, in diesem einstigen Start-up-Unternehmen gebracht hätte, welches damals noch hohe Verluste einfuhr. Man sagte, dass es „Geld verbrannte“ („burn rate“). Schauen Sie sich die heutige Bewertung des Marktführers an und stellen Sie sich vor, Sie besäßen annähernd fünf Prozent an Google …
Also müssen erfahrene Investoren am Ende des Tages sagen können: „So what, shit happens!“ Wer auf das Risiko verzichtet, geht das größere ein. Erfolg hat nur der, der einmal mehr aufsteht, als er hingefallen ist. Diese Weisheit stammt von Winston Churchill.
So sehe ich meine Begegnung mit den jungen Männern von Google heute.
Shit happens …
III. Wäre es so einfach, dann würden es wohl alle machen ...
Die wirklich guten Projekte sind jene, die aus den unterschiedlichsten Gründen niemand so recht anpacken möchte: „Zu kompliziert, zu schwierig. Das schafft doch niemand! Zu teuer! Zu festgefahren! Funktioniert ohnehin nicht! Falscher Ort! Schlechter Zeitpunkt!" Das sind einige der vielen tausend Gründe, um etwas nicht zu tun.
Dabei sind diese Projekte so interessant, weil sie niemand anpacken will. Der Traum eines hochmotivierten Investors besteht darin, den sogenannten „First Mover“ zu finden, den Unternehmer, Erfinder, Entwickler oder Kreativen, der tatsächlich etwas bewegt, der die Zukunft einer Technologie, einer Methode, einer ganzen Branche oder übergreifend der gesamten Wirtschaft verändern wird.
Aus exakt solchen Ideen, Entdeckungen und Erfindungen, beflügelt durch unternehmerische Persönlichkeiten, die sich wenig darum scherten, was andere denkend, sprechend und schreibend analysieren, entstanden Unternehmen wie Microsoft, Google, Hewlett-Packard, Apple oder Ford, General Motors und McDonalds.
Doch eines ist klar: Keiner der Gründer der genannten Unternehmen -und man könnte hunderte weitere Unternehmen dieser Art nennen - hatte es zu Beginn einfach. Und aus diesem Grund haben wir Microsoft, Google und McDonalds auf dieser Welt. Alle anderen, die sich den Ideen der First Mover angeschlossen haben, diese kopierten oder mit erheblichem Aufwand versuchten, Kopien zu verbessern, stehen hinten an. Sie sind lediglich die Pflücker, die ernten wollen, aber selbst nichts gesät haben.
Die Geschichte fast aller Marktführer - und unter ihnen der Global Player - zeigt, dass gerade noch die Nummer zwei oder die Nummer drei wahrgenommen werden. Danach wird die Luft an den Märkten sehr dünn.
Es entstehen Plagiate und „Me-Too-Unternehmen“ und -Produkte. Und beachtet man den Mut, die Kreativität und insbesondere das Durchhaltevermögen der First Mover, als sie am Anfang standen und ihre Ideen, Konzepte, Entdeckungen oder Erfindungen gegen alle möglichen Zweifler und deren Widerstände durchsetzen, ist der kritische Blick später auf die Nachzügler gerecht.
Der First Mover hat in der Regel einen bestimmten Vorsprung, der nicht mehr oder schwer einzuholen ist: seine Positionierung am Markt. Er ist und bleibt die Nummer eins, was zumindest die Kommunikation der Innovation betrifft, denn er war ja „der Erste“. Er bleibt es in jedem Fall historisch.
Natürlich gibt es Fälle, in denen First Mover irgendwann, z. B. durch noch innovativere Ideen oder Marken, eingeholt werden. Erfolg verpflichtet im Interesse schon allein des eigenen Überlebens wegen zur ständigen Risikobereitschaft. Der Aufwand, besonders der kommunikative Aufwand, ist enorm.
Eine Technologie lässt sich immer irgendwie kopieren oder verbessern. Nicht einmal Coca-Cola kann sich darauf berufen, dass die scheinbar geheimnisvolle Rezeptur anscheinend nicht nachzuahmen sei, seit es Pepsi-Cola gibt. Eine einmal erzielte, in den Köpfen der Menschen besetzte Marktposition hingegen ist sonst nicht kopierbar. Sie muss durch Besseres ersetzt werden können. Das ist ein schwieriges, oftmals unmögliches Unterfangen.
Damit wird klar, dass Investoren, die darauf aus sind, ein Investment zu tätigen, welches sich zumindest mittelfristig am Markt behauptet und profitabel ist, gern auf First Mover setzen. Die Vorteile für den Investor liegen auf der Hand.
Der First-Mover ist in der Regel „billig zu haben“. Einem echten First Mover glaubt man zunächst nicht. Er kann nichts vorweisen, was sich bereits bewährt hat.
Es gibt keine Fünfjahresbilanzen, beeindruckende Gewinn- und Verlustrechnungen oder eine „sexy Liste“ mit wohlklingenden Referenzen. Dies gilt für das Start-up-Unternehmen im Silicon Valley ebenso wie für den Mittelständler in Hamburg, der eine bahnbrechende Innovation finanzieren will, was er aus eigener Kraft nicht schafft.
Objektive Beweise - und dazu zählen aus kaufmännischer Sicht historische Ergebniszahlen und Benchmarks - sind für First Mover schwer zu führen. Gäbe es sie, wären sie keine First Mover. Hier liegt die Crux für den Investor, die berühmte Frage nach dem Sein oder Nichtsein. Doch Weisheit bringt auch geschäftliches Glück.
Handelt es sich bei dem jeweiligen Investment neben weiteren Investitionskriterien tatsächlich um einen First Mover? Gibt es einen Markt für ihn? Oder entsteht ein ganz neuer Markt durch seine Idee(n)? Wie lässt sich das Ganze umsetzen? Und ganz wichtig: Wie viel Zeit und Geduld benötigt die Umsetzung?
Niemand hat einem Christoph Columbus geglaubt. Viele erklärten ihn für verrückt oder hielten ihn für einen Scharlatan. Indien entdecken wollen? Es dauerte einige Jahre, bis er unter Zuhilfenahme eines kommunikativen Tricks das spanische Königshaus davon überzeugen konnte, ihm eine Flotte für seine gigantische, die damalige Welt bewegende Expedition zu finanzieren. Und Amerika bewegt die Welt noch heute.
Den „Big Mac“ gibt es schon. Aber wenn Sie nicht ein zweites Amerika entdecken oder die inzwischen 150. Variante des „Big Macs“ kreieren wollen, sondern eine Idee, ein Konzept, ein Verfahren, eine Strategie oder eine Technologie entwickelt haben, die einmalig ist und idealerweise „vom Ersten bewegt“ wird („First Mover“) und Sie diese finanzieren müssen, wird Ihnen diese Lektüre behilflich sein.
Vergessen Sie besonders in schwierigen Momenten nicht: Wäre alles einfach zu bewegen, gäbe es kaum noch Chancen für das Besondere.
MACHEN SIE SICH AUF WAS GEFASST
Ein Unternehmen aufzubauen, dass zunächst lediglich auf einer Idee oder einem Konzept beruht, ist eine Herausforderung, sowohl geschäftlich, als auch privat. Es geht um Konzeption, Strategie, Taktik, Gründung, Steuerung, Management und Wachstum. Und gerade das Wachstum birgt Risiken in sich, denn es muss kontrolliert und organisiert werden, wozu gerade junge Unternehmen oft einfach zu wenig Zeit haben. Wir werden in diesem Buch viele technische und kaufmännische Aspekte besprechen, die man lernen und relativ einfach umsetzen kann – die „Hard-Facts“. Doch nicht selten sind ganz andere Faktoren erfolgsentscheidend, die weniger wissenschaftlicher oder kaufmännischer Natur sind, sondern die alleine von Ihnen abhängen. Darum möchte ich gleich zu Beginn auf diese „Soft-Facts“ eingehen, die Sie noch lange nach der Gründungsphase zu persönlichen Entscheidungen herausfordern werden. Natürlich sind die folgenden Anmerkungen subjektiv und resultieren aus rein persönlichen Erfahrungen. Werte, Prinzipien, Charakter und Arbeitsweisen sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Darum sollten Sie die folgenden „Soft-Facts“ weniger als Anleitung als mehr als Anregung zum Nachdenken verstehen.
WEN NEHMEN SIE MIT ?
Menschen machen Unternehmen. Um Ideen umzusetzen, benötigt man in fast allen Fällen ein Team, also Menschen, die Sie begleiten und unterstützen. Das Team sollte perfekt sein. Dabei zählen nicht nur fachliche Komponenten der Mitglieder, sondern auch persönliche. Es ist nicht einfach, gute Mitstreiter zu finden, die tatsächlich hinter Ihnen stehen. Insbesondere nach der ersten Kapitalrunde, wenn plötzlich Geld zur Verfügung steht, um endlich alle Träume umzusetzen, beginnt eine kritische und sehr belastende Phase. Sie können jetzt hoch qualifizierte Leute bezahlen, Manager einstellen, Strukturen aufbauen und Marketingkampagnen umsetzen. Die Menschen, die Sie in dieser Phase mit an Bord nehmen, können der Schlüssel sein für Ihren gesamten zukünftigen Erfolg oder Misserfolg. Sie haben nur wenig Zeit, und die Erwartungshaltung der Investoren ist hoch. Darum empfehle ich, so früh wie möglich nach klaren und überprüfbaren Kriterien zu selektieren. Nehmen Sie sich die Zeit und definieren Sie sehr detailliert Ihre Erwartungen an ein Management-Teammitglied und schreiben Sie diese nieder. Besteht das Team bereits, so sollte jeder für sich seinen Input beschreiben. Sie benötigen klare Commitments, keine Versprechungen und Blabla. Prüfen Sie die Resultate alle 60 Tage. Wenn die Ziele nicht erreicht wurden, sollten Sie sich trennen. Sie haben auch keine Zeit, Menschen zu verändern. Wenn Sie Team-Player brauchen, dann müssen diese im Team funktionieren. Wenn sie ein tageslichtscheuendes Genie haben, dass in seiner einsamen Kammer mit seinen Erfindungen die Welt verändert, dann sorgen Sie dafür, dass es immer genügend Kaffee hat. Aber besprechen Sie zuvor ganz klar Ihre Erwartungen.
Ich hatte in meinem IT-Unternehmen, welches ich später an die Börse führte, das große Glück, gleich zu Beginn einige Mitstreiter zu finden, die mich verstanden und über alle Phasen des Unternehmens zu mir standen. Allen voran Klaus Peter Stoll, der mich auch in schwierigsten Zeiten mit seiner Erfahrung unterstützte. Klaus-Peter hatte ein unglaubliches Talent, Menschen einzuschätzen. Im Gegensatz zu mir kannte er die Mechanismen von Großunternehmen, wo es mehr um Karriere, Gehaltserhöhungen und Macht geht, als um den „Spirit“ des Unternehmens. Wo „Manager“ eine Position annehmen und gleich am ersten Tag ihrer Tätigkeit ihren Lebenslauf anpassen, bereit und auf der Suche nach „dem nächsten“ Job. Diese Leute können Sie, besonders in der Startphase, nicht gebrauchen! Sie sollten Menschen finden, die an Ihre Sache glauben und sich hundertprozentig darauf konzentrieren. Suchen Sie unternehmerisch denkende Persönlichkeiten, die Sie unterstützen, die Ihnen Zeit ersparen, statt diese zu rauben. Und trennen Sie sich rechtzeitig, wenn es nicht funktioniert. Das ist nicht immer einfach und Sie schaffen sich damit nicht nur Freunde. Aber bedenken Sie: Ihre wohl wichtigste Aufgabe besteht darin, ein Top-Team auf- und auszubauen und nicht einen Beliebtheits-Contest zu gewinnen.
TRENNEN SIE SICH VON ALLEM, WAS SIE BELASTET
Dieser Satz stammt von einem ebenfalls sehr geschätzten Mitstreiter, Dr. Bernd Kiel, der mein Unternehmen ebenfalls in einer sehr frühen Phase unterstützte, zunächst als Aufsichtsrat, später als Chef der Entwicklung. Auch Bernd kannte als ehemaliger SAP-Manager sehr gut die Strukturen und Mechanismen eines Großunternehmens. Also ein Unternehmen, wie wir es damals selbst einmal werden wollten, ein Global Player. Seine große Stärke, von der wir sehr profitiert hatten, lag nicht nur in der hohen wissenschaftlichen Fachkompetenz als Physiker, sondern insbesondere in seiner sozialen Kompetenz und Intelligenz. Er verstand es, als Leader und Tutor Teams zu motivieren. Dabei zeigte er Verständnis auch für persönliche Anliegen oder Probleme seiner Mitarbeiter, aber zugleich schaffte er es, die Mitarbeiter immer wieder auf die Ziele zu konzentrieren.
Als ich Bernd Kiel kennenlernte, erzählte ich ihm von meinem Leben als Start-up-Unternehmer: keine Zeit für Privates, nur noch im Flieger unterwegs. Wie schwer es doch war, gute Leute zu finden. Ich arbeitete 16 Stunden am Tag, hatte keine freien Wochenenden. Ich hatte nicht einmal Zeit, mein Geld auszugeben. Meine Anzüge kaufte ich an Flughäfen. Bernd hörte sich meine „Klagen“ an und sagte nur: „Trennen Sie sich von allem, was Sie belastet.“ Und damit hatte er Recht. Zeit und dessen Management ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich fragte mich selbst, was mich in meinem geschäftlichen als auch in meinem privaten Leben (sinnlos) belastet. Was kann ich über Bord werfen? Was (und wer) bringt mich weiter? Welche Aktivitäten sind wirklich wichtig für mich, auf welche kann ich verzichten? Bekannte und Freunde außerhalb des Geschäftslebens sind wichtig, aber sie können auch viel Zeit kosten. Für wen opfere ich meine Zeit, also wen lasse ich überhaupt noch in mein Leben?
Für viele ist die private Beziehung, die Familie, sehr wichtig. Aber auch hier sollten Sie sich ein Commitment einholen. Erklären Sie zu Hause, was sie tun und wo Sie hinwollen. Sie benötigen hier Verständnis und Unterstützung und keine weiteren Probleme! Ich hatte zu meiner Gründerphase mit meiner damaligen Lebensgefährtin Susanne das große Glück, einen Menschen an meiner Seite zu haben, der mich zu 100 Prozent unterstützte. In schwierigen Zeiten hatte sie mich immer unterstützt, in guten Zeiten gelobt. Als halber Italiener kenne und schätze ich die Stärke und Kraft, die einem eine Familie geben kann. Wenn es aber zu Belastungen kommt, dann lösen Sie diese so schnell wie möglich.
WACHSTUM RECHTZEITIG KONTROLLIEREN
Wir werden im Folgenden noch an verschiedenen Stellen auf das kritische Thema „Wachstum“ eingehen. Es gibt einige betriebswirtschaftliche Instrumente, um Wachstum organisatorisch zu steuern und zu kontrollieren. Ich möchte jedoch gleich zu Beginn auf zwei vollkommen verschiedene Philosophien eingehen, die entscheidend sein können, wenn es um schnelles Wachstum geht, was eines der typischen und unvermeidlichen Merkmale eines jungen Unternehmens ist.
Wenn Sie wachsen, dann werden allmählich Abteilungen entstehen: Sales/Marketing, Produktion/Entwicklung, Human Resources, Management, Finance, Organisation … Für all diese Abteilungen werden Sie Manager einstellen, die ihre Bereiche leiten. Sie werden die Ziele, Aufgaben und Kompetenzen der Abteilungen definieren, die Manager setzen diese mit ihren Teams um. Klassische Betriebswirtschaft! Aber das klassische Abteilungsdenken birgt Gefahren. Eine Abteilung in einem Unternehmen ist ein System von Menschen, Strukturen und Regeln. Ein typisches Merkmal von Systemen besteht darin, sich selbst zu schützen. In Großunternehmen kann es so weit gehen, dass einige entstandene Abteilungen eigentlich sinnlos sind, sich selbst aber ihre eigene Existenzberechtigung immer wieder durch konstruierte, vorgeschobene Argumente als unersetzlich darstellen. Nicht selten entstehen Konkurrenzsituationen zwischen Abteilungen, die bis zu gegenseitigen Anfeindungen eskalieren können. Ein weiterer negativer Aspekt von Abteilungsdenken ist der „Kompetenz-und-Verantwortungs-Ping-Pong“. „Dafür sind wir nicht zuständig, nicht unsere Abteilung!“ Die Folge sind nicht nur stockende oder unerledigte Aufgaben, die sich niemand erklären kann. Das System birgt auch sehr viel Frustpotential in sich, welches bei eigentlich sehr guten Mitarbeitern aufkommt, weil sie aufgrund fehlender Erfolge oder – schlimmer noch – aufgrund von Schuldzuweisungen demotiviert werden.
DIE LÖSUNG : PROZESSDENKEN
Abteilungen, ich nenne sie lieber „Organisationsbereiche“, um den Begriff zu vermeiden, sind im Rahmen eines Wachstums unvermeidbar. Der Aufbau ist sehr arbeitsintensiv. Die Rollen von Menschen in festen Strukturen zu definieren, ist immer mit hohem Energieaufwand verbunden. Eine der großen Herausforderungen besteht darin, verschiedene Individuen mit vollkommen verschiedenen Qualifikationen, Ansichten, Lebensumständen, Sprachen und Charakteren so schnell wie möglich produktiv zu fahren. Ich konnte bei verschiedenen Start-ups beobachten, dem meinigen eingeschlossen, dass genau hier das organisatorische Hauptproblem liegt. Das Konzept stimmt, Geld ist da, wir stellen jede Menge gute Leute ein, wir bauen (theoretische) Strukturen auf. Aber wie fahren wir das ganze Paket nun auch möglichst schnell effizient? Ich darf Ihnen sagen: Mit den schicken, abteilungsdefinierenden und toll designten 3D-Organigrammen Ihres Businessplans wird es nicht funktionieren!
Organisationsbereiche (Abteilungen) funktionieren nur, wenn Sie übergreifend und koordiniert funktionieren. Wie erreichen wir das? Die Lösung, insbesondere für junge Unternehmen, die gerade damit starten, ihre Strukturen zu entwickeln, liegt im Prozessdenken. Vergessen Sie einfach einen Moment die Abteilungen und konzentrieren Sie sich auf die bestehenden Prozesse selbst in Ihrem wachsenden Unternehmen. Lokalisieren Sie die täglichen Prozesse, die im Einkauf, im Vertrieb, der Produktion oder im Kundensupport entstehen, zeichnen Sie die Prozesse auf ein Blatt Papier in einer Time-Line und schauen Sie sich die Informations- und Kommunikationswege an. Wer ist mit welcher Aufgabe an einem Prozess beteiligt? Wer benötigt wen? Welche Ressourcen werden für jeden einzelnen Prozess benötigt? Und das Wichtigste: Definieren Sie die Ziele der Prozesse und wer für welchen Prozess verantwortlich ist - und zwar vom Anfang bis zum Ende. Sie benötigen also weniger Abteilungsleiter, als vielmehr Prozessmanager. Es sollte bei der Organisation eines Unternehmens um die Ziele der einzelnen Abläufe gehen, nicht um die Abteilungen. Sie werden erstaunt sein, wie viele Abteilungen an einem einzigen Prozess beteiligt sein können. Nur durch Prozessdenken werden sie effizient.
Prozesse kommen immer dann ins Stocken, wenn sie an den massiven Schutzmauern der Abteilungen abprallen („wir sind nicht zuständig, nicht unsere Abteilung“). Ich kann nur empfehlen, so früh wie möglich die Organisation in Prozessen und nicht in Abteilungen aufzubauen. Es funktioniert nur dann, wenn alle Mitarbeiter prozessorientiert (um)denken und handeln. Eine Aufgabe, die für ein bereits abteilungsorientiertes, strukturiertes Unternehmen fast unmöglich ist. Wenn Sie aber am Anfang des Aufbaus Ihrer Organisation stehen, ist die Strukturierung aller Abläufe Ihres Unternehmens in definierte Prozesse eine enorme Chance, gleich zu Beginn Ihre Organisation viel effizienter zu gestalten. Insbesondere bei schnellem Wachstum!
Man hört so oft die Kommentare über gescheiterte Start-ups von Besserwissern, die selbst eine solche Herausforderung des Aufbaus eines Unternehmens nicht erlebt haben: „Die sind zu schnell gewachsen, darum haben sie es nicht geschafft.“ Lassen sie das für Ihr Unternehmen nicht zu!
IV. First Mover
Große Erfindungen verändern die Welt. Immer wieder gibt es neue Ideen und Technologien, die tiefgreifend auf die Geschichte der Menschheit einwirken. Auch wenn heute niemand mehr sagen kann, wer das Rad oder den Webstuhl erfunden hat, wissen wir, dass sich das kulturelle, gesellschaftliche oder politische Leben der Menschen anders entwickelt hätte, wenn wir keine Textilien oder Transportmittel herstellen könnten. Sowohl Rad als auch Webstuhl sind so alt, dass wir weit in die Vorzeit zurückgehen müssten, um ihren genauen Ursprung zu ermitteln. Ihre Erfinder sind vergessen, denn die Geschichte lehrt uns, dass Entwicklungen früher wesentlich mehr Zeit brauchten, um ihren großen Durchbruch zu erlangen und gesellschaftlich viral zu wirken.
Die umwälzende Wirkung großer Ideen ist geblieben, verändert hat sich die Geschwindigkeit ihrer Verbreitung. In den letzten zwei Jahrhunderten gab es immer wieder große Erfinder und Investoren, die mit ihren innovativen Ideen die Welt veränderten – und es bis heute tun. Kein Politiker und keine politische Idee wirkt gesellschaftlich so nachhaltig wie die Kreativität von starken Unternehmerpersönlichkeiten. Sie eröffnen neuen Handlungsspielraum, neue Möglichkeiten, neues Wissen, neue Freiheit. Sie sind es, die mit ihren Visionen und ihrer Beharrlichkeit für gesellschaftlichen Wandel sorgen.
Jeder Unternehmer, der wirklich großartigen Erfolg mit seinem Produkt erreichen will, muss versuchen, der Erste mit seiner Idee oder seinem Konzept zu sein. Die Geschichte zeigt jedoch, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht, um wirklich erfolgreich zu sein. Viele gute Ideen scheitern, bevor sie überhaupt bekannt werden. Andererseits reicht es durchaus aus, eine existierende Idee lediglich um eine kleine Nuance zu verändern, um zum Weltmarktführer aufzusteigen.
Viele First Mover sind deshalb unsterblich geworden, weil sie als erster das Potenzial eines bestehenden Produktes erkannten und dieses mit einem leicht veränderten Verfahren, einer anderen Methode, einem variablen Konzept, einem neuen Marketing oder einem abgewandelten Businessmodell auf den Markt brachten. First Mover verstehen es, den Nutzen ihrer Produktidee so zu kommunizieren, dass möglichst jeder einen Nutzen für sich erkennen kann, und sie dadurch Erfolg auf dem Massenmarkt erzielen können.
Fleisch essen die Menschen seit Jahrtausenden. Auch gebratene Hackfleischbällchen werden seit unendlich vielen Jahren gegessen. Aber gebratenes Hackfleisch, zwischen zwei weiße, süße Brötchen gepackt und mit Mayonnaise und Salat garniert, das ist das Werk eines First Movers, der sich mit seiner Produktidee „schnelles, unkompliziertes Essen für Menschen mit wenig Zeit und Lust auf Konventionen“ zu einem der größten Konzerne der Welt entwickelte. McDonalds hat es auf geniale Weise verstanden, den Nutzen seiner Speisen an gehetzte Berufstätige zu kommunizieren und damit eine Millionenkundschaft zu erreichen.
Nicht jeder ist überzeugt davon, dass die Brötchen von McDonalds hochwertige Produkte sind, weil sie im Prinzip von jedem hergestellt werden können. Entscheidend für den Erfolg des Unternehmens war deshalb nicht das Produkt, sondern die konsequente Standardisierung aller Prozesse von der Herstellung der Speisen bis zur Ausstattung der Läden. Die Idee ließ sich folgerichtig weltweit als Franchisekonzept verbreiten. Hier war der amerikanische Hamburgerhändler der Erste, der mit seinem Businessmodell den Markt aufrollen konnte.
In den letzten 150 Jahren gab es viele großartige Unternehmerpersönlichkeiten, die mit ihrer zündenden Idee die Welt veränderten. Zu meinen persönlichen Vorbildern gehören die großartigen Unternehmer Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, John P. Morgan, Henry Ford.
UNTERNEHMER, DIE DIE WELT VERÄNDERTEN
ANDREW CARNEGIE
Andrew Carnegie kam 1835 in Schottland zur Welt. Sein Vater war Weber, seine Mutter die Tochter eines Schuhmachers. Die zunehmende Mechanisierung der Textilindustrie ließ die Familie verarmen und trieb sie 1848 von Schottland in die USA. Im Alter von 13 Jahren arbeitete Andrew Carnegie bereits zwölf Stunden als Spuler in einer Textilfabrik, nach Feierabend besuchte er die Abendschule. Bald darauf wechselte er in ein Telegraphenamt und lernte dort das Telegraphieren. Wenig später wurde der Leiter der örtlichen Eisenbahngesellschaft, Thomas A. Scott, auf ihn aufmerksam und ernannte ihn zu seinem Sekretär bei der Western Division Pennsylvania Railroad Company. Carnegie machte eine steile Karriere und wurde bald darauf Leiter des Eisenbahnbereichs. Bei Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges folgte er Thomas A. Scott nach Washington D.C., der dort zum Kriegsminister berufen worden war. Carnegie organisierte in Scotts Auftrag das militärische Telegraphensystem. Er erledigte diesen Job erfolgreich. Denn nach Kriegsende übernahm er bereits die Leitung der Western Division der Pennsylvania Railroad. Im Alter von 30 Jahren sah Carnegie in der Eisenbahngesellschaft für sich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Er verließ das Unternehmen und gründete eine Investmentgesellschaft, die in mehrere Eisenhütten und Eisenwerke investierte.
Der Visionär Andrew Carnegie hatte erkannt, dass Stahl die Produktion von schweren Maschinen, die bis dahin aus Gusseisen gefertigt wurden, revolutionieren würde. Der Hochofen von Henry Bessemer, mit dem Eisen in Stahl gewandelt werden konnte, faszinierte ihn. 1870 baute Andrew Carnegie seinen ersten eigenen Stahlkocher. 1873 eröffnete er sein erstes eigenes Stahlwerk, das bald darauf den ersten Großauftrag von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Pennsylvania Railroad Company, bekam. Carnegie verstand sich vorrangig als Investor. Er nahm unterschiedliche Partner in seinen Stahlkonzern auf und konnte auf diese Weise das Know-how und die Fertigungstiefe des Unternehmens um wichtige Komponenten erweitern, beispielsweise um die Koksproduktion. Dennoch sorgte er dafür, immer die Mehrheitsanteile an seinem Unternehmen zu behalten. Dies eröffnete ihm die Chance, auch in Krisenfällen handlungsfähig zu bleiben.
Im Alter von 54 Jahren zog er sich aus der aktiven Geschäftsführung seines Stahlimperiums zurück, um sich vorrangig seinen Stiftungen und kulturellen Projekten zuzuwenden. Carnegie gab - angesichts seiner eigenen Herkunft - einen Großteil seines Reichtums für die Förderung von fleißigen und ehrgeizigen Menschen aus, die selbst über kein eigenes Vermögen verfügten. Er gründete mehr als 1.600 Bibliotheken in den USA, um möglichst vielen Menschen den Zugang zur Bildung zu eröffnen. Bis heute trägt die berühmte New Yorker Konzerthalle „Carnegie Hall“ den Namen ihres Stifters. Weiterhin gründete er Stiftungen für die Förderung von Wissenschaften und Hochschulen sowie zu allgemein wohltätigen Zwecken.
1901 setzte er sich vollends zur Ruhe. Er hatte seine Stahlfabrik an den Bankier J. P. Morgan für die damals unvorstellbare Summe von 480 Millionen US-Dollar verkauft und war damit der drittreichste Bürger der USA. Einen Teil davon gab er an seine neu gegründete, internationale Friedensstiftung „Carnegie Endowment for International Peace“, den größten Teil erhielt die „Carnegie Corporation New York“, eine Stiftung für die Vermögensverwaltung des Carnegie-Erbes, die das Ziel verfolgte, die von ihm benannten sozialen Werte wie Fleiß, Bildung, Kultur und soziales Engagement zu fördern. Andrew Carnegie starb 1919 im Alter von 84 Jahren in New York.
JOHN D. ROCKEFELLER
John Davison Rockefeller kam 1839 als Nachkomme deutscher Einwanderer in New York zur Welt. Der älteste Sohn unter fünf Geschwistern musste früh für die Familie Verantwortung übernehmen, da der Vater die Familie verließ als John 15 Jahre alt war. Rockefeller begann seine Karriere als Lehrling in einer Speditionsfirma, die ihn schon bald als Hilfsbuchhalter beschäftigte. Mit 18 hatte er bereits die Position des vollverantwortlichen Buchhalters in der Firma inne. Im Jahr 1858 wechselte Rockefeller in die Erdöl-Branche. Er machte sich selbstständig und entwickelte in Kooperation mit einem Chemiker ein neues Verfahren für die Weiterentwicklung von Rohöl. Rockefeller produzierte in seinem Unternehmen die Fässer und hatte eine eigene Spedition für den Vertrieb der Ware. Dies unterschied ihn von seinen Wettbewerbern. Das Geschäft entwickelte sich gut. Rockefeller gelang es, weitere fähige Leute als Teilhaber an sein Unternehmen zu binden. 1870 entstand aus diesem Unternehmen die Standard Oil Company. Alle bisherigen Teilhaber zählten dadurch zu den Gründungsaktionären. Das Unternehmen profitierte von der aufstrebenden Großstadt New York. Zunächst lieferte die Standard Oil Petroleum, das für die Beleuchtung der Stadt verwendet wurde. Benzin als Autotreibstoff kam erst später hinzu.
Standard Oil wuchs vor allem durch strategische Zukäufe und Zusammenschlüsse mit anderen Ölfirmen. Rockefellers Ziel war es, durch die Fusionen genügend Marktanteile zu gewinnen, um günstigere Frachttarife für die benötigten Öltransporte zu erhalten. Durch dieses Vorhaben geriet er in einen jahrelangen Rechtsstreit gegen unterschiedliche Bundesstaaten, die ein Anti-Trust-Gesetz gegen ihn verabschieden wollten. Rockefeller gelang es jedoch immer wieder, durch neue strategische Beteiligungen die Zerschlagung seines Imperiums abzuwenden, bis er im Jahre 1906 dennoch unterlag und sein Imperium in 34 Einzelgesellschaften zerlegt wurde. Der Börsenkurs für Standard Oil fiel ins Bodenlose. Doch Rockefeller ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen. Er war Visionär und sah den großen Bedarf an Treibstoff durch die neue, von Henry Ford vorangetriebene Automobilisierung voraus. Deshalb kaufte er seine eigenen Aktien zu einem Dumpingpreis zurück, bevor er dann in enorme Höhen stieg. Dies war der eigentliche Deal, wodurch er Ölmagnat und Multimillionär wurde.
Rockefeller Senior galt um 1913 als einer der reichsten Bürger der Welt. Rockefeller gründete ebenso wie Carnegie zahlreiche Stiftungen, die Universitäten, Krankenhäuser, Forschung und Entwicklung, aber auch Kirchen und Museen förderten. John Davison Rockefeller wurde 98 Jahre alt und starb 1937 in Ormond Beach (Florida).
JOHN PIERPONT MORGAN
Nahezu zeitgleich mit Rockefeller und Carnegie wurde John Pierpont Morgan 1837 in Connecticut geboren. Bereits sein Vater war Bankier, sodass der junge John das Geschäft von früh auf kennenlernen konnte. Er genoss eine gute Schulbildung und studierte sowohl in der Schweiz als auch im deutschen Göttingen. Mit 21 zog er nach New York, wo er 1871 mit seinem Partner das Bankhaus Drexel, Morgan & Co., die spätere J. P. Morgan & Co., gründete. 1878 stellte der weitsichtige J.P. Morgen dem genialen Erfinder Thomas Alva Edinson 130.000 Dollar zur Verfügung, mit denen er die Erfindung seiner Glühbirne und später die Investition in die Strom- und Telefonleitungen für alle Häuser vorantreiben konnte.
Morgan spezialisierte sich auf die Merger von großen Firmenzusammenschlüssen. Während der Eisenbahnkrise 1893 war er an der Umstrukturierung der amerikanischen Eisenbahnen beteiligt und sorgte für die passende Finanzierung. 1901 war Morgan maßgeblich an der Gründung des United States Steel Corporation Trusts beteiligt. J. P. Morgan erkannte frühzeitig den enormen Stahlbedarf in der schnell wachsenden Automobilindustrie. Da war das Investment in die Carnegie-Stahlwerke für ihn nur folgerichtig.
1902 leitete er die Verhandlungen zur Finanzierung und Gründung des internationalen Schifffahrtstrust IMMC, zu dem auch die Titanic gehörte. Morgan mehrte sein Vermögen durch den Wertpapierverkauf, aber auch durch die Honorare, die er für seine Verhandlungsführungen bei großen Firmentransaktionen einnehmen konnte. Bei allem Engagement suchte er immer wieder neue disruptive Unternehmen, in die er sein Vermögen investieren konnte. 1903 stieg Morgan in die junge Automobilindustrie ein. Er übernahm zwei Drittel des Aktienkapitals der Maxwell Briscoe Motor Company, aus der später die Chrysler Company hervorging.
Sein Einfluss wuchs weiter, sodass er mehrmals Staatsanleihen kaufte, um den Staatshaushalt der USA während der Börsenkrise zu sanieren. J. P. Morgan starb 1913 in Rom. Bis zu seinem Tod hat er seine Geschäftstätigkeiten über alle damaligen „Hightech-Branchen“ ausgedehnt. Dazu gehörte die Finanzierung von Eisenbahnen, Banken, Stahlproduktion, Telekommunikation und Elektroindustrie. Unter ihm war das halbe Streckennetz der USA und zwei Drittel der Stahlproduktion vereinigt. Die Stärke John P. Morgans bestand darin, dass er die aufstrebenden Technologien Stahl, Erdöl, Elektrizität und Automobilbau im Gesamtzusammenhang sah. Die eine Entwicklung wäre ohne die andere nicht zu realisieren gewesen. Sein starker Glaube an die Kraft neuer Produkte und Ideen ließ ihn konsequent handeln und gab ihm die innere Stärke, auch gegen die Mehrheitsmeinung voranzugehen.
HENRY FORD
Der vierte, große Treiber der Industrialisierung war Henry Ford. Er hat das Auto nicht erfunden, aber Ford hatte die Vision, allen Menschen den Erwerb eines Autos zu ermöglichen, denn alle vorher produzierten Automobile, beispielsweise die Modelle von Carl Benz, wurden in Manufakturen einzeln gefertigt und standen nur einem sehr vermögenden Kundenkreis zur Verfügung.
Henry Ford wurde 1863 als Sohn irischer Einwanderer in Wayne, einer Kleinstadt westlich von Detroit, geboren. Er war das älteste Kind von insgesamt sechs Geschwistern. In Wayne gab es nur eine Dorfschule, sodass er kaum Schulbildung erhielt. Auf der Farm seiner Eltern konnte er sich jedoch eine eigene Werkstatt einrichten, in der er bereits früh an eigenen Erfindungen zu experimentieren begann. Ihn interessierten vor allem mechanische Elemente und Motoren. Als er 20 Jahre alt war siedelte er nach Detroit über, um dort eine Ausbildung zum Maschinisten zu machen. Nach dem Abschluss fand er eine Anstellung bei der Westinghouse Electric Corporation. Er arbeitete an Ottomotoren und konnte hier sein Wissen vervollständigen. 1891 wurde er Ingenieur bei der Edison Illumination Company. Er lernte den Gründer Thomas Alva Edinson Jahre später persönlich kennen und freundete sich mit ihm an. Parallel zu seinem Beruf entwickelte er einen eigenen Rennwagen und fuhr mit seinem Modell beachtliche Erfolge ein. Dies brachte ihm genügend Aufmerksamkeit ein, um Investoren zu finden, mit denen er 1903 die Ford Motor Company gründen konnte. Der Rest ist legendär. 1908 brachte er die „Tin Lizzy“ (Modell T) auf den Markt. Sein Businessmodell: ein leichtes, preiswertes Auto für jedermann.
Den wahren Durchbruch erreichte er 1913, als er die Produktionsprozesse in seinem Unternehmen revolutionierte und die Fließbänder in den Fabriken einführte. Die neue Produktionsweise erlaubte ihm, seine Produkte noch preiswerter zu produzieren. Fünf Jahre später, im Jahr 1918, war jeder zweite Wagen in den USA ein Modell T. Er konnte diese Marktführerschaft bis 1927 verteidigen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er 15 Millionen Autos verkauft, bevor andere Hersteller nachzogen. Diese visionäre Entwicklung der Massenproduktion machte Henry Ford zum eigentlichen First Mover der Automobilindustrie.
Die Geschichte zeigt, dass First Mover einander bedingen. Um tatsächlich umwälzende Erneuerungen in der Gesellschaft zu bewerkstelligen, müssen Erneuerungen an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig ansetzen. Rockefeller (Öl und Benzin), Carnegie (Stahl), Ford (Automobil) und Morgan (Finanzierung) benötigten einander, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Eine Entwicklung pushte die nächste – auch wenn sie unterschiedliche Produkte und Businessmodelle entwickelten, aus unterschiedlichen Familien stammten und einen unterschiedlichen Bildungshintergrund hatten. Was sie einte, war der Glaube daran, etwas Neues schaffen zu können, die Welt zu verändern und in ihrem Bereich „der Erste“ zu sein.
DIE FIRST MOVER VON HEUTE
Die oben genannten Gründer waren Barone des Industriezeitalters. Sie arbeiteten daran, das materielle Leben der Menschen zu verändern, indem sie die Infrastruktur für Industrieprodukte schufen. Vernetzt denken, Versorgung mit Produkten sicherstellen, für deren Betrieb sorgen und die Erfindungen so preiswert produzieren, dass sie für den Massenmarkt tauglich sind – dieses Rezept gilt auch noch heute.
Die großen Gründer der Neuzeit haben nichts Anderes getan. Lediglich ihre Produkte unterscheiden sich grundlegend von den Industrieprodukten des letzten und vorletzten Jahrhunderts. First Mover wie Bill Gates, Steve Balmer, Steve Jobs, die Gründer von Google & Co. und die vielen anderen kleinen und großen Pioniere des Internets haben während der letzten dreißig Jahre ein neues Zeitalter geprägt und einen gesellschaftlichen und industriellen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Heute ist eine Welt ohne PC-Betriebssysteme, Internet, Smartphones und Suchmaschinen nicht mehr denkbar. Sie sind zum Massenprodukt geworden. Gleichzeitig hätte keines dieser Produkte ohne die anderen eine so durchschlagende Marktpower entwickeln können. PCs ohne Anschluss an das Internet sind dumme Maschinen, das Internet wäre starr ohne die mobilen Smartphones und niemand könnte das Internet so selbstverständlich wie heute ohne Suchmaschine nutzen. Was uns heute selbstverständlich erscheint, war die parallele Entwicklung verschiedener Erfindungen, die ursprünglich nichts miteinander gemein hatten. Ihre Erfinder waren jedoch Visionäre, die frühzeitig erkannten, welches Potenzial in ihren Entwicklungen steckte und wie ihre Leistungen von den Erfolgen anderer Erfinder profitieren würde, wodurch sie ihren Nutzen erhöhten. PCs verkaufen sich wesentlich einfacher, wenn die Kunden mit anderen Usern ihre Daten austauschen können. Käufer des Smartphones haben mehr von ihren Telefonen, wenn sie auch mit PCs kommunizieren können. Google könnte seine Dienste nicht verkaufen, wenn die Kunden keine PCs hätten. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Produkte, die rund um die Digitaltechnik entwickelt wurden: E-Commerce, Kryptographie, Social Media, Online-Banking, usw.





























