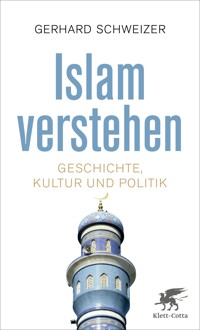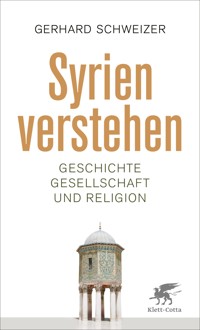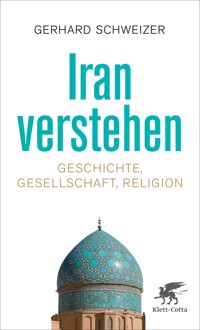
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
»Man kann jedem, der sich umfassend über die Hintergründe der Entwicklung im Nahen Osten informieren will, dieses Buch nur empfehlen.«Die Zeit Mit profunder Kenntnis schildert der Kulturwissenschaftler Gerhard Schweizer Höhen und Tiefen iranischer Geschichte, vom antiken Persien, über Zarathustra bis zur Islamischen Republik, und schenkt Kultur wie Politik gleichermaßen Aufmerksamkeit. Gerhard Schweizer verknüpft seinen historischen Rückblick mit der Analyse von Zeitgeschichte und Politik. Unmittelbar und authentisch gelingen ihm Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Iran, der seit islamistisch regiert wird. Das iranische Staatssystem versteht sich als Vorbild für alle »rechtgläubigen« Muslime, scheitert aber an seinen inneren Widersprüchen. Es ist ein Dilemma, das den Iran auch in den kommenden Jahren zu einem Brennpunkt der Weltpolitik machen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1080
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gerhard Schweizer
Iran verstehen
Geschichte, Gesellschaft, Religion
Klett-Cotta
Impressum
Das vorliegende Buch ist die überarbeitete, korrigierte und ergänzte Neuausgabe des Titels von Gerhard Schweizer: »Iran. Drehscheibe zwischen Ost und West«, Stuttgart, Klett-Cotta 2005.
Die vorliegende Ausgabe wurde 2024 aktualisiert und erweitert.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2017, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung
von © mauritius images/Jose Fuste Raga
Karten: Rudolf Hungreder, Leinfelden-Echterdingen
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98834-5
E-Book ISBN 978-3-608-12328-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung – Der unbekannte Iran
Bilder im Kopf
Fanatismus? Toleranz? Erste Fragen
Aktuelle Überraschungen
Irans Geschichte und westliche Vorurteile
Die einigende Klammer über 2500 Jahre
Propheten und Gottkönige
1. Also sprach Zarathustra
Eine Sternstunde der Religionsgeschichte
Einfluss auf Judentum, Christentum und Islam
Der jüdische Prophet Daniel lernt von Zarathustra
Mani und Mazdak als Revolutionäre
Die Wende zum Islam
Nietzsche deutet Zarathustra um
2. Glanz und Elend der persischen Antike
Der Aufstieg der Achämeniden
Das erste Weltreich der Geschichte
Die zukunftsweisende Ordnung des Dareios
Susa und Persepolis, die Residenzen
Der Ursprung des Gottkönigtums
Die Griechen besiegen einen »Gott«
Griechenland lernt von Persien
3. Modell für ein Jahrtausend
Zeit des Umbruchs
Die wegweisende Kultur der Sassaniden
Das böse Erbe des Gottkönigtums
Iran und Islam
1. Mohammed und die Folgen
Die Botschaft des Propheten
Der Schah weicht dem Kalifen
Die Perser gewinnen an Einfluss
2. Bagdad: Das Persische an der »Hauptstadt der Welt«
Die Abbasiden – in der Nachfolge der Gottkönige
Harun al-Raschid – Legende und Wahrheit
Kalif Mamun träumt von Aristoteles
Mutaziliten, die ersten modernen Kritiker des orthodoxen Glaubens
3. Die iranische Drehscheibe der Kulturen
Al-Chwarizmi, der persische Wissenschaftler und die »arabische« Mathematik
Firdausi und das »Buch der Könige«
Die Folgen eines kulturellen Umbruchs
Avicenna, das Universalgenie aus Buchara
Avicenna, der umstrittene Wegbereiter einer »islamischen Aufklärung«
Ablehnung und Anerkennung – Avicennas ambivalenter Nachruhm
Erste Anzeichen einer islamischen Stagnation
Seldschuken und Perser – eine neue kulturelle Dynamik
Omar Chayyam: Mathematiker, Dichter, Mystiker – und »Ketzer«
Dschelaleddin Rumi, der persische Mystiker in Anatolien
Jenseits aller Dogmen – die Grenzüberschreitung bei Rumi
Der ambivalente Nachruhm des Sufismus
4. Die Mongolenherrschaft
Die Zerstörung Bagdads beendet eine Epoche
Saadi und Hafis, Persiens große Dichter in Schiras
Täbris, Samarkand und andere neue Kulturzentren
Schiiten und Sunniten
1. Die Tragödie der Religionsspaltung
Mit Mohammeds Tod beginnen die Konflikte
Kalif Ali, der Ahnherr der Schiiten
Das Martyrium Husseins
Der Streit um den richtigen Weg
Die »unfehlbaren« Imame der Schiiten
Die Siebener-Schiiten als sozial-religiöse Revolutionäre
Die Assassinen, Terroristen im Namen der Schia
Die Zwölfer-Schiiten und ihr Mythos vom »Verborgenen Imam«
2. Der schiitische Glaube wird Staatsreligion im Iran
Der Derwischstaat von Ardebil
Schah Ismail schafft ein schiitisches Großreich
Die schiitische Dynastie der Safawiden
Die folgenreiche Schlacht von Tschaldiran
Schiitische Perser, sunnitische Türken – Beginn einer tiefen Feindschaft
Krisen gefährden das »neue« Persien
3. »Gottkönige« im Namen der Schia
Schah Abbas, das skrupellose Genie
Mesched, Ghom, Schiras – der Aufstieg schiitischer Wallfahrtszentren im Iran
Isfahan, »Spiegel des Paradieses«
Dekadenz am Hof des Großkönigs
Mullah, Modschtahed, Ajatollah – die neue Hierarchie
Die Verwestlichung und der Gegenschlag
1. Zwischen Fortschritt und Rückschritt
Die Kolonialmächte kommen
Die Kadscharen, eine Dynastie ohne Glanz
Bab – das »Tor« zu einer neuen Religion
Die »ketzerische« Lehre der Baha’i
Die Kadscharen-Schahs als »Lakaien im Dienst der Ungläubigen«
Aufstieg und Krise der Dynastie Pahlevi
1935 – aus »Persien« wird »Iran«
Der folgenreiche Zwischenfall von Ghom
Der junge Schah Mohammad Reza Pahlevi
Mossadeghs gescheiterte Revolution
Despotie im Namen des Fortschritts
2. Khomeini und die Islamische Revolution
Kindheit und Jugend des Revolutionsführers
Vom Ajatollah zum Politiker
Die wachsende soziale Krise und die »Weiße Revolution«
Der Volksaufstand von 1963
Die düstere Bilanz der »Weißen Revolution«
Die fehlgeschlagene Modernisierung
Ursprung des islamischen Fundamentalismus
Khomeinis extreme Position
Ali Schariati, der Revolutionär zwischen den Fronten
Ashura – ein schiitischer Mythos als Motor der Revolution
Fundamentalisten und Reformer
1. Die »Islamische Republik« und erste Probleme
Gottesstaat oder Republik? Die Streitfrage
Toleranz? Intoleranz? Die Duldung religiöser Minderheiten
Khomeini und »Islamische Demokratie«
Widerstand bei säkularen und islamistischen Mitkämpfern der Revolution
Taleghani und Schariat-Madari – Widerstand von ranghohen Geistlichen
Der Krieg mit dem Irak – und die Dynamik des Märtyrerkults
Die sozialen Probleme bleiben ungelöst
Khomeini – historisch eingeordnet
2. Politische und kulturelle Umbrüche nach Khomeinis Tod
Montaseri und Khamenei – die Konflikte bei der Nachfolge des Imam
Rafsandschani, der wendige Pragmatiker
Khatami, der gefährdete Hoffnungsträger
Khatami im wachsenden Konflikt mit Reformgegnern
Montaseri und andere Kritiker in Gefahr
»Keine Religion verfügt über die absolute Wahrheit«
Sorusch, der unbequeme Denker
Doulatabadi, der Dichter zwischen allen Fronten
Terror und Bildungspolitik im Widerstreit
Filmregisseure in der »Islamischen Republik«
Frauenemanzipation und »Islamische Republik«
Der mühsame Fortschritt für Frauen
Tschador und andere »islamische« Kleidung
3. Muslimische Nachbarn und die ungelösten Probleme
Iran und Irak – die Spannung bleibt
Iran und Afghanistan – zwei islamistisch regierte Staaten im Konflikt
4. Zugespitzte Gegensätze
Ein weiterer Vormarsch der Reformer?
Hafis, Goethe – und Khatami
Aghadscheri fordert einen »islamischen Protestantismus«
Khamenei und Montaseri – ein neuer Konflikt
Der Pyrrhussieg der Konservativen
Krisen mit immer neuen Facetten
Ein »schamloser« Film und der große Publikumserfolg
Ahmadinedschad und der neue Vorstoß der Konservativen
Mesbah Yazdi, der radikale Mentor Ahmadinedschads
Atombombe? Antisemitismus? Fragen zur iranischen Außenpolitik
Ein »Glaubenskrieg« zwischen Schiiten und Sunniten im Nahen Osten?
Die Ursachen der »Grünen Revolution«
Das vorläufige Scheitern einer Rebellion?
5. Eine ungewisse Zukunft
Rohani, ein neuer Hoffnungsträger?
Khamenei und Rafsandschani – eine ambivalente Beziehung bis zuletzt
Die Präsidentschaftswahl von 2017
Eine iranische Zivilgesellschaft – unterwegs mit einem Aktivisten
Islam? Republik? Überraschende Kommentare
Die Herausforderung der westlichen Moderne – ein Dialog auf Augenhöhe?
Reformen? Die weiterhin ungelösten Probleme
Aufstände gegen soziale und politische Fehlentwicklungen
Präsident Raisi und die Kritik an »Islamischer Demokratie«
Die bisher größte Rebellion gegen das Regime
Warum Sorusch und viele andere modern denkende Theologen im Exil leben
Warum Aghadscheri, der »islamische Protestant«, nicht im Exil ist
Vom theokratischen zum säkularen Staat? 2023 die aktuelle Frage
Die weiter drohenden Konflikte mit anderen Staaten
Das folgenschwere Attentat in Kerman. Seit 3. Januar 2024 eine weitere Krise
Die sich weiter zuspitzende Krise
ANHANG
Zeittafel
Literaturhinweise
Personenregister
Für Hossein Pur Khassalian meine Frau Brigitte und meine Reisefreunde Gisela Kerntke Dieter Dumont
Einleitung – Der unbekannte Iran
Bilder im Kopf
Die Moscheen von Isfahan, Yazd, Schiras und Kerman mit ihren bunt gekachelten, ornamentübersäten Wänden, dominiert von leuchtendem Blau . . . Die dreitausend Jahre alten Ruinen von Persepolis mit ihren kunstvollen Figurenreliefs . . .
Es sind diese Bilder, die jeder Reisende im Kopf hat, bevor er überhaupt das erste Mal den Iran betritt. Es sind diese Bilder, die besonders zu einer Reise in das Land mit seiner lang zurückreichenden, vielschichtigen Kultur animieren.
Aber dann die Bilder aus der unmittelbaren politischen Gegenwart: überlebensgroße Porträts des Revolutionsführers Ajatollah Khomeini(1) und seines Nachfolgers Ajatollah Khamenei(1), wie sie von den Fassaden der Moscheen, Regierungsgebäude, Bahnhöfe und Banken auf die Passanten herabsehen, mal mit aggressiv kontrollierendem Blick, mal mit überraschender Milde. Und auf den Straßen bewegen sich verhüllte Frauen, viele davon im schwarzen Tschador, der nur das Gesicht freigibt. Zwischendurch finden sich zwar auch Frauen in westlicher Kleidung, das bunte Kopftuch nach hinten geschoben, so dass demonstrativ eine Haarsträhne sichtbar wird. Aber trotz solch starker Kontraste im Erscheinungsbild bleibt der Eindruck strenger Reglementierung bis in Details des Alltags hinein bestehen.
Wie fremd ist der Iran für unser westliches Empfinden? Wie unnahbar? Oder anders gefragt: Wie stark sind westliche Beobachter der Versuchung ausgesetzt, angesichts der Übermacht solcher Bilder die fremde Kultur von vornherein nur sehr eingeschränkt, sehr eindimensional wahrzunehmen?
Der westliche Blick auf den Iran war – und ist – belastet durch die »Islamische Revolution« von 1979. Damals war es für viele Europäer und Amerikaner ein Schock, dass es Vorkämpfern eines politischen Islam gelang, Schah Mohammad Reza Pahlevi(1) zu stürzen und anstelle eines säkularen Staatswesens einen »Gottesstaat« zu errichten – nach westlicher Logik also das Rad der Geschichte von der Moderne ins Mittelalter zurückzudrehen. Auch wenn damals schon für aufmerksame politische Beobachter deutlich war, wie brutal diktatorisch der Schah regierte, so schien er als »säkularer«, »prowestlicher« Despot doch nach landläufigem westlichen Verständnis das kleinere Übel im Vergleich zu einem »islamischen« und »antiwestlichen« Despoten zu sein.
»Gottesstaat« . . . Kein Schlagwort kann allerdings missverständlicher sein als dieses. Denn es verleitet dazu, den politischen Islam des Iran ideologisch undifferenziert auf eine Ebene mit dem engstirnigen Denken wahhabitischer Fundamentalisten zu rücken, so etwa jenem in Saudi-Arabien oder gar jenem von islamistischen Terror-Organisationen wie al-Qaida und dem »Islamischen Staat«. Noch stärker zur undifferenzierten Einstufung verleitet schließlich ein Schlagwort, das US-Präsident George W. Bush(1) am 9. Januar 2002 in Umlauf brachte. Bush behauptete, der »Gottesstaat Iran« würde, zusammen mit der Diktatur Saddam Husseins(1) im Irak und der Diktatur der Kim-Dynastie in Nordkorea eine »Achse des Bösen« bilden und die größte Bedrohung für den Weltfrieden überhaupt darstellen. Und dies äußerte Bush(2) ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der iranische Staatspräsident Mohammad Khatami(1) nicht nur einen Dialog mit westlichen Staaten anstrebte, sondern auch innenpolitisch Reformen gegen ideologische Hardliner des eigenen Systems durchzusetzen versuchte.
Mehr als drei Jahrzehnte dominierte in europäischen wie amerikanischen Medien die Befürchtung, dass es dem Iran gelingen könne, seine Form von »islamischer Revolution« in andere Länder zu exportieren – und damit würde das »Mullah-Regime« den gesamten Nahen und Mittleren Osten in einen explosiven Unruheherd verwandeln. Die Auswirkungen könnten letztlich auch die Stabilität westlicher Staaten erschüttern.
Seit dem Einmarsch amerikanischer und britischer Truppen in den Irak (2003) und vollends seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien (2011) ist im Nahen Osten tatsächlich ein Unruheherd entstanden, dessen weltweite Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. Und der Iran ist in die Bürgerkriegswirren beider Staaten verwickelt, ja, er versucht die Krise zu nutzen, um seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Aber der Iran hat die Krise nicht verursacht. Wesentlich mehr als der vielgeschmähte »Gottesstaat Iran« trugen das irakische wie das syrische Regime und erst recht radikal-sunnitischer Fundamentalismus der Terror-Organisationen al-Qaida und »Islamischer Staat« zu den verheerenden Zerstörungen nahöstlicher Strukturen bei, nicht zu vergessen auch die kurzsichtige Politik der USA und anderer westlicher Staaten.
Der westliche Blick auf den Iran hat sich im Verlauf der Jahrzehnte mehrmals geändert. So etwa als die ideologisch moderaten Staatspräsidenten Rafsandschani(1) und Khatami(2) im Konflikt mit dem religiös-politischen Staatsoberhaupt Khamenei(2) Reformen durchzusetzen versuchten. Sie haben damit einen Iran vorstellbar gemacht, dessen System politisch wie kulturell vielschichtig ist. Anders dann, als der ideologisch radikale Nachfolger Ahmadinedschad(1) exakt den gegenteiligen Eindruck einer nicht reformierbaren Diktatur erweckte. Und wiederum mit einer neuen Variante, seit 2013 der ideologisch moderate Hassan Rohani(1) Staatspräsident geworden ist und der Iran sich 2014 dem Tourismus stärker geöffnet hat. Seither häufen sich die Kommentare von Journalisten wie auch von Reisenden über eine »Liberalisierung« in dem islamistisch regierten Land. Gleichzeitig erreichen uns jedoch Nachrichten von Amnesty International, wonach die Zahl der Hinrichtungen – ausgerechnet unter der Regierung von Rohani(2) – rasant gestiegen sind, ebenso die Repressalien von »Revolutionswächtern« gegen die Bevölkerung. Muss man also nicht doch von einer »rigiden Diktatur« sprechen?
Die Begegnungen mit dem Iran der Gegenwart bieten für den westlichen Besucher zahlreiche Eindrücke, die in ihrer Gegensätzlichkeit nicht sofort auf einen Nenner zu bringen sind. Umso größer erscheint die geistige Herausforderung, den Iran zu verstehen.
Fanatismus? Toleranz? Erste Fragen
Bei meiner Reise durch den Iran im November 2016 hatte ich ein Erlebnis, das besonders geeignet erscheint, den Eindruck einer nicht leicht zugänglichen Kultur zu vermitteln. Und bereits damit verknüpfen sich eine Reihe Fragen.
Fremdartiger hätte die Atmosphäre nicht sein können. Hunderte Männer, völlig in Schwarz gekleidet, schlugen sich monoton rhythmisch mit der rechten Hand auf die Brust. »Ya Hussein(1) . . . ya Hussein«, »oh Hussein . . . oh Hussein . . .« Hunderte Männer bewegten sich im großen Kreis und schlugen sich mit Eisenketten, die sie in der linken Hand hielten, auf den Rücken. Ein Prozessionswagen folgte, auf dem ein Sänger stand, der mit einem Megaphon das »ya Hussein, ya Hussein« im Tonfall steigerte, begleitet vom dumpfen Schlag einer Trommel. Hunderte Männer reihten sich als Zuschauer hinter metallenen Absperrgittern, viele von ihnen schlugen sich im gleichen Takt mit der rechten Hand auf die Brust, manche hatten die Augen andächtig geschlossen. Und in der zweiten Reihe drängten sich Hunderte Frauen, nahezu alle im tiefschwarzen Tschador. »Ya Hussein(2) . . . ya Hussein . . .« Der rhythmische Klang der Sprechchöre, das rhythmische Klatschen von Händen und Ketten, das rhythmische Schlagen der Trommel, die gedehnten Vokale im Gesang, das alles war geeignet, bei den Versammelten eine Art Trance zu erzeugen.
Es war eine Prozession zu Ehren des Prophetenenkels Hussein(3), der als Märtyrer zu einer überragenden Symbolfigur des schiitischen Islam geworden ist. Das Schlagen mit Fäusten und Ketten steht symbolisch für die Geißelung der Sünder, die im Jahr 680 unserer Zeitrechnung den Enkel des Propheten Mohammed im Kampf gegen seine »ungläubigen« Feinde im Stich gelassen hatten. Husseins(4) Todestag am zehnten Tag des islamischen Monats Muharram wird unter dem arabischen Namen Ashura »der Zehnte« von Schiiten in aller Welt durch mehr oder weniger große Prozessionen begangen. In geringerem Umfang gilt dies auch für den Abschluss des Trauergedenkens am vierzigsten Tag unter dem arabischen Namen Arbain »der Vierzigste«. Am intensivsten werden solche Rituale im Iran praktiziert, wo rund 90 Prozent der Bevölkerung Schiiten sind.
Die Trauerprozession, die ich beobachtete, bewegte sich im weitverzweigten Gebäudekomplex des Schreins der Fatemeh Masoumeh(1). Die dort verehrte Tote ist eine Schwester von Ali Reza(1), des achten Imam in der Reihe der zwölf heiligen schiitischen Imame. Der Schrein gilt als eine der wichtigsten Pilgerstätten des Iran und befindet sich in der Stadt Ghom, dem bedeutendsten Zentrum religiöser Hochschulen des Landes. Gerade in den Höfen des Schreins mit den bunt ornamentierten Wänden, Torbögen, Minaretten und den goldenen Kuppeln sammelt sich an hohen Feiertagen eine unübersehbare Menschenmenge.
Ghom . . . Der Name verbindet sich in den westlichen Medien vor allem mit der Tatsache, dass in dieser heiligen Stadt Khomeini(2) mehrere Jahrzehnte lebte und als Professor für Theologie und islamisches Recht lehrte. Als ich dort sein ehemaliges Wohnhaus besuchte und das Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Bücherregalen besichtigte, erklärte mir mein iranischer Begleiter stolz: Hier sei die »Islamische Revolution« geboren worden. Ghom . . . Der Name verbindet sich in der Tat mit dem Beginn des Umsturzes gegen den Schah. In den Straßen Ghoms haben im Januar 1978 Demonstrationen gegen die säkular orientierte Diktatur der Pahlevi-Dynastie ihren Anfang genommen, mit radikalen Parolen auch gegen den Einfluss der »zersetzenden« Ideologien und Lebensformen des Westens.
Aber die Unruhen, die in Ghom begonnen haben, sind auch nicht zu trennen von den Prozessionen zu Ehren des Prophetenenkels Hussein(5). Die Unruhen gegen den Schah wurden entfacht während des Trauermonats, in dem sich die Gläubigen besonders leicht zu religiös-politischen Aktionen motivieren ließen. Und mehr noch: Gegen Ende desselben Jahres 1978, als die Revolution den gesamten Iran erfasst hatte, nutzte Khomeini(3) den Todestag Husseins, den Tag der »Ashura«, für eine besonders wirksame Agitation. Er rief die vielen Tausend Demonstranten in iranischen Großstädten dazu auf, todesmutig in das Gewehrfeuer der Schah-Soldaten zu rennen und zu sterben wie der »heilige Märtyrer Hussein(6)«, denn nur durch eine derartige Opferbereitschaft lasse sich die Herrschaft des »ungläubigen Tyrannen« brechen. Die Bilder von Demonstranten, die zu Tausenden mit dem Ruf »ya Hussein, ya Hussein« religiös aufgeputscht tatsächlich dem Aufruf Khomeinis(4) folgten und ihr Leben opferten – eine solch explosive Dynamik hat viele europäische und amerikanische Beobachter darin bestärkt, dass wir es mit einer sehr fremden, für das westliche Denken letztlich nur schwer zugänglichen Mentalität zu tun haben.
Und doch: Ausgerechnet in Ghom, dem Geburtsort der Ideologie der »Islamischen Revolution«, hatte ich ein Gespräch, das wenig zu einer solch fanatischen Abwehrhaltung gegenüber einer säkularen, pluralistischen Weltordnung zu passen schien.
Ich war unterwegs mit meiner Frau und Freunden durch das Gelände des Schreins der Fatemeh Masoumeh(2). Uns begleitete durch das Gedränge im heiligen Bezirk eine Frau, die uns als obligate Führerin zugeordnet war. Sie, von Beruf Englischlehrerin, sprach perfektes Englisch. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Tschador, der den ganzen Körper verhüllte und nur das Gesicht freigab. Ein schmales, ernstes, nahezu feierliches Gesicht, das zusammen mit der dunklen Farbe des Tschadors die Aura eines düsteren Engels ausstrahlte. Als sie jedoch zu reden anfing, wurde ihre Miene weich und freundlich, und das Gespräch brachte eine Überraschung. Wir diskutierten anfangs über den Islam, dann über Christentum und Judentum. Und sie erklärte: Sie respektiere alle Religionen. Entscheidend sei, dass in jeder Religion Humanität praktiziert werde. Im Vergleich dazu seien die dogmatischen Unterschiede unwichtig.
Wie war ein solches Bekenntnis zu Toleranz und religiöser Vielfalt vereinbar mit dem Absolutheitsanspruch der »Islamischen Revolution«? Wie mit dem unanfechtbaren Primat einer islamischen Staatsordnung?
Eine nahezu deckungsgleiche Aussage erhielten wir jedoch auch in Schiras vom obligaten Fremdenführer im Schah-Tscheragh-Heiligtum, einer weiteren zentralen Pilgerstätte des Iran. Und zusätzlich noch von Familien, die uns zum Essen eingeladen hatten. Aber unsere Gesprächspartner bejahten ausdrücklich den Sturz des Schahs und die Notwendigkeit einer »islamischen Revolution«.
Nur wenige Wochen später ergab sich ein weiterer Anstoß für Fragen. Zurück aus dem Iran, erreichte uns eine E-Mail mit der Überschrift »Ein muslimischer Gruß zum Advent und zum bevorstehenden Weihnachten«. Abgeschickt hatte die Nachricht ein muslimischer Freund, der Deutsch-Iraner Dr. Hossein Pur Khassalian(1), der in Bonn wohnt und uns auf der mehrwöchigen Reise fünf Tage lang begleitet hatte. Er schrieb unter anderem: »Es gehört zum gut Integriertsein, sich über die Feste zu freuen, die im Gastland gefeiert werden. Auch ich freue mich über die Advents- und Weihnachtszeit. Nicht zuletzt, weil Jesus einen überragenden Stellenwert im Koran hat. Zu diesem Anlass möchte ich einige meiner Lieblingsverse aus dem Koran, Sure 3, übermitteln, dort, wo es um die Geburt Jesu geht. Möge dies als ein Beitrag zum besseren Verständnis und gegenseitigen Vertrauen verstanden werden.« Wenige Tage später erreichte uns eine Mail seines Bruders Abbas Pur Khassalian(1) aus Teheran, der uns im Namen seiner ganzen Familie ebenfalls schöne Weihnachten wünschte. Beide Grüße stammen von Muslimen, die unter dem Schah verfolgt wurden, den Umsturz unter Khomeini(5) begrüßt hatten und die »Islamische Revolution« nach Jahrzehnten im Prinzip immer noch bejahen, allerdings entschieden Reformen im Iran von heute wünschen.
Sind solche Muslime Einzelfälle?
Anlass zu weiteren Fragen bietet erst recht ein Weihnachtsgruß, wie ihn ein hochrangiges Mitglied der iranischen Regierung, nämlich Staatspräsident Mohammad Khatami(3), 1998 an den damaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog(1) gesandt hat: »Zur gesegneten Geburt des hochangesehenen Propheten Jesus Christus, Geist und Wort Gottes, übermittle ich Ihnen, der deutschen Regierung und dem deutschen Volk die besten Glückwünsche.«
Was bedeutet das? Staatspräsident Khatami(4) ist wenige Jahre nach seiner Amtszeit (1997 – 2005) wegen kritischer Äußerungen politisch geächtet worden, und seither darf im Iran keiner seiner Aussprüche mehr veröffentlicht werden. Auch dürfen keine Bilder mehr von ihm gezeigt werden. Welche Rückschlüsse lässt dies auf die ideologischen, religiös-politischen Spannungen in der »Islamischen Republik Iran« zu? Auf meiner Reise im November 2016 entdeckte ich zu meiner Überraschung aber in Moscheen und in Basaren der Stadt Yazd, in deren Nähe Khatami(5) geboren wurde, immer wieder Porträts von ihm, und die Einheimischen nickten mir freundlich zu, wenn ich diese Porträts fotografierte. Welche Rückschlüsse lässt dies auf die politische Situation im Iran der Gegenwart zu?
Auf westliche Besucher warten vielfältige Eindrücke, die einerseits die oft negativen Medienberichte in Europa und Amerika voll bestätigen – aber andererseits auch solche, die ihnen widersprechen. Es ergeben sich zahlreiche Überraschungen, die sich nicht in die sattsam bekannten Schemen fügen lassen. Dies sind Erfahrungen, wie ich sie bei meinen Reisen in den Iran seit 1964, als noch Schah Mohammad Reza Pahlevi(2) regierte, in immer neuen Variationen erlebt habe. Ich biete zur Einführung noch einige weitere Beispiele meiner Begegnungen im November 2016 – mit vielen offenen Fragen.
Aktuelle Überraschungen
»Welcome to Iran.« Eine Gruppe junger Frauen im dunklen Tschador umringte uns. Sie seien Studentinnen und wollten ihr Englisch üben, ob sie mit uns ein paar Minuten sprechen dürften? Sie seien sehr erfreut, dass wir ihr Land besuchten. Wie wir die Menschen, wie wir die Kultur beurteilten? In westlichen Medien würde immer nur schlecht über den Iran berichtet. Weshalb wir trotzdem in den Iran kämen? Die Frauen baten um ein Gruppenfoto und zückten ihre Digitalkameras. – Ein Gruppenfoto! An manchen Tagen wiederholte sich eine derartige Bitte bis zu zwanzig Mal. Etliche der Männer legten hierbei vertraulich den Arm auf meine Schulter, als seien wir befreundet, die Frauen stellten sich dicht neben meine Frau. Sie alle schienen großen Wert darauf zu legen, zusammen mit Besuchern aus dem Westen auf einem Foto vereint zu sein und hierbei den Anschein von »Nähe« zu erwecken. Ob sie uns zu einer Tasse Tee einladen dürften? Ob wir Hilfe brauchten? Wir könnten gerne ihre Telefonnummer haben und notfalls anrufen. Wie passt dies zu einem Land, das seit der »Islamischen Revolution« 1979 weitgehend gegen das westliche Ausland abgeschottet war? Mussten die Iraner nicht durch eine nahezu drei Jahrzehnte dauernde antiwestliche Propaganda die Abneigung gegen die Fremden aus dem »ungläubigen«, »islamfeindlichen«, »imperialistischen« Ausland zutiefst verinnerlicht haben?
Shakespeare(1) . . . An der Vorderfront eines Theaters in Teheran sah ich Romeo und Julia angekündigt, in Isfahan Othello . . . Wiederum in Teheran: Arthur Millers(1)Tod eines Handlungsreisenden . . .
Immanuel Kant(1), Sören Kierkegaard(1), Friedrich Nietzsche(1), Aristoteles(1) . . . In etlichen akademischen Buchhandlungen von Ghom, Isfahan und Schiras entdeckte ich Titel mit den Porträts europäischer Denker, die für das Religionsverständnis einer islamistischen Regierung eine Herausforderung darstellen müssen. Weshalb trotzdem die Präsenz? Für westliche Besucher ergibt sich die Schlussfolgerung: Auf welche Weise iranische Autoren sich auch immer mit solchen Geistesgrößen der fremden Kultur auseinandersetzen – offensichtlich ist, dass diese herausragenden abendländischen Denker in der »Islamischen Republik Iran« wichtig genug für eine Veröffentlichung erscheinen.
Maria Montessori(1) . . . Eine Überraschung auch dies: eine Diskussion mit Lehrerinnen in Teheran. Die Frauen in weiten, körperverhüllenden Mänteln und mit Kopftüchern erklärten, dass sie in ihrer Freizeit sozial verwahrloste Jugendliche betreuten und sie nach dem Prinzip der italienischen Pädagogin Montessori(2) erziehen würden. Nein, sie würden dabei nicht von der Regierung finanziell unterstützt und sie wollten das auch nicht, denn dann müssten sie sich dem Diktat konservativer Bürokraten beugen, die das Ziel einer individuellen freien Erziehung ablehnten. Die Gelder würden sie aus dem Ausland von fortschrittlich denkenden Iranern beziehen. – Ob sie die gegenwärtige Regierung ablehnten? Diese Frage stellte ich in den geschlossenen Räumen einer Wohnung, wo wir vor unerwünschten Zuhörern sicher waren. Die Frauen antworteten: Die »Islamische Revolution« sei im Prinzip notwendig gewesen, sie müsse sich allerdings im Sinn einer islamischen Moderne weiterentwickeln, sie dürfe nicht erstarren.
Die Frauen hatten uns Männern zur Begrüßung in der Wohnung die Hand gegeben, was einen demonstrativen Verstoß gegen den offiziellen »islamischen« Verhaltenskodex bedeutete. Als uns aber eine Frau vor die Haustür begleitete und ich ihr im Reflex zum Abschied die Hand reichen wollte, hob sie, fremden Blicken ausgesetzt, erschrocken beide Arme: »No! No!«
Persepolis? Der Taxifahrer, der uns von Schiras in die rund 40 Kilometer entfernte altpersische Ruinenstätte brachte, antwortete auf meine Frage: Es gebe kaum einen Iraner, der nicht stolz auf die dreitausend Jahre alte Kultur sei. Und es sei gut, dass die islamische Regierung die Erhaltung der vorislamischen Ruinen intensiv fördere, das unterscheide sie von den engstirnigen Dogmatikern in Saudi-Arabien, auch von den Muslimbrüdern, erst recht von den Fanatikern der al-Qaida und des »Islamischen Staates«.
Persepolis? Wenige Tage später erklärte mir ein Lehrer in Yazd: Persepolis und die ganze altpersische Kultur bedeute eine Provokation für das engstirnige Geschichtsverständnis der radikal-islamischen Regierung. Am liebsten würde die verbieten, dass in Restaurants, in Busbahnhöfen und in Flughäfen Reliefs altpersischer Gottkönige, Drachen und Fabelwesen abgebildet seien. Nur habe die Regierung nicht genug Macht, das zu verbieten, was im Volk populär sei.
Diktatur? Theokratie? Republik? Demokratie – spezifisch islamisch? Manche meiner Gesprächspartner zuckten betont ironisch die Achseln. Das alles seien Begriffe, die irgendwie zuträfen und andererseits auch wieder nicht. Die »Islamische Republik« sei von allem etwas. Religiöse Fanatiker, jawohl, die gebe es. Kritische, unorthodoxe Denker, die gebe es auch. Brutale Zensur, Gefängnisstrafen, Hinrichtungen . . . oh ja. Aber genauso künstlerisch interessante Bücher und Spielfilme, offene Diskussionen mit sozial und religiös kritischem Inhalt. Das alles existiere nebeneinander, und niemand wisse, wohin die Entwicklung gehe.
Die Meinungen im Spezifischen fächerten sich vor allem in drei vorherrschende Richtungen auf. Manche Gesprächspartner identifizierten sich mit den Idealen der »Islamischen Revolution« und meinten, man solle die Krisen in ihrer Bedeutung nicht überschätzen. Andere bekannten sich zwar im Prinzip zur Revolution, identifizierten sich jedoch nicht mit dem gegenwärtigen Staat, sondern wünschten sich nachhaltige Reformen. Andere wiederum lehnten die sogenannte »Islamisierung« grundsätzlich ab, ohne allerdings eine Rückkehr zur säkularen Diktatur des Schahs zu wünschen.
Meine Gesprächspartner, Männer und Frauen des iranischen Bildungsbürgertums, traf ich, von der Öffentlichkeit abgeschirmt, in Wohnungen oder war mit ihnen in Taxis unterwegs. Oder es waren Taxifahrer, etliche von ihnen arbeitslose Akademiker, begierig darauf, mit Ausländern zu reden. Aber gemeinsam war ihnen allen die Grundhaltung, man solle die »Islamische Republik Iran« bitte nicht mit Regimes wie denen in Saudi-Arabien, den Golf-Emiraten, dem sogenannten »Islamischen Staat«, den Taliban auf eine Ebene rücken. In westlichen Medien werde das ja immer wieder getan. Für jeden Iraner sei das eine Beleidigung. Und viele der Gesprächspartner legten Wert auf die Feststellung, dass sich in der »Islamischen Republik« die Alphabetisierung sowie die soziale Lage erheblich gebessert haben, trotz der massiven wirtschaftlichen Sanktionen durch westliche Staaten.
Es sind ambivalente, offensichtlich widersprüchliche Auskünfte, von denen ich nur einige aus der Vielzahl meiner Begegnungen aus dem Jahr 2016 zitiere. Die Überraschung war, dass derartige Gespräche teilweise wenig von denen abwichen, die ich mit iranischen Männern und Frauen im Ausland führen konnte. Dass ich aber bei persönlichen Begegnungen nur auf Iraner einer gehobenen Bildungsschicht hinweisen kann, macht allerdings auch etwas anderes deutlich: Es ist erst recht schwierig, den Iran jenseits dieser Bildungsschicht – in seinen traditionell voneinander abgeschlossenen Strukturen – zu verstehen.
Irans Geschichte und westliche Vorurteile
Iran verstehen. Geschichte, Gesellschaft, Religion. Das vorliegende Buch konzentriert sich, wie schon der Titel vermuten lässt, nicht nur auf die politischen und religiösen Konflikte der »Islamischen Republik Iran«. Vielmehr geht die Darstellung weit zurück in die Vergangenheit, ja, bis hin zu den Anfängen iranischer Geschichte zur Zeit Zarathustras und der altpersischen Gottkönige. Denn nur mit einer derartigen Spannweite lassen sich die Konfliktursachen von heute in ihrer ganzen Vielfalt begreifen. Und erst dann wird auch deutlich, welch ungeheure Bedeutung der Iran als Kulturraum seit nahezu drei Jahrtausenden hat – eine Bedeutung, die der westliche Besucher selbst bei einer eiligen Reise in Städten wie Isfahan, Yazd und Schiras ebenso wie in der vorislamischen Ruinenstätte von Persepolis erahnen kann. Ich greife in den Ausführungen auf mein schon in den 1990er-Jahren veröffentlichtes Buch Iran. Drehscheibe zwischen Ost und West zurück, das bis 2005 in fünf Auflagen erschien. Aber hierbei setze ich neue Akzente nicht nur in Bezug auf die Gegenwart, sondern auch im Rückblick auf die reichhaltige kulturelle Tradition.
Über 2500 Jahre lang ist der Iran ein exemplarischer Schauplatz kultureller, religiöser und politischer Veränderungen und Aufbrüche gewesen. Schon in vorislamischer Zeit besaß die iranische Kultur weit über die eigenen Grenzen hinaus Ausstrahlung und wurde schließlich eine jener Kernregionen, von der maßgebende Einflüsse auf die islamische Hochkultur und weiter auf Europa ausgegangen sind. Die Geschichte des Iran bietet nicht nur aufschlussreiche Einblicke in großräumige Zusammenhänge islamischer Kultur, sondern auch in den fruchtbaren kulturellen Austausch zwischen Islam und christlichem Abendland. Immer wieder hat der Iran für religiöse, kulturelle und politische Entwicklungen eine Drehscheibe zwischen Orient und Okzident gebildet. Die Nachwirkungen auf unsere Gegenwart sind beträchtlich.
Ein solcher Iran ist bei uns im Westen weitgehend unbekannt. Diese Informationslücke will das vorliegende Buch schließen – um dann den Bogen zu der aktuellen Frage zu spannen, ob der Iran seine moderne Krise überwinden und zukünftig wieder eine wesentliche Rolle im kulturellen Diskurs spielen kann.
Natürlich wissen wir alle, dass der Iran schon bessere Zeiten gesehen hat. Die Ruinen von Persepolis mit ihren äußerst kunstvollen Figurenreliefs, die prächtigen Moscheen mit ihren bunt gekachelten, ornamentübersäten Wänden, dominiert von leuchtendem Blau – dies schon gibt uns einen eindrucksvollen Hinweis auf vergangene Größe, und kaum jemand, der die Monumente durch persönlichen Besuch oder auch nur anhand von Fotos kennenlernte, wird sich der Faszination entziehen können. Aber den Iran deshalb zu den bedeutsamsten und genialsten Kulturnationen der Menschheit zu zählen – da beginnt unser Zögern.
Stets haben wir dazu geneigt, den Iran zu unterschätzen, selbst die größten Leistungen innerhalb seiner 2500-jährigen Geschichte haben wir nie uneingeschränkt anerkennen wollen. Zwar verschweigt heutzutage keines unserer Geschichtsbücher, wie bedeutsam doch die Kultur zur Zeit eines Großkönigs Kyros(1) oder Dareios(1) gewesen ist, im selben Atemzug wird aber auf die »überlegene Kultur« ihrer gewichtigen Rivalen, der Griechen, verwiesen. Athen und das hellenistische Alexandria zählen für uns mehr als Susa, Persepolis und Ktesiphon, jene großen kosmopolitischen Metropolen eines asiatischen Weltreiches. Ein Sokrates(1), Platon(1) und Aristoteles(2) bedeuten uns erheblich mehr als Zarathustra(1), jener wegweisende Religionsstifter aus dem östlichen Iran. Die Griechen haben das erste Perserreich vernichtet, und wir stützen uns vor allem auf die Geschichtsschreibung der Sieger.
Nicht weniger einseitig beurteilen wir den islamischen Iran, selbst dessen vielgerühmte klassische Epoche. Wir bezeugen zwar Respekt vor den kunstvollen Moscheen, und zumindest unvoreingenommene Europäer scheuen sich nicht, manche dieser Bauwerke im Rang unseren Kathedralen gleichzustellen; auch sind uns zumindest dem Namen nach etliche muslimische Geistesgrößen geläufig, so etwa Avicenna(1), Omar Chayyam(1), Firdausi(1), Dschelaleddin Rumi(1), Saadi(1) und Hafis(1), aber wer von uns wollte einer solchen Epoche schon eine zentrale Stellung in der Geistesgeschichte der Menschheit zubilligen?
Islam und Kultur . . . Wir tun uns ohnehin noch schwer damit, unvoreingenommen die Leistungen muslimischer Völker, von den Iranern über die Araber bis hin zu den Türken, zu bewerten. Wir sind belastet von der Erinnerung an »Heilige Kriege«, die im Namen Allahs gegen das christliche Abendland geführt wurden, wir denken zuerst einmal an fanatische Glaubenskrieger und grausame Eroberer, bevor uns Bedeutsames zu muslimischen Wissenschaftlern, Philosophen, Dichtern und Künstlern einfällt. Was uns heute in der Engstirnigkeit mancher Fanatiker entgegentritt, bestätigt vielen von uns die Vorstellung vom Muslim, wie er angeblich immer schon war. Aber: Um das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung mussten sich die meisten europäischen Staaten als »Entwicklungsländer« betrachten, nicht der Orient. Damals stellten islamische Völker die führenden Mächte innerhalb der Weltzivilisation – und der Iran beziehungsweise Persien galt über Jahrhunderte hinweg als das geistige Zentrum dieser überaus schöpferischen, weltoffenen Kultur.
Inzwischen sind wir zwar dabei, uns von den gröbsten Vorurteilen zu lösen. Wir beginnen zu akzeptieren, dass Europa sehr viel an kultureller Anregung gerade der islamischen Welt verdankt. Mit dieser geänderten Einstellung verfangen wir uns aber oft genug in neuen Einseitigkeiten. Bei aller Aufgeschlossenheit lassen wir gerne außer Acht, wie vielfältig und unterschiedlich diese fremden Einflüsse ihrer Herkunft nach sind. Nicht selten setzen wir die Hochleistungen der klassischen islamischen Epoche mit »arabisch« gleich und vernachlässigen, welche Rolle in der Kulturvermittlung zur selben Zeit die Perser (in späteren Jahrhunderten dann die Türken) gespielt haben. Wir sprechen von »arabischen Zahlen«, obwohl diese von persischen Mathematikern aus Indien übernommen wurden. Wir bezeichnen die Algebra und das Rechnen mit Logarithmen gerne als arabische Erfindungen, obwohl ihr Begründer al-Chwarizmi(1) Perser war. Wir neigen dazu, die Märchen aus 1001 Nacht für arabisch zu halten, obwohl viele von ihnen iranischen Ursprungs sind. Wir nennen Bagdad in seiner kulturellen Hochblüte vom 8. bis zum 13. Jahrhundert meist ein arabisches Zentrum, obwohl Perser diese Kultur wesentlich mitgestalteten.
Woher das Missverständnis? Die arabischen Eroberer hatten im persischen Kulturraum ihre Sprache als Herrschaftssprache eingeführt, sie ist über Jahrhunderte auch Kultursprache der Perser beziehungsweise der Iraner gewesen. Manche iranischen Gelehrten erscheinen uns bei flüchtiger Kenntnis als Araber, nur weil sie dem Brauch ihrer Zeit gemäß nicht persisch, sondern arabisch schrieben. Das berühmteste Missverständnis liefern in dieser Hinsicht die arabisch geschriebenen Werke der persisch geprägten Universalgelehrten Avicenna(2) und Omar Chayyam(2) aus dem 11. Jahrhundert. Ein ähnliches Missverständnis gibt es oft bei dem großen persischen Dichter und Mystiker Dschelaleddin Rumi(2), den viele für einen Türken halten, nur weil er nahezu fünf Jahrzehnte in Anatolien gelebt hat und dort 1273 gestorben ist. Nichts kann die Iraner von heute mehr irritieren, als wenn wir im Westen »arabisch«, »türkisch« und »persisch« nicht auseinanderhalten oder wenn wir behaupten, da gebe es keine großen Unterschiede. Deutsche würden sich schließlich auch missverstanden fühlen, falls Ausländer ihre Kultur gedankenlos mit der der Engländer, Franzosen, Italiener gleichsetzten.
Die Orientalistik selber trägt zeitweise zu dem Missverständnis bei. In diesem Zusammenhang ist sogar eines der herausragenden populärwissenschaftlichen Standardwerke zu nennen, das detailreich und exakt beschreibt, welches Kulturgut das Abendland dem islamischen Raum verdankt: Allahs Sonne über dem Abendland von Sigrid Hunke(1). Das Buch trägt den Untertitel: »Unser arabisches Erbe«. Korrekter, weil neutraler, müsste es heißen: unser islamisches Erbe (»islamisch« als ein umfassender Kulturbegriff).
Anhand von 2500 Jahren iranischer Geschichte lässt sich zeigen, wie groß neben dem arabischen Transport östlicher Kultur ins Abendland der Anteil an persischem, iranischem Erbe ist.
Die einigende Klammer über 2500 Jahre
Die Geschichte des Iran ist von Extremen geprägt, weshalb es der Betrachter von heute schwer hat, über 2500 Jahre hinweg eine einheitliche Grundlinie aus der vielschichtigen Vergangenheit herauszuarbeiten. Der Iran wurde nicht nur von Iranern regiert, sondern jahrhundertelang auch von Arabern, Turkvölkern und Mongolen, sie alle brachten fremde Denkweisen mit und setzten alten Traditionen oft jäh ein Ende. Es musste daher als Geschichtsfälschung anmuten, dass der letzte Schah, Mohammad Reza Pahlevi(3), im Oktober 1971 vor den imposanten Ruinen von Persepolis prunkvoll das 2500-jährige Bestehen der »iranischen« Monarchie feiern ließ. Denn eine bruchlose Kontinuität von Kyros(2) bis zur Dynastie Pahlevi gibt es nicht, über Epochen hinweg fehlte der einheimische Monarch. Aber man muss auch an der Betrachtungsweise orthodoxer Muslime zweifeln, wenn sie, wie etwa Khomeini(6) es tat, die Geschichte des Iran erst mit dem Auftreten islamischer Eroberer beginnen lassen wollen und alle vorhergehenden Epochen als für die Gegenwart bedeutungslos abtun.
Der Iran von heute deckt sich nicht mit den früheren Grenzen. Während einiger seiner glanzvollsten Epochen hatte der Iran nahezu die Ausdehnung von Westeuropa; dagegen ist der heutige Staat an Ausdehnung »nur« noch etwa viermal so groß wie Deutschland (weite Flächen sind Steppe und Wüste, während sich die Menschen in wenigen fruchtbaren Regionen zusammendrängen). Manche Städte, deren Namen mit Höhepunkten persischer Geschichte verknüpft sind, befinden sich außerhalb der heutigen Staatsgrenzen: Ktesiphon und Bagdad im Irak, Buchara und Samarkand in Usbekistan, Balch (das antike Baktra) und Ghazni in Afghanistan.
»Persien« oder »Iran«? Hier stoßen wir auf eine weitere Schwierigkeit. Auch diese Namen sind nicht deckungsgleich, selbst wenn wir sie zuweilen wie austauschbar verwenden. Der Begriff »Iran« war ursprünglich umfassender. Er leitet sich von »Aryanam« ab und bedeutet so viel wie »Land der Arier«. Arische Stämme hatten diesen Namen für ihr Herrschaftsgebiet aufgebracht, nachdem sie aus der innerasiatischen Steppe in die weiten Hochlandgebiete zwischen den Flüssen Indus im Osten und Euphrat im Westen eingewandert waren. Parsa – in späterer europäischer Umformung »Persia« – war nur eine dieser Stammesregionen und erstreckte sich um das heutige Schiras. Aber von dort aus unterwarfen die Perser alle übrigen iranischen Stämme, regierten und prägten sie. Und so war es kein Zufall, dass schließlich Griechen und Römer sämtliche Iraner für Perser hielten und sie so nannten – die Griechen haben damit begonnen, und die übrigen Europäer hielten bis in das 20. Jahrhundert ungebrochen an der international geläufigen Bezeichnung fest. Dagegen beharrten die Einheimischen über die vielen Jahrhunderte auf dem ursprünglichen Namen »Iran« und nannten sich selbst »Irani«.
Allerdings liegt in dem Missverständnis von abendländischer Seite viel Wahrheit, denn die Perser sind lange Zeit für den iranischen Raum so beherrschend gewesen, dass sie das gesamte Erbe zu sammeln vermochten, es mit eigener Schöpferkraft umformten und so an die Nachwelt – besonders an die islamischen Völker – weitergaben. Die gemeinsame, alle ethnischen Grenzen überschreitende Kultursprache der Iraner ist über lange Zeiträume hinweg das Persische gewesen, von einer Zwischenphase abgesehen, in der das Arabische dominierte. »Farsi« nennen die Iraner heute ihre Staats- und Amtssprache und leiten den Namen doch nur von der Provinz Fars ab, wie die einstige Provinz Parsa seit Jahrhunderten von den Einheimischen genannt wird. Mit gutem Recht können wir demnach weiterhin von »persischer« Kultur reden und schreiben.
»Persia« lautete der international eingebürgerte Staatsname bis zum Jahr 1935. Diesen Namen benutzten genauso die Einheimischen, wenn sie mit Ausländern aus Europa und Amerika verkehrten, auch nannten sie sich dann, westlichen Gewohnheiten angepasst, »Perser« anstatt »Irani«. Reza Pahlevi, der Vater des letzten Schahs, hat 1935 offiziell mit der doppelten Namensführung Schluss gemacht und »Iran« auch auf internationaler Ebene verbindlich eingeführt. Hierbei ließ er sich einerseits von einem fanatischen Nationalismus leiten, indem er eine Rückbesinnung auf »iranische« Tradition jenseits aller »Überfremdung« forderte. Andererseits besaß seine Entscheidung eine nachvollziehbare politische Logik: Da innerhalb der modernen Staatsgrenzen nur etwa 51 Prozent der Einwohner Perser sind, war es sinnvoll, für den Vielvölkerstaat einen übergreifend neutralen Namen, eben »Iran«, zu wählen. 24 Prozent der Bevölkerung sind Aserbeidschaner, 8 Prozent Masanderaner und Gilaner, 7 Prozent Kurden, 3 Prozent Araber, hinzukommen noch eine Reihe kleinerer ethnischer Minderheiten von Turkmenen, Bachtiaren, Luren, Belutschen und Armeniern.
Ein paradoxer Sachverhalt ist es allerdings, dass ausgerechnet die Aserbeidschaner als die zweitgrößte Volksgruppe keine iranische, sondern eine türkische Sprache sprechen. Sie sind ein Turkvolk und haben nichts mit den arischen Stämmen aus dem iranischen Kernland gemeinsam. Aber von eben diesem Turkvolk der Aserbeidschaner ging zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Anstoß aus, den Iran in ein straff zentral regiertes Reich mit mehrheitlich schiitischer Glaubensrichtung zu verwandeln. Der erste schiitische Schah des Iran, Ismail I. (1)von der Dynastie der Safawiden, sprach das Persische nur gebrochen, doch gerade er hat die festumrissene, überdauernde Form geschaffen, auf der der heutige Nationalstaat Iran beruht.
Auf solch ethnische wie historische Verwerfungen abgehoben, besitzt sowohl die Bezeichnung »Perser« als auch »Iraner« eine unsichere Grundlage. Bei »Iran« handelt es sich um eine moderne Sprachregelung, die angesichts der komplizierten Situation von heute politisch Sinn macht. Wenn aber im vorliegenden Buch – besonders im historischen Teil bis zu eben jenem Jahr 1935 – meist von »Persien« oder von »Persern« geschrieben ist, hat auch dieser Sprachgebrauch viel für sich.
Mehr Widersprüchliches, mehr Trennendes als Gemeinsames scheint die Geschichte des Iran zu bestimmen. Aber hinter den Gegensätzen und Umbrüchen findet sich eine Klammer, die nicht nur vorislamische und islamische Epochen zusammenhält, sondern auch Verbindungen zu anderen Kulturen aufweist. So sind etwa Zarathustra(2) und Mohammed(1) geistig verwandter, als es uns auf den ersten Blick erscheinen mag – ja, Zarathustra, der Religionsstifter aus dem östlichen Iran, hat gar dem Islam, Judentum und Christentum entscheidende Grundlagen geliefert. Und die altpersischen Gottkönige haben Wesentliches von ihrem Regierungsstil an islamische Kalifen und christliche Kaiser des Byzantinischen Reiches weitergegeben, im Guten wie im Bösen. Ein besonders wichtiges, bisher stets unterschätztes Erbe haben uns bereits die vorislamischen Perser mit ihrem Prinzip einer »Weltkultur« hinterlassen. In ihrem Großreich der verschiedensten Völker und Traditionen sammelten sich wie sonst in keinem damaligen Staat der Erde Wissenschaftler, Philosophen und Künstler aus Ost und West; über den iranischen Raum flossen Kulturströme von China und Indien bis in den Vorderen Orient und weiter nach Europa, ebenso umgekehrt. Für beide Richtungen sind meist Perser, Iraner die entscheidenden Vermittler gewesen. Persien beziehungsweise der Iran bildete die erste Nation der Menschheitsgeschichte, die zu einem Ort des geistigen Austausches großen Stils wurde, zu einer Drehscheibe der Kulturen zwischen Ost und West – und diese Funktion hat das Land über Jahrhunderte auch noch in seiner islamischen Zeit beibehalten; es hat gegensätzlichste Einflüsse miteinander verschmolzen und daraus oft genug etwas bahnbrechend Neues hervorgehen lassen. Vieles keimte auf persischem Hoheitsgebiet, was grundlegend für die spätere Menschheit geworden ist, grandiose Schöpfungen, die wir heute nicht selten für europäisch halten, ohne ihren eigentlichen Ursprung zu ahnen.
Vor diesem historischen Hintergrund nehmen sich der letzte Schah des Iran wie auch Khomeini(7) grotesk aus. Beide demonstrierten zwar messianisches Sendungsbewusstsein, beide handelten in dem Glauben, einer außerordentlichen Kulturnation anzugehören, die der Menschheit schon sehr viel gegeben hat – beide aber waren zu sehr vom Niedergang der vorhergehenden Jahrhunderte geprägt, als dass sie ihren laut verkündeten Aufbruch in eine große Zukunft hätten wahrmachen können.
Wie aber ist es heute um den Iran bestellt, und was wird morgen sein? Um dies zu beantworten, müssen wir, zumindest in Grundzügen, zunächst Höhen und Tiefen iranischer Geschichte betrachten.
Meine Darstellung wendet sich allerdings nicht nur an westliche Leser, sondern auch an Iraner. Zahlreiche Gespräche haben mir im Verlauf von Jahrzehnten vor Augen geführt, dass gerade gebildete Iraner mit ausgeprägtem Interesse für historische Zusammenhänge sich der Schwierigkeit bewusst sind, die vielfältigen Brüche und gegenläufigen Bewegungen in der dreitausendjährigen Geschichte ihres Landes zu deuten. Das jüngste Beispiel für dieses Problembewusstsein bot sich mir im Frühjahr 2017, als mich ein E-Mail aus Teheran erreichte. Abbas Pur Khassalian(2), der mir bereits an Weihnachten 2016 in deutscher Sprache Grüße gesandt hatte, kommentierte den Titel meines Buches Iran verstehen folgendermaßen: »Zugegeben, es ist schwer, den Iran zu verstehen.« Seit sieben Jahrhunderten verstünden die Iraner selbst nicht mehr, was Iran eigentlich sei. Im 20. Jahrhundert seien sie zwar aufgewacht, aber was sie wahrnähmen, sei unglaublich und schwer nachvollziehbar. Die Iraner sähen sich teilweise bis heute damit konfrontiert, geistig durch eine riesige Kluft von ihrer Vergangenheit getrennt zu sein, eine Kluft, die sie vorerst weder überbrücken noch überspringen könnten. Allmählich nur komme ein Prozess der Selbstfindung in Gang.
Was diese Aussagen im Einzelnen bedeuten, lässt sich erst ermessen, wenn wir uns auf die Vielfalt iranischer Geschichte einlassen. Aber dies wird ebenso deutlich an der Zuspitzung der religiös-politischen Krise, wie ich sie in der weiteren Neuauflage des Buches in der Zeitspanne von 2017 bis 2023 schildere.
Propheten und Gottkönige
1. Also sprach Zarathustra(3)
Eine Sternstunde der Religionsgeschichte
Die Geschichte des Iran begann bei Baktra. Heute heißt die Stadt Balch und liegt in einer fruchtbaren Ebene des nördlichen Afghanistan, rund 20 Kilometer von der schiitischen Pilgerstadt Mazar-e Scharif entfernt. In Balch leben rund 87 000 Einwohner (so die Zahl im Jahr 2012), es gibt eine große Moschee, außerdem vorislamische Mauerreste, zwischen Erdhügeln halb verschüttet und unkrautüberwuchert. Die heute unscheinbar wirkende, durch Landflucht rasch gewachsene Stadt hatte vor 2500 Jahren als Handelszentrum an der sogenannten Seidenstraße überragende Bedeutung. Aber: Noch bevor dort ein Statthalter im Namen der ersten persischen Gottkönige regierte, lebte dort ein Mann, der wie kaum ein anderer entscheidend für den Nachruhm der persischen Kultur werden sollte. Er war ein Religionsstifter und hat Persien, das zu seinen Lebzeiten noch eine unbedeutende Provinz war, den geistigen Halt gegeben. Mehr noch: Er hat ein Weltbild geschaffen, das selbst auf unsere Kultur eingewirkt, ja sie in wichtigen Teilen mitgeformt hat. Dieser Mann war Zarathustra(4).
Im Iran leben heute noch an die 40 000 Anhänger seiner Religion, in Indien sind es dreimal so viele – eine mehr als bescheidene Schar, die nicht einmal mit der Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt konkurrieren kann. Wer mag da schon an die welthistorische Bedeutung ihres Begründers denken? Als die Araber Persien eroberten und den Islam verbreiteten, verschwand die altiranische Religion fast gänzlich aus ihrem Kernland, weshalb Zarathustra für die Nachwelt lange Zeit nur als ein Prophet galt, dessen Lehre von gewichtigeren Religionsstiftern – Jesus(1) Christus(2), Mohammed(2), Buddha(1) – übertroffen und verdrängt wurde. Ein Mann also, den die Geschichte unwiderruflich überrollt hat. Aber manche wegweisenden Ideen, deren Ursprung wir bislang bei jüdischen Propheten suchten, sind bereits in Zarathustras(5) Schriften vorgeformt. Das ist Grund genug, zu fragen, ob die jüdische Religion – und in der Nachfolge das Christentum und der Islam – nicht wesentlich von ihm beeinflusst wurden.
Über den Menschen Zarathustra(6) wissen wir nach wie vor wenig. Lange genug stritten sich die Historiker, wann er geboren wurde, wo er gelebt und gewirkt hat. Verlässliche Hinweise gibt es kaum, denn fast alle Lehren wurden erst Jahrhunderte nach seinem Tod schriftlich gefasst – mit Ausnahme der Gathas, der Verspredigten, die man Zarathustra selbst zuschreibt; aber auch sie schildern nur in vagen Umrissen die Lebensgeschichte des Propheten. In späteren Schriften regiert die Legende. Stützt man sich auf sie, so muss Zarathustra irgendwann zwischen 1000 und 500 vor unserer Zeitrechnung gelebt haben und irgendwo im östlichen Teil des Iran geboren worden sein. Damit bleibt die Gestalt mehr in mythisches Dunkel getaucht als selbst so legendenumwobene Religionsstifter wie Jesus(3) oder Buddha(2). Heute – nach mühsamen Sprachstudien und Textvergleichen aller altiranischen Schriften – sind die meisten Forscher zu dem Schluss gekommen, Zarathustra müsse um das Jahr 630 vor unserer Zeitrechnung bei Baktra geboren worden sein.
Er war demnach kein Perser, sondern Baktrier, wie man damals die Bewohner seines Landstrichs nannte. Aber er gehörte wie die Perser zu den Ariya, einem großen Stammesverband, der seit dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung aus den Steppen Innerasiens unaufhaltsam nach Süden vorgerückt war. Ariya war ein Name, den sich diese kriegerischen Nomaden selbst gegeben hatten, er bedeutet so viel wie »die Edlen« und sollte den Abstand deutlich machen, mit dem sie sich von den unterworfenen Völkern absetzen wollten. Einige Stämme waren um das Jahr 1900 vor unserer Zeitrechnung nach Indien eingedrungen und hatten dort im Verlauf der nächsten zehn Generationen die Kastenordnung der Hindus errichtet, andere waren zur selben Zeit in die fast menschenleeren Hochebenen mit ihren Steppen, Wüsten, Gebirgen und fruchtbaren Tälern geströmt, die sie schließlich »Iran«, »Land der Arier«, nannten.
Als Zarathustra(7) 630 vor unserer Zeitrechnung bei Baktra geboren wurde, waren 1500 Kilometer westlich die Meder zum mächtigsten Stamm der Iraner aufgestiegen. Sie herrschten von den gebirgigen Hochebenen südwestlich des heutigen Teheran bis an die Grenzen des Zweistromlandes von Euphrat und Tigris, im Süden dehnten sie ihre Herrschaft bis in die dünnbesiedelte Steppe aus. Sie hatten auch die Gebiete um das heutige Schiras unterworfen und deren Bewohner – den iranischen Stamm der Perser – zu Vasallen gemacht. Nichts deutete zu jener Zeit darauf hin, dass nur noch acht Jahrzehnte zu vergehen brauchten, bis der persische Provinzfürst Kyros(3) einen Stamm nach dem andern unterwarf und so die Herrschaft Persiens bis Baktra ausdehnte.
Die Iraner lebten damals überwiegend in unscheinbaren Lehmdörfern oder gar noch in Nomadenzelten, die meisten trieben Ackerbau und Viehzucht. Städte gab es allein in ein paar fruchtbaren Hochebenen des sonst kahlen Steppen- und Wüstenlandes. Einige von ihnen besaßen allerdings schon ein hohes zivilisatorisches Niveau, besonders Ekbatana, die Residenz der Meder, die nach dem Vorbild babylonischer und assyrischer Metropolen gebaut war.
Wie Baktra zu Lebzeiten des Zarathustra ausgesehen hat, wissen wir nicht. Zu weit entfernt von Babylon, Ninive und Ekbatana lag dieser Ort, als dass man dort in ähnlicher Art gebaut haben dürfte. Das Industal mit seinen uralten Lehmziegelstädten lag näher. Baktra war wohl eine Siedlung nach indischem Muster, allerdings viel bescheidener in den Ausmaßen, ein Handelszentrum eben, das den Vorzug hatte, an der belebten Karawanenstraße von Ostasien nach dem Vorderen Orient zu liegen. Es wird etliche große Karawansereien gegeben haben, in denen Kaufleute aus Indien und China ebenso nächtigten wie solche aus Babylon und Damaskus. Eine weltoffene Stadt also, in die mit den vielen Fremden immer wieder neue Ideen gelangten und die Baktrier beschäftigten. Und doch war Baktra auch wieder eine sehr ländliche, bäuerliche Siedlung, denn in der fruchtbaren Ebene lebten vor allem Bauern und viehzüchtende Nomaden. Zarathustras(8) Name deutet darauf hin, dass er selber aus einer Familie reicher Viehzüchter stammte, er lautet übersetzt: »Der, der mit Kamelen zu tun hat«. Sein Vater hieß Porushaspa(1), »Der mit Falben-Rossen«, so berichten uns die noch erhaltenen Bruchstücke des Awesta, der zarathustrischen Bibel. Wenn man der legendären Überlieferung aus dem Awesta glauben möchte, dann kam Zarathustra als dritter Sohn von fünf Kindern zur Welt, Spross einer damals sehr angesehenen Adelsfamilie, der Spitama. Der Vater scheint Priester eines Stammes von viehzüchtenden Nomaden gewesen zu sein, die keinen Tempel kannten, sondern unter dem freien Himmel der Steppe ihre Opferriten vollzogen. Große Viehherden, Nomadenzelte, Weideland, Berge – dies dürfte der vertraute Anblick für den heranwachsenden Zarathustra gewesen sein. Und immer wieder besuchte er das nahe Baktra mit seinen weitgereisten Kaufleuten. Geistig von der Nomadentradition seines Stammes und dem Stadtleben Baktras geprägt, war er schon sehr früh dazu ausersehen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ebenfalls Priester zu werden. Priester aber welcher Religion?
Schriftliche Überlieferungen aus dieser Zeit finden sich nur spärlich, aber sie genügen, um uns ein ungefähres Bild zu machen. Die Iraner – von den Baktriern über die Meder bis zu den Persern – teilten ihre Götter in zwei Klassen: in erhabene Lichtgestalten, die im Kosmos wohnten, Ahuras, und in niedere Geisterwesen, die in der Erde, im Wind, im Wasser und im Feuer hausten, Daevas. Aber kein Mensch fühlte sich in der Lage, das Walten dieser Götter zu durchschauen, man empfand sie das eine Mal ohne erkennbaren Grund als freundlich und helfend, das andere Mal als grausam und vernichtend. Noch fehlte der Prophet, der mit seiner Botschaft eine tiefer greifende, erklärende Ordnung hätte stiften können. Die Iraner konnten nur darauf hoffen, die rätselhaften, unheimlichen Götter durch Lobgesänge und Opfergaben gnädig zu stimmen. Bei diesen kultischen Feiern musste reichlich das Blut von Stieren zu Ehren höherer Wesen fließen, um die Angst vor dem unberechenbaren Schicksal zu dämpfen. Priester und Volk tranken zu bestimmten Anlässen ein berauschendes Getränk, das sie nach dem Namen ihres Ekstasegottes Haoma nannten, und steigerten sich durch endlosen rhythmischen Tanz in Trance, um wenigstens für kurze Momente wie die Götter das beglückende Gefühl der Unsterblichkeit zu haben.
Zarathustra(9) empfand schon sehr früh ein Ungenügen an diesen Ritualen und ihrem Sinn, denn – so berichtet uns knapp eine Textstelle aus den Gathas, seinen Verspredigten – im Alter von zwanzig Jahren verließ er seine Heimat und wanderte in die Einsamkeit. Er, der sich selber einen Zaotar, einen sakralen Dichter und Prediger, nannte, kehrte dem Priesterberuf den Rücken. Zehn bis zwanzig Jahre dürften die Wanderjahre des religiösen Suchers gedauert haben. Wie und wo er meditierte, ob er fastete und sich meist von den Menschen fernhielt, ob er ins nahe afghanische Bergland zog oder in der turkmenischen Ebene blieb, wissen wir nicht. Im Awesta heißt es nur, schließlich habe sich ihm am Fluss Daitya ein Engel offenbart. Dies könnte am Ufer des Amu Darja gewesen sein, des weitaus größten Flusses in der Nähe Baktras, der mit seinem Oberlauf die heutige Grenze zwischen Afghanistan und Usbekistan bildet. Dort, in der weiten Ebene mit ihrem fruchtbaren Weideland, ihren Nomadenzelten und den kahlen Bergen als ferner Kulisse, dort hätte sich demnach eines der folgenreichsten Ereignisse der Religionsgeschichte vollzogen. Zarathustra empfing die Vision vom kosmischen Kampf guter und böser Mächte, von Gott und Satan, von der Auferstehung der Toten am Tag des Jüngsten Gerichts, vom Weiterleben nach dem Tod im Paradies oder in der Hölle – lange bevor Propheten anderer Religionen solche Gedanken verkündeten. Es ist in den Jahren 610 bis 590 vor unserer Zeitrechnung geschehen, falls die Vermutungen der Historiker stimmen. Dies wäre also 600 Jahre vor Jesus(4) Christus(5) gewesen, 1200 Jahre vor Mohammed(3); aber 600 Jahre nach Moses(1).
Am Fluss Daitya erschien – so berichten die Gathas – dem religiösen Sucher nach langer Meditation der Engel Vohu Manu (»Gute Gesinnung«) im strahlenden Lichtgewand und führte ihn vor den Thron des Gottes Ahura Masda (»Weiser Herr«). Zarathustra(10) begrüßte den Gott mit einer Hymne, die in den Worten gipfelte: ». . . Ich erstrebe damit, Dich zu erkennen, Allweiser, den Schöpfer aller Dinge durch den Heiligen Geist.«
Noch Jahre dauerte es, bis Zarathustra nach dieser Vision aus der Einsamkeit zurückkehrte und in der Hauptstadt seines Heimatlandes zu predigen anfing. Das Volk hörte ihm nur mit mäßigem Interesse zu, die Priester und die Adligen lehnten ihn gar heftig ab, so erfahren wir aus den Gathas. In seinen Verspredigten schlägt die Enttäuschung heftig durch. »Fern von Adel und Priesterschaft hält man mich«, so liest sich dort seine Klage, »nicht stellen mich zufrieden die Landgemeinden, um die ich mich mühe, / noch gar des Landes lügenknechtische Gewalthaber. / Wie soll ich da nur Dich, Allweiser Herr, zufriedenstellen? . . .« Wenige Anhänger scharten sich um ihn und begleiteten ihn auf seinen Predigtreisen zu städtischen Marktplätzen, zu Dörfern und Nomadenzelten. Auf Zarathustra traf – wie später auf Jesus(6) und Mohammed(4) – das Bibelwort zu, dass ein Prophet im Heimatland nichts gelte. Nach Jahren der Enttäuschung und Verfolgung – Genaueres wissen wir nicht – verließ er schließlich Baktrien und kam mit seinen wenigen Schülern in das Königreich Chorasmien. König Vishtaspa(1) nahm ihn freundlich auf, pflegte lange Gespräche mit ihm und bekehrte sich zu dem neuen Glauben: ein entscheidender Durchbruch. Dem Beispiel des Königs folgten bald die Adligen am Hof, schließlich auch etliche Priester. Zarathustra konnte mit seinem Aufbauwerk beginnen. Unter der Schutzherrschaft des Königs errichtete er vor den Toren des Städtchens Keschmar sein berühmtes Feuerheiligtum, an dessen Altar nun die Priester unter freiem Himmel ihre Gesänge anstimmten und das Volk lehrten. Keine blutigen Tieropfer waren mehr nötig, um die Götter gnädig zu stimmen. Wer nach den Geboten des »Allweisen Herrn«, des Ahura Masda, handelte – rechtschaffen, arbeitsam und ehrlich zu sein –, durfte fortan auf die Gnade Gottes hoffen. Keschmar wurde Zarathustras(11) Wohnsitz, dorthin strömten Neugierige, um ihn predigen zu hören, von dort aus zogen seine Schüler als Missionare in ferne Provinzen und Königreiche.
Chorasmien – Zarathustras(12) legendäre zweite Heimat. Die Historiker haben lange gerätselt, wo dieses Königreich nun tatsächlich gelegen haben mag. Heute neigt man zu der Ansicht, es müsse sich um jene Landschaft handeln, die später die muslimischen Perser Chorassan, »Land des Ostens«, nennen sollten. Keschmar, wo Zarathustra sein zentrales Heiligtum errichtet haben soll, erklären viele Historiker identisch mit jenem Städtchen Keschmar, das etwa 100 Kilometer südwestlich von Mesched, der heutigen Hauptstadt der iranischen Provinz Chorassan, liegt. Dieses Keschmar unserer Tage ist eine unscheinbare Ortschaft mit Lehmziegelbauten, die so gelbgrau wirken wie die umgebende Landschaft. Nichts mehr deutet auf die einstige Bedeutung hin.
Zarathustra(13) kehrte nicht mehr nach Baktrien zurück. Er blieb am Ort seiner Erfolge, heiratete eine vornehme Adlige und lebte in bescheidenem Wohlstand, ein häufiger Gast am Königshof. Aber unangefochten lebte er dennoch nicht. Der alteingesessene Priesteradel hielt hartnäckig an der bisherigen Religion fest und verbündete sich mit den Fürsten benachbarter Staaten gegen den Neuerer. Krieg sollte den Religionsstifter und seinen Schutzherrn, König Vishtaspa(2), beseitigen. Zarathustra antwortete seinen Gegnern nicht minder kriegerisch, wie eine Stelle seiner überlieferten Verspredigten zeigt: »Keiner von euch horche hinfort auf die Sprüche und Unterweisungen des Lügenknechtes! / Denn dieser stürzt Haus und Dorf, Gau und Land / in Elend und Verderben. Darum wehret ihm mit der Waffe!« Es kam zum ersten Religionskrieg auf persischem Boden. Für Zarathustra endete er mit einer Katastrophe. Als die feindlichen Truppen in die Hauptstadt eindrangen, erschlugen sie den 77-jährigen Greis, bevor sie sich wieder fluchtartig zurückziehen mussten. Zarathustra(14) starb als Märtyrer – wie so viele Religionsstifter. Dies geschah um das Jahr 553 vor unserer Zeitrechnung.
Einfluss auf Judentum, Christentum und Islam
Der Legende nach wurde Zarathustras(15) Lehre noch zu seinen Lebzeiten mit goldener Tinte auf 12 000 Ochsenhäute geschrieben und später in der Königsbibliothek von Persepolis aufbewahrt. Von diesem Original ist uns nichts mehr überliefert, es soll angeblich im Jahr 330 vor unserer Zeitrechnung verbrannt sein, als Soldaten Alexanders(1) des Großen die Brandfackel in die eroberte Stadt schleuderten. Was uns blieb, sind Abschriften, wie sie an die 600 Jahre später Priester aus anderen Exemplaren des Awesta anfertigten, aber auch sie sind nur noch in Bruchstücken erhalten, weil die Araber auf ihrem Eroberungszug Teile davon vernichteten. Diese Reste jedoch geben uns genug Aufschluss über die Lehre. Nur: Handelt es sich tatsächlich immer um Zarathustras(16) ursprüngliche Ideen? Angeblich soll sich seit den 1000 Jahren der ersten Niederschrift wenig geändert haben, aber für den kritischen Religionsforscher bieten solche Auskünfte von Priestern wenig Sicherheit. Ungewiss bleibt es bis heute, was der Prophet selber lehrte und was spätere Anhänger hinzufügten. Zarathustra hat – wie viele Religionsstifter – wenig Geschriebenes hinterlassen. Von dem, was uns erhalten ist, dürften allein die Gathas (Verspredigten) in den Büchern Yasna (Opferriten) auf ihn direkt zurückgehen, sind sie doch in einem dem Sanskrit ähnlichen Dialekt geschrieben, wie er damals in Baktrien üblich war. Dies sind spärliche Anhaltspunkte. Trotz allem lässt sich bereits aus den Gathas ungefähr rekonstruieren, was das Grandiose und Einmalige seiner Lehre ausmacht.
Zarathustra(17) wandte sich gegen den Glauben seiner Väter, die eine Vielzahl von Ahuras, Lichtgestalten, und Daevas, Dämonen, kannten. Er erklärt einen dieser Ahuras zum alleinigen Gott: Ahura Masda, den »Weisen Herrn«. Ahura Masda tritt den Menschen nicht mehr wie die bisherigen Ahuras zuweilen in sichtbarer Gestalt entgegen, heiratet keine Göttinnen und zeugt keine Kinder, er ist auch keine launische Gottheit mehr, die undurchschaubar den Menschen mal Gutes, mal Böses beschert. Sein Ahura Masda ist gestaltlos, allgegenwärtig, abstrakt und ewig; weit entfernt von allen menschlichen Leidenschaften verkörpert er ein klar durchschaubares Prinzip: das Gute. Aber dieser alleinige Gott besitzt einen Widersacher mit dem Namen Angra Mainyu, »Böser Geist«. Dieser Gegenspieler, seiner Herkunft nach ein Daeva, lässt nichts unversucht, um die Menschen vom Glauben an das Gute abzubringen.
Die gute und die böse Macht besitzen Helfer; es sind Geister und Dämonen, in ihren Eigenschaften bisherigen Gottheiten nachgebildet. Auf Ahura Masdas Seite steht vorrangig Spenta Mainyu, der »Heilige Geist«; er tritt zuweilen als Verkörperung des alleinigen Gottes auf, manchmal auch als ein von ihm verschiedenes Wesen, als bedeutsamster Verkünder göttlichen Willens. Diener dieses »Heiligen Geistes« sind Lichtgestalten, Amesha Spentas, »Unsterbliche Geister« – Engel; sie werden gewöhnlich ausgesandt, um den Menschen Botschaften zu überbringen. Vohu Manu, »Die gute Gesinnung«, ist ein solcher Engel; er ist Zarathustra erschienen, um ihn vor den Thron Gottes zu geleiten. Auf der Seite des »Bösen Geistes« Angra Mainyu stehen die Daevas, die Dämonen. Zu ihnen gehört die Mehrzahl jener Götter, die von Zarathustras(18) Zeitgenossen verehrt wurden; sie sind nun dumpfe Geister im Dienst des Bösen.
Gott ist ewig, aber der Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Dunkel hat nur eine begrenzte Dauer, so lehrte Zarathustra(19)