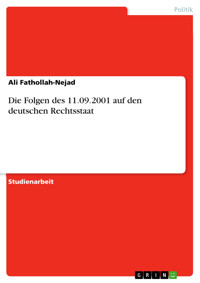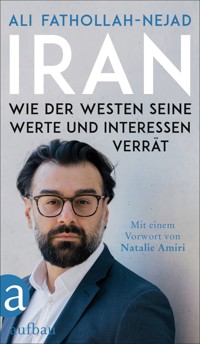
13,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ali Fathollah-Nejad legt den Finger in die Wunden der westlichen Iran-Politik!« Natalie Amiri
Es scheint, als ob die Islamische Republik Iran einen stetigen Anspruch auf die Schlagzeilen der Weltpolitik erhebt – sei es in Bezug auf den Westen, den Nahen Osten oder aber in der Auseinandersetzung mit der unzufriedenen iranischen Gesellschaft. In diesem Buch blickt der renommierte Iran- und Nahost-Experte Ali Fathollah-Nejad auf die innere Verfassung des Landes und auch auf die außenpolitischen Herausforderungen durch die Politik Teherans. Wie stabil ist das Regime eigentlich und was ist unter dem revolutionären Prozess in Iran – ein Begriff, den der Autor geprägt hat – genau zu verstehen? Dabei schaut der Politologe fundiert, differenziert und kritisch hinter die Schlagzeilen – von den »Frau, Leben, Freiheit«-Protesten, der Rolle Irans in Nahost (vor und nach dem »7. Oktober«) bis hin zu den blinden Flecken des Atomdeals und den Beziehungen Teherans zu Russland und China. Abschließend werden Eckpfeiler einer Iran-Politik entworfen, die weder die Werte des Westens noch seine Interessen verrät – und dadurch nicht nur die iranische Demokratiebewegung stärkt, sondern auch sicherheitspolitisch nachhaltig ist. Fathollah-Nejad erklärt dabei, weswegen Staat und Gesellschaft in Iran sich auf Kollisionskurs befinden, das Regime weniger fest im Sattel sitzt als weithin angenommen, welchen Fehlannahmen unsere Iran-Politik hat und weswegen die Islamische Republik im Gaza-Krieg zu einem Kaiser ohne Kleider geworden ist.
Ein umfassender Grundlagentext, der in dieser Form in deutscher Sprache noch nicht vorlag, sowie eine messerscharfe politische Analyse der Gegenwart.
»Einer der wenigen, die ein gründliches, über die Schlagzeilen hinausgehendes und vorausschauendes Verständnis für Iran haben.« Florence Gaub
»Deutschlands Iran-Erklärer Nummer 1.« Nora Müller, Bereichsleiterin Internationale Politik und Leiterin des Hauptstadtbüros der Körber-Stiftung
»Minutiös und pointiert analysiert er – nie um eine scharfe Formulierung verlegen –, wie das Land wurde, was es heute zu sein scheint. Dabei geht es Fathollah-Nejad in erster Linie darum, das ›statische und eindimensionale‹ Iran-Bild zu korrigieren. […] Woran sich eine werte- und interessengeleitete Iran-Politik orientieren müsste, versteht man nach gut 400 kurzweiligen Seiten.« Die zehn besten Bücher des Frühlings 2025, Der Tagesspiegel
»Wer wissen will, was in der Iran-Politik schiefläuft und wie man es besser machen könnte – bitte lesen! Ein Grundlagenwerk.« Jörg Lau, Die Zeit
»Jeder soll bitteschön dieses Buch zur Hand nehmen, der sich auch nur im Ansatz [für Iran] interessiert und mitsprechen möchte. Ein ganz fabelhaftes Buch.« Jörg Thadeusz
»In mehrerlei Hinsicht bemerkenswert und kaum aus der Hand zu legen! Ich empfehle vielen im politischen Berlin [...], dieses Buch zu lesen.« Prof. Dr. Ulrich Schlie, Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung, Universität Bonn
»Dieses Buch liest sich wie ein sezierender Blick hinter die Fassade eines Regimes, das sich Wandel auf die Fahne schreibt, aber Repression zementiert. Ali Fathollah-Nejad gelingt es, die Bruchlinien einer Gesellschaft sichtbar zu machen, die um Würde, Freiheit und Selbstbestimmung kämpft – mit einer Klarheit, die lange nachhallt. Eine unverzichtbare Analyse für alle, die sich für Menschenrechte, regionale Stabilität und die Zukunft Irans interessieren.« Hannah Neumann (MdEP), Vorsitzende der Iran-Delegation des Europäischen Parlaments
»Ali Fathollah-Nejad hat mehr Einblick und Verständnis für die inneren Mechanismen des Landes und sein Verhältnis zum Westen und seinen Nachbarstaaten als die allermeisten westlichen Journalisten und Experten und sollte die Stimme sein, auf deren Einschätzung man hört, wenn es um Iran geht.« Iran Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Das in Deutschland in Politik, Gesellschaft und selbst in Fachkreisen vorherrschende Iran-Bild ist statisch und eindimensional. Wir schwanken zwischen den Extremen eines in Finsternis versinkenden Irans und blinder Euphorie über ein vermeintlich an der Schwelle zur Demokratie stehendes Land. Dabei haben die Entwicklungen der letzten Jahre deutlich vor Augen geführt, dass diese Bild nicht der Realität entspricht. Eine Korrektur unserer Iran-Rezeption und -Politik ist längst überfällig.
Doch wie können wir die ausgetretenen Wege unserer fehlgeleiteten Debatte über Iran verlassen? Wie können wir effektiv und rechtzeitig auf die großen Umbrüche antworten? Diesen drängenden Fragen widmet sich Ali Fathollah-Nejad im vorliegenden Buch. Seine scharfe Analyse stellt gängige Annahmen infrage, bietet erhellende Einblicke in die Politik und Motive von Irans Machthabern und eröffnet einen Ausblick in eine Zukunft, die westlichen Interessen und denen der iranischen Gesellschaft gleichermaßen gerecht wird.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ali Fathollah-Nejad
Iran – Wie der Westen seine Werte und Interessen verrät
Mit einem Vorwort von Natalie Amiri
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Für die Jugend Irans, für ihre Träume
زن، زندگی، آزادی
Vorwort von Natalie Amiri
Es ist der 12. November 2024. Mehrmals setzte ich an, um dieses Vorwort zu schreiben. Immer wieder veränderte sich die Situation gravierend. Wann den Stift zur Seite legen? Ein Ende hat das Regime nach wie vor nicht genommen. Doch noch nie stand es so mit dem Rücken zur Wand. Selbstverschuldet, sicher nicht durch die deutsche Außenpolitik, die sich eher durch seine Appeasement-Politik hervorgetan hat als durch einen Kurswechsel Richtung Teheran.
War und ist dieses Regime wirklich so mächtig, dass die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt keine Mittel hatte, es in die Schranken zu weisen? Sich durch Geiseldiplomatie vorführen zu lassen? Die Handelsbeziehungen weiter bestehen zu lassen, trotz der massiven Menschenrechtsverletzungen des Regimes vor den Augen der Welt?
Die Iran-Politik des Westens, die sich jahrzehntelang auf das Prinzip der »autoritären Stabilität« stützte, hat versagt. Angesichts der expansiven und oft destabilisierenden Außenpolitik Teherans ist eine Neuorientierung unumgänglich.
Iran steht am Scheideweg. Dieses Buch zeichnet das Bild eines Landes, das in seinen Grundfesten erschüttert wird – und wie diese Erschütterungen auch Europa und den Westen betreffen. Es erzählt von einer jungen Generation, die sich nach Freiheit sehnt, und von einer Zivilgesellschaft, die fest entschlossen ist, trotz aller Repression für ihre Rechte zu kämpfen. Das Bedürfnis in der iranischen Gesellschaft nach Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit ist groß. Von der »Frau, Leben, Freiheit«-Bewegung bis hin zu den Protesten gegen wirtschaftliche Ungleichheit – das iranische Volk ist längst aufgebrochen, doch der Westen bleibt oft Zuschauer.
Dieses Buch fordert dazu auf, die blinden Flecken der westlichen Iran-Politik kritisch zu beleuchten und eine entschlossenere Haltung zu entwickeln.
Was bedeutet das? Der Westen muss über seine bisherigen Strategien hinausdenken und die Sicherheitsinteressen mit den Hoffnungen der iranischen Gesellschaft in Einklang bringen. Sanktionen und diplomatische Druckmittel können die Islamische Republik treffen – aber sie sollten den Menschen nicht schaden, die den Wandel tragen. Europa und die USA stehen in der Verantwortung, ihre Iran-Politik neu auszurichten und sich auf eine breitere Agenda zu konzentrieren, die auch Menschenrechte und demokratische Bestrebungen stärkt.
Das Regime ist so instabil wie noch nie. Die Redewendung »Wasser predigen und Wein trinken« passt ganz vorzüglich auf die Islamische Republik, und das Paradoxe an diesem Regime wird zunehmend offenbar.
In Tagen, in denen die Welt auf den militärischen Schlagabtausch zwischen Israel und Iran schaut, schleicht sich ein Gedanke ein: Vielleicht hat dieses Regime nur deshalb fünfundvierzig Jahre überlebt, weil das Theaterstück »Bedrohung durch die Mullahs« von allen Beteiligten gerne mitgespielt wurde – es bediente immerhin verschiedenste Interessen.
Durch die Appeasement-Politik des Westens konnte Teheran jahrelang das Bild eines gefährlichen Staates aufrechterhalten. Keiner wagte es, die Mullahs zu provozieren. Denn Teheran wusste genau, was den Westen triggert: Rohstoffabhängigkeiten, Lieferketten und die Angst vor Flüchtlingsströmen.
Jahrelang wurde vor einem Angriff Teherans gewarnt. Schreckensszenarien wurden heraufbeschworen. Doch nach der Tötung des Hamas-Politchefs Ismail Haniyeh Ende Juli 2024 mitten in Teheran blieb eine Reaktion aus. Israel hatte den Verbündeten der Mullahs präzise getroffen. Ein Affront für den Gastgeber und ein Gesichtsverlust für den iranischen Sicherheitsapparat. Die klare Botschaft aus Israel an seine Feinde: Wir wissen, wo ihr seid.
Der Anschlag auf Haniyeh legte die Unterlegenheit des iranischen Sicherheitsapparates offen, insbesondere die der Revolutionsgarde, die für den Schutz des Gastes verantwortlich war. Seitdem leidet die Elitetruppe und Stütze des Regimes unter einem enormen Vertrauensverlust. Zum ersten Mal wurde selbst in der iranischen Staatspresse von einer Infiltration der Revolutionsgarde durch den Mossad gesprochen.
Bevor Israel mit dem Anschlag in Teheran die Zahnlosigkeit von Irans Machtelite bloßstellte, hatte Revolutionsführer Khamenei für das Überleben des Regimes eigentlich ein neues strategisches Manöver geplant. Irans neuer Präsident sollte es richten, Masoud Pezeshkian. Er wurde installiert, um einen sanfteren Kurs gegenüber dem Westen einzuschlagen, vor allem mit Blick auf die Wiederwahl Trumps, die Teheran mindestens ebenso gefürchtet hat wie Netanjahu. Als vermeintlicher »Reformer« präsentiert, verkörpert Pezeshkian das Paradox der Teheraner Politik: Eine Fassade des Wandels soll eine tiefe Überlebenskrise überdecken.
Dabei ist Pezeshkian nicht etwa Präsident geworden, um die Islamische Republik sanft zu liberalisieren. Er ist Präsident geworden, um den Westen um den Finger zu wickeln – wieder einmal. Die übergeordneten Ziele lauten dabei: Das iranische Atomprogramm retten. Und die Sanktionen lockern.
Seit Jahren hat das Regime Milliarden in seine Sicherheitsarchitektur investiert: Zu Hause standen die Revolutionsgarden parat – und im Rest des Nahen Ostens sollten lokale Kopien die Macht Teherans ausweiten: Seit der Revolution von 1979 baute Iran an einem Netzwerk von Stellvertretern im Libanon (Hisbollah), in Gaza (Hamas), in Jemen (Huthis), in Syrien und dem Irak (schiitische Milizen). Doch diese sogenannte Achse des Widerstandes wird gerade von Israel pulverisiert. Ohne seine Stellvertreter in der Region kann die Islamische Republik nicht viel ausrichten.
Somit befand sich die Islamische Republik im September 2024 im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York in einem Dilemma: Während Irans »Reformer«-Präsident einen »Eintritt in eine neue Ära« verkündet, wird die Hisbollah – das iranische Kronjuwel, sein wichtigster Handlanger in der Region und ein zentrales Druckmittel in Verhandlungen, nahezu ausgelöscht. Neben Generalsekretär Hassan Nasrallah wird fast die gesamte Führungselite getötet. Das gefürchtete Raketenarsenal größtenteils zerstört. Und aus Teheran: Wieder nichts.
Beobachtet man Netanjahu dieser Tage, könnte man meinen, dass er sich nichts sehnlicher wünscht als einen Krieg mit Teheran. Dann endlich könnte er mit Rückendeckung der USA die iranischen Atomanlagen zerstören.
Doch das Regime ist ein Meister im Überleben. Seit bald einem halben Jahrhundert schon verfolgt es die Strategie des Zermürbens, ohne sich selbst in den Konflikt zu stürzen – provozieren und dementieren, aber immer ohne offene Konfrontation, besonders nicht mit den USA. Selbst als beliebte Generäle getötet wurden – der prominenteste unter ihnen war Qasem Soleimani 2020 – folgte zwar heftige Trauer, nach außen hin aber keine beißende Wut: Teheran reagierte kaum. Das Regime hält sich dabei an ein altbewährtes Skript: Keinesfalls will man sich in eine direkte Eskalation reinziehen lassen.
Im Moment sieht es jedoch so aus, dass Irans Strategie nicht aufgeht. Das Kartenhaus der Islamischen Republik wackelt bedrohlich. Innerhalb der Revolutionsgarde herrscht Misstrauen. In Iran tobt ein Machtkampf um die Zukunft. Die Bevölkerung hat sich bereits vor Jahren vom Regime abgewandt. Und – gefährlich für Teheran: Die Vorwürfe der arabischen Verbündeten werden lauter: Die Islamische Republik hätte reagieren müssen. Hätte sie auf die Tötung Haniyehs geantwortet, wäre Nasrallah möglicherweise noch am Leben.
Anscheinend – und das wäre eine Genugtuung für viele Iranerinnen und Iraner, nach so vielen Tricksereien des Regimes – wurden die Mullahs dieses Mal selbst ausgetrickst. Zumindest behauptet Pezeshkian das Ende September. Westliche Nationen hätten ihm versprochen, einen Waffenstillstand in Gaza zu sichern, wenn er sich für eine »Nichtreaktion« auf die Ermordung von Haniyeh entscheiden würde.
Im Moment spielt sich ein Worst-Case-Szenario für Teheran ab. Die Islamische Republik läuft Gefahr, wieder als ein isolierter schiitischer, nicht-arabischer Staat gesehen zu werden, geopolitisch umzingelt von Sunniten, die Teheran gerade als Verräter betrachten. Khamenei hat jetzt die Wahl, entweder als Verräter und Schwächling in die Geschichte einzugehen oder sich mit Netanjahu einzulassen. Und auch das könnte sehr schmerzhaft werden für das Regime.
Für Abgesänge auf die Islamische Republik ist es wahrscheinlich aber trotzdem noch zu früh. Bisher ist den Mullahs noch immer etwas eingefallen, um am Ende doch zu überleben. Viel Handlungsspielraum bleibt der Teheraner Krake aber derzeit nicht. Schließlich sind einige ihrer Tentakel in der Region durch Israels Militär amputiert worden. Doch das bedeutet nicht, dass das Regime tatenlos bleibt. Mit Hinrichtungen soll nunmehr Stärke demonstriert werden.
Teheran, Montagabend, 28. Oktober 2024. Die Justiznachrichtenagentur der Islamischen Republik verkündet die Hinrichtung des deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd am Morgen.
Am 25. Juli 2020 war er von Frankfurt nach Dubai gereist. Der Anschlussflug nach Mumbai fiel aus, er übernachtete in Dubai und informierte seine Familie. Dann herrschte tagelange Funkstille – schließlich ist er im iranischen Staatsfernsehen zu sehen, mit geschwollenem Gesicht und fehlenden Zähnen. »Geständnisse« wurden erzwungen, die ihn als Unterstützer einer Terrororganisation darstellen.
Iranische Geheimdienste hatten Sharmahd, der in Teheran als Regimegegner gilt, aus Dubai entführt und in Iran an einem geheimen Ort inhaftiert, gefoltert und misshandelt. In einem unfairen Schauprozess wird er im Februar 2023 zum Tode verurteilt.
Am 1. August 2023 postet seine Tochter eine Videobotschaft von Friedrich Merz, der die Patenschaft für Sharmahd übernommen hat. Darin sagt er: »Seit über 1000 Tagen befindet sich der deutsche Staatsbürger Jamshid Sharmahd im iranischen Gefängnis. Ich appelliere an die Bundesregierung, die Anstrengungen zu verstärken, dass Jamshid Sharmahd nach Deutschland ausreisen kann. Europäische Regierungen haben es geschafft, in den letzten Wochen und Monaten sieben Häftlinge freizubekommen. Das sollte der deutschen Bundesregierung auch gelingen.«
Gazelle Sharmahds Kritik an der Bundesregierung und den USA wird in den folgenden Monaten immer lauter. Auch ihre Vorwürfe. Sie fühlt sich im Stich gelassen. Ein Ultimatum des Regimes für eine Lösegeldzahlung in Milliardenhöhe ist abgelaufen. »Das Ping-Pong-Spiel zwischen den USA und Deutschland wird meinen Vater das Leben kosten«, so die Tochter.
Immer wieder wendet sie sich verzweifelt an die deutsche Regierung: »Warum wollen Sie nichts unternehmen, um meinen Vater zu befreien? Reden mit Terroristen ist wie ins Feuer spucken.«
Doch die deutschen Handelsbeziehungen zum Regime bleiben bestehen, die Bundesrepublik ist nach wie vor wichtigster Handelspartner des Regimes in Teheran innerhalb der EU, und erst im September 2024 traf sich die deutsche Außenministerin für 30 Minuten mit ihrem iranischen Amtskollegen zu einem Gespräch während der UN-Vollversammlung abseits der Medienaufmerksamkeit.
Am Tag der Verkündung der Hinrichtung heißt es auf dem Account der deutschen Außenministerin routiniert, dass sie die »Ermordung von Jamshid Sharmahd durch das iranische Regime auf das Schärfste verurteilt«. Und weiter: »Unermüdlich hat sich unsere Botschaft in Teheran für Jamshid Sharmahd eingesetzt. Auch hier in Berlin haben wir jeden Tag an diesem Fall gearbeitet. Wir haben dafür mehrfach ein hochrangiges Team des Auswärtigen Amts nach Teheran entsandt. Dabei haben wir Teheran immer wieder unmissverständlich klar gemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird.«
In den Kommentaren zum Post entlädt sich Wut über die »stille Diplomatie der Bundesregierung« ungebremst. Auch Mariam Claren, die Tochter der 70-jährigen Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi, die seit vier Jahren zu Unrecht im Evin-Gefängnis in Teheran sitzt, meldet sich nach der Verkündung der Hinrichtung Sharmahds zu Wort: »Lasst es mich als Tochter der anderen deutschen Geisel mehr als deutlich sagen: dieser staatliche Mord hätte verhindert werden können, wenn die Bundesregierung wirklich gewollt hätte. Das Blut von #JamschidSharmahd klebt nicht nur an den Händen der islamischen Republik.« Sie fügt noch hinzu: »Ich habe große Angst um meine Mutter. Weil ich jetzt zu 100 % weiß, dass das Leben deutscher Staatsbürger für die Bundesregierung keine Bedeutung hat.«
Im November 2024 ist Donald Trump zum zweiten Mal zum mächtigsten Mann der Welt gewählt worden. Für Iran das Worst-Case-Szenario. Trump, der die Tötung des iranischen Top-Generals Soleimani angeordnet und gegen Teheran eine Politik des »maximalen Drucks« (erfolgreich) geführt hatte, wird in seiner zweiten Amtszeit nicht zaghaft mit den Mullahs umgehen. Hinzu kommt eine Anklageschrift des US-Justizministeriums, die Iran vorwirft, die Ermordung Donald Trumps während des US-Wahlkampfs geplant zu haben. Marco Rubio, Senator Floridas soll Trumps Außenminister werden. Ein Falke, der kaum besänftigend auf Trump einwirken wird.
Über die Rolle, die Europa jahrelang nicht eingenommen hat, und darüber, dass es immer noch nicht zu spät ist, eine neue Iran-Politik zu entwickeln und umzusetzen, schreibt Ali Fathollah-Nejad ausführlich in diesem Buch. Er zeigt, warum wir jetzt handeln müssen. Der revolutionäre Prozess in Iran, ausgelöst durch den Mut der iranischen Frauen und einer mutigen Jugend, fordert von uns ein Umdenken und verlangt eine Zeitenwende in der Iran-Politik. Die Zukunft des Landes und seiner Menschen hängt davon ab, ob der Westen bereit ist, die Konflikte und Chancen in Iran mit neuen Augen zu sehen – und endlich aus der Rolle des Zuschauers herauszutreten.
Es ist Mittwoch, der 13. November, ich muss das Vorwort jetzt abgeben.
Einleitung
Es scheint, als ob die Islamische Republik Iran einen stetigen Anspruch auf die weltweiten Schlagzeilen erhebt: Nicht erst seit dem barbarischen Massaker der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober 2023 agiert die Islamische Republik als regionaler Hauptkontrahent des »jüdischen Staates« und der USA. Dies kulminierte innerhalb eines halben Jahres mit den zwei ersten direkten Raketenangriffen Irans auf Israel, bevor sich der Krieg zum ersten Mal jährte. Zudem, kurz vor dem zweiten Jahrestag des brutalen Angriffs Putins auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, ereilte uns die Meldung von der Lieferung Hunderter iranischer Raketen für Russlands Krieg. Im Herbst 2022 trugen die revolutionären »Frau, Leben, Freiheit«-Proteste gegen das Regime den Ruf nach einem demokratischen Wandel in die gesamte Welt. Und zuletzt während des Gaza-Krieges erkoren die Islamischen Revolutionsgarden weitab unserer Aufmerksamkeit das Mittelmeer als Teil ihrer erweiterten Operationszone, der »strategischen Tiefe« der Islamischen Republik. Dieser Abriss zeigt die Dichte und Bedeutung dieser Vorkommnisse allein in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren vor der Fertigstellung dieses Buches im November 2024 kurz nach der Wiederwahl von Donald Trump. Die Herausforderungen für die Menschen in Iran, im Nahen Osten, in Europa, inklusive Deutschland, aber auch für die westliche Sicherheitspolitik, könnten also kaum dramatischer und dringender sein.
Doch seit Beginn des Jahrtausends richtete sich der besorgte Blick des Westens – also Europas und der USA – auf eine ganz andere Sache: das iranische Atomprogramm. Die geradezu obsessive Angst vor einer Bombe in den Händen der Mullahs macht uns dabei allerdings blind für zwei zentrale Aspekte: einerseits den rasch erodierenden Rückhalt eines scheinbar fest im Sattel sitzenden Regimes und andererseits die Außenpolitik Teherans, deren destabilisierende Folgen nicht nur den Nahen Osten erfassen, sondern spätestens mit dem Krieg in der Ukraine ihren Weg bis vor unsere Haustür gefunden haben.
All diese Dynamiken wären nicht überraschend gewesen, hätte der Westen sich nicht auf den Lorbeeren des erfolgreich verhandelten Atomabkommens mit Iran ausgeruht. Es galt als nichts weniger als das Kronjuwel europäischer Diplomatie. Und in der Tat hat der sogenannte Atomdeal von 2015 den Weg Irans zur Atombombe versperrt und im Gegenzug viele Sanktionen aufgehoben. Drei Jahre später jedoch trat der damalige US-Präsident Trump mit ebenso großem Krach einseitig aus dem zwischen Iran und den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China geschlossenen Iran-Deal aus und verantwortete – zumindest nach europäischer Lesart – das jähe Ende eines diplomatischen Meilensteins.
Knapp ein Jahrzehnt später wird umso deutlicher: Das Meisterstück europäischer Außen- und Sicherheitspolitik hatte trotz der Einhegung des iranischen Atomprogramms fatale blinde Flecken. Es wurden bewusst zwei Felder ausgeklammert, die uns später heimsuchen sollten: Teherans Innenpolitik und seine Regionalpolitik. Innenpolitisch hat der Westen sich entschieden, über die damals schon beunruhigende Menschenrechtslage hinwegzusehen. Während Europa sich siegestrunken für seinen Verhandlungserfolg auf die Schulter klopfte, erfuhr man hierzulande wenig davon, dass der Vertragspartner die höchste Exekutionsrate der Welt verzeichnete – noch vor Saudi-Arabien und der Volksrepublik China. Vor allem erreichten die versprochenen Pfründen des Atomdeals kaum die normale Bevölkerung Irans; die Kluft zwischen Gesellschaft und Staat wuchs sogar noch an. Die wachsende soziale Frustration mündete sodann in bis dato noch nie da gewesene landesweite Proteste gegen das Regime. Als sich Europa und die iranische Elite noch die Hände rieben und Geschäfte zwischen ihnen wiederaufblühten, explodierte der angestaute Volkszorn im Winter 2017. Zwar wurden die Proteste niedergeschlagen, doch die Machtelite war erschüttert – der Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses wurde damit eingeläutet.
Der andere blinde Fleck war Irans Regionalpolitik. Die Präambel des Atomdeals beinhaltete noch den Wunsch, wenn nicht gar die Erwartung westlicher Staaten, dass sich die Lage im konfliktreichen Nahen und Mittleren Osten entspannen würde. Beim Abkommen mit Teheran kam folglich Irans Raketenprogramm nicht auf den Verhandlungstisch – zum Unmut vieler Nachbarn Irans, die sich darüber bewusst waren, dass sich die Bedrohung durch die Islamische Republik eben nicht auf die Atomfrage beschränken lässt. Vielmehr sah man Teherans Raketenprogramm und seine überall in der Region verstreuten Milizen als Hauptgefahr an. Knapp ein Jahrzehnt später dämmert es allmählich in den politischen Hauptstädten des Westens, dass die durch Teheran auferlegten Herausforderungen doch größer sind als gedacht: von den Drohnen- und Raketenlieferungen an Putin für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine über Teherans Einfluss auf die Hamas, aber vor allem die Hisbollah in ihrem Kampf gegen Israel, bis hin zur Bedrohung zentraler Handelsrouten durch die auch mit Iran verbündeten jemenitischen Huthis und, wie bereits erwähnt, nicht zuletzt zu den ersten beiden direkten Raketenangriffe der Islamischen Republik gegen den »jüdischen Staat« innerhalb von nur einem halben Jahr.
Trotz alledem tut sich Europa äußerst schwer, seine auf Arrangement mit der Islamischen Republik ausgerichtete Außenpolitik zu überdenken, geschweige denn anzupassen. Denn immerhin liegt zwischen Appeasement und Kriegstreiberei ein allzu oft vernachlässigter großer Graubereich, der durchaus couragiert und kreativ mit Inhalten gefüllt werden kann. Doch oft begnügt man sich noch mit Allgemeinplätzen, wie etwa dem reflexartigen Ruf, ja nahezu hilflosem Flehen nach Diplomatie und Deeskalation, und einem komfortablen Weiter-So.
Diese Zurückhaltung aber droht zu immer neuen Fiaskos zu führen. Die auf autoritäre Stabilität fixierte Iran-Politik birgt die Gefahr, eine Wiederholung des Russland-Desasters heraufzubeschwören. Genauso wie Europa nach der Krim-Annexion 2014 durch Russland hätte aufwachen müssen, so war Irans blutige Intervention in Syrien zugunsten Assads unmittelbar nach dem Atomdeal bereits ein deutliches Warnsignal. So sind die Parallelen zwischen den Russland- und Iran-Verstehern frappierend, deren vielfach irreführende Prämissen unser außenpolitisches Denken und Handeln unnötig eingeengt haben.
Aber unsere Haltung in Sachen Iran betrifft nicht nur unsere außen- und sicherheitspolitischen Interessen, sondern auch unsere Werte. Kaum bestritten wird, dass die iranischen »Frau, Leben, Freiheit«-Proteste die im Westen zu Recht hochgeschätzten universellen Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte, nicht zuletzt von Frauen, vertreten. Doch wie am Beispiel der iranischen Demokratiebewegung und ihrer immer neu entfachten Proteste, die den autoritären Status quo in der Islamischen Republik herausfordern, deutlich wurde, sind Werte auch stabilitätsrelevant. So sind, entgegen dem kruden geopolitischen Zeitgeist, Werte und Interessen kein Widerspruch, sondern stehen in engem Verhältnis zueinander und können einander sogar bedingen.
Von außen betrachtet ist in Iran seit der Niederschlagung der Proteste Anfang 2023 wieder Ruhe eingekehrt. Doch dieser Schein trügt. Die strukturellen Motoren des revolutionären Unmuts existieren nicht nur weiterhin, sondern verstärken sich, während das Erbe der Proteste bis heute spürbar ist und die Innen- sowie Außenpolitik des Regimes mitbeeinflusst. Dazu gehört bereits ein tiefgreifender sozio-kultureller Wandel als Resultat eines landesweiten sozio-politischen Ungehorsams von Frauen:1 Iranerinnen treten ohne den obligatorischen Hidschab in der Öffentlichkeit auf und definieren somit ihre Beziehung zum Staat neu – und dies trotz der repressiven Taktik des Regimes, das Mitte April 2023 die Hidschab-Gesetze durch den Einsatz von Kameras und hohen Geldstrafen verschärfte.2 Ein langjähriger Kommentator bezeichnet dies treffend als »unumkehrbaren Prozess«, der einer Art »Kulturrevolution« gleichkommt, als existenzielle Bedrohung für die Islamische Republik: Ohne den Hidschab werde »diese ›Republik‹ zu einem Kaiser ohne Kleider«.3 Die Kombination aus sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Missständen und Verwerfungen erzeugt somit eine Situation, in der das iranische Regime auf einem – gerade wieder schlafenden – Vulkan sitzt, wie Beobachter innerhalb und außerhalb des Landes übereinstimmend feststellen, der jederzeit wieder ausbrechen kann. Insbesondere die sich verschärfende Wirtschaftskrise wird als potenzieller Auslöser für einen zukünftigen Aufstand der Armen angesehen, die heute den Großteil der Bevölkerung ausmachen. Die immense Kluft zwischen Staat und Gesellschaft scheint zementiert und gar irreversibel zu sein. Und die Führung des Landes hat keinerlei politische Antworten auf die strukturellen, ja existenziellen Krisen parat. Kurzum: In Iran unter der Islamischen Republik herrscht nur oberflächliche Ruhe, eine Scheinstabilität, die jederzeit wieder unter dem gesellschaftlichen Druck kollabieren kann. So tun wir gut daran, uns viel besser und tiefgründiger als bislang mit diesem – wie ich ihn nenne – revolutionären Prozess in Iran zu beschäftigen. Denn er prägt nicht nur die Haltung der Machthaber nach innen, sondern auch nach außen – also auch in Bezug auf uns im Westen.
Ziel dieses Buches
Vor diesem Hintergrund verfolgt dieses Buch gleich mehrere Absichten. Im Kern geht es darum, die immense Kluft zwischen westlichem Wunschdenken und den schonungslosen Fakten aufzuzeigen. Die folgenden fünf Gedanken sollen das Buch anleiten:
Das in Deutschland, Europa und im Westen in Politik- und Fachkreisen gleichermaßen vorherrschende Iran-Bild, das – mit den Worten des renommierten Historikers Ali Ansari – »sehr statisch und eindimensional« ist,4 gilt es zu hinterfragen. Stattdessen sollen Strukturen, Tendenzen, Dynamiken und Prozesse in den Vordergrund unserer analytischen Betrachtung gestellt werden. Dies soll die Leserinnen und Leser dazu befähigen, gegenwärtige, aber auch zukünftige Entwicklungen in und rund um Iran besser zu erkennen und zu deuten.
Dieses analytische Defizit bezieht sich sowohl auf die iranische Innen- als auch Außenpolitik. Dabei wird zwar von jenen oben genannten Kreisen eine gewisse Dynamik der Entwicklungen nicht generell infrage stellt, aber man begnügt sich am Ende doch mit einer statischen Lesart. Was die iranische Innenpolitik anbelangt, hinkt diese Sicht in vielerlei Hinsicht den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen eines solch dynamischen Landes hinterher, in manchen Fällen Jahre und sogar Jahrzehnte. So werden beispielsweise im westlichen Bewusstsein präsente historische Marken genommen und auf die Gegenwart extrapoliert. Hier schwankt man zwischen einem von Dunkelheit (Stichwort: Ayatollah Khomeini – ein durch theokratischen, patriarchalen und religiösen Extremismus in Finsternis versinkender Iran) oder von Euphorie (Stichwort: »Reformpräsident« Mohammad Khatami – ein mithilfe eines aufgeklärten Mullahs, der die Kultur des »islamischen Iran« so gut wie kein anderer widerspiegelt, vor dem demokratischen Wandel stehendes »islamisches« Land) geprägten Iran-Bild, welches immer wieder eine zweifelhafte Renaissance erlebt – wie jüngst beim angeblich neuen »Reformpräsidenten« Masoud Pezeshkian. Kurzum: ein Land zwischen theokratischem Mittelalter und reformistischer Romantik. Dabei haben die Entwicklungen allein im letzten Jahrzehnt vor Augen geführt, dass die Realität in Iran dieser Schablone nicht entspricht. In der außenpolitischen Fachdiskussion wiederum wird die Islamische Republik oft und gerne als Riese gezeichnet, dem man nur mit äußerster Vorsicht begegnen sollte, da er sonst drohe, wild um sich zu schlagen. Dabei deutet die Realität mehr darauf hin, dass das iranische Regime – nach außen wie auch nach innen – eher ein Scheinriese ist.
Hieran anschließend stellt sich die Frage nach der Validität des im Westen nach wie vor omnipräsenten, dominierenden Paradigmas der »autoritären Stabilität und Resilienz« – also die Widerstandsfähigkeit von Diktaturen gegen gesellschaftlichen Veränderungs- und Demokratisierungsdruck. Dieses wird allerdings in der Debatte häufig als »autoritäre Permanenz« missverstanden und somit entstellt.5 Oft camoufliert als Ausdruck einer nüchternen, illusions- und emotionsfreien Bestandsaufnahme realer Machtverhältnisse vor Ort, droht es Dynamiken und strukturelle Krisen, die Veränderungen zeitigen, zu übersehen. Auch reproduziert es das im Westen lange Zeit vorherrschende Bild »vom Orient«, einer zur Despotie verdammten Weltregion, die immun ist gegen Wandel, geschweige denn demokratischen. Dieser Neo-Orientalismus suggeriert die Abwesenheit eines Wunsches nach Wandel, insbesondere in Richtung der Achtung der Menschen- und Freiheitsrechte, Demokratie sowie sozialer Gerechtigkeit. Dabei zeigen die Proteste in Iran den Wunsch der Mehrheit nach all dem, nach einer sozialen und liberalen Demokratie.
Die Art, wie in Deutschland über die Iran-Politik diskutiert wird, suggeriert, sie sei alternativlos. Dabei werden nicht selten einfache Dichotomien bemüht: Diplomatie wäre die einzige Option, oder wolle man etwa einen Krieg provozieren? Oft ist sogar die Rede von einem Dritten Weltkrieg, den man mit einer entschiedeneren Haltung gegenüber der Islamischen Republik heraufbeschwöre – der Westen versus eine angeblich iranisch-russisch-chinesische Allianz – ein Armageddon unbeschreiblichen Ausmaßes.
Das vorliegende Buch soll zudem zu einer fundierteren außen- und sicherheitspolitischen Diskussion beitragen, die nicht zuletzt die Notwendigkeit unterstreicht, Werte und Interessen in der Außenpolitik nicht als Gegensätze, sondern als zusammengehörend und Voraussetzung für eine nachhaltige Sicherheitspolitik zu verstehen.
Außenpolitik ist auch immer Innenpolitik. Diese Maxime wird oft zum Verständnis des außenpolitischen Verhaltens sehr unterschiedlicher Staaten dieser Welt herangezogen, nur selten aber im Falle der Islamischen Republik. Dabei ist es gerade dort besonders angebracht, stellt doch das post-revolutionäre iranische Regime eine Rarität dar – mitsamt seiner politischen Ideologie und seinem stetigen Behauptungskampf. Somit ist es ein zentrales Anliegen dieses Buches, hier Abhilfe zu schaffen, Einblick zu gewähren in die oft als Blackbox geltenden, die Außenpolitik mitbestimmenden innenpolitischen Dynamiken. Dadurch soll der entscheidende Nexus zwischen der Innen- und Außenpolitik der Islamischen Republik herausgearbeitet werden. Denn nicht selten bestimmen die Sorgen der Machthaber um die Stabilität des Regimes auch deren außenpolitisches Verhalten – sei es in Richtung Eskalation oder Deeskalation. Unsere Iran-Analysen werden jedoch zumeist von einer orthodoxen Vorstellung von Geopolitik beherrscht, welche die Islamische Republik als Spielball äußerer, oft westlicher Mächte ansieht, als reaktiven Akteur ohne eigene Agency. Vielmehr ist eine kritische Geopolitik vonnöten, die angebliche Weisheiten und Wahrheiten infrage stellt – wie wir es auch in der Russland-Frage zu lernen hatten. Aufgrund der zentralen Bedeutung dieser »inneren Dimension« werde ich mich ihr direkt zu Beginn dieses Buches widmen. Dabei erläutere ich auch den von mir geprägten Begriff des langfristigen revolutionären Prozesses in Iran, den zwar viele übernommen haben, der aber nur unzureichend verstanden zu sein scheint.
Mit diesem Buch möchte ich also einen korrigierenden Beitrag zu unserer Iran- und Außenpolitik-Debatte leisten. Zugleich ist es das Produkt meines eigenen Lernprozesses im Zuge der aktiven Beschäftigung mit diesen Themen seit über 20 Jahren, und es ist auch ein Korrektiv meiner eigenen, im Nachhinein als naiv und irreleitend zu bezeichnenden Analysen, die ich als Student verfasst und vertreten habe. Denn ich selbst gehörte damals noch zu denjenigen, die man heute als »Iran-Versteher« bezeichnen könnte – und wurde deswegen auch zu Recht kritisiert. Je mehr ich allerdings über die Islamische Republik Iran lernte, desto mehr musste ich viele meiner alten Prämissen hinterfragen, ja sogar über Bord werfen. Zu sehr war mein damaliges Iran-Bild geprägt von der hierzulande noch heute vorherrschenden anti-imperialistischen Brille, die die Schuld stets beim Westen sucht. Eine Praxis, die auch die Islamische Republik kultiviert, indem sie alle inländischen Missstände auf das Agieren und die Aktionen des »bösen Westens« externalisiert. Und auch die iranische Zivilgesellschaft, die in großen Teilen bis zur Grünen Bewegung von 2009 noch die Hoffnung auf innenpolitische Reformen hegte, sah westliche Sanktionen oft als kontraproduktiv an. So zeichnete damals der bekannte politische Karikaturist Mana Neyestani die zivilgesellschaftliche Erfahrung einer Doppelbelastung im Zuge verschärfter Sanktionen der EU. In seiner Zeichnung tritt der vornehme Lederschuh der EU auf die Militärstiefel des Regimes, unter denen ein iranischer Demokratie-Aktivist in den Boden gestampft wird. Während das Regime nur mit einem mageren »Autsch« reagiert, schreit der nun doppelt zerquetschte Aktivist spöttisch in Richtung EU: »Danke für die Hilfe!«
Doch seitdem hat sich vieles verändert. Irans Zivilgesellschaft ist zur Einsicht gekommen, dass Reformen innerhalb der bestehenden Verhältnisse nichts als eine Chimäre sind, dass die Islamische Republik mit jedem Tag ihrer Existenz das Land in eine noch tiefere Misere hineinmanövriert. Dass die auf Selbsterhaltung und -bereicherung fußenden Interessen des Regimes die Gesellschaft aushöhlen, dass das Regime um seines Überlebens willen vor keiner Banalität des Bösen zurückschreckt – von Hinrichtungswellen bis hin zur Veräußerung nationaler Ressourcen und Interessen an das, was es als seine ausländischen Garantiemächte betrachtet (Russland und China). Kurzum, dass die Machthaber bereit sind, für ihre Macht und ihren gestohlenen Reichtum das gesamte Land zu opfern, und dass ausländische Sanktionen ein Hilfsmittel des Demokratiekampfes zur Schwächung der Diktatur bedeuten können, wenn sie denn die Richtigen treffen.
Diese Entwicklung großer Teile der Zivilgesellschaft Irans spiegelte auch meine eigene wider. So lautete der bezeichnende Titel meines Essays, der 2003 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien, noch: »Wie Sanktionen den Tyrannen helfen.«6 Eine Lesart, die später auch Eingang in meine Londoner Doktorarbeit fand – und zu Recht, wie ich heute weiß, von den Gutachtern auseinandergenommen wurde und radikal revidiert werden musste. Das Ergebnis ist nun in diesem Buch nachzulesen.
Zum Aufbau des Buches
In den ersten beiden Kapiteln wird die innenpolitische Lage unter die Lupe genommen und dargelegt, was unter dem »revolutionären Prozess« in Iran eigentlich zu verstehen ist.
Kapitel I untersucht die Vierfach-Krise, mit der die Islamische Republik zu kämpfen hat: sozio-ökonomisch, ökologisch, politisch und in Hinblick auf den Gender Gap. Erstere beschreibt das wachsende sozio-ökonomische Elend, unter dem die Mehrheit der Bevölkerung nunmehr verharrt, mit hohen Armutsraten und einer weitgehend ausgehöhlten Mittelschicht. Die ökologische Krise, die in politischen Fehlentscheidungen begründet ist und durch die Auswirkungen des Klimawandels verschärft wird, beeinträchtigt die Lebensgrundlage von Dutzenden Millionen Menschen und führt immer wieder zu Protesten, die unweigerlich politisch sind. Und die politische Krise geht einher mit der Unterdrückung der Zivilgesellschaft durch das autoritäre Regime, dem Verlust des Ansehens der reformistischen Fraktion des Establishments – die lange Zeit als potenzielle Akteurin des Wandels von oben angesehen wurde – im letzten Jahrzehnt sowie mit der beispiellosen Legitimationskrise des gesamten Regimes.
Kapitel II zeichnet die Entstehung und Entwicklung der landesweiten Protestwellen nach, indem es die Aufstände von 2017/18 und November 2019 untersucht, die als Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses in Iran angesehen werden können, bevor die Besonderheiten der revolutionären Revolte vom Herbst 2022 diskutiert werden.
Der zweite Teil des Buches widmet sich der Außenpolitik, sowohl der der Islamischen Republik als auch der des Westens ihr gegenüber, inmitten sich verändernder Vorzeichen: in Iran selbst, im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Weltordnung. Dabei werden die Kernelemente iranischer Außen-, Regional- und Atompolitik aufgezeigt, deren Verständnis für eine effektivere Außenpolitik gegenüber Teheran unerlässlich ist. Ebenso unabdingbar ist eine kritische Rückschau auf die bisherige Iran-Politik des Westens.
Abschließend werden einige Empfehlungen für eine neue Iran-Politik ausgesprochen, wobei ein Mittelweg zwischen den gleichermaßen wenig Erfolg versprechenden Haltungen der Kriegstreiberei und der Beschwichtigungspolitik formuliert wird. Denn nur eine Zeitenwende in der westlichen Iran-Politik kann die notwendigen Weichen stellen, um nicht nur den irreversiblen revolutionären Prozess in Iran positiv zu begleiten, sondern auch den massiven außenpolitischen Herausforderungen durch Teheran Herr zu werden.
Kapitel III befasst sich mit den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten in den letzten zehn Jahren, insbesondere seit der Unterzeichnung des Atomdeals von 2015, des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Während das regionale Ansehen Irans damals wohl auf seinem Höhepunkt war, hat es seitdem viel eingebüßt. Aufgrund der aktiven Rolle der Islamischen Republik bei der Niederschlagung von Volkserhebungen während der ersten (v. a. in Syrien) und zweiten (v. a. im Irak) Welle des Arabischen Frühlings hat Teherans Soft Power erheblich gelitten, seine Rolle wurde zunehmend von vielen seiner Nachbarstaaten und -gesellschaften als bedrohlich empfunden.
Kapitel IV beleuchtet die Außenpolitik der Islamischen Republik zwischen einer gemanagten Feindschaft mit dem »Großen Satan« (den USA) sowie die magere Ausbeute ihres geopolitischen »Blicks nach Osten«, bei dem die asymmetrischen Beziehungen zu Russland und China im Mittelpunkt stehen.
Kapitel V gibt einen Überblick über die westliche Iran-Politik und ihre größtenteils enttäuschten Erwartungen an den Atomdeal. Anschließend wird der Blickwinkel erweitert, und die Schattenseiten des seit Langem verfolgten westlichen Paradigmas der »autoritären Stabilität« werden betrachtet. Zudem werden Vergleiche mit fehlgeleiteten politischen Annahmen in Bezug auf Russland gezogen, die sich im Fall Iran widerspiegeln.
Kapitel VI widmet sich der Rolle der Islamischen Republik im Nahost-Krieg seit dem 7. Oktober 2023 und bietet dabei seltene Einblicke in das strategische Denken und die Manöver der iranischen Machthaber in Schlüsselmomenten, als es um die Frage nach einem erweiterten, großen Krieg ging.
Kapitel VII diskutiert die jüngste Wahl eines im Westen als Reformer glorifizierten Masoud Pezeshkian zum iranischen Präsidenten, seine Mission für das Regime und was sie für die iranische Gesellschaft und Außenpolitik bedeutet.
Schließlich plädiert Kapitel VIII für einen Paradigmenwechsel in der Iran-Politik als notwendige Voraussetzung, um sie auf eine nachhaltigere Grundlage zu stellen, die sowohl den westlichen Interessen als auch denen der iranischen Gesellschaft gerecht wird. Eine solche Verschiebung würde eine Abkehr von der obsessiven Fokussierung auf die Atomfrage erfordern – die Teheran einen strategischen Vorteil verschafft, da seine »nukleare Eskalation« den Westen in einen reaktiven Modus getrieben hat. Abschließend wird eine Reihe von politischen Empfehlungen formuliert, die bei einer Neuorientierung unserer Iran-Politik zu beachten wären, zudem wird ein Ausblick in die »Zukünfte« Irans eröffnet.
Ali Fathollah-Nejad, Berlin Anfang November 2024
I
Die Islamische Republik in einer Existenzkrise
Einführung: Irans multiple Krisen
Seit den landesweiten Protesten zur Jahreswende 2017/18 (bekannt als Dey-Proteste) befindet sich Iran im Griff einer akuten Vierfach-Krise – sozio-ökonomisch, politisch, ökologisch und geschlechterspezifisch –, die ein neues und eigenständiges Kapitel in der turbulenten, vier Jahrzehnte währenden Geschichte der Islamischen Republik einläutete. Während jede dieser Krisen für sich das Potenzial hat, das Regime zu destabilisieren, verstärkt ihre gleichzeitige Existenz die Bedrohung erheblich. Die Umweltkrise bedroht gar die Zukunft des Landes selbst. Die politische Krise muss als Epizentrum angesehen werden, da sowohl die sozio-ökonomischen als auch die ökologischen Krisen zu einem erheblichen Teil auf die politischen (Fehl-)Entscheidungen des Regimes zurückzuführen sind. Und während der »Frau, Leben, Freiheit«-Proteste vom Herbst 2022 trat noch eine andere, bereits seit 1979 bestehende strukturelle Krise fulminant in Erscheinung: der Gender Gap oder die immense Kluft zwischen Männern und Frauen in der Islamischen Republik. Diese Kluft hat verschiedene Gesichter und umfasst rechtliche (Stichwort: Geschlechter-Apartheid), sozio-ökonomische, politische und sozio-kulturelle (also die staatliche Kontrolle über die Kleidung und Lebensweise von Frauen) Dimensionen.
Die sozio-ökonomische Krise
»Brot, Arbeit, Freiheit« // »Das Volk muss betteln, der Herr [Spitzname des Obersten Führers Ali Khamenei] verhält sich wie Gott persönlich« // »Die Menschen sind gefangen in Armut« // »Stehlen ist zur Tugend geworden, für die Herrschenden so wichtig wie das Beten«
Slogans während der Dey-Proteste 2017/18
Auf dem Papier gehört Iran zweifelsohne zu den reichsten Ländern der Welt – sowohl in Bezug auf seine natürlichen als auch menschlichen Ressourcen. Das Land ist reich an Bodenschätzen, insbesondere an Erdöl und -gas. Es verfügt über die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt und die viertgrößten nachgewiesenen Rohölvorkommen. Zu den Bodenschätzen des Landes gehören bedeutende Vorkommen von Kupfer, Eisenerz und anderen Metallen. Was die menschlichen Ressourcen oder das Humankapital anbelangt, zeichnet sich das Land durch eine hohe Alphabetisierungsrate (etwa 85 bis 90 Prozent) und ein hohes Bildungsniveau, vor allem in den Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) aus. Somit ist Iran geprägt von einer jungen und gebildeten Bevölkerung, die über bedeutende technische und wissenschaftliche Fähigkeiten verfügt. Allerdings müssen die Herausforderungen einer alternden, kinderarmen Bevölkerung, Abwanderung von Fachkräften, Unterbeschäftigung und Jugendarbeitslosigkeit angegangen werden, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Dazu gehören auch eine Verbesserung der Bildung, die Förderung von Innovationen, die Diversifizierung der Wirtschaft, was wiederum alles mit der Regierungsführung zusammenhängt.
Gegenwärtig aber rangiert Iran nur auf Platz 36 weltweit, was das Bruttoinlandsprodukt (BIP) anbelangt – was lediglich etwas mehr als einem Drittel der Volkswirtschaft der Türkei entspricht.1 Seit der Revolution 1979 ist ein eklatanter wirtschaftlicher Abstieg zu beobachten, den man im historischen Vergleich mit ähnlich entwickelten Ländern nachzeichnen kann: Im letzten noch stabilen Jahr vor der Revolution, nämlich 1977, war Irans Wirtschaft noch um 26 Prozent größer als die der Türkei, um 65 Prozent größer als die Südkoreas und fast 5,5-mal so groß wie die Vietnams. 30 Jahre später, im Jahr 2017, war das nominale BIP der Türkei 2,4-mal und das Südkoreas 7,2-mal größer als das Irans, während Vietnam 70 Prozent der iranischen Wirtschaftskraft erreichte.2 Mittlerweile hat Vietnam Iran überholt. Diese Deklassierung verdeutlicht auch ein Vergleich des BIP zwischen 1971 und 2022: Laut Weltbank belegte Iran 1971 den 17. Rang der größten Volkswirtschaften der Welt, während Saudi-Arabien und die Türkei auf den Plätzen 18 und 21 lagen und Südkorea auf Rang 29. Ein halbes Jahrhundert später haben sich die Platzierungen dieser vier Länder völlig verändert: Heute liegt Südkorea auf Platz 11, die Türkei auf 16 und Saudi-Arabien auf 20. Iran nimmt in der Rangliste der großen Volkswirtschaften Platz 27 ein. Dies schlägt sich auch beim Wirtschaftswachstum nieder. Das iranische BIP wuchs zwischen 1971 und 2022 um 190 Prozent. Im selben Zeitraum legte die Wirtschaft Südkoreas fast um das 24-fache (2370 Prozent), die der Türkei um das 9-fache (872 Prozent) und die Saudi-Arabiens um das 4-fache (411 Prozent) zu.3
Die sozio-ökonomische Lage der Iranerinnen und Iraner kann nicht losgelöst von der politischen Ökonomie und der Wirtschaftspolitik der Islamischen Republik betrachtet werden. Die iranische Wirtschaft wird von zwei wichtigen Faktoren geprägt: der Dominanz von monopolkapitalistischen Strukturen sowie der seit den 1990er Jahren eingeführten, von Kamran Matin zutreffend als »illiberale neoliberale« bezeichneten Wirtschaftspolitik.
Im Folgenden soll diese sozio-ökonomische Krise anhand von Zahlen skizziert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass offizielle Angaben von autoritären Staaten mit großer Vorsicht genossen werden müssen. Im Falle der Islamischen Republik betrifft dies Zahlen über die Wahlbeteiligung bis hin zu wirtschaftlichen Daten, von der Inflation bis zur Arbeitslosigkeit. So zählt etwa das Statistische Zentrum Irans (SCI) alle, die auch nur eine einzige Stunde pro Woche arbeiten, als erwerbstätig,4 was die soziale Realität im Land dramatisch verzerrt. Erschwerend kommt hinzu, so iranische Wissenschaftler, dass Menschen ohne Gehalt, Hausfrauen, Soldaten und Studierende von der offiziellen Arbeitslosenstatistik ausgeklammert werden.5 Auch internationale Organisationen legen ihren Iran-bezogenen Daten jene zugrunde, die ihnen von der Islamischen Republik bereitgestellt werden. Vor diesem Hintergrund liegt der Nutzen der offiziellen Daten hier eher darin, Relationen sowie Tendenzen zu identifizieren. Hinzugezogen werden hier und da auch nicht-offizielle Zahlen, die sich womöglich zu einem realistischeren Bild fügen können.
Die sozio-ökonomische Krise in Iran verschärft sich schon seit Jahren, sie reicht von der Unter- bis hin zur Mittelschicht und ist in vielen Fällen der Motor für soziale, aber auch politische Proteste. Sie ist eingebettet in einen massiven Rückgang des Bruttoinlandsprodukts und eine hohe Inflation. Zwischen 2012 und 2023 sank das iranische BIP um etwa 38 Prozent.6 Während die Inflation bis Mitte 2024 im globalen Durchschnitt bei 5,9 Prozent lag, betrug sie in Iran 37,5 Prozent und stellte damit die achthöchste Inflationsrate weltweit dar.7 Auch wenn diese Rate natürlich Schwankungen unterliegt und beispielsweise im Vergleich zu 45,8 Prozent im Jahr 2023 etwas gesunken ist – wobei andere Quellen diese sogar mit 52,3 Prozent, einem 80-Jahres-Rekordwert, beziffert haben8 –, betrug die Inflation in Iran über die letzten vier Jahrzehnte hinweg laut der Weltbank durchschnittlich mehr als 20 Prozent.9 Einige Ökonomen gehen sogar davon aus, dass die reale Inflationsrate in Iran mehr als doppelt so hoch ist wie die offiziell bekanntgegebenen Zahlen.10
In einigen Sektoren, insbesondere in solchen, die Haushalte mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark betreffen, liegt die Inflationsrate viel höher. So wurde im Frühjahr 2022 berichtet, dass die Transportkosten um bis zu 45 Prozent steigen.11 Die Inflationsrate für Lebensmittel erreichte Ende 2022 offiziellen Berichten zufolge mehr als 70 Prozent,12 während sie im Sommer desselben Jahres bei 86 Prozent lag – ein 10-Jahres-Rekord.13 Bis März 2023 stieg dieser Wert weiter auf über 90 Prozent an,14 für einige Lebensmittel wie Fleisch war Ende 2023 sogar von einer Inflationsrate von 130 Prozent die Rede, so dass dieses für viele Haushalte kaum noch zu bezahlen15 und der Pro-Kopf-Fleischkonsum laut Statistiken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zwischen 2020 und 2023 um ein Drittel zurückgegangen ist. Im April 2024, kurz nach dem iranischen Jahreswechsel 1402/03, stiegen die Lebensmittelpreise angesichts des voranschreitenden Einbrechens der Landeswährung Rial gegenüber dem US-Dollar innerhalb von lediglich zwei Wochen um durchschnittlich 30 Prozent an.16 Auch die Mietpreise sollen im iranischen Jahr 1402, also zwischen März 2023 und März 2024, von einem ohnehin hohen Niveau um weitere 42 Prozent gestiegen sein.17 Die Anhebung des zuvor schon der Inflationsrate hinterherhinkenden Mindestlohns um 35 Prozent im selben Jahr kann die Auswirkungen dieser enormen Preisanstiege auf die Bevölkerung nur unzureichend abfedern.18
Die Wirtschaft der Islamischen Republik ist stark staatszentriert und politisch kontrolliert, mit einem bedeutenden informellen Sektor. Rund 80 Prozent der Wirtschaftstätigkeit entfallen auf den öffentlichen Sektor, zu dem staatliche und halbstaatliche Unternehmen gehören. Inzwischen machen der private und der genossenschaftliche Sektor die übrigen 20 Prozent aus. Neben den vielen staatlichen Unternehmen gibt es halbstaatliche, zu denen auch die mächtigen kommerziell-religiösen Stiftungen gehören, die sogenannten Bonyâds, die bevorzugten Zugang zu lukrativen Regierungsaufträgen genießen. Der Oberste Führer der Islamischen Republik übt direkte oder indirekte Kontrolle über diese Einrichtungen aus. Darüber hinaus schätzte die Nationale Steuerverwaltung den Anteil der Schattenwirtschaft am BIP im Haushaltsjahr 2017/18 auf 37,7 Prozent, während die Steuerhinterziehung mit 3,5 Prozent veranschlagt wurde. Der Abgeordnete Hadi Ghavami äußerte sich Anfang 2020 dahingehend, dass etwa 30 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes auf Schattenwirtschaft oder Schmuggel zurückzuführen seien.19
Wie erwähnt, bedingen die besondere politische Ökonomie der Islamischen Republik und die Wirtschaftspolitik die sozio-ökonomische Krise. Erstere ist ideologisch grundiert, zumal Regimetreue gegenüber dem Rest der Bevölkerung bevorzugt werden, während das Fehlen dringend benötigter Strukturreformen die Wirtschaftskrise zementiert. Die Wirtschaft ihrerseits steht nach wie vor unter der monopolistischen Kontrolle staatlicher und halbstaatlicher Entitäten (manchmal auch als »tiefer Staat« bezeichnet) und ist gleichzeitig von der illiberalen neoliberalen Wirtschaftspolitik geprägt. Die Machtstruktur, die aus institutionalisierten Beziehungen zwischen Staat, Wirtschaft und Militär besteht, wurde treffend als »monopolistisches, religiös-kommerzielles System«20 oder als »kapitalistischer Staat mit einer paramilitärischen Polity und einer theokratischen Herrschaft«21 beschrieben. Sie umfasst damit die Wirtschaftsimperien der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), der Bonyâds und des Obersten Führers Ali Khamenei. Dabei sind die Garden, auch aufgrund ihrer politischen und militärischen Macht, der wichtigste wirtschaftliche Player. Ihr Unternehmenskonglomerat macht schätzungsweise ein bis zwei Drittel des iranischen BIP aus und umfasst massive Anteile in den Bereichen Öl, Gas, Transport, Bau und Kommunikation.22 Der größte IRGC-Konzern, Khatam al-Anbiya, ist zugleich die größte Baufirma des Landes und möglicherweise sogar Irans größtes Unternehmen überhaupt und machte 2010 schätzungsweise 7,5 Prozent der iranischen Wirtschaftsleistung aus.23 Später, zum Zeitpunkt des Atomdeals von 2015, wurde angenommen, dass dieses Unternehmensnetzwerk branchenübergreifend 135 000 Mitarbeiter, 5000 Subunternehmer und mehr als 800 Tochtergesellschaften umfasst, darunter Bau- und Ingenieurwesen, aber auch Energie, einschließlich Kernkraft, sowie Verteidigung.24 Der Wert der Aufträge wurde damals auf fast 50 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa zwölf Prozent des BIP entsprach.25
Auch für die religiös-kommerziellen Stiftungen, die sogenannten Bonyâds, sind genaue sowie aktuelle Zahlen schwer zu ermitteln, zumal sie von Steuerbefreiungen und staatlichen Subventionen profitieren, während ihre Geschäftstätigkeit und Buchhaltung intransparent bleiben. Mitte der 2000er Jahre wurde angenommen, dass dieses Netzwerk halbstaatlicher Stiftungen ein Fünftel des BIP ausmachte,26 was auch die Wirtschaftsmacht des schiitischen Klerus verdeutlicht. Fast ein Jahrzehnt später, 2013, machten nach Schätzungen des ehemaligen stellvertretenden Industrieministers Mohsen Safaei Farahani allein schon etwa 120 Unternehmen innerhalb des Bonyâd-Netzwerks die Hälfte der iranischen Wirtschaftsleistung aus.27
Und schließlich kontrolliert der Oberste Führer Khamenei selbst ein Finanzimperium, darunter ein breites Netzwerk von Bonyâds sowie diverse wichtige Akteure der iranischen Wirtschaft.28 Dieses wurde im Jahr 2013 auf einen Wert von 93 Milliarden US-Dollar geschätzt,29 2019 ging die US-Botschaft in Bagdad sogar von 200 Milliarden US-Dollar aus.30
Neben dieser monopolistisch-oligarchischen Struktur wurde von der Islamischen Republik ein Prozess der »illiberalen Neoliberalisierung«31 eingeleitet. Dieser umfasste neoliberale wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Austerität, (klientelistische) Privatisierungen sowie Deregulierung des Arbeitsmarktes zum Nachteil der Arbeitnehmerschaft.32 Illiberal ist diese Entwicklung, zumal der Neoliberalismus à l’Iranienne in einem autoritären Kontext ohne freies Unternehmertum und freien Wettbewerb vollzogen wird. Die Folge war eine rasante Verschlechterung der sozio-ökonomischen Bedingungen der iranischen Arbeiterschaft. Zur Zeit der Dey-Proteste 2017/18 wurde davon ausgegangen, dass 80 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter unsicheren Kurzzeitverträgen ausgeliefert sind. Dies hat auch weitreichende politische Folgen, denn dieser äußerst kritische Zustand schwächt die Streikfähigkeit der Arbeiterschaft, die infolgedessen noch massiver um ihren Arbeitsplatz bangen muss.
Auch soziale Mobilität in der Islamischen Republik wird durch den Mangel an wirtschaftlicher Freiheit behindert. Der Bericht des Fraser Global Research Institute von 2023 stufte Iran mit 4,53 Punkten auf Platz 160 von 165 Ländern ein. Im Vergleich zur Rangliste 2017/18, als Iran noch 5,72 Punkte erhielt, hat das Land einen kontinuierlichen Rückgang der wirtschaftlichen Freiheit erlebt, der vor allem auf seine weltweite wirtschaftliche Isolation, mangelnde Transparenz und finanzielle Korruption zurückzuführen ist.33 So bestehen die größten Herausforderungen nach wie vor bei sehr restriktiven Vorschriften, einem schwachen Schutz von Minderheitsinvestoren und unterentwickelten Finanzmärkten. Iran belegt somit im Index of Economic Freedom 2023 der Heritage Foundation den 169. Platz von 180. Unter 14 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika liegt Iran auf dem letzten Platz und damit weit unter dem regionalen und auch weltweiten Durchschnitt.34
So leidet die Wirtschaft unter Missmanagement, Vetternwirtschaft, Korruption, Abwanderung von Fachkräften und Kapitalflucht – und das alles auf international hohem Niveau. In Bezug auf Korruption hat sich der iranische Wert im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, der das wahrgenommene Ausmaß der Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0 (»hochgradig korrupt«) bis 100 (»sehr sauber«) misst, kontinuierlich seit 2017 von 30 auf 24 im Jahr 2023 verschlechtert. Damit belegt Iran Platz 149 von 180 Ländern. Unter den drei größten Volkswirtschaften des Nahen und Mittleren Ostens schneidet die Islamische Republik damit mit Abstand am schlechtesten ab.35
Außerdem leidet die iranische Wirtschaft unter einem niedrigen Niveau an Kapitalbildung und Produktivität.36 Ohne Reformen droht das Land in einer Falle des niedrigen Wirtschaftswachstums festzustecken, was die Arbeitslosigkeitskrise nur verschärfen und den Weg für neue Ausbrüche der Unzufriedenheit ebnen könnte.37
Tatsächlich scheint die Situation in Iran entgegen der landläufigen Meinung die vieler Länder des Nahen und Mittleren Ostens widerzuspiegeln. So sind die sozio-ökonomischen Indikatoren, insbesondere für soziale Gruppen wie Frauen, junge Menschen und Hochschulabsolventen, schlechter als in vielen anderen Weltregionen.38 Dabei verschärfen Sanktionen die hier skizzierte hausgemachte Wirtschaftskrise, sind aber nicht der wesentliche Faktor. Die US-Sanktionen haben negative Auswirkungen auf die Staatseinkünfte, insbesondere durch den Zusammenbruch der Ölexporte während der Politik des »maximalen Drucks« der Regierung von Donald Trump, als das Volumen der Ölexporte von 60,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 zurückging.39 Wie in einem bemerkenswerten offenen Brief von 61 iranischen Ökonomen vom Juni 2022 hervorgehoben wurde, liegt die Hauptursache für die Wirtschaftskrise im Versagen der Regierung – was die Tatsache unterstreicht, dass die politische Krise, wie bereits erwähnt, das Gravitationszentrum für alle anderen genannten Krisen darstellt.40
Armut, Ungleichheit, Prekarität
Angesichts der mangelnden Klarheit der internationalen und inländischen Datenquellen (Erstere basieren oft auf Letzteren) kann davon ausgegangen werden, dass eine deutliche Mehrheit der Iranerinnen und Iraner in prekären Verhältnissen lebt, wobei Frauen, Arbeiter und Rentner unverhältnismäßig stark davon betroffen sind. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich die absolute Armutsquote drastisch erhöht: Von 2013 bis 2017 lag sie bei 15 Prozent, verdoppelte sich jedoch zwischen 2017 und 2019.41 Ein vom Ministerium für Genossenschaften, Arbeit und Soziales im Sommer 2021 veröffentlichter Armutsbericht zeigt, dass im Jahr 2019 ein Drittel der Haushalte unterhalb der Armutsgrenze lebte.42 Im Oktober 2022, während des »Frau, Leben, Freiheit«-Aufstands, zitierten iranische Medien einen Arbeitsmarktexperten, demzufolge 65 Millionen der 84 Millionen Einwohner des Landes ein Leben unter der Armutsgrenze führten – ganze 77 Prozent der Bevölkerung.43 Laut verschiedenen iranischen Nachrichtenagenturen lebten im iranischen Jahr 1401 (März 2022 bis März 2023) zumindest mehr als 50 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, das Wirtschaftsblatt Jahân-e San’at bezifferte den Anteil sogar auf 60 Prozent.44 Medienberichte vom April 2024 sprachen von mindestens 40 Prozent,45 wobei allein in den zwei Jahren zuvor ein Anstieg um zehn Prozent zu verzeichnen gewesen sein soll.46 Erst im März 2024 warnte Reza Salehi-Amiri, Minister für Kultur und islamische Führung unter den Präsidenten Hassan Rohani und Masoud Pezeshkian, vor einer »zunehmenden Vergrößerung der Armee der Hungernden«, da ihm zufolge 60 Prozent der Bevölkerung regelmäßig hungrig zu Bett gingen.47
Ein weiteres Gesicht der sozio-ökonomischen Krise ist der prekäre Wohnungsmarkt. Während die Mietkosten in Großstädten wie Teheran, Maschhad und Isfahan in die Höhe geschossen sind, leben etwa 13 Millionen – ganze 15 Prozent der Gesamtbevölkerung – in Slumgebieten, so der Leiter der staatlichen Wohlfahrtsorganisation Behzisti Ali Mohammad Ghaderi Ende Juni 2022. Er betonte, dass »diese schockierende Statistik das Ergebnis eines Ungleichgewichts in der Entwicklung [des Landes] ist«.48 Diese offizielle Zahl liegt nahe an der, die der mittlerweile verstorbene Präsident Ebrahim Raisi während einer der TV-Debatten zur Präsidentschaftswahl 2021 nannte, in der er die Zahl von 16 Millionen Slumbewohnern bemühte und sie – politisch motiviert – auf das schlechte Wirtschaftsmanagement des damaligen Präsidenten Rohani zurückführte.49
Irans Superreiche: Ein Staat im Staate?
Währenddessen öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Die Islamische Republik ist von der selbsternannten Vorkämpferin der wirtschaftlich Ausgebeuteten zu einer regelrechten Oligarchie im theokratischen Gewand geworden. Die Wohlhabenden des Landes, von denen nahezu alle mit dem Regime verbunden sind, haben ihren Reichtum sukzessive vermehren können. Im Januar 2021 enthüllte Zohreh Al-Sadat Lajevardi, eine Abgeordnete aus Teheran, dass »58 Milliarden Dollar des [Vorzugswechselkurses] unter bestimmten Personen aufgeteilt wurden«.50 Im Juni desselben Jahres berichtete das US-Magazin Forbes, dass gegenüber dem Vorjahr »2020 die Zahl der vermögenden Privatpersonen (High-Net-Worth Individuals) in Iran um 21,6 Prozent gestiegen ist und damit weit über dem weltweiten Durchschnittswert von 6,3 Prozent liegt. Das Gesamtvermögen dieser Dollar-Millionäre wuchs mit 24,3 Prozent sogar noch schneller.« Danach verfügen ungefähr 250 000 Iraner über ein Vermögen von mindestens je einer Million Dollar. Somit belegt Iran bei den Dollar-Millionären die Spitzenposition in Westasien – noch vor dem ehemaligen regionalen Spitzenreiter Saudi-Arabien, der 210 000 Dollar-Millionäre zählt – und Rang 14 weltweit. Insgesamt verfügt eine winzige Minderheit von 0,3 Prozent der iranischen Bevölkerung über ein Vermögen von mindestens 250 Milliarden Dollar – was dem 13-fachen der größten Industrie-Investition in der Geschichte Irans und dem Sechsfachen aller Auslandsinvestitionen seit Bestehen der Islamischen Republik entspricht.51 Um diesen Superreichtum von mindestens einer Viertel Billion US-Dollar im Verhältnis zu betrachten, hilft ein Blick auf das BIP. Unter dem Einfluss wiedereingesetzter US-Sanktionen lag es 2020 bei relativ geringen 240 Milliarden Dollar.52
Diese Zahlen sind jedoch wohl nur die Spitze des Eisbergs. Denn hinzu kommen die, Schätzungen zufolge, astronomisch hohe Kapitalflucht, die Schattenwirtschaft mit ihrem mafiösen und intransparenten Finanzsystem sowie die – wie es auf Persisch heißt – Kissenwirtschaft, also das Bunkern von US-Dollars und anderen wertvollen Gütern zu Hause (oft buchstäblich unter Kissen oder in anderen Verstecken aus Angst vor Bankenkrisen, staatlichen Eingriffen oder der weiteren Entwertung des Rials).
So geht das iranische Wirtschaftsmagazin Tejarat News davon aus, dass der Grund für die mangelnde Besteuerung darin liegt, dass die »reiche Klasse« Druck auf die Politik ausübt, die dem nachgibt und damit den nationalen Interessen schadet. Es spricht daher in Bezug auf die Superreichen von einem »Staat im Staate« und bezeichnet die Islamische Republik als deren »Steuerparadies«. Um ein vollständigeres Bild des Superreichtums (Abar-Servat) zu erlangen, bedarf es der Zusammenstellung von Indizien – verlässliche und genaue offizielle Zahlen fehlen. Auf der Grundlage von Angaben der iranischen Zollbehörde schätzte Tejarat News Anfang 2022 das Vermögen der Superreichen auf 2500 Billionen Toman (wobei 1 Toman 10 Rial entsprechen), umgerechnet zehn Milliarden US-Dollar. Iran ähnele der Schweiz, einem Land, dass keinerlei Steuern auf Bankguthaben erhebt. Eine Kapitalertragsteuer soll in Iran zwar eingeführt werden und den Kauf und Verkauf von Waren wie Immobilien, Autos, Devisen, Gold und Aktien umfassen, um somit auf kurzfristigen Profit ausgerichtete Geschäfte (hit and run