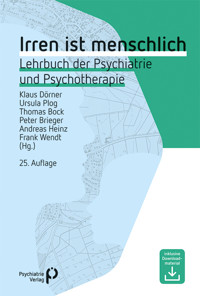
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fachwissen
- Sprache: Deutsch
»Irren ist menschlich« ist seit fast 40 Jahren das sozialpsychiatrische Standardwerk. Es hat mit klaren Positionen die Versorgung psychisch erkrankter Menschen erneuert und geprägt. Die in ihm vertretene Position, dass es für das volle Verständnis von psychischen Beeinträchtigungen und Krankheiten auf die Haltung ankommt, mit der wir uns den Betroffenen und den Phänomenen nähern, hat die nachfolgenden Generationen geprägt. »Ur-Autor« Klaus Dörner versammelt für die 24. Ausgabe ein neues, hochkarätiges Herausgeberteam, das Theorien und Erfahrungen mit dem neuesten Stand der Forschung verknüpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1575
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Herausgeber
Klaus Dörner, em. Prof.Dr. med. Dr. phil., Jahrgang 1933, von 1980 bis 1996 Ärztlicher Leiter der Westfälischen Klinik für Psychiatrie Gütersloh, lehrte Psychiatrie an der Universität Witten-Herdecke. Arbeits- und Interessenschwerpunkte: Psychiatrie, Medizinethik, Geschichte der Moderne.
Ursula Plog, Dr. phil., Dipl.-Psych., Jahrgang 1940. Bis Ende 2000 Leiterin dreier Tageskliniken in Berlin. Vielfältige Lehrtätigkeit, seit 1976 prägende Mitarbeit im Ausschuss Fort- und Weiterbildung der DGSP. Ursula Plog starb am 4. Juli 2002.
Thomas Bock, Prof.Dr., Jahrgang 1954, hat als Psychologischer Psychotherapeut leitende Funktionen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und hat mit Dorothea Buck Psychoseseminare und andere trialogische Projekte initiiert.
Peter Brieger, Prof.Dr. med., Jahrgang 1964, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seine beruflichen Stationen waren: Fulda, Frankfurt/Main, Universität Halle/Wittenberg und SpDi Stadt Halle/Saale (Leiter). Von 2006 bis 2016 Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kempten, seit November 2016 des Isar-Amper-Klinikums München-Ost.
Andreas Heinz, Prof.Dr. med. Dr. phil., Jahrgang 1960, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum der Charité, Berlin; stellvertretender Vorsitzender Aktion Psychisch Kranke e.V.
Frank Wendt, Dr. med., Jahrgang 1966, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit DGPPN-Zertifikat Forensische Psychiatrie, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Forensische Psychiatrie der Charité, ist als Dozent und in eigener Praxis tätig. An »Irren ist menschlich« ist er bereits seit der Bearbeitung von 2002 beteiligt.
Unter Mitarbeit von
Eva-Maria Franck
Uwe Gonther
Susanne Heim
Matthias Heißler
Ulrike Kluge
Susanne Menzel
Christiane Montag
Peter Mrozynski
Sabine Müller
Mechthild Niemann-Mirmehdi
Jens Plag
Sibylle Prins
Ewald Rahn
Michael Rapp
Christian Schanze
Gabriele Schleuning
Andreas Ströhle
Christian Zechert
Klaus Dörner, Ursula Plog, Thomas Bock, Peter Brieger,
Andreas Heinz, Frank Wendt (Hg.)
Irren ist menschlich
Lehrbuch für Psychiatrie und Psychotherapie
25. Auflage 2019
ISBN-Print: 978-3-88414-610-1
ISBN-eBook: 978-3-88414-914-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Psychiatrie Verlag, Köln 1978, 1984, 2002, 2017
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Bei den in diesem Buch angegebenen therapeutischen Verfahren sowie Hinweisen zur medikamentösen Behandlung haben die Autorinnen und Autoren den aktuellen wissenschaftlichen Stand berücksichtigt und sich um äußerste Sorgfalt bemüht. Autorinnen, Autoren und Verlag können aber keine Garantie für die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Inhalte geben. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Bitte lesen Sie dazu den Beipackzettel und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Spezialisten.
Lektorat: Sandra Kieser, Köln
Umschlagkonzeption und -gestaltung: GRAFIKSCHMITZ, Köln, unter Verwendung eines Bildes auf der Grundlage: Topografische Karte 1:25000 – © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), 08.2016, Az.: 2851.3-A/943.
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Einige Kapitel dieses Buchs sind Überarbeitungen der entsprechenden Kapitel dervorigen Auflage. Von dort übernommene Textstellen werden nicht gesondert zitiert.
Die ergänzenden Materialien zum Kapitel 15 Recht und Gerechtigkeit finden Sie unter www.psychiatrie-verlag.de/buecher/detail/book-detail/irren-ist-menschlich.html zum Download.
Für ihre wertvollen Hinweise und Anregungen bedanken wir uns insbesondere bei: Manfred Becker, Stefan Gutwinski, Lieselotte Mahler, Benno Schimmelmann.
Inhalt
Cover
Titel
Die Herausgeber
Unter Mitarbeit von
Impressum
Vorwort
Gebrauchsanweisung
1 Der sich und Anderen helfende Mensch
Thomas Bock, Ulrike Kluge
2 Der sich und Andere behindernde Mensch mit Lernschwierigkeiten
Christian Schanze
3 Der sich und Andere entwickelnde Mensch (Kinder- und Jugendpsychiatrie)
Eva-Maria Franck
4 Der sich und Andere liebende Mensch (Schwierigkeiten mit der Sexualität)
Frank Wendt
5 Der sich und Anderen fremd werdende Mensch (Schizophrenie)
Uwe Gonther
6 Der sich und Andere aufbrechende Mensch (Manie)
Peter Brieger
7 Der sich und Andere niederschlagende Mensch (Depression)
Peter Brieger
8 Der sich und Andere versuchende Mensch (Abhängigkeit)
Andreas Heinz
9 Der sich und Andere bemühende Mensch (neurotisches Handeln, Persönlichkeitsstörungen und Psychosomatik)
Jens Plag, Ewald Rahn, Andreas Ströhle
10 Der für sich und Andere ausweglose Mensch (Krisen und Krisenintervention)
Gabriele Schleuning, Susanne Menzel, Peter Brieger
11 Der für sich und Andere gefahrvolle Mensch
Frank Wendt
12 Der sich und Andere körperkränkende Mensch (körperbedingte Psychosyndrome)
Michael Rapp
13 Der für sich und Andere alternde Mensch
Klaus Dörner
14 Wege der Psychiatrie (Psychiatriegeschichte)
Klaus Dörner
15 Recht und Gerechtigkeit
Peter Mrozynski, Sabine Müller
16 Spielräume (Ökologie der Selbst- und Fremdhilfe)
Susanne Heim, Matthias Heißler, Sibylle Prins, Christian Zechert
17 Umwelttherapeutische Techniken
Mechthild Niemann-Mirmehdi, Christiane Montag
18 Körpertherapeutische Techniken
Andreas Heinz
19 Psychotherapeutische Techniken (der systematische Zugang zur Seele)
Thomas Bock
Anhang
Literatur
Register
Autorinnen und Autoren
Vorwort
Klaus Dörner
»Wir wissen so wenig über das Leben, dass wir nicht wirklich wissen, was die gute und was die schlechte Nachricht ist.«Kurt VONNEGUT (2006, S. 50), aus: »Mann ohne Land«
Vor ungefähr drei Jahren stand irgendwie die Frage im Raum, ob man nicht doch noch mal eine Neubearbeitung von »Irren ist menschlich« wagen solle. Zunächst überraschend, war doch von den beiden Alt-Autoren Ursula Plog 2002 gestorben. Aber nun entsann man sich, dass »Irren ist menschlich« sich nicht zuletzt der 68er-Aufbruchstimmung verdankt hat, was zur Frage zwang, ob die Psychiatrie nicht etwa alle zehn Jahre einen außergewöhnlichen Aufbruchs-Schub benötige. Zudem erinnerten wir uns, dass dieses Lehrbuch seit seiner Erstpublikation 1978 das erste psychiatrische Lehrbuch für berufsübergreifende Teams war, lebte es doch von der achtjährigen Kooperationserfahrung (fast ohne personelle Veränderung) des Hamburger Tagesklinikteams, was sich wohltuend auf die »Irren ist menschlich«-Sprache ausgewirkt hat.
Aus solchen Gründen beschlossen wir eine vierte, grundlegende Umarbeitung des Lehrbuchs, gründeten ein sechsköpfiges Herausgeber- und Redaktionsteam und sammelten 23 Autorinnen und Autoren für die einzelnen Kapitel – alle im erwerbsfähigen Alter, damit Psychiatrie aus der eigenen aktuellen Praxiserfahrung erzählt werden kann. Diese ist ja ebenso wie das Grundkonzept aus der Psychiatriereform-Bewegung ständiger Reflexion und Fortschreibung ausgesetzt. Insofern fanden wir auch Textteile legitim, die z.B. von einem »Alt-Autor« begonnen, aber von einem »Jung-Autor« in dessen Sinne beendet wurden. Und aus demselben Selbstverständnis finden Sie Ursula Plog immer noch unter den Herausgeberinnen, da ihre Textteile ja weiterleben.
Also haben wir uns in diesen drei Jahren möglichst vollständig alle paar Wochen getroffen und – Gott sei Dank – auch wild gestritten. Wenn Sie nun das immer vorläufige amtliche Endergebnis in der Hand haben, vergessen Sie nicht, den beiden Impulsgebern aus dem Psychiatrie Verlag für ihre Mühe zu danken, York Bieger – auch für seine manchmal mutig-schmerzhaften Entscheidungen – sowie Sandra Kieser – für ihre immer wieder kreative Eselsgeduld.
Was soll der Titel »Irren ist menschlich«?
Er soll uns daran erinnern, dass die Psychiatrie an Orten geschieht, wo der Mensch besonders menschlich ist, d.h. wo die Widersprüchlichkeit und Ambivalenz des Menschen oft nicht auflösbar, die Spannung auszuleben ist: so das Banale und Einmalige, Oberfläche und Abgrund, Passivität und Aktivität, das Kranke und Böse, Weinen und Lachen, Leben und Tod, Schmerz und Glück, das Sich-Verstellen und Sich-Wahrmachen, das Sich-Verirren und Sich-Finden. Die Frage »Was ist ein psychisch Kranker?« ist fast so allgemein wie die Frage »Was ist ein Mensch?«. Das weist darauf hin, dass Psychiatrie zwar auch zur Medizin, aber genauso zur philosophischen Anthropologie gehört, psychische Beeinträchtigungen zwar oft auch Krankheiten, aber immer mehr als Krankheit sind. Die Seele ist nicht in Analogie zu einem weiteren Körperorgan zu sehen. Psychiatrie ist daher sowohl Medizin als auch Philosophie, wie schon die Begründer der Psychiatrie um 1800 mit dem Streit zwischen »Psychikern« und »Somatikern« ein fruchtbares Spannungsfeld aufgemacht haben, was sich im weiteren 19. Jahrhundert leider zur Medizin hin vereinseitigt hat, in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten nach 1945 sich wieder zur Philosophie hin (anthropologisch, phänomenologisch, hermeneutisch, existenzphilosophisch) öffnete, um danach wieder medizinisch-technisch zu werden – übrigens durchaus in noch hilfloser Auseinandersetzung mit den Psychiatrieverbrechen der NS-Zeit. Trotz solcher Skrupel bleiben wir bei dem konventionellen Begriff »psychisch Kranke«, wenn auch offen für die Diskussion, welche Begrifflichkeiten künftig den Menschen gerecht werden, mit denen wir hier sprechen (vgl. HEINZ 2014: »Der Begriff der psychischen Krankheit«). Immerhin signalisiert der Titel unsere Absicht, das Spannungsfeld zwischen Medizin und Philosophie endgültig zu öffnen, in der Kapitelsystematik an Begriffen wie »Landschaft«, »Grundhaltung«, »Kränkung« und »Bedeutung« ablesbar. Und noch wichtiger: Dies ist wohl das einzige Lehrbuch, das schon in der Gliederung nie psychische »Krankheiten« abhandelt, sondern immer nur von Menschen spricht, die sich mit bestimmten Erfahrungen ausdrücken und die es zu begleiten gilt. Insofern spielt der Titel natürlich nicht nur auf das Irren der psychisch Kranken an, sondern auch auf das der psychiatrisch Tätigen; denn, wie der Hamburger Psychiater Jan Gross uns immer wieder eingebläut hat, ist auch die wissenschaftliche Erkenntnis zumeist nur der »korrigierte Irrtum«.
Was will das Buch?
Es will darstellen, was in der Psychiatrie passiert oder passieren soll. Psychiatrie besteht aus der Begegnung von psychisch Kranken, Angehörigen und Profis. Nun beginnt jede Begegnung nicht erst mit dem gesprochenen Wort, sondern mit einer Vielzahl von sinnlichen Eindrücken und Gefühlen. All dieses schwer Benennbare wollen wir zur Sprache bringen. Das geschieht auch in den Abschnitten über die »Landschaft« oder die »Grundhaltung«, durchzieht von da aus das ganze Buch. Im Schutz des Unsagbaren stellen wir immer auch das Sagbare dar, und das »Gesagte« ist immer wieder zum »Sagen« zu verflüssigen, damit das Wissen nie selbstherrlich wird oder dogmatisch. So hoffen wir, Psychiatrie einigermaßen vollständig darstellen zu können. Das macht das Lesen manchmal befremdlich. Daher ein Lesetipp aus Georges DEVEREUX »Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften« (1988, S. 14): »Die Lektüre dieses Buches wird sich für diejenigen als leicht erweisen, die, mit einer scheinbar schwierigen Passage konfrontiert, nach innen schauen, um herauszufinden, was ihr Verständnis hemmt – so wie ich selbst beim Schreiben dieses Buches nach innen schauen musste, um herauszufinden, was mein Verständnis hemmte.«
An wen wendet sich das Buch?
Es soll dem lernenden Leser helfen, das Examen in Psychiatrie/Psychotherapie zu bestehen, egal, ob er sich in der Ausbildung zur Krankenpflege, zum Arzt, zur Sozialarbeiterin, Psychologin, zum Ökotrophologen, Ergo- oder Bewegungstherapeuten befindet. Deshalb haben wir die Prüfungsrichtlinien für diese Berufe berücksichtigt, vermitteln einerseits Wissen und Techniken, mehr aber noch Grundhaltungen, weil dieser Praxisbezug sonst oft vernachlässigt ist.
Es soll den psychiatrisch tätigen Leser in all den erwähnten Berufen befähigen, seine Alltagsarbeit nachdenklicher, vollständiger, wahrhaftiger, leichter und mit mehr Freude zu tun. Die Allgemeinverständlichkeit der gewählten Sprache soll helfen, eine berufsübergreifend verständliche Teamsprache zu finden.
Es ist aber genauso für Psychiatrieerfahrene, also für Patienten lesbar, auch für Angehörige und Nachbarn. Denn wir wollen die auch notwendige objektivierende Sprache der Wissenschaft über die Betroffenen einbetten in eine Sprache, in der Betroffene und Professionelle chancengleich miteinander sprechen können (Trialog). So können Betroffene verhindern, dass wissenschaftliche und praktische Profis zu besitzergreifend sind, können vielmehr deren Verantwortlichkeit beanspruchen. Die Verständlichkeit der Sprache soll zudem die Psychiatrie in ihren Möglichkeiten und Gefahren durchsichtig und öffentlich kontrollierbar machen.
Das Buch soll den Leser schließlich auch privat befähigen, mit sich und Anderen besser umzugehen. Denn wir als Beziehungswesen sind letztlich das einzige Mittel, das im psychiatrischen Arbeiten zählt, mehr noch wie wir sind, als was wir tun. So entdecke ich in jeder Begegnung mit einem Anderen an mir eine neue Empfänglichkeit – oder es ist keine Begegnung.
Wie ist dieses Buch entstanden?
Die beiden Alt-Autoren – Psychologin und Psychiater – hatten das Glück, in den 1970er-Jahren acht Jahre lang fast ohne jede personelle Veränderung in dem beruflich gemischten Tagesklinikteam der Psychiatrischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf zu arbeiten, fünf Jahre mit Langzeitpatienten, drei Jahre mit Akutpatienten aller Diagnosen. Unter den vielen dort gemachten Erfahrungen ist eine wohl die wichtigste: Es kann zwischen mir als Profi und einem psychisch Kranken nur dann eine Beziehung geben, wenn es auch zwischen mir und seinen Angehörigen eine Beziehung gibt – am besten in Angehörigengruppen; denn ohne solche eigenen Angehörigengruppen hätte ich aus dem psychisch Kranken ein gar nicht denkmögliches isoliertes Individuum mit nur seiner Sicht der Dinge und damit eine künstliche Abstraktion gemacht – auch eine Form meiner – ethisch wie logisch verbotenen – imperialistischen Aneignung des Anderen. Für diese Erfahrung war die Tagesklinik als ambulant-stationärer »Zwitter« besonders hilfreich. Auch durch die Teilnahme an den grundsätzlich beruflich gemischten Arbeitsgruppen auf DGSP-Tagungen konnten wir Psychiatrie vielseitiger und alltäglicher erfahren, als dies durch Diskussionen mit berufsgleichen Kolleginnen und Kollegen möglich ist. Durch all das entstand allmählich eine Sprache, die sich im Team sowie zwischen psychiatrisch Tätigen, Angehörigen und psychisch Kranken bewährte. Daher auch die Stilmittel dieses Buches: häufige Verwendung der Ich-Form; persönliches Ansprechen der Leser; Gesprächsverläufe sowie Dialogfragmente; Fall- und Situationsbeispiele; Übungen bzw. Denkanstöße für den Leser, z. T. mit einer Aufforderung zum Rollenspiel.
Übrigens verwenden wir, wenn nicht anders vermerkt, den Begriff »Psychiatrie« in der Regel als Kürzel für »Psychiatrie und Psychotherapie« bzw. »Psychiatrie/Psychotherapie; «; denn beides ist nicht trennbar.
Phasen der Umarbeitung
Nun liegt die vierte Fortschreibung oder Umarbeitung unseres Buches vor. Die Lebendigkeit des eigenen Denkens mag sich an der Fähigkeit zur Selbstkritik erweisen: Unsere jeweils neuen Erkenntnisse stellen sich teilweise als neue Schuppen auf unseren Augen heraus, die es abzutragen gilt. Dies geschieht im Licht sowohl neuen Wissens als auch neuer sozialer Bewegungen. Wenn wir hier kurz die Phasen der Umarbeitungen zusammenfassen, dann vielleicht so:
Mit der ersten Fassung von 1978 haben wir versucht, die Psychiatrie in einer Lehre vom Menschen, also anthropologisch, zu begründen, und zwar indem wir den Menschen weniger als isoliertes Individuum, sondern als Beziehungswesen gesehen haben, indem wir die Aufmerksamkeit vor allem nach innen gelenkt haben, auf die bisher praktisch wie wissenschaftlich vernachlässigte Subjektivität des Menschen. Deshalb ist in den Überschriften der Patientenkapitel (2–13) auch stets von »Menschen«, nicht von »Krankheiten« die Rede, auch wenn das unbeholfen, weil ungewohnt, klingt. Wir waren geprägt von der 68er-Bewegung, die u.a. auch das Psychische – leider noch nicht soziosomatisch »geerdet« – wieder der öffentlichen Aufmerksamkeit zugänglich gemacht hatte, sowohl in Form des Psychischen in jedem einzelnen Menschen als auch in Form der bis dahin vergessenen psychisch Kranken, vor allem unter den »elenden und menschenunwürdigen Verhältnissen« in den Anstalten. Daraus ergab sich fast wie von selbst die Aufbruchsstimmung der Psychiatriereform-Bewegung, die unser Buch geradezu erzwungen hat.
Mit der Fassung von 1984 kamen die Denkanstöße der ökologischen Bewegung (im weitesten Sinne des Wortes) hinzu. Da man primär nicht isolierte Individuen – wie in der Körpermedizin –, sondern Beziehungen zwischen Menschen vorfindet, wurde unser Denkansatz sozialanthropologisch. Die Anregungen von Gregory BATESON (»Ökologie des Geistes«, 1981), dass der »Kontext« wichtiger und beeinflussbarer sei als der »Text«, trugen zu unserem Bild der »Landschaft« bei. Dass psychosoziale und körperliche Bedingungen psychischer Erkrankung nicht ideologisch zu polarisieren sind, sondern sich eher komplementär ergänzen, hatte damals auch mit der engeren Beziehung von Geistes- und Naturwissenschaften zu tun, wie sie PRIGOGINE & STENGERS (1981) in »Dialog mit der Natur« formuliert haben. Danach besteht jede Wissenschaft aus harten und weichen Daten, aus Mathematik und Dichtung; denn das in der klassischen Wissenschaft Ausgegrenzte (der Kontext von etwas, die Randbereiche, das Ungeordnete, Nicht-Gerichtete, Unstabile, Schwankende, Störende, Verzweigende, Selbstorganisierte, Unkontrollierbare, Unerwartete, Entropie, Subjektivität, Freiheit, Geschichte, Zufall usw.) gehört genauso zur Wirklichkeit wie das, was man zuvor daraus isoliert und dadurch auf allzu einfache Gesetze getrimmt hat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht dasselbe – weder für das Atom noch für den Stein, für den Menschen, die Familie, die Gesellschaft, den Kosmos. Diese ökologische Wende wurde ab 1980 praktisch.
Die Umarbeitung von 1996 ist nicht nur vom Zusammenbruch des Ost-West-Gegensatzes, sowohl in Deutschland als auch weltweit, geprägt sowie von der Globalisierung ökonomischer Strategien und von der zugehörigen Gegenbewegung: dem Regionalismus, der die Organisation lokaler Hilfesysteme begünstigt hat. Vielmehr wurden für uns noch wirksamer die Kraft und Aufbruchsstimmung der Selbsthilfebewegung, als eine Entfaltung der weltweiten zivilgesellschaftlichen und kommunitaristischen Bewegung (SENNETT 1991). Hatten sich Anfang der 1980er-Jahre die Angehörigen psychisch Kranker organisiert, so schlossen sich Anfang der 1990er-Jahre die psychisch Kranken selbst zum »Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen« zusammen. Bereits 1989 begann mit den Psychoseseminaren die Trialog-Bewegung, die dann 1994 mit dem Weltkongress für Sozialpsychiatrie in Hamburg unter dem Motto »Abschied von Babylon« international wurde. Damit wurde der Umsturz des klassischen hierarchisch-vertikalen Verhältnisses zwischen psychisch Kranken und Profis zugunsten des Aushandelns von Möglichkeiten auf derselben, horizontalen Ebene zunächst denkmöglich, mit noch gar nicht auslotbaren praktischen Chancen – eine angstmachende Provokation für uns Profis. Durchaus in Zusammenhang damit ist zu sehen, dass im Unterschied zur Psychiatrie-Enquete von 1975 die »Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Psychiatriereform« von 1988 erstmals die chronisch Kranken als die medizinisch stets ungeliebten »Letzten«, die »Unheilbaren«, in den Mittelpunkt stellten. Jetzt konnte die Bewegung der Deinstitutionalisierung der angelsächsischen und skandinavischen Länder (GOFFMAN 1972) auch bei uns greifen: Wir rückten die Befriedigung der Grundbedürfnisse der chronisch Kranken nach Wohnen und Arbeiten in der Kommune in den Mittelpunkt. Es ging um die Deinstitutionalisierung nicht nur in der Praxis, sondern zuerst lange Zeit in den Köpfen der psychiatrisch Tätigen. Erst Anfang der 1980er-Jahre hatten wir begonnen, uns aktiv mit der Psychiatrie während des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, die unter dem Motto »Heilen und Vernichten« mit ihrer Heilungsbegeisterung das negative Gegenbild der »Unheilbaren« erst erfunden und sie ihrer Ermordung freigegeben hat. Die Ergebnisse dieserAuseinandersetzung fanden in der Ausgabe von 1996 ebenfalls ihren ersten Niederschlag.
Dass es schon 2002 zur nächsten Umarbeitung kam, lag an der inzwischen gewachsenen Selbstkritik der Psychiatriereform-Bewegung. Wenn auch viele Reformtrends weiterhin integrationsfreundlich waren, nahm doch das Bewusstsein dafür zu, dass die Erfolge sich oft auf die organisations-technische Ebene beschränkten, während die philosophische Ebene der Grundhaltungsänderung »in den Köpfen« eher stagnierte oder weiterhin der früher scheinbar bewährten Verwertungslogik der Industrieepoche folgte – mit ihren Ausgrenzungsstrategien zugunsten des leistungssteigerungsfähigen, isolierten Individuums und der gesund-egoistischen Eigeninteressen besonders der Profiverbände.
Beispiele Trends zum neoliberalen Marktkapitalismus pur; Auseinanderdriften der Schere zwischen Arm und Reich; neue bioethische Akzeptanz von Formen der Mitleidstötung von hoffnungslosen »Unheilbaren«; Reinstitutionalisierung (Umhospitalisierung in Heime); aber auch (psychotherapeutische) Expansion des Psychomarkts analog zum Medizinmarkt sowie neue Formen der Profi-Aneignung der psychisch Kranken auch auf der Haltungsebene – bis hin zur besitzergreifenden Subjekt-Objekt-Beziehung des »Ich verstehe dich«, ohne den Kern der Andersartigkeit und Fremdheit des Anderen und damit seine unverfügbare Würde zu achten.
Insofern musste jetzt auch für »Irren ist menschlich« eine radikalere Grundhaltung und auch eine Repolitisierung der Reformbewegung gewagt werden, wie wir uns das bisher nicht getraut hatten. Hier waren philosophische Anthropologen wie Helmuth Plessner, auch Jürgen Habermas und vor allem Emmanuel Levinas für uns zwei Alt-Autoren hilfreich. Es war zu fragen, ob unser bisheriger Ansatz »einer nochmaligen strengen kritischen Prüfung standhält. Er impliziert nämlich, dass der Andere nicht wirklich ein ganz und gar Fremder, sondern im Grunde doch ein Gleicher sei. Dem aufgehobenen Fremdsein scheint eine verstohlene Angleichung anzuhaften, die dem Anderen nicht sein radikales Anders-Sein lässt« (PLOG 1997, S. 46). Aus solcher Einsicht haben wir dann endlich auch den »Letzten« und Ausgegrenztesten, den psychisch kranken Straftätern, ein eigenes Kapitel gewidmet.
Und da jeder, der es wissen will, auch wissen kann, dass heute praktisch alle sonstigen chronisch kranken Unheilbaren in eigenen Wohnungen mit eigener Arbeit (in »Zuverdienstfirmen« speziell für die »Chronischen«) leben können, haben wir die Betreiber von geschlossenen Heimen und geschlossenen Chroniker-Stationen in Krankenhäusern, die sie festhalten und sich damitder Freiheitsberaubung im Amt schuldig machen, »Geiselnehmer« genannt, freilich ohne dass das in unserer Republik (schon) viele juckt, weil die Unheilbaren offenbar immer noch als die geistig und damit sozial Toten gelten, wie in der Industrieepoche von uns Profis verfügt. Das geschah nur anfangs zu Recht, solange als Fortschritt »Stationär vor ambulant« galt. Was aber lange vorbei ist, wie z.B. Schweden und Norwegen vorgemacht haben.
Insbesondere der Chronischen wegen ist also eine Radikalisierung unserer Grundhaltung existenziell notwendig. Hilfreich kann dabei zum einen die trialogische Selbsthilfebewegung der Psychiatrieerfahrenen und der Angehörigen bzw. Nachbarn sein. Zum anderen muss uns in der ethischen Orientierung neben dem individuellen Gerechtigkeitsmodell das soziale Sorge-Modell (care ethics) wichtiger werden. Schließlich hat uns Alt-Autoren der erwähnte Rabbilehrer und Philosoph LEVINAS (1992) beeinflusst, für den – auf dem Hintergrund seiner persönlichen Holocaust-Erfahrungen noch radikaler – meine Freiheit in meiner Verantwortung für die Freiheit des Anderen gründet und theoretisches Erkennen sich vom praktischen Handeln des Menschen herleitet.
Und nun sind wir endlich bei der vorliegenden Umarbeitung unserer »narrativen« Psychiatrie (analog zur »narrativen Ethik«) angekommen, die uns vor die ziemlich unmögliche Aufgabe stellt, jetzt so viele Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einzuarbeiten, wie vielleicht seit Begründung der Psychiatrie nicht mehr. Der Psychiatrie Verlag hat eine eigene Buchreihe »Anthropologische Psychiatrie« gestartet. Die humorigen Engländer haben dafür gar den Begriff »Postpsychiatrie« erfunden, womit sie z.B. aufs »Hometreatment« Bezug nehmen, wo nicht nur chronisch, sondern auch akut Kranke ambulant betreut werden, inzwischen u.a. von Matthias HEISSLER (2012) eingedeutscht (siehe auch Kapitel 16, S. 806 ff.), während Martin ZINKLER (2012) anmerkt, Deutschland stehe immer noch beim vorsintflutlichen Motto »Stationär vor ambulant«. Immerhin hat die Protestbewegung gegen die falsche Krankenhausfinanzierung erreicht, dass Hometreatment auch in Deutschland Pflichtleistung wird. Wir begnügen uns mit der etwas bescheideneren Idee, dass wir seit 1980 einen Epochenumbruch durchleben – von der 150-jährigen Industrieepoche zu einer natürlich noch nicht benennbaren, aber jedenfalls anderen Epoche. Auch das hat seinen Bezug: Während das psychiatrische Versorgungssystem mit seiner Institutionslastigkeit ein lupenreines Produkt der Industrieepoche (mit Arbeitsteilung, Spezialisierung, Beschleunigung und Fabrikanalogie) ist, mit der dreifachen Fortschrittsfeier der Professionalisierung, Institutionalisierung und Medizinisierung des Helfers, nehmen wir seit 1980 auch deren Schattenseiten (»Heilen und Vernichten«) wahr und sehen uns aufgefordert, ohne deren Vorteile zu opfern, nun auch wieder ihre Gegentrends (Bürger- und Nachbarschaftshilfe, Sozialraumorientierung und philosophische Reflexion) stark zu machen.
Daher spricht man heute auch von einem »Fortschrittsschock«: Eben noch erwartete man, vom Fortschritt begeistert, dass der Sieg über immer mehr Krankheiten uns am Ende eine leidensfreie Gesellschaft bescheren würde, da müssen wir heute feststellen, dass wir in Wirklichkeit umgekehrt – schon dank des demografischen Wandels – in eine Gesellschaft mit dem größten Hilfebedarf der Menschheitsgeschichte hineinwachsen. Zudem lehnen bis zu 90 Prozent von uns heute das Pflegeheim ab, wollen lieber in der eigenen Wohnung leben und sterben. Dazu brauchen sie zwar auch die Profihelfer, jedoch mehr die Bürgerhelfer als Nachbarn; denn – wie wir schon von den 435 Gütersloher »Unheilbaren«, die alle 1996 in eigener Wohnung (mit Arbeit) lebten, gelernt haben –, es »können nur Bürger (im jahrelangen Alltag) andere Bürger integrieren«, was übrigens exakt der Definition von »Inklusion im Sozialraum« der UN-Behindertenrechtskonvention (seit 2009 geltendes Recht) entspricht. Und damit das Wirklichkeit werden kann, beweisen alle Messinstrumente, dass die Bürger in der Breite seit 1980 – als bisher größtes Wunder der neuen Epoche – gegenüber der Industrieepoche ihr Menschenbild geändert haben: Sie lieben zwar weiterhin ihr Selbstbestimmungsbedürfnis, aber jetzt nur noch im Spannungsfeld mit ihrem anderen Grundbedürfnis, als Beziehungswesen auch »ihre Tagesdosis an Bedeutung für Andere« zu bekommen oder »helfensbedürftig« zu sein (DÖRNER 2012).
Hinzu kommt eine noch gar nicht absehbare Fülle weiterer epochaler innerer und äußerer Veränderungen: Ganz abgesehen vom Gewicht der Dienstleistungsepoche für den Arbeitsmarkt ist so z.B. die »ökologische Wende« seit 1980 praktisch geworden mit ihrem Ersatz der Reparatur von Defekten durch Pflege von Ressourcen. So werden die neurobiologischen Techniken philosophisch-phänomenologisch in eine Sinngeschichte eingebunden (»Das Gehirn – ein Beziehungsorgan«, FUCHS 2008; siehe auch »Sinnsuche und Genesung«, BOCK u.a. 2014). So gibt es in der Psychotherapie – unabhängig von ihrer fatalen Wachstumskrise der Privilegierung von relativ gesunden psychisch Kranken – eine philosophische Viktor-Frankl-Renaissance, der nach seiner Rückkehr von Auschwitz seine Wiener Medizinstudenten lehrte, dass um Anderer willen zu leiden besser sei als das Leiden an sich selbst. Und schließlich sei noch erwähnt, dass die erwähnte Sozialraumorientierung auch bedeutet, dass ich als Profi- und Bürgerhelfer – im Bürger-Profi-Mix – primär für den Hilfebedarf eines kleinen Territoriums (Viertel, Quartieroder Dorfgemeinschaft) Verantwortung übernehme; endlos spezialisierte Zielgruppen gibt es nur noch sekundär, ein Regime, in das sich auch die psychisch Kranken und die Psychiatrie mit dem Gewinn vieler wechselseitiger Synergien einzuordnen haben – vor allem wenn über ein Regionales Budget finanziert, weshalb sich selbst die geschichtsbewusste Lektüre von Elinor OSTROM (1999) »Die Verfassung der Allmende« lohnt.
Fazit: Wie bisher wollen wir auch mit dieser vierten Fortschreibung dem Leser und der Leserin auf ihrer Suche nach der Wahrheit der Psychiatrie ein Wegbegleiter sein, wobei es immer wieder neu gilt, die heute möglichen Denkhorizonte zu überschreiten.
Das scheint dieses Mal besonders leicht zu sein; denn seit 2009 ist das Geschenk der UN-Behindertenrechtskonvention auch bei uns Gesetz – mit ihren drei epochalen Inklusions-Fernzielen: eine Schule für alle, ein Wohnviertel für alle und ein Arbeitsmarkt für alle. Und da es sich dabei um Menschenrechte handelt, gibt es natürlich auch keine Alternative dazu, was u.a. heißt, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung (psychischer Erkrankung, Demenz) von uns für die Inklusion zu engagieren sind. Das ist ebenso leicht wie atemberaubend schwer. Unser Beitrag dazu kann daher nur bescheiden sein, nämlich den Leser dazu zu ermutigen, in jeder seiner Alltagssituationen wenigstens seinen nächsten Schritt in die richtige Richtung zu lenken, also in Richtung Inklusion (im obigen Sinn). Somit lautet unser Ziel nur: »Auf dem Weg zur Inklusionspsychiatrie« – schon weil wir immer schon wussten, dass bestenfalls der Weg das Ziel sein kann.
Unsere theoretischen Gewährsleute sind: E. Goffman, Deinstitutionalisierung; M. Merleau-Ponty, Wahrnehmungsphilosophie; G. Devereux, Psychoanalyse und Ethnologie; C. R. Rogers undV. Frankl, Psychotherapie; J. Habermas, M. Horkheimer und T. W. Adorno, kritische Theorie; H. Plessner und T. Bek., Anthropologie; E. Levinas und H. Jonas, Ethik; M. Bleuler, Schizophrenie; A. Pirella und F. Basaglia, italienische Psychiatrie; M. Buber, Philosophie der Begegnung; N. Pörksen und M. Bauer, Gemeindepsychiatrie; A. Finzen, Psychiatrie als Aushandeln; G. Bateson, Ökologie; L. Ciompi, Sozialpsychiatrie und Vulnerabilitätskonzept; I. Prigogine, Wissenschaftstheorie; U. Bronfenbrenner und R. Kegan, ökologische Entwicklungspsychologie; A. Etzioni und R. Sennett, Kommunitarismus; W. R. Wendt und B. Müller, Soziale Arbeit; R. Bauer, Beziehungspflege. (Alle Titel siehe Literatur am Ende des Buches.)
Gebrauchsanweisung
Klaus Dörner
»Ich bin du, wenn ich ich bin.«Paul Celan, aus dem Gedicht »Lob der Ferne«, 1948
»Das Geschöpf, das gegen seine Umgebung siegt, zerstört sich selbst.«Gregory BATESON 1981, S.632
Beispiel Geschichte der Frau aus Verl: »Also wissen Sie, wenn es mir schlecht geht, traue ich mich meist nicht, mit jemandem darüber zu sprechen.« – »Warum nicht?« – »Aus Angst, der Andere könnte mir helfen wollen!« – »Was wünschen Sie sich denn stattdessen?« – »Ich wünsche mir einen Anderen, von dem ich sicher sein kann, dass er mir unendlich lange zuhört, damit ich so lange reden kann, bis ich selbst wieder weiß, was los ist und was ich zu tun habe.«
Philosophie und Aufbau des Buches
Da Menschen zunächst immer in Beziehungen leben, noch bevor sie handeln, ist Psychiatrie die Begegnung nicht von zwei, sondern von mindestens drei Menschen: dem psychisch Kranken, dem Angehörigen (Nachbarn) und dem psychiatrisch Tätigen. Wo einer von ihnen real fehlt, muss er hinzufantasiert werden, damit der Trialog zustande kommt.
Ein psychisch Kranker ist ein Mensch, der bei der Lösung einer altersgemäßen Lebensaufgabe in eine Krise und Sackgasse geraten ist, weil seine Verletzbarkeit und damit sein Schutzbedürfnis und sein Bedürfnis, Nichterklärbares zu erklären, für ihn zu groß und zu schmerzhaft geworden sind (BLEULER 1987). Das Ergebnis nennen wir Krankheit, Kränkung, Störung, Leiden, Abweichung, Schicksal; was es genau ist, wissen wir nicht. Weil so etwas jedem von uns jeden Tag widerfahren kann oder, zumindest in Ansätzen, schon passiert ist, ist uns unser Schutzbedürfnis als Selbsthilfeweg innerlich zugänglich, wozu (paradox) die Achtung der Andersheit des Anderen gehört.
Ein Angehöriger ist ein Mensch, der der Störung des psychisch Kranken ausgesetzt, in sie verstrickt ist, sich mit – grundsätzlich unsinnigen – Schuldgefühlen herumschlägt, nicht unterscheiden kann, ob der psychisch Kranke böse oder krank (»bad or mad«) ist, und darunter mindestens so sehr leidet wie der psychisch Kranke, zumal er (gerade auch gegenüber den Vorwürfen Dritter) keinen Schutz durch Symptombildung hat. Er bedarf dringend des kritischen Beistands anderer Angehöriger, um seinen eigenen Standort wiederzufinden. Nur so kann er hilfreich für den psychisch Kranken sein. Das gilt auch für Freunde, Nachbarn; denn: Nachbarschaft ist die Lebendigkeit des Sozialraums.
Ein psychiatrisch Tätiger ist ein Mensch, der dafür bezahlt wird, so auf der Beziehungsebene zu sein und auf der Handlungsebene sich um die Grundbedürfnisse von psychisch Kranken zu sorgen und ihre Störung so zu stören, dass psychisch Kranke ihren Sinn erfassen können und die Störung dadurch überflüssig werden kann. Wir erinnern an die Frau aus Verl vom Anfang dieses Kapitels. Entscheidend ist zunächst die Beziehung, nicht das Handeln. Sie findet – wie alle Beziehungen – immer auf zwei Ebenen statt. Zunächst bin ich dem Anderen gegenüber Objekt, er das Subjekt: Ich setze mich ihm aus, bin empfänglich für ihn. Sein nacktes, ungeschütztes, leidendes Antlitz spricht, noch bevor Worte gefallen sind: »Du sollst mich nicht töten, du sollst mich dir nicht aneignen, mich dir nicht angleichen« (LEVINAS 1992). Ich spüre die Versuchung, aber indem ich mich dem Anderen öffne, auch mich riskiere, antworte ich auf seine Forderung mit »Ver-antwortung«, entsteht Nähe zum Anderen im Schutz des unendlichen Abstands zwischen mir und ihm. Hier nehmen Abstand und Nähe gleichsinnig zu. Das von oben nach unten wohlmeinende, aber selbstgefällige, angleichende, nicht selbstlose »Ich-verstehe-dich« ist hier ausgeschlossen.
Beispiel »Ich habe mal gezählt: In den letzten drei Jahren hatte ich wegen meiner psychischen Erkrankung Kontakte mit zehn Ärzten und Therapeuten. Alle haben immer wieder betont, wie gut sie mich verstehen. Nur einer hat das nie gesagt: Er ist der Einzige, mit dem eine wirkliche Beziehung zustande gekommen ist.«
Fredi SAAL (1992), körperbehindert, hat sein Leben lang gegen die wütenden Versuche der Nichtbehinderten gekämpft, stets irgendetwas an ihm ändern zu wollen, bevor sie ihn in seinem Sosein anerkannt haben. Daher gab er seiner Autobiografie den Titel: »Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?«. Die Beziehung zwischen dem Anderen und mir ist zunächst also asymmetrisch, der Andere erwählt mich zur Verantwortung. Zuspitzung der Asymmetrie dieser Beziehung durch LEVINAS (1992): »Ich kann auch Gott auf keine andere Weise als nur im anderen Menschen begegnen. Sekundär kann natürlich daraus auch eine wechselseitige Beziehung, eine Ich-Du-Beziehung (Buber), werden.«
In Anerkennung dieses atemberaubenden Andersseins und der Würde des Anderen möchten wir daran erinnern, dass das Wort »verstehen« ursprünglich aus der Handwerkersprache kommt und reflexiv gebraucht wurde: »Ich verstehe mich auf etwas … auf dich.« Wenn man nun noch bedenkt, dass das Wort »Begegnung« in allen europäischen Sprachen mit »kontra« und »Gegnerschaft« zu tun hat, also der Satz »In der Begegnung begegnen sich Gegner« seine Berechtigung hat, ergibt sich als hilfreiche Denkfigur für die Grundhaltung der Beziehung zwischen mir als psychiatrisch Tätigem und dem psychisch Kranken – mit Worten und ohne Worte: Wenn ich meine neue, noch unbekannte Begegnung mit dir zwar nicht als feindlich, wohl aber erst mal als gegnerschaftlich auffasse, bringe ich damit meine Achtung vor deiner Fremdheit und Würde zum Ausdruck. Dies ermöglicht uns zugleich, uns gegenseitig gegensätzliche Interessen zu gestatten, wie das unter Fremden üblich ist. Also kein Dankbarkeitszwang für Helferwillen. Vor allem anerkennen wir, dass wir kein gemeinsames Maß haben, nicht Gleiche, sondern »Unver-gleichliche« sind. Dessen müssen beide sich sicher sein. Wenn ich jetzt, angesichts dieses Abstands zwischen uns, mich an die Aufgabe des Verstehens deines Problems mache, kann es gut sein, dass ich dich nicht verstehe. Vielleicht gelingt es mir aber, mich selbst im Hinblick auf dein Problem besser zu verstehen. Das muss dir zwar nichts nutzen, da es ja meine Sicht der Dinge ist, aber vielleicht macht dir meine Suchhaltung, mich einer neuen Sicht zu öffnen, Mut, vielleicht steckt sie dich an, sodass du dich selbst deiner dir verloren gegangenen Suchhaltung wieder öffnest und selbst zu einer neuen Sicht deines Problems kommst. LEVINAS: »Die Freiheit des Anderen kann niemals in der meinen ihren Anfang haben« (1992, S. 40). Oder: »Sich finden, indem man sich verliert« (S. 42). Ich als Profi habe gar nicht die Aufgabe, den Anderen zu verstehen, sondern ich habe mich so zu verhalten, dass der Andere sich selbst (wieder) versteht.
Innerhalb dieser Grundhaltung macht natürlich jedes Subjekt den Anderen auch zum Objekt, macht ihn oder sie zum Gegenstand von Beobachtung, Fremdwahrnehmung, beschreibt, erforscht, diagnostiziert und therapiert ihn oder sie, bildet Theorien über die Person. Das ist die andere Beziehungsebene, die Subjekt-Objekt-Ebene. Der Schutz meiner Grundhaltung ist aber bitter nötig, damit die Objektivierung des Anderen nicht eigengesetzlich wird, den Anderen nicht angleicht, aneignet, vergewaltigt, vernichtet. Um das erlebnisfähig zu machen, handelt das erste Kapitel des Buches sehr bewusst von den psychiatrisch Tätigen (Kap. 1, ab S. 31), zeigt den Weg des Menschen mit »sozialem Beruf« ins psychiatrische Arbeiten, wobei das Professionelle daran nicht im Helfen besteht; denn dieses ist allgemein menschlich. Das Kapitel ist genauso gegliedert wie die Patientenkapitel. Das soll zeigen, wie viel Gemeinsames der »Weg in die Psychiatrie« für werdende Patienten und für werdende psychiatrisch Tätige hat. Es zeigt sich ferner, dass sich die Begegnungen von psychiatrisch Tätigen mit Kollegen, mit einem Patient, einer Patientin oder mit Angehörigen im Grundsatz nicht unterscheiden. Weil in diesem Kapitel die Anwesenheit des Anderen so viel Gewicht hat, haben wir hier auch die transkulturellen Begegnungen mit Migranten beschrieben, um ihrer Würde gerecht zu werden.
Kapitel 2 bis 13 sind die Patientenkapitel, beschreiben die verschiedenen Typen von Situationen, in denen Menschen sich psychiatrierelevant ausdrücken. »Krank« ist von uns nur konventionell gemeint, etwa orientiert an der sozialen Wirklichkeit des Patienten, der »krankgeschrieben« und dessen Therapie von der »Krankenkasse« getragen wird. Im Übrigen sprechen wir lieber von »Kränkung«. Das kann man körperlich, seelisch oder sozial auffassen. Vielseitig genug ist vielleicht auch das Wort »Störung«. Man kann sagen: Jemand hat eine Störung, wird gestört, stört sich selbst, stört Andere, kann eine »Betriebsstörung« sein; auch Beziehungen und Entwicklungen können gestört sein.
Zur Krankheitssystematik (Nosologie) haben wir in diesem Lehrbuch eine biografische Ordnung gewählt: Wer die Patientenkapitel der Reihe nach durchliest, verfolgt damit den Lebensweg eines Menschen von der Geburt bis zum Tod, wobei er ihn (und sich selbst) durch die verschiedenen aufeinander folgenden Altersstufen mit ihren altersspezifischen Lebensaufgaben und Krisen und mit seinen unterschiedlichen, gelingenden oder scheiternden Problemlösungen begleitet. Logischerweise wird dadurch der »geistig sich und Andere behindernde Mensch« zum ersten Patientenkapitel – »mit Lernschwierigkeiten«, wie wir heute etwa sagen. Dann geht es durch die Kindheit und Jugend zu den Problemen der Liebe, der Ablösung von der Familie, dem Autoritätskonflikt, dem Erwachsenwerden und den vielfältigen Partner- und Arbeitsproblemen.
Es folgen die eher lebenszeitunabhängigen Situationen des Umgangs mit Krisen und mit dem Strafrecht (Kapitel 10 und 11), bevor es in Kapitel 12 und 13 an die Lebensaufgaben des Trennens, Verlierens, Abschiednehmens und Sterbens geht. Im Übrigen haben wir in den jeweiligen Kapiteln gegenüber den akuten Krisen den chronisch Kranken und der besonderen Bedeutung ihrer Begleitung durch Nachbarn und Bürgerhelfer im Sozialraum mehr Gewicht gegeben, womit wir der »Handwerksregel« folgen, dass für das Helfen die Techniken der Profis und die Zeit der Bürger gleich wichtig sind.
Eine andere Einteilung der Störungen betrifft die unterschiedlichen Bedingungen oder Kontexte. Statt von Ursachen (»Ätiologie«) sprechen wir gemäß der größeren Bescheidenheit der heutigen Wissenschaft lieber von Bedingungen, die die Entstehung eines Leidens fördern (Pathogenese). Wir unterscheiden körperliche und psychosoziale Bedingungen. In früheren Zeiten wurde oft von einer »endogenen«, d.h. von innen heraus entstehenden psychischen Störung gesprochen. Das Konzept haben wir gestrichen, weil es wissenschaftlich nicht haltbar ist. Dem folgt inzwischen auch die internationale Diagnosenklassifikation ICD-10. An die Stelle dieser in der Vergangenheit oft fatalen Leerformel hat häufiger der Mut zu treten, Nichtwissen einzugestehen. Wenn wir uns – bescheidener – von der pathogenetisch-ätiologischen Kausalkette auf die phänomenologische Lebensebene zurückziehen und psychische Störungen grundsätzlich als allgemein menschliche Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Problemsituationen ansehen, dann besteht Kränkbarkeit nach drei Richtungen: als Kränkung des Körpers, der Beziehungen und des Selbst. Diese drei Typen der Kränkbarkeit können wir aus dem Erleben der Patienten und Patientinnen und aus unserem Leben ableiten. Alle drei Richtungen sind freilich bei jedem einzelnen Patienten beteiligt, nur unterschiedlich stark.
Und noch ein Schema, aber bitte nur als Verständniskrücke gemeint: Erlebnismäßig könnte der beziehungskranke Mensch sagen: »Ich bin zwar ich selbst (habe mein Selbst), aber ich habe meine Beziehung zu mir und Anderen eingeengt.« Der depressive Mensch könnte ausdrücken: »Ich bin nicht ich selbst, sondern unter mir.« Der manische: »Ich bin nicht ich selbst, sondern über mir.« Der schizophrene Mensch: »Ich bin nicht ich selbst, sondern neben mir oder schräg zu mir.« Der persönlichkeitsgestörte Mensch: »Ich bin nicht ich selbst, sondern nur das ewig identitätsgefangene Ich, habe kein reflexives Mich und damit keine Anderen.« Der körperkranke Mensch: »Ich ringe um den Erhalt der körperlichen Basis meines gefährdeten Selbst.«
Die Kapitel 14 bis 16 sind Beiträge zur Psychiatrie als Hilfesystem und Wissenschaft. Kapitel 14 schildert die Entwicklung der Psychiatrie, sozusagen ihre Biografie als Theorie, Praxis und Philosophie. Die NS-Psychiatrie wird in der Kontinuität der Gesamtgeschichte geschildert, um für heutige Gefährdungen daraus lernen zu können; vielleicht könnte sie als letzte Radikalisierung der Industrieepoche historisiert werden. Kapitel 15 beleuchtet – unter dem Leitgedanken »Recht und Gerechtigkeit« – das Verhältnis der beiden Normenwächter Justiz und Psychiatrie. Der praktischen Psychiatrie liegt heute das territoriale Konzept des Sozialraums zugrunde. Wie dieses umzusetzen und weiterzuentwickeln ist, stellt Kapitel 16 dar.
Während es in den Kapiteln 2 bis 13 aus der Sicht der psychiatrisch Tätigen um die jeweils angemessene Grundhaltung und die jeweils tragfähige Alltagsbeziehung geht, werden in den Kapiteln 17 bis 19 die professionellen Techniken dargestellt, die die verschiedenen Berufsangehörigen des psychiatrischen Teams ambulant wie stationär einbringen und wofür sie Anspruch auf Bezahlung haben. Umwelttherapie ist dabei als Kapitel 17 zugleich die Basis für die anderen Techniken. Und zwar in dem Maße, wie die Pflege- und Sozialberufe das therapeutische Milieu gestalten, durch ihre Ausbildung spezialisiert für die Wahrnehmung alltäglicher, besonders hautnaher Grundbedürfnisse und – als Spezialisten fürs Allgemeine – für die Vermittlung privater und öffentlicher Bereiche und damit für den Anteil der sozialen Umwelt, der im Lebenslauf zunehmend zum Bestand auch der Person jedes Einzelnen wird. Auf dieser notwendigen Basis können die körpertherapeutischen und psychotherapeutischen Techniken als Kapitel 18 und 19 aufbauen; denn Grundhaltung und Technik sind komplementär und gleichermaßen bedeutsam!
Hier möchten wir Sie noch mehr als sonst ermutigen, unsere Wortwahl zu hinterfragen und nach besseren Worten zu suchen: Wenn wir nämlich »psychiatrisch Tätige« und »psychisch Kranke« als »Patientinnen und Patienten« gewohnheitsmäßig gegeneinandersetzen, gibt es gute Gründe dafür, diese Beziehung umzudrehen: Tätige sind eigentlich eher die psychisch Kranken und die Angehörigen, während wir Professionellen die »patientes«, also die Geduldigen, zu sein haben, eher passiv für den jeweils Anderen empfänglich. Um noch einmal an die Frau aus Verl zu erinnern, haben wir Profis Geduld von uns und gerade nicht vom Anderen zu verlangen. Über diese Konsequenz der Trialog-Bewegung ist nachzudenken, zumal mit den neuen »Genesungshelfern« (den EX-INlern) und natürlich den Bürgerhelfern (den Nachbarn) das Spektrum der neuen Hilfekultur noch fließender geworden ist.
Gliederung jedes einzelnen Patientenkapitels
Jedes Patientenkapitel beginnt in der Regel mit einem Bild der »Landschaft«, in der die jeweilige Störung sich abspielt. Hier versuchen wir, für uns und die Leserinnen und Leser den komplexen, schwer in Worte zu fassenden Sinn auszumalen, den die jeweilige Störung als riskante Problemlösungsmethode hat – im Rahmen einer Biografie, im Rahmen der familiären, kommunalen und gesellschaftlichen Bedingungen und im Zusammenhang mit der inneren und äußeren Natur des Menschen. Diese Versuche der Landschaftsgestaltung in Sprachbildern wollen auch das Unsagbare, das Elementare, Atmosphärische und das wissenschaftlich Unbekannte ausdrücken. Sie dienen dem Erahnen des Bedeutungshorizonts und des Andersseins des Anderen. Sie sind somit ein Kernstück des philosophischen Beitrags zur Psychiatrie. Sie sind unvollkommen, da wir darin wenig geübt sind. Dennoch kann man vielleicht sagen, dass »Irren ist menschlich« in der vorliegenden Form auch ein Beitrag der Psychiatrie zur »Integrierten Medizin« ist, wie wir sie Thure von UEXKÜLL und Wolfgang WESIACK (1988) verdanken – wenn man nur an die große Idee der »Passung von Innen- und Außenwelt« denkt.
Der darauf folgende Abschnitt hingegen benennt, was zu beobachten sein muss, damit einem Menschen die Diagnose des jeweiligen Kapitels einigermaßen passt. Es ist der Abschnitt der Auffälligkeiten, der Fremdwahrnehmung, der Subjekt-Objekt-Ebene, der beschreibenden Psychopathologie der klassischen Lehrbücher, der Symptomsammlung, der Syndrom- und Diagnose-Konstruktion. Erst mit dem nächsten Abschnitt sind wir auf der Ebene der Beziehung zwischen mir und dem Anderen, womit in der Alltagspraxis jede Begegnung beginnt. In Begriffen der Hirnhemisphären-Forschung: Wir beginnen rechtshemisphärisch mit der ganzheitlich-bildhaft-analogen Wahrnehmung (der Wald) und lassen mit der Psychopathologie linkshemisphärisch die beobachtend-benennend-digitale Wahrnehmung (die Bäume) folgen, um beides dann der Beziehung zwischen mir und dem Anderen dienstbar zu machen. Etwas holprig lässt sich das als Begegnungs-Psychopathologie benennen. Da es Ziel unserer Beziehung und unseres Handelns ist, dass der Patient über Selbstwahrnehmung und Selbstdiagnose zur Selbsttherapie kommt, beginnt Therapie zugleich mit der Diagnose. Es ist ermutigend, dass Hartmut ROSA (2016) in seinem Werk »Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung« nicht nur mit demselben anthropologischen Beziehungsbegriff arbeitet, sondern auch dasselbe basale Landschaftsbild wie wir benutzt – scheint also was dran zu sein. Heißler hat das im Kapitel »Spielräume« (ab S. 805) aufgegriffen.
Weil Angst grundsätzlich Angst vor Undurchschaubarem, Unwägbarem ist, wozu auch das Fremde gehört, das Fremde in uns, der fremde Andere und das Fremde um mich herum, ist Kernstück des Abschnitts zur Beziehung der Umgang mit der Angst (die Angst zulassen, auf sie hören, sie teilen, sie nutzen) in der Begegnung zwischen mir und dem Anderen, das Mich-Öffnen, das Mich-Aussetzen dem Anderen und damit die schmerzhafte Ersetzung des nicht möglichen Verstehens durch eine hilfreiche Suchhaltung bei mir selbst. Wenn ich dem Anderen helfen will, muss ich mit der Suche bei mir beginnen, um die Voraussetzungen zu schaffen. Es ist unmöglich, dem Anderen gerecht zu werden, und es ist nicht möglich (und auch nicht erlaubt), einen anderen Menschen zu ändern, während es durchaus möglich ist, mich zu ändern – und zwar so, dass gerade dadurch auch der Andere sich ändern kann. Der körpermedizinische Begriff »Therapie« ist also für die Psychiatrie nicht recht geeignet. Für all das, was wir Grundhaltung nennen, hat sich für uns die Unterscheidung dreier psychotherapeutischer Stile bewährt, die sich am ehesten nacheinander der gesprächstherapeutischen, der verhaltenstherapeutischen und der psychoanalytischen Haltung verdanken:
Selbstwahrnehmung: Es ist immer wieder neu, sich dem Anderen, seinem Leiden, seinem ungeschützten Antlitz zu öffnen, bis ich von ihm berührt bin. Ich lasse ihn mich berühren, auch angreifen, ohne eine besitzergreifende Verbindung mit ihm einzugehen – so weit, dass er zugleich mit dieser Näherung meiner Anerkennung des unendlichen Abstands zwischen uns, seiner völligen Fremdheit und damit seiner Existenz sicher sein kann. Ich achte ihn nicht einfach als Mitmenschen, der und weil er mit mir gemeinsame Züge hat. Das ist bereits vereinnahmend. (Insofern enthält noch die Formel »Irren ist menschlich« die Gefahr von Missverständnissen.) Es ist eine Aufgabe, die eine ständige Selbst-Prüfung erfordert; immer wenn ich die Suchhaltung bei mir praktiziere, mache ich mich zum Modell, ihn mit dieser Suchhaltung anzustecken, sich aus seiner krankheitsbedingten Isolation zu befreien und in Beziehung mit Anderen (z.B. Angehörigen) seine Problemlösung auch wieder aus sich selbst zu suchen.
Vollständigkeit der Wahrnehmung: Dies bezieht auch die äußere Seite der Wahrnehmung ein, die Ausschöpfung des jeweiligen Bedeutungshorizonts, z.B. dass ein psychisch Kranker Opfer und Täter seines Krankseins ist (selbst im Delir), dass er sein Kranksein immer auch in Beziehung zu Anderen lebt, dass er die Bedingungen seines Krankseins – innere und äußere – unterscheiden lernt und dass die Symptome stets von seinen Lebensproblemen her Sinn bekommen: als ihr Ausdruck, als Abwehr und Vermeidung, aber auch als Selbsthilfeversuch.
Normalisierung der Beziehung: Mit der Wahrnehmung der Gefühle, die der Patient in mir auslöst, als meiner Vorleistung (Gegenübertragung) beginnt die Aufhebung der Isolation des Patienten, und zwar im Schutz der Anerkennung seiner unbedingten Fremdheit und Würde, und damit die Wiederherstellung von Offenheit und die Chance für den Austausch unterschiedlicher Positionen, also die Herstellung einer normalen Beziehung, in der ich die Symptome des Patienten weder ausblenden noch angreifen noch auf sie hereinfallen muss, einer Beziehung, in der wir – jeder für sich – daran arbeiten, dass die Symptome überflüssig oder ersatzweise in die Biografie integriert werden.
Die Abschnitte zum Handeln beschreiben die Therapie, also das, was sich aus Landschaft, Diagnose, Grundhaltung und der Beziehung zwischen mir und dem Anderen als Handeln und im Rahmen des Handelns auch als Ver- oder Behandeln ergibt. Es geht also um die Beeinflussung der Kontextbeziehungen und ihrer Bedeutung für die Betroffenen und Angehörigen. Es geht auch um die Integration der Bewegungen, in denen ich mich ändere, der Patient sich ändert, die Angehörigen sich ändern, ich den Patienten ändere – wozu auch die Medikation gehört – und er mich ändert. Auf diesen Wegen und Umwegen ist Selbst-Therapie aus eigener Suchhaltung die angestrebte Richtung, während die sogenannten »Unheilbaren« mehr Alltagsbegleitung bei der Integration ihrer Symptome in ihr Leben brauchen, was durchaus auch mal zu besseren Reifungsergebnissen als »Heilung« (restitutio ad integrum) führen kann. Wenn wir in der Begegnung mit dem Patienten oder der Patientin so weit sind, kann diese erste Begegnung etwa nach folgendem Schema dokumentiert werden:
Schilderung der Beschwerden im Rahmen der gegenwärtigen Lebensprobleme in körperlich-seelisch-sozialer Hinsicht. Je mehr konkrete Beispiele für das Erleben und Handeln des Patienten, gerade auch schon aus dem aktuellen Gespräch zwischen ihm und mir, desto besser.
Schilderung der Lebensgeschichte (Anamnese), ebenfalls körperlich-seelisch-sozial, mit den Schwerpunkten nach dem jeweiligen aktuellen Problem. Die Fähigkeiten des Patienten kennenzulernen ist wichtiger als seine Unfähigkeiten.
Darstellung der Situation, Eigen-Sicht und Eigen-Bedeutung der Angehörigen bzw. Nachbarn.
Schilderung des Eindrucks (psychischer Befund): Beschreibung des sprachlichen und nicht sprachlichen Austauschs, mit der Unterscheidung zwischen seinen und meinen Gefühlen. Der Anfänger geht dann systematisch weiter: äußere Erscheinung, Mimik, Gestik, Beziehungsgestaltung; Aufmerksamkeit und Wahrnehmung bzw. Selbstwahrnehmung; Bewusstsein und Orientierung; Merkfähigkeit und Gedächtnis; Antrieb und Bedürfnisse; Stimmung und Gefühlsäußerungen; Primärpersönlichkeit (Charakter und Temperament) und Verhaltensgewohnheiten Menschen und Aufgaben gegenüber; Denken – inhaltlich und formal; Umgang mit Angst und Symptomen; Ich-Erleben und Beziehung zum Selbst.
Testpsychologischer Befund (falls erforderlich).
Befund der körperlichen Untersuchung (klinisch und apparativ, falls erforderlich).
Diagnose: Sie sollte neben der nosologischen Zuordnung beschreibend die wichtigsten Züge der Problemkonstellation in drei bis vier Zeilen umfassen. Auch die »
Sozialraumdiagnose
« gehört dazu. Und: Diagnosen sind immer vorläufig.
Vorläufige Zielsetzung der Therapie, wie zwischen den psychiatrisch Tätigen und dem Patienten vereinbart, mit Angabe der ersten Schritte. Dies wird am häufigsten unterschlagen, ist gleichwohl am wichtigsten und in der Dokumentation des Verlaufs laufend zu korrigieren und fortzuschreiben.
Wichtig: Gerade weil ein solcher Bericht der Wahrheit möglichst nahekommen soll, ist er umso besser, wenn Sie häufiger Ich-Sätze verwenden. Sie signalisieren damit, dass der Bericht Ihre Sicht der Dinge und damit Ihre Wahrheit ist, machen sich für den Anderen auf diese Weise kontrollierbar, der ja eine andere Sicht haben könnte. Und für die Annäherung an die Wahrheit sind gerade die Unterschiede zwischen verschiedenen Sichtweisen besonders ergiebig.
Als Therapeutinnen und Therapeuten können wir lediglich günstige Bedingungen für Selbst-Therapie schaffen. Mit dieser Aussage knüpfen wir an Hippokrates an: »Der Patient selbst ist der Arzt. Der Arzt ist nur der Helfer.« Wie es bei der Diagnose um das Sich-Wahrnehmen geht, so bei der Therapie um das Sich-Wahrmachen des Patienten, ein Begriff, den wir der italienischen Psychiatrie verdanken (verifica). Zielvereinbarung kann es sein, dass jemand etwas ändern will, aber auch, dass jemand lernen will, sich so anzunehmen, wie er ist. Denn bei jedem Menschen gibt es änderbare, aber auch feststehende Anteile, die man nur annehmen kann.
Der Abschnitt zur Epidemiologie und Prävention beschließt jedes Patientenkapitel. Manche Leser mögen den Begriff »Sozialpsychiatrie« in diesem Buch vermissen. Wir halten ihn für überflüssig: Psychiatrie ist soziale Psychiatrie oder sie ist keine Psychiatrie. Andererseits finden Sie in den Abschnitten zur Epidemiologie und Prävention einen Teil von dem, was auch mit Sozialpsychiatrie gemeint sein kann: Epidemiologie ist die Erforschung seelischer Erkrankungen
nach ihrer Verbreitung,
nach ihren körperlichen und psychosozialen Bedingungen und
nach ihrer ökologischen, historischen und anthropologischen Bedeutung.
So ist es kein Wunder, dass wir an dieser Stelle auch auf den gesellschaftlichen Kontext zu sprechen kommen, z.B. auf Arbeitslosigkeit, Automatisierung, Globalisierung, Umweltschutz, Isolation, Wachstumsorientierung der Wirtschaft. Was beim einzelnen Patienten die Diagnose für die Therapie ist, ist auf der allgemeinen Ebene die Epidemiologie für die Prävention: Jene liefert dieser die Daten für Maßnahmen, die das Auftreten einer Erkrankung seltener machen, es bei gefährdeten Personen verhindern oder einem Rückfall vorbeugen sollen. All unser Tun sollte daher auch eine präventive Dimension haben. Das fängt schon bei der Arbeit mit einzelnen Patientinnen und Patienten an, wo »Hilfe zur Selbsthilfe« unsere Leitidee ist. Ein Teil unserer Arbeitszeit oder freien Zeit sollte aber zudem der Teilnahme an einer direkt präventiven Aktivität vorbehalten sein (z.B. Inklusionsförderung in meinem Sozialraum). Das macht die oft entmutigende Alltagsarbeit erträglicher und langfristig wirksamer.
Wichtig: Freilich ist auch hier eine Grenze zu beachten. Wir dürfen nie – wie im Nationalsozialismus – Fürsorge für einen konkreten Anderen durch Vorsorge für alle ersetzen wollen, das endet in Vernichtung.
Da wir der Auffassung sind, dass jede Psychiatriebewegung ihre Kraft von der Orientierung an den Bedürftigsten, insbesondere den »Unheilbaren«, bezieht, bedarf es wohl einer Repolitisierung sowohl der gemeindepsychiatrischen Programme als auch unserer Grundhaltung. Daher stellen wir abschließend so etwas wie einen kategorischen Imperativ zur Diskussion:
Handle für deinen Verantwortungsbereich so, dass du mit dem Einsatz all deiner Ressourcen (an Kraft, Zeit, Manpower, Aufmerksamkeit und Liebe) immer bei dem Bedürftigsten beginnst, bei dem es sich »am wenigsten lohnt«!
Natürlich ist das nur eine Norm, d.h., keiner von uns kann sie zu Lebzeiten vollständig erfüllen. Andererseits hat aber jeder von uns mindestens einmal am Tag die Wahlmöglichkeit und Gelegenheit, dieser Norm zu folgen. Wenn wir nur dies tun, wirkt sich das sehr wohl langfristig aus.
1Der sich und Anderen helfende Mensch
Thomas Bock, Ulrike Kluge
Die Landschaft der psychiatrisch Tätigen
Im gesellschaftlichen Zusammenhang
Wie die Psychiatriegeschichte lehrt, ist die Psychiatrie immer abhängig von dem Gesellschaftssystem, in dem sie arbeitet. Lange Zeit waren psychiatrische Krankenhäuser vorrangig Orte der Verwahrung, der völligen Entprivatisierung des Einzelnen. Die damit verbundene Entrechtung fand ihren Höhepunkt in der Nazizeit, in der der vorherrschende Rassismus dazu führte, psychisch Kranke als Gefahr für den »gesunden Volkskörper« zu sehen. Diese Menschenverachtung gipfelte in der Ermordung von 300.000 psychisch Kranken. Mit der Entwicklung demokratischer Gesellschaftssysteme musste auch die Psychiatrie sich ändern. Die Prinzipien demokratischen Denkens müssen nicht nur in die psychiatrischen Institutionen hinein, sondern auch im alltäglichen Handeln psychiatrisch Tätiger wirken. Wo das nicht geschieht, findet Ausgrenzung statt.
Heute muss an Psychiatrie der Anspruch gestellt werden, mehr von den Bedürfnissen der Betroffenen und der Angehörigen auszugehen, individuelle Lebenskonzepte und soziale Ressourcen zu berücksichtigen, mehr Flexibilität und zugleich Kontinuität zu gewährleisten sowie nicht unnötig zu pathologisieren, sondern auch anthropologische Sichtweisen auf psychische Besonderheit zugrunde zu legen. Diesem Anspruch, der sich aus der Entwicklung des Fachs und der Leitlinien, aber insbesondere auch aus der Humanität und der UN-Menschenrechtskonvention speist, wird das Versorgungssystem noch lange nicht gerecht; doch auf der Basis des Trialogs und des Erstarkens der Betroffenen- und Angehörigenbewegung ist er nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Um die Versorgung entsprechend von stationären zu ambulanten Schwerpunkten radikal umzugewichten, ist auch eine Veränderung des Finanzierungssystems in Richtung sektorübergreifender und regionalbezogener Budgets notwendig. Ansonsten droht mit der zunehmenden Ökonomisierung psychiatrischer Dienstleistungen deren zunehmende Konkurrenz und Zersplitterung, mit dem Risiko, dass Patientinnen und Patienten auf die Rolle von Kunden oder sogar auf die Funktion einer Ware reduziert werden. – Eine Umkehrung dieser Rollen könnte stattfinden, wenn – was leider noch selten geschieht – dem Patienten ein persönliches Budget zuerkannt wird, aus dem er selbst die notwendigen Hilfeleistungen finanziert. Auf diese Weise wird er zum Auftraggeber unserer Dienstleistungen.
Wie geht es Ihnen damit, wenn die Menschen, denen Sie helfen wollen, Kunde oder Klientin genannt werden? Welche Bedeutungen schwingen in diesen Begriffen mit? Wie geht es Ihnen, wenn Sie zum bezahlten Dienstleister des Patienten werden?
Professionelles Handeln in der Psychiatrie hat das Ziel, Autonomie zu fördern und zu unterstützen, also die Rechte des Patienten, der Patientin auf ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu fördern. Dieses Ziel wird durch die UN-Behindertenrechtskonvention noch einmal in den Mittelpunkt gerückt. Damit sind hierarchische und autoritäre Einrichtungen grundsätzlich obsolet. Denn Mitarbeitende, die selbst in ihrem eigenständigen Handeln behindert werden, werden kaum Wege fördern, die die Handlungsfreiheit des Patienten erhöhen.
Große Hoffnungen sind mit der Bewegung der Erfahrenen und Angehörigen sowie mit der Idee und Vision des Trialogs verbunden: Über eine Beziehung auf Augenhöhe könnten auch Versorgungsstrukturen sowie Lehre und Forschung zunehmend partizipativ mitgestaltet werden. Doch diese Entwicklung erfordert einen langen Atem, denn sie setzt nicht nur demokratische Strukturen und Umgangsformen, sondern auch eine gemeinsame Sprache und ein offenes, menschlich-anthropologisches Verständnis psychischer Störungen voraus (BOCK u.a. 2013).
Heute leben wir – nicht nur, was die Psychiatrie betrifft – in einer Zeit des noch nicht abgeschlossenen Umbruchs. Es besteht auch durchaus die Gefahr, dass erzielte positive Veränderungen wieder rückgängig gemacht, dass z.B. abgeflachte Hierarchien wieder aufgebaut oder Informationen nur noch hierarchisch weitergegeben werden. Hinzu kommt das Risiko, dass immer neue Kundengruppen erschlossen werden und neue Hilfsangebote an den wirklich Bedürftigen vorbeigeplant werden (BOCK 2013a). Vor allem aber gilt es, auf allen Ebenen den unseligen Hang zur Vereinfachung abzuwehren: Psychische Krankheiten lassen sich nicht auf besondere Gene oder entgleiste Stoffwechsel reduzieren. Und Menschen mit psychischen Erkrankungen hören nicht auf, Menschen mit allgemeinen Bedürfnissen, besonderen Stärken und Ressourcen und mit vielen anderen Eigenschaften zu sein (s. auch Schriftenreihe des Psychiatrie Verlags zur Anthropologischen Psychiatrie).
Mit der Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquete des Deutschen Bundestages im Jahr 1975 wurde erstmals nach dem Krieg eine Bestandsaufnahme über den Zustand der Psychiatrie in der Bundesrepublik gemacht. Es wurde aufgezeigt, dass die Zustände in vielen Landeskrankenhäusern menschenunwürdig waren. Es wurden Ideen entwickelt, die großen Anstalten zu verkleinern, von der Idee her aufzulösen, Hilfe in überschaubaren Institutionen anzubieten, dort, wo die Probleme der Menschen entstehen, in ihren Lebensbereichen, sodass sie und die Institutionen nicht in Vergessenheit geraten. Der Anspruch lautet: Hilfe wird möglichst ambulant angeboten, stationäre Einheiten sind ebenfalls gemeindenah und so klein wie irgend möglich. Alle für die psychische Gesundheit Tätigen, die Betroffenen und die Angehörigen entscheiden gemeinsam über die Art der Versorgung. Es ist für viele deutlich geworden, dass der Umgang mit psychisch Kranken und die Organisation von Hilfen vorrangig eine gesellschaftliche und politische Aufgabe ist. Doch immer noch laufen die regelhaften Finanzierungsstrukturen der Idee der Kontinuität und Flexibilität entgegen, obwohl Modelle der Integrierten Versorgung und Einrichtungen mit globalem Budget ihre Überlegenheit in dieser Hinsicht bewiesen haben (BOCK 2013 a; BOCK & LAMBERT 2013).
Jeder psychiatrisch Tätige weiß heute, dass ärztliche Hilfe nur ein Aspekt des Helfens sein kann. Psychotherapie, Hilfen beim Arbeiten und Wohnen sowie viele weitere Therapien müssen den medizinischen Hilfen zugeordnet sein, ja sind häufig sogar vorrangig. Nicht nur dem Individuum ist zu helfen, sondern auch die Umgebung, das System, ist in die Wahrnehmung einzubeziehen. Im Rückblick auf die verschiedenen Modellverbünde und -programme ist festzustellen, dass weniger die Finanzierung bestimmter Institutionen als die Gewährleistung bestimmter Funktionen und die Sicherung von Lebensräumen Maßstab der Reform sein müssen.
Neue Impulse sind mit dem Begriff Recovery (AMERING & SCHMOLKE 2012) und den Ansprüchen der UN-Behindertenrechtskonvention verbunden: Hilfen mögen sich nicht nur auf die Beseitigung von Symptomen konzentrieren, sondern dem gesunden Leben dienen. Sie mögen nicht in erster Linie auf Compliance und Anpassung setzen, sondern die eigenständige Lebensgestaltung fördern.
Gemessen daran sind nach wie vor gerade in Deutschland zu viele Ressourcen in hospitalisierenden Strukturen gebunden und gibt es für Krisen zu wenige mobile und aufsuchende Dienstleistungen. Immer noch und schon wieder werden Strukturen ökonomisch gefördert, die eine autoritäre Begegnungsweise aufrechterhalten. Zum Beispiel gibt es nach wie vor nur wenige Arbeitsplätze für Pflegende im ambulanten Bereich und die Finanzierung vieler als sinnvoll erkannter Institutionen ist keineswegs gesichert. In dieser Zeit des Umbruchs müssen psychiatrisch Tätige sich ihres Handelns bewusst werden. Neben dem Wissen kommt gerade in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Begegnung dem Menschenbild, nach dem der oder die psychiatrisch Tätige handelt, besondere Bedeutung zu. Bewusstsein über Bedingungen der Begegnung in und mit der Psychiatrie kann über die Psychiatrie hinauswirken und zum Ansatzpunkt für Nachdenken über menschenwürdiges Umgehen mit Kranken werden.
Neue Strukturen erfordern eine neue Haltung, ein anderes Verständnis psychischer Erkrankungen: Stationäre Behandlung braucht ein besonderes Milieu (Soteria-Idee), Hometreatment (HT) und eine weniger klinische Sichtweise; beide zusammen ergänzen sich (Soteria als stationäres HT, HT als ambulante Soteria) in der Suche nach einem angstfreien Raum für therapeutische Begegnung und erfordern ein eher anthropologisches als pathologisches Verständnis.
Für das Handeln in der Psychiatrie sind die Entwicklung einer gemeinsamen Suchhaltung, die koordinierte Anwendung des jeweiligen professionellen Wissens und eine spezifische, für alle Berufstätigen geltende Ethik erforderlich. Bei der Umsetzung neuer Ideen wie Trialog und Recovery, bei der Verwirklichung niedrigschwelliger Hilfen, beim Erreichen eigensinniger Patientinnen und Patienten sowie ganz grundsätzlich als Gesundheitslotsen, Genesungsbegleiter, als Brücke und Vermittler zwischen Selbst- und Fremdhilfe spielen Peerbegleiter eine wichtige neue Rolle. Ihnen ist ein eigener Abschnitt gewidmet (S. 75), aber sie werden in Zukunft auch unsere alltägliche Zusammenarbeit und unser Teamverständnis prägen (BOCK & KRÄMER 2015; UTSCHAKOWSKI u.a. 2016).
Die Begegnung mit der Psychiatrie aus der Nähe
Wie kann ich in der Psychiatrie arbeiten – egal ob als Pflegefachperson, Arzt, Psychologin, Sozialarbeiter usw. –, und zwar so arbeiten, dass es auch für mich erträglich ist, einen Sinn hat und dass nicht nur andere profitieren, sondern auch ich etwas davon habe?
Zur Beantwortung der Frage wollen wir in diesem Kapitel einen psychiatrisch Tätigen auf dem Weg in die Psychiatrie begleiten – und zwar speziell im Umgang mit Kollegen und mit sich selbst. Das geschieht genau so, wie wir in den »klinischen Kapiteln« den Weg der jeweiligen psychisch Erkrankten und Angehörigen durch die Psychiatrie begleiten – speziell in ihrem Umgang mit uns (und unserem Umgang mit ihnen). Deshalb ist dieses erste Kapitel fast so gegliedert wie die klinischen Kapitel 2 bis 13. Die Untertitel geben das je entsprechende Element an. Es genügt nicht, mir die Psychiatrie nur zum Objekt meiner Wahrnehmung zu machen. Denn gleichzeitig löst die Begegnung mit der Psychiatrie in mir etwas aus, nimmt mich gefangen, beeinflusst und verändert mich. Wie jede Begegnung hat auch diese zwei Anteile: Einmal mache ich mir als Subjekt den Anderen zum Gegenstand, zum Objekt, zum anderen trete ich als Subjekt mit dem Anderen als Subjekt in eine Wechselbeziehung, in einen Austausch. Im ersteren Fall lasse ich die Begegnungsangst nicht an mich heran, lasse mich innerlich nicht davon berühren, wehre ab. Im zweiten Fall lasse ich die Begegnungsangst in mich hinein, lasse mich vom Anderen anrühren, infrage stellen, schwinge mit, lasse den Anderen mit mir etwas machen. Also habe ich nicht nur meine neue Umgebung wahrzunehmen, sondern auch mich in ihr sowie die oder den Anderen in mir. Zur Wahrnehmung kommt die Selbstwahrnehmung. Nur in dem Maße, in dem ich das für mich und mein Handeln gelten lasse, kann ich es von den Patienten auch fordern: Ich kann für sie Modell sein. Da jedes psychiatrische Handeln modellhaft wirkt, muss darin das sichtbar werden, was erreicht werden soll. Zugleich funktioniert Begegnung nur, wenn ich das veränderte, vielleicht »ver-rückte« Selbstverständnis des Anderen annehme und gelten lasse, also bis zu einem bestimmten Punkt in die Welt des Anderen eintauche.
Trialogforen wie das Psychoseseminar sind dafür ein guter Übungsraum, doch lebendig werden muss diese dialogische Form der Begegnung im psychiatrischen Alltag.
Wer sich auf psychisch erkrankte Menschen wirklich einlässt, wird in der Psychiatrie das spannendste Fach der Medizin, in der klinischen Psychologie den vielfältigsten Ausdruck der Psychologie, in der Fachpflegeausbildung oder in vergleichbaren Spezialisierungen einen Zugang zum ganzen Menschen finden. Die Psychiatrie lebt von der immer noch zunehmenden Vielfalt ihrer Berufsgruppen (s. u.). Entscheidend ist, dass sie sich auch der Vielfalt ihrer Wurzeln – in Philosophie und Naturwissenschaften – bewusst bleibt.





























