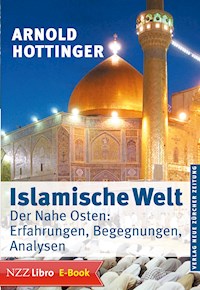
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Arnold Hottinger ist einer der international angesehensten Kenner der islamischen Welt zwischen Marokko und Afghanistan. Rückschau auf 50 Jahre Berichterstattung. Arnold Hottinger Islamische Welt Der Nahe Osten: Erfahrungen, Begegnungen, Analysen Format E-Book: EPUB. 2013. 752 Seiten. sFr. 19.90 / € (D) 19.90 / € (A) 20.10 ISBN 978-3-03823-984-0
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1371
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnold Hottinger
Islamische Welt
Der Nahe Osten:Erfahrungen, Begegnungen, Analysen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 6. Auflage 2005 (ISBN 978-3-03823-167-7).
Titelabbildung: Moschee in Najaf/Irak, Foto: © Keystone
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03823-984-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
Vorwort
Dieses Buch ist aus der Erfahrung eines langjährigen Berichterstatters entstanden, der gelernt hat, dass es keine völlig objektiven Berichte gibt. Immer fliesst etwas vom persönlichen Leben und Erleben des Berichtenden ein, gleich ob er die Feder führt, oder ob er eine Kamera lenkt, um mit ihr Bilder «zu schiessen». Aus diesem Grund schien dem Verfasser der ehrlichste Weg, seine eigene Konditionierung offen zu legen, mindestens soweit als er sie sich selbst klar zu machen vermag.
Im Verlaufe des Versuchs, die Verhältnisse und Erlebnisse des Berichtenden zusammen mit dem Berichteten vorzulegen, ergab sich eine weitere Dimension. Rückblickend wissen wir erstaunlich viel mehr und Genaueres über die damaligen Geschehnisse als es damals in Erfahrung gebracht werden konnte. Für den am Geschäft des «news»-Machens und -Überbringens Beteiligten hat es eine besondere Faszination, nachträglich zu lernen, was er damals nicht wusste, und die Irreführungen zu erkennen, denen er damals zum Opfer fiel. Doch auch für den «news»- Empfänger sollte es von Bedeutung sein, zu erfahren, dass er damals nicht alle Fakten und deshalb nicht immer die richtige Orientierung geliefert bekam und dass er dies auch für die Zukunft schwerlich erwarten darf.
Der Begriff «news» wurde für «Neuigkeiten» geprägt, die sich in der eigenen Kultur und Gesellschaft ergeben. Doch im Verlauf der heutigen Globalisierung wurde auch immer mehr zu «news», was in fernen Kulturen und Gesellschaften geschah. Dies wirkt ja auch mehr und mehr auf die unsrigen ein. In der eigenen Gesellschaft genügt es, die Neuigkeit zu erfahren und aufzunehmen, weil der Gesamtzusammenhang, in den sie gehört, bekannt ist. Dies ist nicht der Fall, sobald es um «news» aus einer fremden Gesellschaft geht. Oft gibt es über sie mehr Vorurteile als Kenntnisse. Deshalb werden die «Neuigkeiten» aus einer fremden Welt leicht im Licht der bestehenden Vorurteile oder der Zusammenhänge gesehen, die in der Aufnehmergesellschaft bestehen. Das macht sie dann unverständlich. Das Wort «Parlament» bedeutet nicht das gleiche in einem europäischen und in einem nahöstlichen Land. Information über die arabische oder die islamische Welt müsste anders gegeben werden als die über Ereignisse im vertrauten Eigenbereich. – Wie anders? – Womöglich so, dass die Zusammenhänge klar werden, in denen sich die Dinge «dort» abspielen. Sogar «Terroristen» werden innerhalb dieser Zusammenhänge zwar nicht entschuldbar aber verständlich. Und eine wirksame Terrorbekämpfung, welche die Krankheit anpackt, nicht nur ihre Symptome, dürfte erst möglich sein, nachdem die Ursachen der Terroraktionen verstanden sind.*
Die Zusammenhänge sind immer wieder der Schlüssel, der den Europäern und natürlich auch den Amerikanern zum Verständnis der Lage fehlt. Vielleicht kann man sie überhaupt erst erkennen, wenn man in die betreffenden Länder reist. Jedenfalls gehört es zu den Erfahrungen des Verfassers, dass er selbst immer wieder, wenn er ein Land besuchte, in dem er noch nie gewesen war, trotz aller vorbereitenden Lektüre das Land und seine Leute ganz anders fand, als er sie sich vorgestellt hatte. Diese Erfahrung macht ihn bescheiden in Bezug auf die Wirkung seiner eigenen Arbeit; offenbar lässt sich durch blosses Beschreiben nur ein geringer Teil der Lebenszusammenhänge übermitteln, die «dort» in einem neuen Land und in einer fremden Kultur die entscheidenden sind.
Einen Begriff davon zu bekommen, wie fremde Gesellschaften funktionieren, ist heute wichtiger geworden als früher, weil die Welt enger zusammenrückt. Als andere Kulturen weit entfernt lagen, konnten die meisten Nachbarkulturen sich mit einigen Stereotypen begnügen, die über die anderen umliefen. Das tat nicht viel Schaden, bis zu der Zeit, die vor 200Jahren begann, als die unsrige anfing, sich den anderen Kulturen der Welt aufzuzwingen. Ohne die unsrige kommt heute keine mehr aus. Eingriffe dort, angeblich um unserer Sicherheit willen, sind gegenwärtig eine politische Mode. Die Nachbarkulturen bestehen fort, allerdings in geschädigter, von unserer Kultur angeschlagener Form. Sich in ihnen auszukennen, wird ein wichtiges Bedürfnis, weil es für ein Zusammenleben ohne allzu brutale Reibungen und Zerstörungen wesentlich ist.
TEIL I
Bunte Faszination der Oberfläche
Bekanntschaft mit dem Nahen Osten
Eingewöhnung in Libanon
Es war aufregend, im Frühjahr 1955 zum erstenmal in Beirut anzukommen. Das Schiff war von Gepäck- und Lastenträgern geradezu gestürmt worden – und wir führten einen truhenartigen Blechkoffer mit, den wir nicht alleine zu tragen vermochten. Es gab eine wilde Zollprozedur in einem heissen und überfüllten Hafenschuppen. Möglichst viele Träger wollten sich um uns verdient machen und bestanden darauf, so reich wie möglich und am liebsten im voraus entlohnt zu werden. Grosse Eile und Verwirrung wurden zu diesem Zweck simuliert. Die Zollbeamten wurden als gefährliche Freibeuter dargestellt, an denen ungeschoren vorbeizukommen nur mit Hilfe der Träger möglich sein werde.
Den Ankommenden war es ihrerseits darum zu tun, ihre kleine Barschaft nicht zu sehr zu erschöpfen. Sie versuchten sich Zeit zu lassen. Die Eile und die angebliche Schärfe der Zollbeamten erwiesen sich nur als ein Spiel, das die Dramatik der Ankunft erhöhen sollte. Doch einen der grossen alten amerikanischen Wagen, die als Taxis funktionierten, am Ausgang des Hafenschuppens zu nehmen, war unerlässlich. – Wohin nun? – Auch der Taxichauffeur schien in furchtbarer Eile zu sein. Einem uralten Baedeker aus der Vorkriegszeit hatte der junge Orientreisende die Information entnommen, direkt am Rande des Hafens befinde sich die «Pension Europe», das älteste Hotel von Beirut «im europäischen Stil». Doch der Taxichauffeur behauptete, er habe noch nie etwas davon vernommen. Dies war verständlich, da ihm der Weg bis zum Rande des Hafengeländes zu kurz war. Doch ein rettendes Schild mit «Pension Europe» wurde sichtbar, sobald das Gefährt die Umrandungsmauer des Hafengeländes hinter sich liess. – Auszusteigen und dem Chauffeur den kleinen Betrag zu entrichten, den er für den kurzen Weg fordern konnte, war nur eine Frage der Energie.
Eine Wendeltreppe aus Marmor führte zur Pension empor. Sie nahm den ersten und den zweiten Stock eines älteren Geschäftshauses ein. Der besondere Geruch des Hafens von Beirut haftete an Strasse und Haus. Er war vegetativer Art, wohl durch die Massen von Alfalfa gegeben, die dort lagerten, um verschifft zu werden. Ein Doppelzimmer in der Pension war ohne weiteres zu erhalten, und der Preis dermassen mässig, dass der junge Reisende aufatmete, war er doch mit seiner erst kürzlich angetrauten Ehefrau unterwegs und verfügte nur über ein kleines Stipendium für eine Person, um den Orient und seine Sprachen kennenzulernen. Da ihm bewusst war, dass dies keine einfache Sache sein und er viel Zeit brauchen würde, um seine Ziele auch nur einigermassen zu erreichen, ging er darauf aus, dieses Stipendium soweit wie irgend möglich zu strecken.
Das Zimmer enthielt ein riesiges Messingbett, ganz im europäischen Stil. Es war gewiss vor Jahrzehnten aus der französischen Provinz herbeigeschafft worden; daneben gab es einen Waschstand und einen etwas ächzenden Holzschrank, einen Sessel und zwei Stühle. Das war alles, aber was brauchte es mehr! Es gab sogar hinter geschwungenen Bogenfenstern einen sonnigen Balkon, der auf die Hafenstrasse hinausblickte. Die Zimmertüre war nicht abschliessbar, «das sei auch nicht nötig» meinte der junge Mann, der bediente und den Koffer hinauftragen half, gestohlen werde hier nichts, und – Seitenblick auf die junge Gattin – in der Nacht und auch sonst könne man einen Stuhl gegen die Türe rücken, wenn man ungestört bleiben wolle. Ein Frühstück aus Kaffee, arabischem Fladenbrot, dicker Sauermilch und Aprikosenmarmelade brachte der gleiche junge Bursche am nächsten Morgen ins Zimmer. Die ganze Familie des Besitzers der Pension lebte in anderen Teilen des geräumigen Hauses; doch die Gäste bekamen sie kaum zu Gesicht.
Draussen zeigte sich eine fremde und überaus farbige Stadt. Gleich an den Hafen schloss sich das alte Marktquartier an, kein gedeckter Basar, sondern enge Strassen, auf beiden Seiten von kleinen zweistöckigen Läden eingeschlossen. Dort wurden vor allem Stoffe und Kleider verkauft. Um diesen Kern herum lagen die Depots der Grossisten. Lastträger verkehrten dazwischen. Einige der Geschäftsleute trugen noch den roten Fez, der einst im Osmanischen Reich das Abzeichen der gebildeten Mittelschicht war. Es gab auch noch Läden, in denen man sich seinen Fez auf einer Messingform, die unter Dampf gesetzt wurde, aufbügeln lassen konnte. Die Bauern, die aus den Bergen kamen, trugen die osmanischen Pluderhosen, schwarz und eng an den Waden. Dazu einen Kittel orientalischen oder europäischen Ursprungs. Man sah auch lange Gewänder aus bunt gestreiftem Baumwollstoff, über die braune Wollüberhänge als Mäntel getragen wurden, sowie europäische und halb-europäische Anzüge. Als Kopfbedeckungen dienten die arabischen Kopftücher, rot oder schwarz gemustert, mit dem Agal-Ring, der verschiedene Formen annehmen konnte, Hüte, Kappen, selten gab es Turbane, doch der rote Fez konnte mit einem goldgelb bestickten Kopftuch umwunden sein, das den Hajji, der als Pilger nach Mekka gereist war, auszeichnete. Frauen konnten sowohl tief verschleiert gehen wie auch ganz modern nach französischer Mode. Zwischen diesen beiden Extremen gab es alle Arten von Kopftüchern. Schwarze Kleider wurden jedoch von einer Mehrzahl auch der jungen Frauen getragen. Die verschiedenen Schuluniformen für Knaben und Mädchen, die aus bunten Schürzen bestanden, hellten das Bild auf. Geistliche des Islams und der christlichen Konfessionen traten in vollem Ornat in Erscheinung.
Zum Strassenbild gehörten die grossen amerikanischen Autos älterer Bauart, die als Taxis und als Gemeinschaftstaxis verkehrten und sowohl vorwärts wie auch rückwärts durch die Strassen zu fahren pflegten. Manchmal sass ein Knabe als Ausrufer mit darin, der die Zielrichtung ausrief und Passagiere zum Zusteigen einlud. Türen knallten, Stimmen riefen einander zu, auch von Wagen zu Wagen, mit Gesten untermalt. Manche der Händler traten plötzlich aus ihren Läden heraus und griffen nach den Händen von Vorbeigehenden, um sie in ihren Laden zu ziehen, oder ihnen ein Stück ihrer Ware auf offener Strasse unter die Augen zu halten. Dazu kam die einzige Tramlinie, al-Khatt, die Linie, genannt, welche die Stadt durchschnitt: parallel zur Küste nach Süd-Westen hinaus, und im rechten Winkel dazu über den zentralen Platz in der Mitte von Beirut und dann der Damaskusstrasse entlang nach dem östlichen Stadtausgang. Die Bahn fuhr klappernd, kreischend und klingelnd, aber so gemütlich, dass in der Innenstadt die jungen Männer beständig auf- und absprangen, während die Strassenjungen auf den Stossstangen mitfuhren. Ein hart arbeitender Conducteur, in einer dicken braungelben Uniform, die wohl aus Frankreich importiert worden war, sammelte die 25-Piasterstücke ein, die man für eine Fahrt zu entrichten hatte.
Zum Bild der Innenstadt gehörten die vielen Reklameschilder in verschiedenen Schriften. Die lateinischen Buchstaben rangen mit den arabischen um die erste Stelle. Doch fehlten auch die armenischen nicht, weil viele der im Ersten Weltkrieg von den Türken aus ihrer Heimat vertriebenen Armenier, die den damaligen Todesmarsch überlebten, in der Innenstadt von Beirut Läden eröffnet hatten, stets in damals neuen Berufen, wie Uhrmacher, Schneider für europäische Kleider, Schuhmacher für europäische Stiefel und Halbschuhe, Garagist, womit sie offenbar berufliche Nischen fanden.
Moscheen und Kirchen lagen nebeneinander im Zentrum. Doch Nicht-Muslimen wurde abgeraten, die Moscheen zu besuchen. Die Muslime würden das nicht erlauben, hiess es. So begnügte sich der Reisende vorläufig damit, einen Blick durch die offenen Tore auf die weiten Innenräume und Höfe zu werfen, wo sich periodisch die Betenden in langen Reihen versammelten. – Dafür standen die Kaffeehäuser allen Männern offen. Frauen sah man keine darin. Vor einem winzigen Tässchen ausgetrunkenen türkischen Kaffees, den man hier arabischen nannte, durfte ein Kunde stundenlang sitzen bleiben. Die Zeitungsverkäufer, oft kleine Jungen, kamen regelmässig vorbei. Man konnte von ihnen eine Zeitung erstehen, französisch oder arabisch, die sie dann bereitwillig und kostenlos für eine zweite und dritte eintauschten, bis man den ganzen Blätterwald des Tages durchgesehen hatte. Doch viele der Kunden zogen Domino oder Trick-Track vor, wozu Bretter und Steine im Café selbst zur Verfügung standen. Dazu lief beständig das Radio, laut und meist mit arabischen Sängerinnen und Sängern. Das schönste dieser Kaffeehäuser lag auf einem Steg aus schwarzen Holzpfeilern über dem Meer, das man unter sich brausen und quirlen hörte. Der leutselige Ministerpräsident Sami as-Solh, ein rundlicher älterer Herr mit weissem Schnurrbart, der noch den roten Fez als Kopfbedeckung trug und neben arabisch gerne türkisch sprach, die Regierungssprache im Osmanischen Reich seiner Jugend, kam dort an manchen Nachmittagen vorbei, um seine Wasserpfeife zu rauchen.
Man konnte sich leicht auf offener Strasse verköstigen. Überall gab es offene Ladenfenster mit steinernen Theken, hinter denen ein Verkäufer alle Arten Sandwiches anbot (das Wort wurde auch arabisch geschrieben) oder Felafel und Hommos in den eigens dafür vorgesehenen braun-gelb glasierten Schüsselchen zubereitete. Er begoss sie mit einem Schuss Olivenöl und setzte sie mit frischem Fladenbrot, das auch als Löffel diente, seinen Kunden vor. Scharfe saure Gurken und Radieschen gehörten dazu; man erhielt Wasser, soviel man begehrte, und konnte sich so für 25Piaster satt essen. Andere Esswarenhändler zogen mit beweglichen Ständen herum, auf denen hinter Glas ihre Waren lagerten. Getränkeverkäufer im traditionellen osmanischen Anzug zirkulierten und klapperten mit ihren Messingschalen, um die Aufmerksamkeit der Durstigen auf sich zu lenken. Sie trugen auf dem Rücken einen ledernen Wasserschlauch, aus dem sie mit Schwung ihre Messingtrinkschalen füllten. Es war nicht Wasser darin, sondern Zebib, ein süsser schäumender Sirup aus Rosinen.
Ebenfalls in der Altstadt lag der zentrale Markt für Gemüse und Früchte, wo auch Fleisch und Fische feil geboten wurden. Dort drängten sich viele Menschen, und Träger schleppten bauchige Einkaufstaschen hinter schwarzverhüllten Matronen her. Manche von diesen brachten ihre eigenen Dienstmädchen mit oder liessen sich von Töchtern und Schwiegertöchtern begleiten. Der Ort war bedrängend eng, halbdunkel, menschen- und stimmengefüllt, die Pflastersteine schwarz und rutschig vom vielen Wasser, mit dem die Frucht- und die Fischhändler ihre Ware besprengten, um sie unter den Bunsenbrennern der Petrollampen glänzend zu halten. Der «französische Markt», kleiner und an einer anderen Stelle im Zentrum, war viel gefälliger. Dort wurden ausgesuchte Früchte und Blumen in ihrer ganzen Farbenpracht ausgestellt und verkauft, und ein wohlhabenderes Publikum kam, um sich bedienen zu lassen.
Ins Auge stachen in der Altstadt auch die zahlreichen Geldwechsler, die ihre Geschäfte von offenen Läden und Buden aus tätigten. Ein jeder besass ein Telefon, über das er sich über die Kurse auf dem Laufenden hielt. Die Kunden traten an ihre Wechseltische heran und fragten, wie viel sie heute für ihre Dollars, britischen, syrischen, ägyptischen Pfunde, jordanischen oder irakischen Dinars, saudischen Rials, indischen Rupien, französischen Franken und was es alles noch geben mochte, erhielten. Manche wechselten dann, andere gingen weiter, um sich beim nächsten Wechsler zu informieren. Das Basarprinzip, nach dem alle Geschäfte der gleichen Sparte nebeneinander liegen, bestand auch hier. Die Geldwechsler befanden sich zwar nicht alle in einer Reihe, doch konnte man leicht fünf oder sechs nacheinander besuchen und sich so vergewissern, dass man den bestmöglichen Kurs erhielt.
Wer spricht arabisch mit mir?
So sehr dieses bunte Schauspiel der Strassen auch faszinierte, waren die ersten Wochen in der neuen Stadt für den jungen Besucher doch schwierig. Die sprachliche Situation war verwirrend und frustrierend. Der Fremde war ja gekommen, um gesprochenes Arabisch zu lernen, doch die Leute wollten mit ihm französisch sprechen. Dies war für sie die natürliche Sprache gegenüber einem Europäer. Klassisches Arabisch, das der Besucher mit viel Mühe und mässigem Erfolg an den Universitäten zu lernen versucht hatte, gab es für sie nur in den Büchern und vielleicht noch «ex cathedra» in Vorträgen oder Predigten. Ihr Dialekt aber, so meinten viele, «habe gar keine Grammatik», man könne ihn darum auch nicht lehren. Regeln wie im Französischen oder im klassischen Arabisch «gebe es keine». Dennoch war spürbar, das Französische war für die meisten erlernte, offizielle Sprache, die einer starken Selbstkontrolle unterstand. Was sie wirklich dachten und empfanden, kam offenbar viel mehr im Dialekt zum Ausdruck. Das Französische schien beinahe als ein Schutzpanzer zu wirken, hinter dem ein jeder sein wahres Wesen verbarg. Ohne den Dialekt zu kennen, würde man den Libanesen nicht wirklich nahe kommen.
Der Reisende besuchte die Amerikanische Universität, paradiesisch in einem weiten Park gelegen mit Aussicht aufs Meer, mit eigenen Sportanlagen und einem Strand zum Schwimmen, mit einem soeben neu gebauten Bibliotheksgebäude aus weissem Travertin, mit einer gut ausgestatteten Mensa und Nebenräumen für Aufenthalt und Erholung der Studenten. Die Universität verfügte sogar über ihren eigenen Buchladen und ihr eigenes Postbüro. Der Reisende wurde gütig vom Professor für Arabisch empfangen, die Bibliothek könne er gerne benützen, jedoch «nein», den Landesdialekt konnte man hier nicht lernen. Nur klassisches Arabisch werde gelehrt.
Auf der französischen Universität, die von Jesuiten geleitet wurde und in der Mitte der Innenstadt lag, gab es Vater Lator, spanischer Herkunft, der einen Kurs für libanesischen Dialekt erteilte. Er hatte sogar ein unterhaltsames Büchlein verfasst nach der Methode von Assimil, das lauter nützliche Phrasen enthielt. Doch der Unterricht fand nur zweimal die Woche statt. Französische Damen kamen dorthin, die sich mit ihren Dienstboten in dem, was man «Küchenarabisch» nannte, verständigen wollten. –«Wenn Sie wirklich arabisch sprechen lernen wollen», so meinte Vater Lator nach der dritten Stunde, «dann müssen Sie nach Bikfaya gehen». –«Und was ist Bikfaya?»– «Ein maronitisches Dorf oben in den Libanon-Bergen, im Sommer ist es voll Sommerfrischler, aber im Winter steht es fast leer. Dort unterrichtet Vater d‘Alvérny im lokalen maronitischen Kloster. Seine Schüler sind junge Geistliche, die später als Missionare im Orient wirken sollen. Gehen Sie hin! Er wird Sie schon aufnehmen.» Weitere Fragen ergaben, dass ein Autobus gleich hinter dem Hauptplatz der Innenstadt, «Burj» (der Turm, die Festung) oder «Place des Martyrs» genannt, alle paar Stunden nach Bikfaya hinauffuhr. – Und Bikfaya war dann die Rettung!
Ein Winter in Bikfaya
Die Busfahrt selbst war ein erfrischendes Abenteuer. Der nördlichen Ausfallstrasse, der Küste entlang, durch die christlichen Viertel und Vorstädte, wo die armenischen und anderen Flüchtlinge ihre Notunterkünfte und späteren Hüttenvorstädte eingerichtet hatten, an der staatlichen Régie des Tabacs vorüber, die damals das beinahe einzige grössere Industrieunternehmen der Stadt war, am Meeresstrand entlang, der freilich in diesen Stadtteilen auch als Schuttablage verwendet wurde, vorbei an der armenischen Kathedrale von Antelias. Sie war von traditioneller armenischer Architektur mit zentraler Rundkuppel aus gelbem Sandstein, jedoch in der Zwischenkriegszeit gebaut, Sitz des armenischen Patriarchen «von Antiochia». Dann bog der Bus ab und stieg über steile Kurven nach Osten den Berg hinauf, so dass schon nach wenigen Minuten die Küste tief unter der Strasse und dahinter das Meer hinaufschienen, das sich immer mehr weitete. Die Strasse, wohlgebaut, stieg an, die Luft wurde spürbar dünner und belebender, Bergschluchten taten sich auf, deren obere Hänge ganz von Terrassen bedeckt waren, die fleissige Generationen von Menschen angelegt hatten. Darauf wuchsen Trauben, Fruchtbäume, Gemüse, Kakteen und in den höheren Lagen vor allem Äpfel. Die Äpfel waren damals ein grosses Exportprodukt. Sie gingen als Luxusfrüchte nach Ägypten und nach Arabien, wo das Erdöl begann, einen bedeutenden Importmarkt zu schaffen. Libanesische Geschäftsleute legten gewaltige Pflanzungen an. Die Mitfahrer im Bus kommentierten, dass ein jeder der beschlagenen Kalksteinquader, die zu Tausenden die Stützwände der Terrassen für die Apfelpflanzungen bildeten, zwei Pfund koste, woraus man die grossen Kapitalien gewissermassen abzählen könne, die für solche Bauten ausgelegt wurden. Mehr Bewunderung als Neid auf die erfolgreichen Unternehmer sprach aus solchen Bemerkungen. Das libanesische Pfund war damals 1Franken 30 wert. Heute, 2004, ist es, infolge der Bürgerkriege, auf etwa 800 pro Schweizer Franken gesunken.
Kurz vor der Dorfeinfahrt von Bikfaya erhob sich ein schlossartiges, etwas protziges neues Gebäude mit roter Bemalung und vielen Balkonen, von einer gewaltigen Terrasse aus den besagten Zwei-Pfund-Steinen gestützt; dem Vorbeifahrenden zeugte es nicht von bestem Geschmack, doch er hütete sich, dies zu zeigen. Dieses neue Haus gehöre einem gewissen César Gemayel, wurde ihm mitgeteilt, der das viele Geld in Afrika gemacht habe. Gemeint war Französisch-Westafrika, damals noch Kolonie, wohin manche Libanesen während der Zwischenkriegszeit unter französischem Schutz ausgewandert und wo einige als Händler reich geworden waren. Die Gemayel, so lernte man auch, waren eine der Hauptfamilien von Bikfaya; berühmt sei natürlich auch der Pharmazist Pierre Gemayel, der seine Apotheke auf dem Hauptplatz von Beirut führe und der Gründer einer Partei sei, die in allen christlichen Teilen des Landes Anhänger habe, der Kata’eb oder Phalanges.
Das Dorf Bikfaya bestand eigentlich nur aus zwei Zeilen von Häusern und einigen Garagen, die als offene Läden dienten, entlang den beiden Durchgangsstrassen gebaut. Man konnte zwischen den Häusern hindurch an manchen Stellen in den schluchtartigen Abgrund des Hundsflusses und darüber hinweg auf der anderen Schulter der Kluft auf die roten Ziegeldächer des Städtchens Beit Chebab hinabschauen – ganz nah der Luftlinie nach, aber der Abgründe halber mehrere Stunden Weges entfernt. Das kleine Kloster lag am Dorfende, und Vater d’Alvérny war leicht zu finden. Gerne könne der Fremde an seinen Kursen teilnehmen. Eine Wohnung für seine Frau und für ihn wäre leicht zu finden. Er selbst kenne eine Witwe im Dorf, die während der Winterzeit, da ihr Haus beinahe leer stehe, gewiss gerne vermieten werde. Schon in der kommenden Woche könne der neue Schüler beginnen, an den Kursen teilzunehmen und sich in dem Haus einzurichten.
Vater d’Alvérny, hochgewachsen in schwarzer Soutane mit weissem kurzgeschnittenem Bart, von fast militärischem Auftreten, kurz angebunden, jedoch gleichzeitig humorvoll und gütig, war gewiss einer der besten Lehrer, die der Verfasser je kennenlernte. Er hatte ein dreiteiliges Lehrbuch des in Libanon gesprochenen Arabischen verfasst, in Lautumschrift, nicht in den arabischen Lettern, in denen die Vokale im besten Falle andeutungsweise wiedergegeben werden: Grammatik, Übungen, Vokabular, und er machte dem Anfänger von Anfang an klar, wenn er zielbewusst arbeite, werde er in drei Monaten sprechen können. Was sich denn auch bewahrheiten sollte.
Der Umzug nach Bikfaya ging leicht vonstatten. Der grosse Blechkoffer mit den meisten Habseligkeiten der beiden Jungvermählten blieb in der «Pension Europe» zurück. Er wurde einfach unter das Treppenhaus im ersten Stock in einen dunklen Winkel geschoben. Später, wenn irgend etwas gebraucht wurde, konnte man es ohne Umstände dort abholen und nach Bikfaya bringen. In den Monaten, während denen der Koffer so stand, jedermann zugänglich, ist nicht ein Stück daraus abhanden gekommen.
«Pension Europe» hielt eine letzte Überraschung für ihre beiden Gäste bereit. Der Besitzer der Pension, ein alter Mann, war gestorben. Seine Leiche lag aufgebahrt in dem hallenartigen, weiten Gang im ersten Stock auf der Seite, welche die Familie bewohnte. Alle Verwandten kamen auf Besuch, um ihr Beileid zu bezeugen. Die Reihe der Besucher brach Tag und Nacht nicht ab. Sie alle mussten mindestens mit Kaffee bewirtet werden. Der Tote lag mitten im Besucherreigen; schliesslich war er ja auch der Anlass dafür. Für die junge Ehefrau aus Amerika, für die das «funeral home» und die «Einbalsamierung» der Leichen die Norm waren, Gewohnheiten, die mit angeblich hygienischen Gründen gerechtfertigt wurden, wirkte dies schockierend, wohl mehr als alle anderen fremden Bräuche, die ihr bisher begegnet waren. Sie konnte es kaum fassen, dass sie nun mit einer ihr unbekannten Leiche auf dem gleichen Stockwerk gewissermassen zusammenleben sollte. Obwohl natürlich gar nichts Besonderes geschah: Die Trauerzeremonien liefen trotz der vielen Menschen, die sich versammelten, still und glatt ab; jeder Mann und jede Frau wussten genau, was von ihnen erwartet wurde. Nach einiger Zeit, es mögen zwei oder drei Tage gewesen sein, wurde der Sarg geschlossen, mit einiger Mühe die Marmortreppe hinabgeschleppt, feierlich durch die Stadt transportiert und der Tote in einem der griechisch-orthodoxen Friedhöfe begraben.
Unterkunft in Bikfaya
Die Umsiedlung nach Bikfaya fand zur gleichen Zeit statt. Frau Muawwad hiess die Witwe, die bereit war, den Oberstock ihres Hauses zu vermieten. Sie war an Untermieter gewöhnt, weil sie stets in den Sommermonaten Leute aus der Stadt bei sich beherbergte. Und die Wohnung besass alles Nötige, sogar Bettwäsche und einen kleinen Petroleumofen für die kalten Wintertage sowie einen Primus zum Kochen. «Gas! Gas!» war der Ruf des Strassenverkäufers, der mit einem von einem Esel gezogenen kleinen Petroleumtank durch die Strassen zog und das Schweröl in die Kanister der Frauen abfüllte, die es als Brennstoff zum Kochen verwendeten. Man musste allerdings lernen, mit diesen Kochern umzugehen. Es gab ein besonderes kleines Instrument, das dazu diente, die Düse zu putzen, wenn eine Unreinheit im Petrol sie verstopfte, ohne dass der Brenner erkaltete und dann neu in Betrieb gesetzt werden musste. Das brauchte einige Übung.
Die Wohnung besass einen leeren Speisesaal mit einem langen Tisch für eine grosse Familie, auf dem die Bücher und Papiere zum Arbeiten reichlich Raum fanden. Die Wintersonne schien auf den langgestreckten Balkon, welcher der Strassenfront des ganzen Hauses vorgelagert war.
Die Klassen für Arabisch dauerten den ganzen Vormittag lang, und am Nachmittag gab es noch einmal zwei Stunden Repetition. Sie wurden im Kloster gegeben. Drei junge Mönche aus Belgien waren die Schüler, zusammen mit dem neu dazu gestossenen weltlichen Aussenseiter. Später kam noch ein Fremder dazu; er war ein junger französischer Offizier, der in Algerien Dienst geleistet und gewiss auch gekämpft hatte und der nun abgeordnet war, um Arabisch zu lernen. Der algerische Bürgerkrieg, der acht Jahre lang dauern sollte, war 1955 gerade in sein zweites Jahr eingetreten. Einer der Belgier, rothaarig und extrovertiert, sehr rasch von Begriff und zeitgemäss, links orientiert, hielt mit seinen Meinungen und Ansichten nicht zurück. Er war auch der Schnellste beim Lernen. Die anderen beiden, schwarzhaarig, bedächtig und gewiss konservativer, liessen sich weniger leicht zu Diskussionen hinreissen. Sie hatten genug damit zu tun, ihr tägliches Pensum zu absorbieren und sich auf ihre vorgesehene Missionstätigkeit weit im Inneren Syriens vorzubereiten. Vater d‘Alvérny erteilte ihnen die Aufgabe, ihr Arabisch zu üben, indem sie den lokalen Jungen den Katechismus abhörten, den diese für ihren Religionsunterricht auswendig lernen mussten. Der Katechismus war natürlich, wie die maronitische Messe, in arabischer Hochsprache abgefasst.
Der rothaarige Mönch und Mitschüler stiess mehrmals heftig mit dem französischen Offizier zusammen, weil er, schon damals, die Ansicht äusserte, die Franzosen sollten abziehen und den Algeriern ihre Unabhängigkeit gewähren. Der Offizier geriet in heftige Erregung und sprach von seinen toten Kameraden, deren Opfer er nicht zu entehren gedenke, nicht in Worten und nicht in Taten und schon gar nicht auf Aufforderung von Aussenseitern, die nicht einmal Franzosen seien. Der Rothaarige wollte entgegnen, doch Vater d‘Alvérny brachte seine Autorität zur Geltung, um derartige Diskussionen abzubrechen. Wir seien hier, um Arabisch zu lernen, und das sollte genug zu tun geben.
Die farbigste aller Figuren war jene von Mahmud, dem Repetitoren. Er lebte auch im Kloster, und seine Aufgabe war, die Lektionen d’Alvérnys vom Morgen oder vom Vortag zu repetieren und sie in Übungen anzuwenden, bis sie gut sassen. Mahmud war der Sohn einer guten muslimischen Familie aus Damaskus, der zum Christentum übergetreten war. Der hagere, nervöse, bebrillte und fast immer lächelnde junge Mann wohnte ebenfalls im Kloster. Er schien unter starkem psychischem Druck zu stehen. Hinter vorgehaltener Hand erzählten seine Schüler, er trage stets einen Rosenkranz in der Tasche. Er habe eine Schwester, die er sehr liebe. Doch seitdem er Christ geworden sei, spreche sie nicht mehr mit ihm. Wenn er in sein Elternhaus komme, greife sie ihm an die Tasche, um festzustellen, ob der Rosenkranz noch da sei. Wenn sie ihn vorfände, wende sie sich schweigend ab. Der neu eingetretene Mitschüler wagte es nicht, den Betroffenen über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte auszufragen. Jedenfalls zeigte dieser eine gewisse Fragilität, die sich in Stimmungsschwankungen ausdrückte, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt; dabei war Mahmud sehr mitteilsam und leicht in Erregung zu bringen. Seiner Zöglinge nahm er sich mit Geduld und Hingabe an.
Die Welt der Frauen
Gegenüber der neu bezogenen Wohnung bei Frau Muawwad auf der anderen Seite der Strasse stand ein kleines einstöckiges altes Haus. Dort lebten drei Schwestern mit ihrer Mutter und Grossmutter, einem Grossvater und einem Bruder. Der Vater war kürzlich verstorben. Der Bruder war nur selten zu Hause. Der Grossvater war ein sehr alter Mann, der nicht mehr gut hörte und sich nur langsam bewegen konnte. Er pflegte sich in dem anliegenden Gärtchen aufzuhalten. Die Frauen hatten bald festgestellt, dass ihr neuer Nachbar am Morgen das Haus verliess und erst am Mittag wieder zurückkehrte. Seine junge Frau blieb allein zu Hause. Für die Frauen von Bikfaya war dies eine vertraute Situation. Ein grosser Teil der männlichen Bewohner des Ortes verliess frühmorgens das Dorf, um in der Stadt arbeiten zu gehen. Manche der Männer kamen erst spätabends zurück. Es gab sogar solche, die so weit weg arbeiteten, dass sie nur einmal im Monat nach Hause kamen. Die Frauen hatten ihren Lebensrhythmus dieser Lage angepasst. Auch sie standen sehr früh auf, schon lange vor sechs Uhr, um ihren Männern ein möglichst nahrhaftes Frühstück zu bereiten. Dann fuhr gegen sieben der Autobus durch die beiden Hauptstrassen des Dorfes und holte alle Frühpassagiere für die Reise nach Beirut ab. Die Frauen blieben alleine. Das war die Zeit für ihr Frühstück und ihre ersten geselligen Treffen mit anderen Frauen der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft. Solange ihre Männer im Haus weilten, waren sie ganz für sie da; doch dann kamen die langen Stunden ihrer einsamen Häuslichkeit, die sie sich durch die Gesellschaft anderer Frauen erleichterten. Kleine Kinder im Vorschulalter waren immer dabei. Zuerst einmal wurde Kaffee getrunken und danach ausführlich die Zukunft aus dem Kaffeesatz ins Auge gefasst. Dies war zum Teil ein gesellschaftliches Spiel, zum Teil glaubte man daran. Es gab Frauen, die ein besonderes Talent zeigten, aus dem Kaffeesatz zu prophezeien. Dabei ging natürlich aller Klatsch und alles, was man ohnehin voneinander wusste, mit in diese Voraussagen ein. Die immer gleiche und doch stets interessierende Zeremonie bestand darin, dass die ausgetrunkenen Kaffeetässchen mit ihrem dickflüssigen Satz auf die Untertasse umgestülpt wurden. Der Satz zerfloss in schwarz-weisse Flecken, welche die Grundlage für das Orakel bildeten – eine Art von libanesischem Rorschachtest, könnte man fast sagen
Die Frauen von nebenan begannen, die junge Besucherin aus Amerika in ihr gesellschaftliches Vormittagsleben einzubeziehen. Dass sie alleine zu Hause blieb, tat ihnen leid. Zwei der drei jungen Schwestern waren Lehrerinnen, die jüngste wollte es auch werden und befand sich noch in der Ausbildung. Ihr Leben, abgesehen vom Beruf, spielte sich einzig zu Hause ab. Nie hätten sie es gewagt, in ein Restaurant zu gehen, nicht einmal in der Gesellschaft von Freundinnen. Das wäre so ungehörig gewesen, dass sie nicht nur ihren eigenen, sondern auch den Ruf ihrer ganzen Familie geschädigt hätten.
Im Dorf gab es neben den maronitischen auch griechisch-orthodoxe Familien. Noch nie, so betonten die Schwestern emotional, waren sie im Haus von solchen Leuten gewesen, und nie würden sie dorthin gehen! Doch zu Hause gab es ein geselliges Leben für die Frauen, das verbunden war mit den Haus- und Näharbeiten, die sie gemeinsam verrichteten. Die jungen Frauen trugen stets Schwarz, wegen der Trauer um ihren verstorbenen Vater. Diese dauerte ein Jahr lang. Doch dies hinderte sie nicht daran, ihrer Bekleidung grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Eine der Schwestern war eine begabte Schneiderin, deren Rat und Hilfe auch befreundete Frauen in Anspruch nahmen. Stoffe und Kleider bildeten einen unerschöpflichen Gesprächsgegenstand. Wegen der Trauer hatten sie auch einen Stoffüberzug über ihr Radiogerät gestülpt. Er würde erst weggenommen werden, wenn das Trauerjahr zu Ende sei. Fernsehen gab es noch nicht. Doch die Lieder der Sängerinnen und Sänger am Radio, besonders derjenigen aus Ägypten, waren so beliebt, dass der Verzicht auf sie ein echtes Opfer bedeutete.
In dieses Leben wurde die junge Amerikanerin nun mit sanftem Druck und freundlicher Güte einbezogen. Ziemlich empört kam sie von einem der ersten Besuche zurück, man habe sie an den Bauch gefasst und gefragt, ob schon ein Kind im Anzug sei. Sie wurde auch zu einer Sitzung geladen, für welche die Frauen eine Zuckermasse hergestellt hatten, die sie sich über die Arme und Beine rollten, um sämtliche Haare zu entfernen. Die Prozedur sei schmerzhaft gewesen. Am Abend, wenn der Gemahl miteingeladen wurde, ging es konventioneller zu. Die Gastfreundschaft wurde zelebriert; alle möglichen Leckerbissen wurden aus der Küche gebracht, wobei sich die Frauen darauf beschränkten, sie anzubieten. Nie würden sie sich zusammen mit ihrem Bruder, und schon gar nicht mit dem fremden männlichen Gast, an denselben Tisch setzen, erklärten sie den erstaunten Besuchern. Sie blieben stehen, boten an und servierten und schienen sehr zufrieden, wenn die Gäste ihren Speisen kräftig zusprachen. Immer wieder wurde neu nachgelegt. Dreimal müsse man ablehnen, so lernten die Gäste, bevor angenommen werde, die Weigerung sei nicht bloss Höflichkeit, sondern ernst gemeint.
Traditionen des Berglandes
Andere Traditionen aus der Vergangenheit der libanesischen Berge waren auch noch lebendig. Einst war die Seidenindustrie einer der Haupterwerbszweige dieser Dörfer gewesen. Überall wurden Maulbeerbäume angepflanzt, und die Seidenraupen in fast jedem Haus in hölzernen Brutkästen mit den Maulbeerblättern gefüttert, bis sie sich einsponnen. Dies war Frauenarbeit, weil es sich im Inneren der Häuser abspielte. Die Kokons wurden dann an «Fabriken» verkauft, wo sie im kochenden Wasser aufgeweicht und später abgewickelt und aufgespult wurden. Die Rohseide wurde in erster Linie nach Lyon exportiert. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es regelmässig über das Mittelmeer verkehrende Dampfschiffe, die diese kostbare Fracht nach Marseille brachten. Die Kontakte mit Lyon waren damals so eng, dass man im Französisch der Libanesen noch nach dem Zweiten Weltkrieg den Akzent von Lyon wahrnehmen konnte. Auch die Jesuiten der Französischen Universität, die zuerst nach Libanon kamen, stammten in erster Linie aus jener Stadt. Die alten Steingebäude der Manufakturen zur Seidengewinnung waren am Rande von manchen Dörfern noch anzutreffen. Man konnte sie auf den ersten Blick an ihren konisch geformten Kaminen erkennen. Sie waren solide aus Sandsteinquadern gebaut. Doch nun standen sie leer, weil die japanische Konkurrenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts die libanesische Seidenindustrie überrundet hatte. Viele der Maulbeerbäume wurden umgehauen und durch Apfelbäume ersetzt. Nur in einigen Dörfern liess man die den Strassen entlang gepflanzten Bäume ihrer essbaren Früchte und ihres Schattens wegen weiterwachsen; und weil sie da waren, dauerte auch die Zucht von Seidenraupen in gewissen Familien noch an.
Für unsere jungen Nachbarinnen waren die Seidenraupen eine Art von Haustieren, die man auch als solche hegte. Die Raupen mit ihren langen beweglichen Fühlern sassen auf den Fingern der jungen Frauen, wenn diese mit ihnen spielten. Indem sie die Fühler mit den kopfartigen Enden berührten, brachten sie die Raupen zum raschen Zurückzucken. Sie sprachen dabei zärtlich mit ihnen, als ob sie Kätzchen wären. Ein kleines Taschengeld konnte man für die eingesponnen Kokons noch immer erhalten.
Der Erste Weltkrieg war noch in aller Gedächtnis. Die ältere Generation hatte ihn durchlebt und der jüngeren davon berichtet. Damals hatte eine furchtbare Hungersnot den Berg heimgesucht, weil die Dörfer schon seit Generationen ihre Nahrung nicht mehr selbst angebaut hatten, sondern ihren Weizen über das Mittelmeer importierten. Sie hatten sich ihrerseits auf Dienstleistungen wie die Raupenzucht, aber auch das Bauwesen in den reicheren Städten der Umgebung, auf Handels- und Transportunternehmen über die Berge hinweg spezialisiert. Aber auch die Auswanderung der jungen Leute nach Übersee war zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor geworden. Der Weltkrieg, in den Libanon als Teil des Osmanischen Reiches gezogen wurde, unterbrach den Verkehr über das Mittelmeer. Spekulation in Getreide, der Zwang, Lebensmittel an die osmanischen Armeen abzutreten und schlechte Regenfälle bewirkten zusammen, dass die Nahrungsmittel in den Bergdörfern völlig ausgingen. «Es gab so viele Hungrige auf den Strassen», berichteten die älteren Leute, «dass es unmöglich war, Feuer zu entfachen, sogar wenn man etwas zu kochen hatte. Sobald die Leute auf der Strasse aus einem Kamin Rauch aufsteigen sahen, wussten sie, dass es in jenem Haus noch etwas zu essen gab. Dann schlugen sie die Türen ein und drangen mit Gewalt in das betroffene Haus. Die Menschen starben wie Fliegen.»
Auswanderer aus den Bergdörfern
Die Tradition der Auswanderung hatte sich erhalten. Es gäbe so viele Libanesen im Ausland wie in der Heimat, wurde behauptet. In Südamerika wurden die ausgewanderten Libanesen «los turcos» genannt, weil sie mit osmanischen Reisepässen ankamen. Solche «turcos» mit ihrer Ware auf Flussbooten konnte man auf den hintersten Oberläufen und Zweigflüssen der grossen Ströme antreffen, die vor dem Bau von Überlandstrassen als Verkehrsadern dienten. Die libanesischen Wanderhändler drangen in monatelangen Bootsreisen mit ihren Waren bis in die abgelegensten Siedlungen vor.
Zur Zeit des Völkerbundsmandats der Franzosen, nach dem Ersten Weltkrieg, waren deren Kolonien in Westafrika als Auswanderungsziele dazugekommen. Dort sollten die libanesischen «épiciers» berühmt werden, die den Einheimischen – nicht sehr viel anders, als sie es auch in Beirut und in den Bergdörfern taten – die allernötigsten Nahrungsmittel und Haushaltsgegenstände, vom Kochtopf bis zur Streichholzschachtel, verkauften. Sie machten sich allerdings unbeliebt, weil sie kleine Schulden zuliessen, diese aber dann, wenn sie sich aufhäuften, mit aller Härte eintrieben. Nach den libanesischen Händlern zu urteilen, die dem Verfasser später in Senegal begegneten, gab es noch einen anderen, vielleicht wichtigeren Grund für die starke Abneigung, die ihnen die Einheimischen entgegenbrachten. Sie gaben sich französischer als die Franzosen, auf die schwarzen Eingeborenen schauten sie mit tiefster Verachtung herab. Manche von ihnen waren wohlhabend, einige sogar reich geworden.
Die Ausgewanderten, die es vermochten, zogen Söhne oder andere Verwandte nach, die ihnen als Gehilfen dienen und später vielleicht einmal das Geschäft übernehmen sollten. So kam es, dass bestimmte Dörfer ihre Auswanderer in bestimmte Städte oder Regionen Afrikas aussandten. «Unser Dorf geht dort und dort hin», hiess es zu Hause. Nicht nur die Maroniten, sondern auch die Schiiten aus dem Süden des Landes hatten so ihre Auswandererkolonien. Die Verbindung mit der Heimat brach nie ab. Geldüberweisungen wurden an die zurück gebliebenen Familien geschickt, Kinder kamen zur Ausbildung nach Libanon heim, neue Auswanderer wurden nachgezogen. Das Traumziel fast aller Auswanderer war, mit genügend Geld in die Heimat zurückzukehren, um sich dort ein Haus zu bauen und vielleicht eine Apfelpflanzung anzulegen, oder sonst ein Geschäft zu beginnen, das mehr der Aufsicht als allzu intensiver Mitarbeit bedürfe. Verwandte, denen man die tägliche Arbeit anvertrauen konnte und die dafür dankbar waren, fehlten selten.
Die Auswanderer schufen sogar eine bedeutende Literatur. Diese hatte in New York begonnen und sich in Südamerika, Rio und Buenos Aires fortgesetzt. Unter den nach Nordamerika ausgewanderten Libanesen und Syrern entstand eine Schule, deren berühmteste Namen, Jubran Khalil Jubran (korrekt Jabran), Mikha’il Nu’ayma und Amin ar-Rihani, zur Weltliteratur gehören. Die Mitglieder und Nachfahren der nordamerikanischen Auswanderer blieben oft in Amerika und manche gingen allmählich zum Gebrauch des Englischen über. Die Dichter und Literaten in Südamerika kehrten meist in ihre alte Heimat zurück, und sie hielten engeren Kontakt mit den Ländern ihrer Herkunft. Ihr Werk war eher lyrisch; das der «Nordamerikaner» enthielt mehr Prosa. Die «Südamerikaner» legten grossen Wert auf ihr arabisches kulturelles Erbe. Eine ihre wichtigsten Zeitschriften hiess «al-’Usba al-Andalusiya», die Andalusische Gruppe.
Allgemein übten die Dichter und Schriftsteller «der Auswanderung» (al-Mahjar), wie man sie nennt, einen wichtigen Einfluss auf die moderne arabische Literatur aus, weil sie entschieden für die Erneuerung der alten Formen und Inhalte eintraten und die neuen Motive ihrer persönlichen Erfahrung und Empfindung kraftvoll hervortreten liessen. Heimweh ist eines der Grundthemen ihrer Lyrik.
Mezze für den älteren Bruder
An Abenden, an denen im Nachbarhaus der ältere Bruder erwartet wurde, bereiteten seine Schwestern ihm eine Mezze vor. Sie bestand aus mindestens zwölf verschiedenen Kleingerichten und Leckerbissen, ein jeder auf seinem eigenen Plättchen serviert, begleitet vom Arak, dem aus Weintrauben destillierten und mit Anis durchsetzten glasklaren Schnaps. Er bildet mit kaltem Wasser verdünnt, das ihn wolkig werden lässt, das wichtigste geistige Getränk aller Araber und besonders der Levantiner und ist viel beliebter als Wein. Darüber befragt, ob es wirklich nötig sei, sich für einen Bruder so viel Arbeit zu machen, erklärte die älteste der Schwestern bestimmt: «Ja, unbedingt! Sonst könnte der Bruder statt zu Hause zu bleiben, hier im Dorf ins Café gehen, um seinen Arak zu trinken. Und das wäre eine unüberwindliche Schande für unsere Familie. Die Leute im Dorf würden sagen: «Seine Familie aus so vielen Frauen kann nicht einmal für ihn sorgen, so dass er ins Gasthaus geht!»
Ein Sozialist in Bikfaya
Der Bruder, Bschara, war Tischler und arbeitete in Beirut. Dort konnte er ein Restaurant besuchen. Denn dort hatte er keine Familie und kein eigenes Haus. Er war ein kräftiger, hochgewachsener, selbstsicherer Mann mit einer tiefen Stimme. Er besass eine Eigenheit, über welche die ausländischen Gäste etwas verlegen aufgeklärt wurden: Er sei nämlich «Sozialist». Vielleicht der einzige, oder jedenfalls einer von ganz wenigen, die es in Bikfaya gab. Dies war deswegen eine so ungewöhnliche Sache, wie der Besucher allmählich begriff, weil der Chef der libanesischen «Sozialisten» ein Druse war, und nicht irgendeiner, sondern der Fürst einer der beiden grossen Stammesföderationen der libanesischen Drusen, Kamal Jumblat. Die überwiegende Zahl der Mitglieder der von ihm angeführten «Progressiven Sozialistischen Partei» waren getreue Gefolgsleute aus «seinen» drusischen Dörfern.
Jumblat habe seinen Sozialismus in Indien gelernt, berichtete Bschara über ihn. Er nehme ihn sehr ernst; der Beweis dafür sei, dass er alle Ländereien, die ihm und seiner Familie seit Generationen gehörten, unter seine Bauern verteilt habe. Deshalb liebten ihn die Bauern über alles. Sie bildeten in der Tat die Hauptmasse seiner «Progressiven Sozialisten». Doch er, Bschara, und seine engsten Parteifreunde seien keine Drusen. Sie seien überzeugt, dass die sozialistische Lehre nichts mit den Religionsgemeinschaften zu tun habe. Es gehe um Politik und nicht um Religion. Die Vormacht der grossen reichen Familien im ganzen Lande müsse gebrochen werden, unter den Christen (aller Konfessionen), unter den Muslimen (Sunniten und Schiiten) und unter den Drusen (jenen der Arslan- und der Jumblati-Gruppierungen). Das würde dann auch dazu führen, dass die politische Macht der verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu Ende gehe. Die Politik müsse eine Sache der Bürger werden, die sich zu echten Parteien mit politischen Programmen zusammenfinden sollten. Die untereinander rivalisierenden Anführer der antagonistischen Religionsgemeinschaften seien überholt. Daher sei er Sozialist, obwohl er aus einem maronitischen Dorf und einer maronitischen Familie stamme. Bscharas Schwestern und seine Mutter, die solche Reden gewiss schon oft mitangehört hatten, enthielten sich aller Kommentare.
Kamal Jumblat, Drusenfürst und Sozialist
Mit der Zeit sollte der Besucher erkennen, dass die Gruppe der «echten» Sozialisten, das heisst jener, die in der Partei Kamal Jumblats eine Partei im europäischen Sinne erblicken wollten, einen Zusammenschluss also von Gleichgesinnten zur Durchsetzung ihres politischen Programms, nur eine winzige Minderheit war. Die grosse Masse der «Sozialisten» hielt zu Jumblat, weil sie durch Geburt und Herkommen «seine» Anhänger waren und weil er auch immer bemüht war, diese ererbten Bande zwischen Patron und Klient lebendig zu erhalten und zu stärken, indem er für seine Klienten, die Drusen der Jumblat-Faktion, die sich ihm zuliebe auch «Sozialisten» nannten, sorgte, so gut es ihm möglich war.
Natürlich gibt es derartige Verhältnisse von Klient und Patron in vielen politischen Systemen, doch im Libanon waren sie so dominierend, dass die gesamte innere Politik und sogar alle inneren Kriege der späteren Jahre durch sie bestimmt waren. Dabei wirkte sich immer aus, dass die Klientelgruppen innerhalb der jeweiligen Religionsgemeinschaften zusammentraten und fast nie über deren Grenzen hinweg. Wie die grosse Mehrzahl der Libanesen innerhalb ihrer Religionsgruppen heiratete und Verwandtschaften aufbaute, die sich nur ganz ausnahmsweise auf eine andere Gemeinschaft erstreckten, so unterstellten sie sich auch einem Chef oder Führer aus ihrer eigenen Gruppe. In Libanon nannte und nennt man auch heute noch diesen Chef Za’îm, ein Wort, das das deutsch-arabische Wörterbuch von Wehr mit «Führer, Anführer, Oberst – als militärischer Dienstgrad im Irak –, Bürge» widergibt; das französische von Belot mit «Garant, Répondant, Représentant, Prince, Chef», das englische von Hava mit «Surety, Answerable, Chief, Spokesman». Man sieht, der Begriff bedeutet «Anführer», aber gleichzeitig auch «Fürsprecher» und «Verantwortlicher».
In der Tat ist in Friedenszeiten der Za’îm seinen Klienten als «Fürsprecher» bei den Behörden und staatlichen Stellen unentbehrlich. Nur über ihn und mit seiner Vermittlung kann der kleine Mann bei den Behörden oder den politischen Stellen wirklich Gehör finden. Sich direkt an sie zu wenden, erscheint ihm – und ist es auch oft – unmöglich, er würde einfach nicht wahrgenommen, wenn man ihn überhaupt vorlassen würde. Jumblat war also der Za’îm der Drusen «seines» Jumblati-Klans; dies war seine ihm angeborene Hauptposition. Er war aber auch Sozialist, weil er dies sein wollte und weil er der Ansicht war, das alte Regime, das eben auf den Chefs der Gemeinschaften beruhte, müsse beendet werden und einem «modernen» Parteiensystem weichen. Kamal Jumblat ist inzwischen gestorben (er wurde am 16. März 1977, vermutlich vom syrischen Geheimdienst, erschossen), doch das alte Regime besteht bis heute fort. Die Solidarität der Religionsgemeinschaften (die auch durch die Bande der Endogamie zusammengehalten werden) war (und ist) stärker als der Zusammenhalt von Gesinnungs- und Interessengemeinschaften (soweit solche überhaupt je zustande kamen), auf denen eine Partei im europäischen Stile beruht.
Erste Begriffe über die Phalangisten
In Bikfaya hörte der junge Besucher auch zum erstenmal ausführlicher von den Kata’eb oder «Phalanges» des Apothekers Pierre Gemayel. Für Bschara waren sie Feinde. Pierre Gemayel, ein Maronite aus Bikfaya, hatte 1936 als Student der berühmten Olympiade Hitlers beigewohnt. Er kehrte zurück mit dem Willen, seinerseits eine «national» und «sozial» ausgerichtete Partei zu gründen, und er sah die Bildung einer Miliz in Uniform als ein Mittel an, um seine Partei zu einer disziplinierten und modernen Formation zu machen. Die «Phalanges» entwickelten sich denn auch zu einer militanten Mittelstandspartei mit mehr oder minder bewaffneten Aktivisten. In den 1930er Jahren gab es in Ägypten ähnliche Aktivistengruppen, die Grünen Hemden oder die Roten Hemden, nach dem Modell der damals vielerorts in Europa (z.B. in Deutschland, Italien, Spanien, Rumänien, aber auch in der Sowjetunion) zur Mode gewordenen politischen «Jungvölker» paramilitärischer Organisation. Die Anhänger Gemayels sahen sich als Demokraten an. Das war insofern für sie nicht schwierig, als sie alle aus Maroniten bestanden, und die Maroniten als die erste Gemeinschaft Libanons den libanesischen Staat beherrschten. Der Präsident und, ebenso wichtig, der General, der unter dem Präsidenten die Armee kommandierte, mussten (und müssen bis heute) nach Vorschrift der Verfassung Maroniten sein.
Allerdings sollten die «Phalanges» in der Politik Libanons nie eine solch bedeutende Mehrheit erringen, dass sie sich gegen andere maronitische Rivalen voll durchsetzen konnten, die als «Za’îme» (der korrekte arabische Plural lautet Zu’amâ’) auftraten und wirkten. In allen Wahlkreisen, in denen Maroniten lebten, gab es die lokalen Anführer aus den grossen Familien, die sich beinahe berufsmässig mit Politik und der Anführung ihrer Klienten befassten und deren Führungsposition innerhalb «ihrer» Regionen fast immer, wie das Vermögen, vom Vater auf einen der Söhne vererbt wurde. Meistens erhielten diese Zu’amâ die Stimmen der Maroniten ihrer Regionen. In vielen Wahlkreisen standen zwei oder mehr solcher Familien in Konkurrenz, und es gab auch Bündnisse unter ihnen. Nur in der Stadt Beirut und in anderen grösseren Orten, in denen viele Maroniten des Mittelstandes lebten, konnten die Anhänger Gemayels ihren Zaîm und einige ihrer anderen Kandidaten ins Parlament bringen. Im Parlament mussten sie sich dann mit anderen Gruppierungen verbinden, wenn sie eine Wirkung ausüben wollten, und ihre Verbündeten waren stets andere maronitische Gruppen.
Doch die «Milizen» dieser Partei sollten dazu bestimmt sein, in den beiden Bürgerkriegen des Landes 1958 und 1975–1990 eine wichtige Rolle zu spielen, weil sie in Kämpfen und Schiessereien die bewaffnete Speerspitze der Maroniten abgaben. Die «Phalanges» waren eine Ein-Mann-Partei, die ihrem Gründer und Führer Gemayel und später auch dessen Söhnen bedingungslose Gefolgschaft leistete. Man konnte sie sehen als eine Verbindung der in der Zwischenkriegszeit «modisch» gewordenen uniformierten und militanten Gruppierungen mit der alten Idee des Za’îm. Gemayel war letztlich ein Za’îm, wie die anderen, jedoch einer, der aus dem städtischen oder verstädterten Mittelstand hervorgegangen war und der sich eine militarisierte und uniformierte Gefolgschaft unter den maronitischen städtischen Kleinbürgern schuf.
Die Gross-Syrische Partei PPS
Auf einem Ausflug zu alten libanesischen Freunden, die wir in Chicago gekannt hatten, kamen wir in nähere Verbindung mit einer weiteren Partei Libanons, der PPS oder «Parti Populaire Syrien». Unser Freund Fawzi Najjar stand dieser Partei nahe. Sie war von einer charismatischen Figur gegründet worden, dem in Libanon aufgewachsenen, jedoch als 18-Jähriger nach Brasilien ausgewanderten Antoine Saadeh. Saadeh stammte aus Shwair, dem Dorf unmittelbar über Bikfaya. Er kam aus einer griechisch-orthodoxen Familie. Sein Vater, der Arzt Dr.Khalil Saadeh, ein Zögling der AUB (American University of Beirut) und der Verfasser eines arabisch-englischen medizinischen Wörterbuches, war noch zur Zeit der Osmanen nach Brasilien ausgewandert, weil er für die Befreiung seines Landes von den Türken agitiert hatte. Er hatte seine Frau und seine Kinder zu Hause zurückgelassen. In Brasilien veröffentlichte er zwei Emigrantenzeitungen, die beide eingingen. Seine Frau starb 1913 in Ägypten und der junge Antoine, damals 12-jährig, wuchs als Halbwaise bei Verwandten in Shwair auf. Die grosse Hungerperiode des Ersten Weltkriegs fiel in seine Jugend. Er überlebte und reiste 1919 nach São Paolo zu seinem Vater. Vater und Sohn träumten im fernen Exil von der grossen Zukunft ihrer Heimat und der Rolle, die der Sohn dort noch spielen würde.
Was war jedoch diese Heimat? – Die Maroniten glaubten an Libanon als ihr Land und ihren Staat. Die Sunniten jedoch wollten sich lieber Syrien anschliessen. Die Sunniten von Damaskus hofften auf einen neu gebildeten arabischen und syrischen Nationalstaat, zu dem nach der Ansicht vieler von ihnen auch Palästina hätte gehören sollen. Ein – reduziertes – unabhängiges Syrien konnten sie jedoch den Franzosen erst 1946, nach 25 Jahren schwerer Unruhen und politischer Kämpfe, abringen. Libanesen und Syrier empfanden sich als Araber, und diese weitere sprachliche und kulturelle Identität drängte ebenfalls nach einem politischen Ausdruck. Der Orthodoxe Saadeh jedoch legte sich eine eigene Heimat zurecht; sie hiess Syrien. Er meinte damit einen gross-syrischen Staat, der die heutigen Länder Libanon, Syrien, Palästina (mit dem heutigen Israel), Jordanien und sogar Zypern umfassen sollte. Der sich schon damals abspielende Streit um die Zukunft Palästinas zog auch Saadeh in seinen Bann. Für ihn war Palästina ein Teil von Gross-Syrien. Palästina war in der Tat während den Jahrhunderten der osmanischen Herrschaft eine Unterprovinz der Provinz (Pashalik) Syrien mit der Hauptstadt Damaskus gewesen. Doch Saadeh ging viel weiter zurück; sein Gross-Syrien wollte er archäologisch und sogar geologisch begründen. Er behauptete, es sei die Quelle der Zivilisation schlechthin gewesen. Die Griechen hätten «die Kultur» von den Syrern Gross-Syriens übernommen. In ihrem Ursprungsland sei sie dann allerdings unter dem Druck der «orientalischen» Nachbarländer (Ägypten, Arabien) zerfallen. Saadeh und seine Gefolgsleute wollten dieses imaginäre Gross-Syrien in seinem alten Glanz wieder aufrichten. Saadeh kehrte zuerst in den 1930er Jahren nach Libanon zurück, doch stiess er wegen politischer Agitation mit der französischen Mandatsmacht zusammen, wurde vor Gericht gestellt, eingekerkert und dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ausgewiesen. In den Jahren vor 1939 muss seine Partei einige Tausend Mitglieder gezählt haben. Sie war halb-militärisch als Kaderpartei aufgezogen. Saadeh ging zurück nach Südamerika, wo er einige Bücher in arabischer Sprache verfasste, und tauchte 1947, zur Zeit der Unabhängigkeit Libanons, wieder in seiner Heimat auf. Er hatte schon während seines ersten Aufenthaltes die Amerikanische Universität und das sie umgebende Viertel von Ras Beirut zum Hauptschauplatz seiner politischen Aktvitäten gewählt. Eine Zeitlang wirkte er als Lektor für Deutsch an dieser Universität, weil es ihm gelungen war, das Wohlwollen ihres damaligen Präsidenten, Bayard Dodge, zu erlangen. Seine Lehre von Gross-Syrien war wirksam, obwohl sie keinerlei faktische Grundlage besass, ausser dass es in der Tat in dem von ihm in Anspruch genommenen Raum ein Volk und eine Sprache gegeben hat, neben einer Vielzahl von anderen, die man als syrisch bezeichnen kann. Es lag im Klima der Vorkriegszeit, dass die Imperien, das Reich, als grosse Ziele dargestellt wurden, denen sich die Einzelnen aufzuopfern hätten. Solche Lehren zogen vor allem die geistig heimatlos gewordenen Schichten der städtischen Kleinbürger und ihrer Intellektuellen an, die einen neuen Sinn für ihr Leben suchten und sich selbst grossen Führern und Idealen hingeben wollten.
Saadeh muss ein charismatischer Mann gewesen sein. Es gab Studenten der AUB, die sich ihm mit Leib und Seele verschrieben. In der Levante mit ihren zahllosen Klans und Gruppierungen ethnischer wie auch religiös-konfessioneller Natur brachte die neue Ideologie vom gross-syrischen Ideal eine Art von Befreiung mit sich. Man war nun nicht mehr «nur» libanesischer Schiite, Druse, Maronit oder Orthodoxer, eingefügt in den engen Kreis von Familie, Sippe und Konfession, und dazu noch der Allmacht der kolonialen Behörden unterworfen, sondern konnte sich als «Syrier» fühlen, als Träger eines neuen Ideales uralter Wurzeln, dessen Wiederbelebung als eine grosse Aufgabe erschien. Auch gegenüber den Kolonialmächten, den Franzosen, die meinten, sie müssten «la civilisation fran¢aise» ausbreiten, oder den Briten, die alle Asiaten als geborene Untertanenvölker ansahen, konnte man sich auf Grund dieser Ideologie als gleichwertig, ja sogar, als ein Mann der Zukunft, heimlich überlegen betrachten.
Die Anhänger Saadehs waren sehr stolz darauf, dass sie nur eine einzige Loyalität kannten, nämlich, wie sie erklärten, ihren alle anderen Bindungen ablegenden Willen, dem Führer Saadeh zu folgen und die «Syrische Nation» zu verwirklichen. Ihre Meinung war, die Mitglieder ihrer Partei, der PPS, seien über ihre alten Konfessionsbande hinausgewachsen. Für sie existierten sie nicht mehr. Deshalb könnten Muslime und Christen aller Konfessionen innerhalb der Partei und einzig in ihr rückbehaltlos zusammenarbeiten, wurde den Aussenstehenden immer wieder erklärt.
Doch Saadeh stiess, wohl ohne sie voll zu erkennen, mit den scharf geprägten, althergebrachten Loyalitäten und Gruppenegoismen der Levante zusammen. Nach Erhalt der Unabhängigkeit stellte die libanesische Regierung dem ihr gefährlich erscheinenden Ideologen und seinen kämpferischen Milizen eine Falle, indem sie die der PPS feindliche Miliz der Phalanges dazu ermunterte, ihren Parteisitz und ihre Zeitung zu erstürmen. Saadeh entkam nach Syrien zu seinem vermeintlichen Freund, Oberst Husni Za’îm, der kurz zuvor in Damaskus die Macht durch einen Staatsstreich an sich gerissen hatte. Doch der Oberst lieferte ihn an zwei Abgesandte der Polizei Libanons aus, nachdem die Anhänger der Partei von Syrien aus einige libanesische Grenzposten angegriffen und Beirut «den Krieg» erklärt hatten. Saadeh wurde in Beirut vor ein Militärgericht gestellt, das ihn hinter verschlossenen Türen zum Tode verurteilte und auch sogleich, am frühen Morgen des 8. Juli 1949, erschiessen liess. Er wurde dadurch zum Märtyrer und von seinen Anhängern geradezu vergöttert.
Seine Witwe und einer seiner getreuesten Schüler, Georges Abdel Massih, übernahmen die Leitung der Partei, deren Mitglieder von der libanesischen Polizei verfolgt wurden wegen angeblicher Verschwörung gegen den Staat, «mit Hilfe der Zionisten», wie der libanesische Staat behauptete. In Syrien wurden kurz darauf Offiziere, die der PPS anhingen, zum Hauptinstrument der politischen Kräfte, die den Sturz von Husni Za’îm und seine Erschiessung am 14. August 1949 bewerkstelligten, nachdem Za’îm, der erste der syrischen Militärdiktatoren nach der Unabhängigkeit seines Landes, nur viereinhalb Monate regiert hatte. Der libanesische Ministerpräsident und Gründervater des Staates Libanon, Riad as-Solh, der die Hinrichtung Saadehs hatte durchführen lassen, wurde seinerseits zwei Jahre später auf einem Besuch in Amman von einem Mitglied der PPS ermordet.
Diese ganze verwickelte Geschichte bekam der damalige junge Besucher von verschiedenen Freunden nur fragmentarisch und in undeutlichen Andeutungen zu Ohren, bis er später die Zusammenhänge aus den wenigen Büchern in Erfahrung brachte1, die sich genauer mit dieser politischen Episode befassten. Doch die Menschen lernte er aus direkter Erfahrung kennen. Die Sympathisanten der verbotenen Partei sprachen gerne von ihren Idealen und Hoffnungen, während sie die jüngste und blutige Vergangenheit, deren Einzelheiten in der Tat wohl auch für sie nicht immer leicht zu erkennen waren, im Halbdunkel liessen.
Der Zweite Weltkrieg in Tripolis
Einer der früheren Parteimitglieder, Fawzi Najjar, der Freund, den wir beide an einem heiteren Herbsttag 1955 in seinem Dorf in Nordlibanon aufsuchten, auf den Hügeln über der Stadt Tripolis, war stolz auf das grosse Haus, das er sich am Rande des Dorfes hatte erbauen können und wo er mit seiner Schwester lebte. Bald kam er auf die ausserordentliche Geschichte zu sprechen, die mit dem Haus und seiner Karriere zusammenhing. Während des Krieges hatten die Engländer bei Tripolis ein gewaltiges Materiallager angelegt, das dem Nachschub und der Hilfe für die russischen Truppen diente. Lastwagen gingen von dort in Konvoys durch den Irak, durch Persien und den Kaukasus an die russische Front. Bis nach Tripolis brachten britische Schiffe die Waffen und Hilfsgüter. Der junge Najjar war in einem solchen Depot als Verwalter angestellt worden. Er arbeitete unter der Aufsicht britischer Offiziere, und er berichtete, er habe es sich zum System gemacht, nichts zu stehlen, obwohl viele seiner Mitarbeiter allerhand Waren auf den Schwarzen Markt verschoben. Weil er als ausnehmend ehrlich gegolten habe, so erzählte er weiter, sei er im Laufe der Jahre avanciert, und als eine Vorschrift erlassen wurde, nach der alle Engländer Frontdienst zu leisten hätten und ihre Verwaltungsarbeit den einheimischen Angestellten überlassen sollten, sei er zum Direktor des ganzen Lagers ernannt worden. Auch als solcher habe er sich an seinen Grundsatz gehalten, nie etwas zu entwenden. Doch gegen Ende des Krieges habe er erfahren, dass die Transporte nach der Sowjetunion aufhören und die Lager geschlossen werden sollten. Da habe er sich entschieden, nun mit aller Gewalt seine eigenen Interessen zu fördern. Er habe mit dem Bau seines Hauses begonnen und lastwagenweise Tag und Nacht zuerst den Zement und später die anderen Baumaterialien und Güter, bis zu den Betten und Tischen, in sein Dorf bringen lassen. In aller Eile habe er soviel auf die Seite gebracht wie immer möglich. Der Schiffsraum, um all dieses Material nach England zurückzutransportieren, habe ohnehin gefehlt. Was er nicht gestohlen habe, hätte sich irgend ein anderer angeeignet. Die Leute aus seinem Dorf, die alle an der Operation interessiert waren, hätten ihn verständnisvoll unterstützt. Bis heute, so erwähnte er stolz (der Krieg war seit zehn Jahren beendet), halte z.B. der Vorrat von Glühbirnen an, den er sich damals in seinem Haus angelegt habe. Das Geld, das er verdiente, so erzählte er auch, habe ihm sein Studium der Philosophie in den Vereinigten Staaten finanziert und dies hätte ihm später erlaubt, zum Dozenten an der Amerikanischen Universität von Beirut aufzusteigen.
Die Khoura-Region ist eine Olivenlandschaft, grün, hügelig mit Aussicht auf das Meer nach Westen und auf die kahlen Höhen des Libanonkamms im Osten. Das Haus lag mitten drin, am Rande des Dorfes. Wie bei den meisten neueren Gebäuden in Libanon erhoben sich einige Zementpfeiler über das Flachdach hinaus, die Armierungseisen ragten aus ihnen empor. Das sei, so wurde den Besuchern erklärt, einerseits für den Fall, dass man ein weiteres Stockwerk auf das Haus aufbauen wolle, etwa wenn die Familie anwachse oder weitere Familienmitglieder zuzögen, aber andrerseits auch, weil man auf fertiggestellte Häuser Steuern zu zahlen habe. Ein derartiges Haus sei ja offensichtlich nicht fertig.
Alte und neue Häuser der Libanesen
Zement war schon damals das Baumaterial für neue Häuser. In der Zwischenzeit hat er so überhand genommen, dass die traditionelle Bauweise aus gehauenen Steinquadern mit roten Ziegeldächern und einer ganz bestimmten Anordnung der Wohnräume nur noch an einigen alten Gebäuden bewundert werden kann. Diese alten Häuser waren völlig angepasst an das Klima im Lande und auch an die Lebensgewohnheiten seiner Bewohner. Es gab zwei Varianten, eine einfachere und eine für wohlhabende Leute. Das einfachere Haus war einstöckig; man kam durch ein meist gerundetes Eingangstor direkt in den zentralen Wohnraum, wo die Familie sich aufhielt und auch Besucher empfangen wurden. Dort stand der Esstisch, ein Diwan, das Radio, mehr oder minder bequeme, aber jedenfalls reich dekorierte Stühle, die sich an den Tisch rücken liessen oder der Wand entlang aufgereiht wurden. In diesem zweiten Falle stellte man kleine Tischchen davor, um eine grössere Zahl von Gästen empfangen und, mindestens mit Kaffee, bewirten zu können. Von dem zentralen Raum aus führten drei Türen in die Nebenzimmer, von denen eines die Küche war, die anderen Schlafräume, die ihrerseits in mehrere weitere Räume unterteilt werden konnten. Im einfachsten Fall gab es einen Schlafraum für Frauen und einen für Männer. Wenn viele Leute dort wohnten, schliefen sie auf dünnen Matratzen am Boden, die tagsüber aufgerollt wurden und mit Teppichen überdeckt der Wand entlang als Sitzgelegenheiten dienten. Ein Garten, womöglich mit einem Brunnen oder Wasserbecken, gehörte zu jedem Haus, und im Sommer stand das Haupteingangstor zum Zentralraum hin offen, so dass der Garten in den Lebensbereich der Familie einbezogen wurde.
Die bescheidensten der einstöckigen Häuser, wie sie die Bauern bewohnten, hatten flache Lehmdächer, die leichter zu bauen waren als die Dachstühle für Ziegeldächer, welche die Kunst eines Zimmermannes erforderten. Die schwere Steinwalze, mit der man alljährlich den Lehm dieser Dächer wieder flach walzen musste, wenn sie dicht bleiben sollten, blieb das ganze Jahr über auf den Lehmdächern liegen.





























