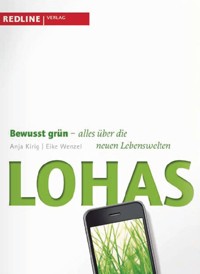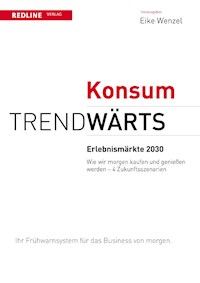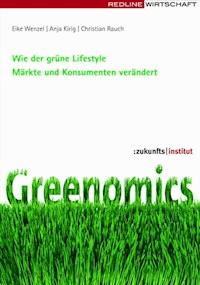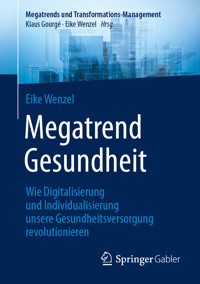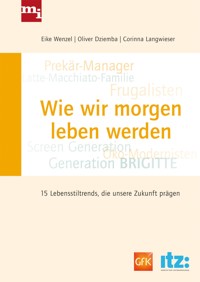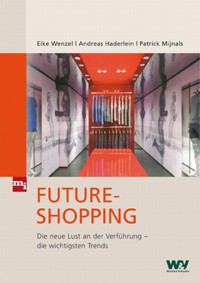7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Endspiel um die Zukunft beginnt jetzt
Alle sprechen von der Krise. Der Zukunftsforscher Eike Wenzel richtet den Blick nach vorne: Er zeigt, welch einmalige Chance diese Krisenzeit birgt, die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens zu verbessern. Klarsichtig und schonungslos analysiert er die Risse und Problemfelder unserer Gesellschaft und leitet daraus überraschend optimistische Aussichten und Wege für die Zukunft ab.
Wir befinden uns inmitten einer gesellschaftlichen Umbruchphase: Kirchen, Vereine, Gewerkschaften und politische Parteien verlieren dramatisch an Mitgliedern. Zugleich zeigen die bundesweiten Protestwellen gegen Projekte der Politik – sei es die Schulreform in Hamburg oder Stuttgart 21 –, dass die politischen Institutionen den Bedürfnissen der Bürger nicht mehr gerecht werden. Wie können wir alle in Zukunft mehr Einfluss nehmen? Solchen Fragen geht Eike Wenzel nach, indem er den wahren Bedürfnissen und Sehnsüchten der Menschen nachspürt und zeigt, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um unsere Zukunft besser zu gestalten. Denn diese Krise ist unsere große Chance: Wegweisend zeigt dieses Buch, wie wir das Projekt Zukunft jetzt anpacken können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
Vom Ist-Zustand in die Zukunft
In den nächsten zehn Jahren wird die Matrix unseres Lebens neu angelegt. Gerade haben wir eine existenzielle Krise bewältigt, schon merken wir, dass wir trotzdem nicht richtig auf die Zukunft vorbereitet sind. Krisenmanagement und staatliche Beatmungsaktionen der Wirtschaft machen noch keine Zukunftsgesellschaft aus. Wie definieren wir künftig Wohlstand und Glück? Was wird aus der Mittelschicht, kommt jetzt der endgültige Absturz, oder müssen wir das alles vielleicht ganz anders sehen? Die Wirtschaft wird trotz des sich abzeichnenden Aufschwungs im 21. Jahrhundert noch einmal unberechenbarer und risikoträchtiger werden. In den vergangenen 20 Jahren haben wir Wirtschaft und Wachstum zu einem Götzen erklärt, der für unseren Wohlstand sorgte, uns glücklich macht – oder eben auch nicht. Grenzenlos wachsende Wirtschaft, neue Märkte und den digitalen Kapitalismus haben wir als quasi automatischen Masterplan für unser Leben akzeptiert – eine scheinbar sich selbst erklärende Software für Glück und Sorglosigkeit. Und wir hielten es für eine »Win-win-Situation«, dass man die Weltökonomie an der Wall Street einfach nur ihre Algorithmen rechnen lassen muss, um selbst dabei reich zu werden.
Das Ergebnis sehen wir jetzt vor uns: Unsere Gesellschaft, die Hardware für unsere Existenz, steht auf dem Spiel. Praktisch von allen Seiten wird die Architektur unseres Gesellschaftsentwurfs infrage gestellt. Egal, ob von links oder rechts, ein bisschen linksliberal oder orthodox-wirtschaftsliberal, ob vom Gewerkschaftsfunktionär oder vom Arbeitgeberpräsidenten – aus allen Himmelsrichtungen hören wir die Signale: »So kann es nicht weitergehen!« Ein erzkonservatives Blatt wie der Rheinische Merkur ruft zum Sturm auf die Etablierten auf. Im Wirtschaftsteil beginnt das Blatt den Barrikadenkampf. Bayreuth, Wagner – das ist doch nur noch dekadent: »In Bayreuth vergnügt sich eine privilegierte Elite auf Kosten der Allgemeinheit. « So der O-Ton vom 5. August 2010.
Das 20. Jahrhundert war eine Ära der hemmungslosen Anhäufung von Waren und Wohlstand – auf Kosten der Zukunft. An die Wand genagelt von einem implodierenden Finanzsystem, der strukturellen Erschöpfung der Konsumsphäre, konfrontiert mit der Endlichkeit der Ressourcen und den Umgestaltungsanforderungen einer alternden Bevölkerung, verlieren wir unsere Zukunft immer mehr aus dem Blick. Uns wird mit einem Mal bewusst, dass wir keinen Masterplan für morgen und übermorgen haben. Zukunft wird gerade deswegen auf fast jeder Konferenz beschworen, weil sie uns endgültig verloren zu gehen droht. Gibt es überhaupt einen Masterplan für die Zukunft? Nein. Hätten wir den, bräuchten wir uns nicht zu bemühen, und wir könnten die Hände in den Schoß legen.
Dafür bleibt uns jetzt aber keine Zeit. Wir erkennen, dass unsere Gesellschaft von innen zu kollabieren droht. Unser Vertrauen in die Märkte hat uns davon abgehalten, die Fundamente der Gesellschaft in Schuss zu halten. Was wollen wir wirklich, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin?
Im Juli 2010, unmittelbar nach den Rücktritten von Horst Köhler und Roland Koch, und nachdem die ersten Wellen der Empörung um die Missbrauchsfälle in Kirche und Odenwaldschule abgeebbt waren, waren in den Zeitungen folgende Schlagzeilen und Nachrichten zu lesen: »Wider den Wachstumswahn. Maß und Mitte sind wertvoller als steigendes BIP«, schreibt der Rheinische Merkur. In der Süddeutschen Zeitung wird von »Lobby-Watching« berichtet. Gegen die Macht der Lobby-Organisationen kämpfen Non-Governmental Organizations (NGOS) mittlerweile mit modernen Mitteln. www.lobbycontrol.de organisiert Führungen durch Berlin zu einzelnen Lobbyorganisationen und erklärt »kritischen Berlin-Besuchern«, welche Funktionen die jeweilige Organisation zwischen Politik und Wirtschaft ausübt. In den USA werden investigative Projekte www.prwatch.org oder www.lobby-watch.org immer einflussreicher, die den Schulterschluss zwischen PR, Politik und Industrie ans Licht der digitalen Öffentlichkeit zerren möchten. Wikileaks fordert seit Dezember 2011 die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft heraus. Bei Info-Hackern wie Wikileaks ist einstweilen nicht zu beantworten, ob sie einer anarchischen und nihilistischen Idee der Unterwanderung von Machtkomplexen folgen und Destabilisierung zum Ziel haben, oder den Beginn einer radikaldemokratischen Öffentlichkeit markieren.
Zu lange haben wir uns an dem Gefühl berauscht, dass wir alles im Griff haben. Doch der Fortschritt fällt uns heute immer häufiger vor die Füße und führt zu bizarren Erscheinungen. Nachzulesen in der Neuen Zürcher Zeitung im Sommer 2010. Thema: Nur noch jedes zehnte Rindvieh in der Schweiz hat Hörner. Experten waren bis vor kurzem noch überzeugt, davon, dass Hörner die Verletzungsgefahr der Tiere unnötig erhöhen. Diese lässt sich zwar noch nicht wegzüchten, aber man fand eine innovative Lösung: Die Hörner wurden schmerzhaft ausgebrannt. Leider bewirkte diese Maßnahme genau das Gegenteil von dem, was man sich davon versprochen hatte. Ohne natürliche Hörner auf den Köpfen (nur noch 10 Prozent der insgesamt 700 000 Schweizer Rinder tragen Hörner) brach Chaos in den Ställen aus. Die alpenländische Initiative »Horn auf!« empfahl deshalb, zu den alten Gepflogenheiten zurückzukehren und die Hörner in naturbelassener Schönheit wachsen zu lassen. Hörner als Kampfwerkzeug und Gegenstand von Imponiergehabe sorgen nämlich für klare Hierarchien im Kuhstall, was am Ende des Tages für mehr Ruhe und Ordnung im Stall sorgt und die Milchleistung steigert.
Fortschritt ist ein schwieriges Geschäft. Wir – und nicht nur die Schweizer Viehzüchter – haben in den zurückliegenden Monaten lernen müssen, dass das Menschenmögliche nicht immer das Beste sein muss. Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier nicht mit einem Klagegesang belästigen, »zurück zu …« ist in der gegenwärtigen Lage keine Alternative. Wofür ich in diesem Buch eintrete, ist eine kritische Bestandsanalyse der vergangenen 20 bis 30 Jahre. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Was ist passiert, dass Politiker und Populisten, Wirtschaftslenker und Theaterintendanten, Börsenmakler und Fußballtrainer, Hochschulprofessoren und der Mann von der Straße davon sprechen, dass »etwas zu Ende geht«, dass »es so nicht mehr weitergeht«, dass wir »neu anfangen müssen« und so weiter? Natürlich hat das alles mit unserer Wirtschaft und der Finanzkrise zu tun, aber vor allem damit, dass wir vor Jahrzehnten die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass sich Börsen und Märkte zum »Autopiloten unseres Denkens« aufschwingen und den Laden gegen die Wand fahren konnten.
Nehmen wir zum Beispiel Irland. Die grüne Insel ist ein besonders schockierendes Beispiel, wie man mit dem globalökonomischen Autopiloten einen Staat und eine Gesellschaft an den Abgrund bringen kann. Amerikanische Unternehmen investierten aufgrund niedriger Unternehmenssteuern fleißig in Irland. Das Bruttosozialprodukt stieg zu Beginn des neuen Jahrhunderts mit schwindelerregender Dynamik an, da die erzielten Gewinne nicht in Irland blieben, sondern nach Amerika und zu den anderen Global Playern zurückwanderten. Im Jahr 2009 schrumpfte schließlich das Bruttosozialprodukt in Irland um 10,7 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg im Juli 2010 auf 13,7 Prozent, den höchsten Wert seit 1994. Exporte nach Großbritannien und in die USA halten das Land vorläufig über Wasser. Doch Irlands Defizit beläuft sich mittlerweile auf gigantische 12 Prozent. Die großen Computerfirmen ebenso wie internationale Banken (darunter viele deutsche Geldinstitute) benutzten Irland als strategisches Stundenhotel und wanderten weiter. Die bereits verstaatlichte Anglo Irish Bank kann auf 25 Milliarden Staatsgelder hoffen, was 80 Prozent der irischen Staatseinkünfte in diesem Jahr entspricht. Der Staat stolpert von einer Fundamentalkrise in die nächste und spart sich zu Tode, um die Banken zu retten. Was der kurze Frühling der Globalisierung auf der grünen Insel hinterließ, ist eine der absurdesten Immobilienblasen überhaupt. In Irland stehen 300 000 Wohneinheiten leer, wie die Neue Zürcher Zeitung errechnet hat. Die Wiederverwandlung der irischen Bauruinen in Weideland, so die Empfehlung von unabhängigen Experten, könnte zu einer schnelleren Markterholung beitragen.
Jetzt stellen wir fest, dass wir uns mit dieser »Harry-Potter-Zauberökonomie« (Peter Sloterdijk) selbst hereingelegt haben. Das Wirtschaftssystem hat sich ab einem bestimmten Moment seine eigenen Gesetze gegeben. Und wir haben die Götzen des neuen Marktes brav weiter angebetet. In dieser gesamten Phase, beginnend etwa Mitte der 1990er Jahre bis zum großen Crash 2008, haben wir vergessen, was uns wirklich wichtig ist. Jetzt ist der Katzenjammer groß, denn wir merken, dass es den ökonomischen Systemen ziemlich gleichgültig ist, was mit uns und unserer Gesellschaft passiert. Um aus dieser fatalen Lage herauszukommen, müssen wir die Autopiloten des Marktes ausschalten und wieder selbst mit dem Denken anfangen. Es wird Zeit, dass wir uns daran erinnern, was Aufklärung bedeutet: »Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung«, sagt Immanuel Kant. Wir müssen uns wieder trauen, uns unseres eigenen Verstands zu bedienen. Denn solange wir selbst nicht genau sagen können, wie wir morgen leben wollen und was uns wirklich wichtig ist, werden wir immer wieder auf die Zaubersprüche der Analysten und Konjunkturgesundbeter hereinfallen.
Es wird Zeit, dass wir uns darüber klarwerden, wie unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert auszusehen hat. Zukunft passiert jetzt. Der Absturz der Weltwirtschaft, Bürgerbewegungen in vielen Ländern des reichen Westens, existenzielle Probleme wie der Klimawandel und die Neukonfiguration des Energiemarktes schaffen eine Situation, in der vernünftiges und kühnes Handel auf der Tagesordnung stehen muss. Als die Bürger dieses Landes müssen wir wieder die Herren des Prozesses werden und definieren, was wir von der Wirtschaft verlangen, wie sich Institutionen verändern sollen und wie unsere Gesellschaft in der Zukunft aussehen soll. Wir müssen die Regeln des Spiels neu aufstellen und überhaupt erst wieder definieren lernen. Wir müssen uns klar darüber werden, wer wir in der Zukunft sein wollen, was wir brauchen, was uns weiterbringt und wie wir ein besseres Leben schaffen können.
Das 21. Jahrhundert hat mit gewaltigen Herausforderungen begonnen. Eine der zentralen Aufgaben wird sein, neue Verbindungen zwischen Sphären zu knüpfen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten auseinandergerissen worden sind. Die Analysen in diesem Buch laufen deshalb immer auf einen Fluchtpunkt zu: Wie werden wir morgen leben? Dabei werden Daten und Fakten aus Wirtschaft und Politik berücksichtigt, aber auch die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur, unserer Fernsehkultur und der Philosophie wird einbezogen. Es soll dadurch ein möglichst breites Spektrum abgedeckt werden, um den Sehnsüchten und Wünschen, Ängsten, Befürchtungen und Bedrängnissen der Menschen auf die Spur zu kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich in der unübersichtlichen Welt des 21. Jahrhunderts nur in komplexen Zusammenhängen neue Wege aufzeigen lassen. Eine Fortschrittsparole der Trendforscher in den 1990er Jahren kreiste um den aus der Systemtheorie entwendeten Begriff der Komplexitätsreduktion. Eine Maxime der nächsten Jahre wird lauten: Man solle so viele Kontexte wie möglich zur Kenntnis nehmen, um ein Problem sichtbar zu machen. Bekanntlich kann die Menschheit es sich nicht mehr leisten, die Wirtschaft als autistisches System vor sich hin brüten zu lassen. Ressourcennutzung darf nicht mehr nur vor dem Hintergrund möglichst niedriger Preise behandelt werden. Konsum muss im direkten Zusammenhang mit seinen Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit betrachtet werden.
Ein Blick zurück auf die 1990er und 2000er Jahre: Die 1990er Jahre waren eine Dekade der Verheißungen und Pseudo-Durchbrüche. Sie waren eine Epoche voller technologischer Versprechungen, die allerdings nur zu einem Bruchteil erfüllt wurden. Spaßgesellschaft, Themenparks, Privatfernsehen prägten eine Erlebnisökonomie, die nur die Devise »schneller, schriller, lauter« kannte, am Ende des Jahrzehnts in der Medienkrise aber dramatisch implodierte. Die 1990er Jahre waren die Phase, in der sich die Optimismus-Industrie aufstellte und ihren ideologischen Feldzug des think positive! startete. An den Börsen schien nur der Himmel die Grenze: Medien, Biotechnologie, Telekommunikation – das Informationszeitalter und die Ära der cleanen Werte und Technologie versprach Reichtum für alle. Die Algorithmen der Börse schienen eine neue Zeitrechnung vorzubereiten. Doch zu Beginn des neuen Jahrhunderts – 2000, 2001, 2002 – brachen erst einmal die Märkte ein. Der 11. September tat ein Übriges, der Riese Amerika begann zu wanken, die neuen Giganten China, Russland, Indien bereiteten erst langsam ihren Auftritt vor.
Die 2000er Jahre werden dagegen als das vergeudete Jahrzehnt in die Geschichtsbücher eingehen, weil man an der alten Wirtschaft und den alten Wertschöpfungsmodellen krampfhaft festzuhalten versuchte. In den »Naughties« (dem unnützen Jahrzehnt), wie die Amerikaner schließlich das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts tauften, haben wir viele Chancen verpasst: Weder setzte die Pharmaindustrie zu den angekündigten Innovationssprüngen an, noch bekamen wir das e-Auto, noch revolutionierte die Nanotechnologie unseren Alltag. Das einzige Ausrufezeichen setzte Apple mit iPod (gestartet kurz nach 9/11) und iPhone. Der heimliche Sieger der Dekade war jedoch Nokia, ein auf Massenausstoß spezialisiertes Telekommunikationsunternehmen, das weltweit fast jedes zweite Handy verkauft. Keine technologischen Durchbrüche, keine neuen Wertschöpfungsmodelle, keine neue Wirtschaft, kein 21. Jahrhundert.
Bei der Analyse bin ich auf einige Grundmotive gestoßen, die für unser Verhalten in Gesellschaft und Wirtschaft in den vergangenen 20 Jahren besonders kennzeichnend waren. Seit den 1990er Jahren wurde beispielsweise das Marketing immer wichtiger. Die Lehre vom richtigen Verkaufen sprang aus dem Business in andere gesellschaftliche Sphären über: in die Politik, den Sport und die Medien. Mit dem Siegeszug des Computers und der Digitalisierung der Arbeitswelt keimte die Hoffnung eines dauerhaften Aufschwungs. Mit dem Ende des Kalten Kriegs und der Ideologien gab es plötzlich kein Links und kein Rechts mehr. Damit einher ging die Täuschung, dass wir am Vorabend einer Gesellschaft stehen, in der es keine Klassen, kein Oben und Unten mehr gibt. Die Mittelschichten der westlichen Welt waren noch nie so einflussreich wie in dieser Phase. Sie begannen, über die Wirklichkeit zu herrschen, und definierten, was gut ist und was nicht. Doch im Zuge dieses ungekannten Wohlstands- und Wellnessschubs haben wir mit dem zerstörerischen Werk der Entkopplung von gesellschaftlichen Sphären begonnen: Die Wirtschaft entkoppelte sich von der Gesellschaft, die Politik von den Wählern, die Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft, die Menschen entfernten sich von der Gemeinschaft, die Nachricht koppelte sich ab von der Realität, das Produkt von den Qualitätsversprechen, der Glaube fiel von der Kirche ab und so weiter, die Aufzählung ließe sich beliebig fortführen.
Von hier aus beginnt die Reise in das kollektiv Unbewusste unserer Gesellschaft. Auslösendes Moment ist die Feststellung, dass wir gerade zu Zeugen einer dramatischen Implosion von gesellschaftlichen Autoritäten und Institutionen werden. Im Frühjahr/Sommer 2010 verlassen innerhalb weniger Tage mehrere Spitzenpolitiker fluchtartig ihre Ämter. Wenige Wochen davor wurden die Missbrauchsfälle in den Kirchen bekannt, immer neue Hiobsbotschaften verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, Tausende von Kirchenaustritten waren die Folge. Ebenfalls in diesen Zeitraum fiel der Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule: ein hoch angesehenes Eliteinternat entpuppte sich als Ort der Bedrängung und des sexuellen Übergriffs – und das alles seit Jahrzehnten und unter dem Deckmantel einer neuen, weltoffenen Reformpädagogik.
In Kapitel 1 wird deshalb die Frage gestellt, wie wir künftig mit Idolen, Idealen und Autoritäten umgehen sollten. Was läuft falsch in den Institutionen der Gegenwart, und wie müssen neue Institutionen aussehen, die nicht nur verwalten, sondern Veränderung gestalten? Kapitel 2 verfolgt diesen Strang weiter und geht der Frage nach, wie wir Verantwortung in einer Situation neu organisieren können, in der die Moral aus den Institutionen und dem politischen System zu emigrieren beginnt. Wie soll Verantwortung und Moral künftig auf neue Weise in der Gesellschaft verankert werden? Wichtig ist hierbei, dass es bei den Menschen (aber auch bei den wach gewordenen Unternehmen) eine starke Sehnsucht gibt, Verantwortung zu übernehmen und für einen neuen ethischen Konsens in Staat und Wirtschaft einzutreten. Der neoliberale Zeitgeist der 1990er und 2000er Jahre hat dazu geführt, dass wir einen Sozialstaat aufgebläht haben, der Menschen verwaltet und zur Passivität verpflichtet hat. Zugleich haben wir eine transnationale Wirtschaftsordnung etabliert, die Eigeninitiative und Entrepreneurship ausschließt.
Kapitel 3 dringt noch tiefer in die Sehnsuchtswelten der Menschen ein. Was viele momentan umtreibt, ist die Sehnsucht nach einem neuen großen WIR, nach Identität und Aufgehobensein in einem Kollektiv. Während uns der Wellness-Hype der vergangenen Jahre unkomplizierte Selbstfindung in der Sauna vorgaukelte, richten sich die Wünsche der Menschen heute auf neue Erfahrungswelten, die sie mit anderen teilen können. Aber auch hier gibt es große Erwartungen (beispielsweise gegenüber Facebook), die nicht immer halten, was sie versprechen. Wichtig ist aber, den Trend greifbar zu machen: Wenn wir in den nächsten Jahren über Identität und Erfahrung reden, dann hat das nichts mehr mit dem Ego-Trip im Edel-Spa zu tun, sondern mit der Sehnsucht, ein neues Wir leben zu können. Dass es dabei ausgerechnet auf dem Feld der Politik und des Bürgerengagements zu einem Durchbruch kommen würde, war für mich zu Beginn der Arbeit an diesem Buch noch nicht absehbar. Spätestens seit Stuttgart 21 kann man von einer neuen Bürgerbewegung sprechen, die sich daran gemacht hat, deutlich »Wir« zu sagen. Sapere aude, ein Land hat den Mut, sich der Vernunft zu bedienen. Gut situierte Bürger ketten sich an Bahngleise und protestieren gegen Atomenergie. Studienräte im Manufactum-Look lassen den Literaturzirkel einmal ausfallen, und Agenturchefs verschieben die Business-Meetings, um sich für den Erhalt von uralten Bäumen einzusetzen.
Kapitel 4 untersucht, wie die Sehnsucht nach Teilhabe an dem Schicksal unserer Welt zu wachsen beginnt. Politik verlagert sich wieder auf die Straße, kommt auf neue Weise ins Fernsehen und unterstreicht nebenbei, dass Veränderung vorerst nicht in den Social Media, sondern in der Wirklichkeit stattfindet.
Kapitel 5 beschäftigt sich direkt mit der Medienlandschaft in unserem Land. Wenn wir die Weichen für die Zukunft jetzt stellen wollen, müssen wir uns Klarheit über den Status der Medien in der Gesellschaft verschaffen. Die Diagnose indes ist eher ernüchternd: Wir stehen vor den Trümmern eines dualen Fernsehsystems. Das Privatfernsehen hat sich längst von der Tugend, Realität zu erklären, verabschiedet und versinkt in Schund und Niveaulosigkeit. Zugleich haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender in einen selbst auferlegten Konkurrenzkampf mit den privaten begeben, der zuerst zur Selbstkommerzialisierung und dann zur Selbstvergreisung geführt hat. Auch angesichts der Herausforderung der klassischen Medien durch Digitalisierung und Social Media wirken die großen Verlage und Sender eher verzagt. Dabei ist jetzt schon klar, dass sie die neue Konkurrenz nicht fürchten müssen und wieder einmal die Kulturrevolution nicht eintritt. Denn was – trotz Facebook & Co. – an neuen Erscheinungen in unserer Medienwelt feststellbar ist: Wir lesen und schreiben mehr als jemals zuvor.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Sehnsucht der Menschen nach ursprünglichen, authentischen Lebensformen. Doch mit dieser Sehnsucht wird zukünftig nicht ein reaktionärer Wunsch nach der alten Zeit verbunden. Ganz im Gegenteil. Viele Bewegungen, die sich für eine neue Ernährungs- und Genusskultur einsetzen, fordern neue Wertschöpfungsmodelle. Kurzum, die Suburbanisierung unseres Lebensstils, bestehend aus Shoppingmall, Autokultur, Massenmarketing und freistehendem Einfamilienhaus, hat ein Ende. Und dort, wo im 20. Jahrhundert Trennungen vorgenommen wurden (zwischen Lebenswelt und Einkaufswelt, zwischen Konsum und Kommunikation), sehnen sich die Menschen heute nach neuen Bindungen.
In Kapitel 7 wird der Gedanke einer neuen Kultur der Bindungen und des Miteinanders noch einen Schritt weiter verfolgt. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die selbst von Bundeskanzlerin und Bundespräsident als fragmentarisiert und zerrissen bezeichnet wird, dann brauchen wir neue starke Bindungen, um Zukunft wieder möglich zu machen. Dazu gehört an zentraler Stelle, dass das Rückgrat der Wohlstandsgesellschaften, die Mittelschicht, einen Mentalitätswandel vollzieht. Die »Scary Rich« werden sich überall auf dem Globus nicht nur in Absturzängsten ergehen können, sondern die anderen mit ins Boot lassen müssen. Denn um einen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten, der zu mehr Aufwärtsmobilität zwischen den Schichten führt, darf sich die Mittelschicht nicht weiter mit sich selbst und der Verteidigung ihres Wohlstandskonzeptes beschäftigen, das zudem noch aus dem 20. Jahrhundert stammt.
Die Immobilität der globalen Mittelschichten spielt auch in Kapitel 8 eine wichtige Rolle. Wenn wir eine neue Beziehungs- und Familienwelt schaffen wollen, müssen wir neu über Lebenszeit und Arbeitszeit nachdenken. Wenn wir eine neue Vereinbarung von Mama und Papa zwischen Wiege und Schreibtisch schaffen wollen, dann müssen wir unter anderem über die veralteten Karriererituale der Mittelschichtsmänner reden und über die Ängste der Unternehmen, angesichts einer neuen Zeitkultur die Kontrolle über die Mitarbeiter zu verlieren. Die Reform von Ursula von der Leyen ist ein Anfang, aber die wirkliche Herkulesaufgabe besteht in einem Mentalitätswandel, der mit unseren Lebenszeitmodellen (Lebenszeit, Arbeitszeit, Erziehungszeit, Gefühlszeit) vielleicht endlich auch die Arbeitswelt auf den Kopf stellen würde.
Kapitel 9 stellt die Sinnfrage: Wie kommen wir im 21. Jahrhundert zu Zufriedenheit, Seligkeit oder gar Glück? Hier rückt nochmals der Bedeutungsverlust einer einst machtvollen Institution wie der Kirche ins Zentrum: Während wir Religion und Glaube immer mehr aus unserer Welt hinausdrängen, haben wir uns in den 2000er Jahren zu leichtgläubigen Kunden der Ersatzreligion think positive! gemacht. Beides, sowohl die Entchristlichung unseres Lebensstils als auch der Kult um »Positive Psychologie« und die Milliarden-Euro-Optimismus-Industrie, führen dazu, dass unser persönlicher Gott für das Glück zuständig ist. Welche Konsequenzen das hat, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen.
Wer von Menschen und Märkten permanente Wandlungsbereitschaft verlangt, muss sich auch selbst verändern können. Der Mainstream der Trendforschung hierzulande tut das nicht. Seit Jahrzehnten hat sie sich der unablässigen Proklamation des Wandels und der Marktgläubigkeit verschrieben und ist zu einem Ableger der Optimismus-Industrie geworden. Trendforschung hat sich in Deutschland zu lange um Personen mit dem berühmten »Händchen für Trends« gruppiert, die sich auf ihre Intuition berufen und den Fragen nach Modellen und Methoden eloquent zu entziehen vermochten. Den Rest erledigt die Konjunktur, die doch immer wieder anspringt, sodass der häufig von unergründlichen Bauchgefühlen getriebene Trendforscher wieder verkünden kann, dass alles gar nicht so schlimm ist. In diesem Buch möchte ich keine schnellen Antworten geben und Strategiepläne aus der Hüfte schießen, die in den bunten Powerpoint-Präsentationen immer so einleuchtend aussehen. Dieses Buch markiert einen Abschied von der Trendforschung, wie sie sich in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland dargeboten hat. Mit der Gründung des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (www.zukunftpassiert.de) werden sich auch andere Partner und Forschungswege ergeben. Trendforschung muss nach meinem Dafürhalten in enger Partnerschaft mit universitärer und internationaler Forschung stattfinden.
Intuitive Trendforschung hat jahrzehntelang mit einer Zukunftserwartung kokettiert, die sich in futuristischen Bildern von rückwärtsfliegenden Autos, programmierbaren Haushaltsrobotern und rund um die Uhr arbeitswilligen Menschen ausdrückte. Das Repertoire der bauchgesteuerten Trendforscher war indes begrenzt und eher bescheiden. Meistens reichte es gerade dafür aus, eine flippige Marketingberatung zu machen. Intuitive Trendforschung wurde so zur Entertainmentabteilung des Neuen Marktes und der New Economy. Marketingorientierte Trendforschung ist die Rechtfertigungsbelletristik für die Wachstumsfetischisten und Blasen-Ökonomen. Der Zeithorizont, der in diesem Buch zugrunde gelegt wird, ist für eine Trendanalyse ebenfalls neu. Ich möchte Ihnen keine blumigen, futuristischen Szenarien, wie die Welt im Jahr 2050 aussehen wird, ausmalen. Mir geht es darum, die vergangenen 20 Jahre Revue passieren zu lassen und auf der Grundlage dieser Einsichten die kommenden zehn Jahre begreifbar und planbar zu machen.
Deutschland ist in der Weltwirtschaftskrise mit einem blauen Auge davongekommen. Wir können uns auf einen fleißigen Mittelstand verlassen, auf funktionierende Industrien und Spitzenkompetenz in vielen Zukunftstechnologien. In einer internationalen Umfrage von AlixPartners äußerten 70 Prozent der Deutschen, dass sich die eigene finanzielle Situation durch die Finanzkrise nicht negativ verändert hat. In Frankreich stimmen dem nur 57 Prozent zu, in Großbritannien gerade einmal 48 Prozent. Die Rezession ist hierzulande nicht angekommen, obwohl der viel bejubelte Aufschwung nach wie vor ein geliehener Aufschwung durch Konjunkturspritzen ist.
Trends zu verstehen, heißt ab sofort, die Realität in den Blick zu nehmen und Zukunft planbar zu machen. Trends sind gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeit und Alltag, Branchen und persönlichen Befindlichkeiten betreffen. Sie sind das Gegenteil von vorübergehenden Moden, aufgeregten Hypes und anderen Zeitgeisterscheinungen. In diesem Buch werden die Veränderungen der nächsten Jahre auf dem Gebiet der Gesellschaft, der Politik und der Institutionen analysiert und die Konsequenzen für unser Leben in der Zukunft beschrieben.
Das vorliegende Buch ist keine Abrechnung mit dem Neoliberalismus. Es ist vielmehr eine Bestandsaufnahme der vergangenen 20 Jahre; dabei spielen der neoliberale Zeitgeist und seine Alliierten (Optimismus-Industrie und Mediensystem) eine prominente Rolle. Statt »ismen« zu denunzieren, sollen hier sozioökonomische und soziokulturelle Grundlagen eines Wertesystems sichtbar gemacht werden, aufgrund dessen sich der Neoliberalismus entfalten konnte. Aufklärung ist wichtiger als Entlarvung, Verstehen wichtiger als Verleumdung. Trendforschung muss gerade in der momentanen Lage Kritik am Bestehenden sein und Instrumente entwickeln, die es Gesellschaft und Wirtschaft ermöglichen, aus dem Ist-Zustand zu lernen und Perspektiven für die kommenden Jahre zu entwickeln. Trendforschung hat die Aufgabe, Kritik zu üben, um gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen (und nicht, um noch mehr bodenlosen Optimismus in willfährige Märkte zu pumpen). Nach einer Definition von Lepsius ist ein nützlicher Intellektueller derjenige, der »unter Berufung auf allgemein anerkannte Grundwerte öffentliche Kritik übt«. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Heidelberg, im Januar 2011
Dr. Eike Wenzel
KAPITEL 1
Götterdämmerung: Wie wir künftig mit Idolen, Idealen und Autoritäten umgehen
Hurra, Der Spiegel hat den neuen Deutschen entdeckt! Und zwar mittels einer Umfrage, die er im Spätsommer 2010 von TNS Infratest hat durchführen lassen: »Der ideale Deutsche, von Deutschen gesehen, ist leichtfüßig wie Mesut Özil, fehlbar wie Margot Käßmann, pragmatisch wie Angela Merkel, unprätentiös wie Günther Jauch, konsequent wie Jogi Löw, unbeschwert wie Lena Meyer-Landrut, abgeklärt wie Helmut Schmidt.« Die ganze westliche Welt sucht seit Jahren »den Superstar«. Je weniger in unserer Welt selbstverständlich ist, umso mehr sehnen wir uns nach Idolen und auch nach Autoritäten, möchten aber am liebsten solche haben, wie sie uns das Kommerzfernsehen allabendlich auswirft: Laut Umfrage hätten die Deutschen lieber Günther Jauch als Christian Wulff im Schloss Bellevue gesehen, denn für 84 Prozent der Bevölkerung eignet sich Jauch am ehesten als Vorbild. Die Macht der Medien, speziell des Fernsehens, wenn es darum geht, Idole und leicht verdauliche Autoritäten zu verfertigen, ist eben ungebrochen. Der smarte Günther Jauch selbst weiß, welch selektive Wahrnehmung solchen Einschätzungen zugrunde liegt und wiegelt ab: »Es ist natürlich völliger Unsinn, wenn ich bei Umfragen mal vor, mal nach dem Dalai Lama und dem Papst genannt werde oder der intelligenteste Deutsche sein soll. Wir werden doch nur als Projektionsfläche genutzt.«
Für 83 Prozent der Befragten, so die Spiegel-Umfrage weiter, verkörpert Helmut Schmidt das Deutschland, das die meisten sich wünschen. Schmidts Beliebtheit wird immer an seinem hohen Alter aufgehängt und daran, dass er Kette raucht – als wäre er ein Übriggebliebener aus einer anderen Zeit. Schmidt wird von den (älteren) Deutschen in erster Linie deshalb als moralische Instanz geschätzt, weil er in der größten Staatskrise der Nachkriegszeit, der Schleyer-Ermordung und dem Geiseldrama in Mogadischu, standhaft die Staatsräson verteidigt hat. Schmidt hat diesen schweren Konflikt, der darauf hinauslief, ob sich der Staat erpressen lässt, durchgestanden und ist dabei persönlich und als Bundeskanzler an die Grenze des Menschenmöglichen geraten. Das macht ihn zur moralischen Instanz Nummer eins in unserem Land. Autorität geht nach wie vor mit altmodischen Begriffen wie moralischer Integrität und Prinzipientreue einher – und Helmut Schmidt verkörpert genau diese Tugenden.
Die Vorturner der Nation: Autoritäten oder Armleuchter
Dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sei die auflagensteigernde Schlagzeile, dass wir in einem Land leben, in dem ein Quizmaster angesehener ist als der Papst, gegönnt. Aber bringt uns das wirklich weiter? Es zeigt, dass wir über Autorität, Integrität und Popularität nicht immer nach rationalen Kriterien entscheiden und unsere Meinungsbildung von medialen Idealisierungen beeinflusst ist. Abgesehen davon war es schon immer so, dass Intellektuelle wie Grass oder Enzensberger niemals die Popularität eines erfrischend jungen und eleganten Kickers wie Mesut Özil erlangen werden. Der Autor des Spiegel-Artikels, offenbar getrimmt, starke Bilder und Begriffe zur Unterstützung einer ziemlich lapidaren Studie zu kreieren, greift dann noch tief in den kollektiven Metaphernschatz des Landes und tituliert Merkel als »Trümmerfrau«, nur weil sie keine Edelrhetorikerin ist und sich zu oft mit hochgezogenen Schultern verteidigungsbereit macht. Dass Josef Ackermann und der böse Gangsta-Rapper Bushido ähnlich unbeliebt, aber zugleich nicht völlig unmöglich bei den Deutschen ankommen, ist auch keine aufwühlend neue Erkenntnis.
Unser Umgang mit Autoritäten ist eine vertrackte Angelegenheit. In jeder Talkshow wird die Binsenweisheit gedroschen, dass wir autoritäres Gehabe nicht ausstehen können, weil es nicht mehr in unsere Welt passt, aber dass wir uns sehr wohl nach so etwas wie »natürlicher Autorität«, Charisma und »visionärer Führung« sehnen. Angela Merkel solle endlich einmal durchregieren, verlautet es aus der eigenen Partei, aus den Reihen der politischen Mitbewerber und in den Salongespräche der Journalisten bei Maybrit Illner und Anne Will. »Durchgreifen« schleicht sich aus dem reaktionären Vokabular in den Alltagssprech im Büro, wenn Demonstrationen außer Rand und Band geraten oder auch nur der FC Bayern nicht mehr siegt.
Unheimlich gerne aber stoßen wir unsere Ideale auch vom Sockel. In letzter Zeit am liebsten vor den skandalhungrigen Augen der Weltöffentlichkeit mit anschließendem Rosenkrieg und Ausweidung der sexuellen Vorlieben der Beteiligten. Margot Käßmann kostet ein Glas Wein zu viel das Amt, Kachelmann verschwindet in Hochsicherheitsfahrzeugen, wie wir es aus Gangsterfilmen kennen, Klaus Zumwinkel wird von der Staatsanwältin aus seinem Haus gezerrt.
Wir entlarven die Vorturner der Nation bei erstbester Gelegenheit und fordern einen Wertewandel. Seit Ende der 1990er Jahre trauen sich die Deutschen wieder, konservativ zu sein. Erste »Träume von Jamaika«, einer Koalition der Modernität und Werte zwischen Grün, Schwarz und Gelb oder Grün, Schwarz und Rot werden geträumt, eine Politik der Werte und des Wertebewusstseins angemahnt. Und das ausgerechnet von Seiten der Grünen. Joschka Fischer, der sich 2001 noch einmal zu seiner paramilitärischen Vergangenheit äußern musste, stellte später fest, dass diejenigen, die sich früher als Bürger und Anti-Bürger (Bürgerschreck) am Familientisch gegenübersaßen, plötzlich gemeinsame Überzeugungen und Werte entdecken. Mitten in der Anzeigenkrise zu Beginn des neuen Jahrtausends erblickte ein wertkonservatives Magazin wie Cicero das Licht einer nach dem 9. September 2001 aus den Fugen geratenen Welt und provozierte mit klugen Gedanken gegen den linksliberalen Medienmainstream. In den letzten fünf Jahren ist die verkaufte Auflage des hochpreisigen Magazins von 54966 Exemplaren (2005) auf 82 320 Exemplare (2010) angestiegen. Die Reichweite pro Ausgabe liegt sogar bei 318 000 Lesern (AWA 2009). Cicero bietet Orientierung, ordnet für den Leser die Welt, lässt polarisierende Gastautoren zu Wort kommen und widmet sich mit Vorliebe komplexen und schwer zu fassenden Themen wie Klimawandel, Ökowelle, kürt die wichtigsten Ost- und Westdeutschen und lässt die einflussreichsten Intellektuellen per Umfrage ermitteln.
Geben wir es ruhig zu: Wir sehnen uns nach Autorität und Orientierung. Oder, wem das zu moralisch klingt: nach Grundsatztreue und einer stimmigen Persönlichkeit. Anspruch und Wirklichkeit sollen in Einklang stehen. Wir wünschen uns eine Welt, in der es klare Rahmensetzungen gibt, die unserem Leben Sinn geben. Heute avancieren Bücher zu Bestsellern, die an Sekundärtugenden und alte Werte appellieren, vor allem in der Kindererziehung. Lob der Disziplin (2006) heißt der Bestseller des ehemaligen Direktors des Eliteinternats Salem, Bernhard Bueb, Von der Pflicht zu führen der nachgeschobene Hit des Pädagogen. Kinder sollen sich nicht mehr alles erlauben dürfen. Wenn wir in unseren eigenen vier Wänden keine »kleinen Diktatoren« heranzüchten wollen, dann müssen wir ihnen mit Autorität begegnen. Das Buch Warum unsere Kinder Tyrannen werden von Michael Winterhoff hielt sich lange in den Bestsellerlisten. Schluss mit dem Ausdiskutieren und Relativieren, mit dem Wegdiskutieren von Hierarchien (zwischen Kind und Erziehungsberechtigten, Mitarbeiter und Chef, Universitätsprofessor und Studentin). Der Psycho-Experte Winterhoff sprach in seinen Bestsellern das aus, was allen auf der Zunge lag: Kinder brauchen Führung und Autorität. Und wenn sich die eigene Brut zum Tyrannen aufschwingt, dann liegt das daran, dass sich die Eltern diesem Führungsanspruch verweigern.
In der CDU, das scheint offensichtlich, möchten viele nach all den Jahren des weichgespülten Positionierens und Profilierens in der »gemainstreamten« Erlebnisgesellschaft der Berliner Republik gerne mal wieder so richtig klare Kante zeigen, den eigenen Standpunkt klar benennen, durch Herausforderung des politischen Gegners die eigene Position markieren, nicht immer vage bleiben, nach Gutsherrenart konservativ und endlich einmal nicht mehr politisch korrekt sein. Friedrich Merz musste gehen, Roland Koch warf genervt das Handtuch, beides exzellente Wirtschaftsfachleute, beide stramm konservativ, weil sie des vagen Kurses der Politik überdrüssig waren.
Doch dieses Retro der klaren Kante ist auch in anderen Parteien und auf anderen gesellschaftlichen Schauplätzen zu vernehmen. Die Sehnsucht nach neuen »alten« Werten durchzog die ganze erste Dekade des 21. Jahrhunderts. Die einen sahen eine neue Spießigkeit heraufziehen, die anderen debattierten mit visionärem Pathos über die Zukunft der Bürgergesellschaft. Ausgerechnet die taz widmete der Sehnsucht nach dem Bürgerlichen eine ganze Artikelserie. Der Berliner Historiker Paul Nolte avancierte zum Philosophen der Phalanx der Autoritätshungrigen, die auf einmal von taz bis FAZ reichte, mit Sätzen wie diesen: »Es geht um die Wiederentdeckung und Hochschätzung von Werten und Konzepten, die vor nicht allzu langer Zeit als altmodisch, verstaubt, überholt, als ›konservativ‹ oder gar reaktionär im schlechten, abwertenden Sinne des Begriffs gegolten hatten.« (Aus Noltes Buch Generation Reform.) Was die Lage für die in der CDU und CSU verbliebenen Konservativen dessen ungeachtet so hoffnungslos machte, ist Folgendes: Während der gesellschaftliche Mainstream von Liberalen über Sozialdemokraten bis zu den Grünen Wertebewusstsein und konservativ-bürgerliche Ideale predigt, hat sich der Konservatismus der CDU immer reaktiv aus der Abgrenzung gegenüber 68, Sozialismus und den Protestbewegungen definiert. Man war »bei sich« (und glaubte bei seiner Wählerklientel zu sein), wenn man gegen die Reform des Sexualstrafrechts, gegen die rechtliche Anerkennung von nicht ehelichen Lebensgemeinschaften und Homosexualität war. Und während Linke und Liberale jetzt aktiv und unvorbelastet eine neue Werterepublik ausrufen können, ist für die Christdemokraten kein Platz im Rennen um den universell verbürgerlichten Wähler.
Weil wir dieses Wertevakuum spüren, »wertebewusst«, aber nicht spießig sein wollen, greifen wir vorläufig auf bewährte Autoritäten zurück, auch wenn wir dabei hin und wieder gerne ein bisschen Geschichtsklitterung betreiben müssen, wie bei Helmut Schmidt. Oder wir fantasieren von Charismatikern, die auf anderen Feldern der Gesellschaft reüssierten, aber nicht ernsthaft für staatstragende Ämter infrage kommen. Als einer der Ersten wird gerne der Fußballheilige Franz Beckenbauer aufgerufen, es folgen die Schwiegersöhne der Nation: Günther Jauch, Jörg Pilawa und so weiter. Wir hofieren Autoritäten, wenn sie längst außer Dienst sind und sich nicht mehr zur Wehr setzen können. Ansonsten macht es uns einen Heidenspaß, wenn wir Idole und Promis immer wieder einmal vom Sockel stoßen können. Die ernste Frage, die sich daran anschließt, lautet allerdings: Wie lange können wir uns dieses Schwanken im Ungefähren noch leisten? Denn unsere Kultur wurde in den vergangenen rund zwei Jahren von Ereignissen heimgesucht, die gezeigt haben, dass Autorität in unserer Gesellschaft gerade den Offenbarungseid zu leisten hat.
Drei Vorfälle, die zwischen März und Juli 2010 die deutsche Öffentlichkeit erreichten, stellen sozusagen historische Zäsuren dar. Erstaunlicherweise führten sie jedoch zu keinen tieferen Erschütterungen im kollektiven Mindset, auch zu keinem nachdenklichen Innehalten. Innerhalb kurzer Zeit sind wichtige, staatstragende Institutionen in sich zusammengebrochen, und bislang moralisch unangefochtene Autoritäten haben sich als gespaltene Persönlichkeiten offenbart. Gemeint sind: 1. die Kirche durch die Missbrauchsskandale, 2. die Missbrauchsskandale in einem pädagogischen Eliteprojekt wie der Heppenheimer Odenwaldschule und 3. die politische Sphäre, in der in diesen Monaten wichtige Staatslenker das Zepter aus der Hand gaben. Staatsämter, Führungsstäbe und Kanzeln wurden fluchtartig verlassen. Ethisch unzweifelhafte Institutionen gaben ihren verfaulten Kern preis. Amt und Würde entkoppelten sich – vor den Augen der Weltöffentlichkeit und auf der Basis erdrückender Beweislast. Offenbar können wir uns nicht länger diese unentschlossene Haltung zu Autoritäten leisten. Im Frühsommer 2010 merkten wir plötzlich, dass Ämter und Institutionen leer wirkten und verlassen und kompromittiert wurden. Und wir stellten fest: Unserer Gesellschaft fehlt etwas.
Dass das Vertrauen der Menschen in Institutionen sinkt, ist kein neues Phänomen und betrifft nicht nur die bundesdeutsche Gesellschaft. Trotzdem sind die Zahlen besorgniserregend: Zwischen 1990 und 2009 ist die Zahl der SPD-Mitglieder von 949 550 auf 512 520 geschrumpft, was einen Rückgang um fast die Hälfte bedeutet ( – 46 Prozent). Die CDU hat es nicht besser getroffen, im gleichen Zeitraum verlor die Regierungspartei 33 Prozent ihrer Mitglieder, 1990 waren es noch genau 777767 Mitglieder bei den Christdemokraten, 2009 nur noch 521 149. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bekommt seit der Wiedervereinigung bis heute ebenfalls seinen Mitgliederschwund nicht in den Griff: 1990 hatte die Gewerkschaft noch stolze 7 937 923 Mitglieder, 2009 waren davon nur noch 6 264 923 übrig – ein Schwund von 21 Prozent. Bei den beiden großen Kirchen in Deutschland haben die Missbrauchsfälle eine Austrittswelle beschleunigt, die ohnehin seit Jahren auf hohem Niveau lag: 1990 zahlten insgesamt 57 694 000 der wiedervereinigten Deutschen ihre Kirchensteuer, 2009 waren es bereits 15 Prozent weniger, nur noch 49 104 000. Laut einer Forsa-Umfrage vom April 2010 könnte die Dynamik bei den Kirchenaustritten noch deutlich zunehmen. Fast ein Viertel (23 Prozent) der Deutschen denkt über einen Austritt nach. Sogar 19 Prozent derjenigen, die sich selbst als tiefgläubig bezeichnen, gehören zu den Empörten und Entgeisterten. Bei rund 25 Millionen Katholiken in Deutschland könnte das in nächster Zeit einen Verlust von gut fünf Millionen Mitgliedern für die Kirche bedeuten.
Die Rücktritte der CDU-Politiker haben natürlich gar nichts mit den Missbrauchsfällen an den Schulen und in der Kirche zu tun. Aber in allen drei Fällen gerieten innerhalb kürzester Zeit Institutionen ins Wanken, staatstragende Ämter verwaisten, Autoritäten wurden infrage gestellt oder führten sich selbst ad absurdum. Die Rücktritte von Köhler, Koch, von Beust, Rüttgers und auch Oettinger haben alle ihre Situationsabhängigkeit und ihre persönlichen Hintergründe. Doch sie geschahen unisono ziemlich abrupt und beendeten einen Lebensentwurf an der Spitze der Gesellschaft. Mit den Missbrauchsfällen an der Odenwaldschule wird ein pädagogisches Reformprojekt gerichtsnotorisch, und ein ganzer Traditionsstrang der bundesrepublikanischen Elite muss sich fragen lassen, warum man davon nichts gewusst hat. Das Gleiche in der Kirche: Innerhalb kürzester Zeit kamen weltweit mehrere hundert Missbrauchsfälle ans Tageslicht. Noch etwas haben die drei Ereignisse gemeinsam: Sie zeigen, dass Entkopplung von Amt und Würde leider auch ein ganz spezielles Drama der Männer ist. Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, zog als Einzige sofort die Reißleine.
Ende der Volksparteien, Abpfiff für Überzeugungstäter und die Autoritätslücke
»Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten — mit sofortiger Wirkung. Ich danke den vielen Menschen in Deutschland, die mir Vertrauen entgegengebracht und meine Arbeit unterstützt haben. Ich bitte sie um Verständnis für meine Entscheidung.« Berlin, 31. Mai 2010, 14:02 Uhr, Bundespräsident Horst Köhler erklärt seinen Rücktritt. Zerrieben zwischen den Anfeindungen der Opposition und mangelnder Unterstützung durch CDU und F DP, verlässt der beliebte Bürger-Präsident die Kommandobrücke. Köhler wollte ein politischer Präsident sein, was in der Verfassung eigentlich nicht vorgesehen ist. Der Spiegel verhöhnte ihn in Anspielung auf den an Demenz erkrankten Ex-Bundespräsidenten Heinrich Lübke zuletzt als »Horst Lübke«. Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik kündigt ein Bundespräsident. Innerhalb von vier Wochen muss das Amt neu besetzt werden. Die Kür des Kandidaten gerät zur Farce. Angela Merkel schickt den farblosen Landesfürsten Christian Wulff in den Kampf, während die Opposition mit der Berufung Joachim Gaucks einen Wirkungstreffer landet. In Umfragen schneidet Gauck regelmäßig besser ab. Laut »Deutschland-Trend« der ARD vom 11. Juni 2010 würden 40 Prozent Joachim Gauck wählen und nur 31 Prozent sich für Christian Wulff aussprechen. Die Social-Media-Gemeinde auf Twitter tritt unter dem Hashtag »mygauck« eine riesige Sympathiewelle für den ostdeutschen Bürgerrechtler los. Und was noch erstaunlicher ist: Die meisten Printmedien, allen voran die konservativen Blätter Bild am Sonntag, Welt am Sonntag und Frankfurter Allgemeine Zeitung, legen sich für Gauck ins Zeug. Trotzdem wählt die Bundesversammlung Christian Wulff im dritten Wahlgang mit 625 zu 494 Stimmen zum neuen Bundespräsidenten, während der gescheiterte Kandidat Gauck dazu ansetzt, Popstar-Status zu erlangen.
Politik, Deutschland 2010, eine Tragikomödie. Kandidaten werden mit Hängen und Würgen durchgebracht, Wahlen führen zu keinen Entscheidungen mehr. Wir leben in einem Dauerzustand der tendenziellen Unregierbarkeit und des stets dräuenden Misstrauensvotums. Wenn das Vertrauen nicht von der Opposition gekündigt wird, dann vom Wähler. Wahlen geraten immer häufiger zu Rechenkunststücken. Vollblutpolitiker ziehen die Notbremse und verabschieden sich in die Privatwirtschaft. Politik wird zur Teilzeitbeschäftigung, Politiker werden zu ordentlich bezahlten Zeitarbeitern, die pragmatisch ihren Job machen, weil Visionen oder Ideologien verpönt sind.