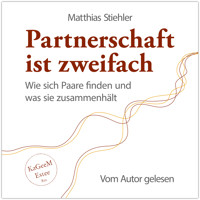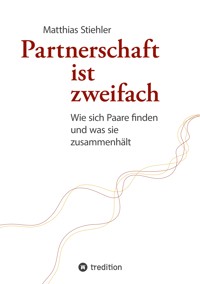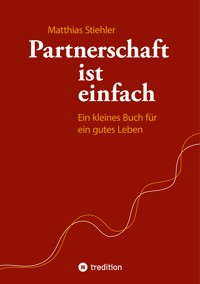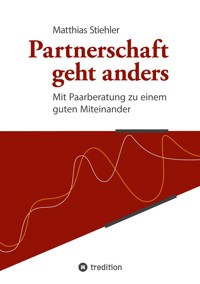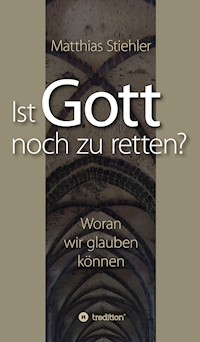
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum scheitert die menschliche Sehnsucht nach einer gerechten und friedlichen Welt wieder und wieder? Warum gelingt es bestenfalls, Ungerechtigkeit und Leid ein wenig zu verringern, aber nie wirklich zu besiegen? Warum bleibt die Erlösung der Welt seit Jahrtausenden aus, obwohl sie von den Religionen immer wieder versprochen wurde? Matthias Stiehler geht diesen grundlegenden Fragen unserer Existenz nach. Die Antwort findet er in der Entstehung des Christentums - allerdings in überraschender Weise. Das erste Jahrhundert unserer Zeit war gekennzeichnet von großen Hoffnungen auf Erlösung der Welt. Der Lauf der Geschichte zeigte jedoch, dass sie sich nicht erfüllten. So wurden sie in eine immer unbestimmtere Zukunft verschoben - oder es musste von ihnen gelassen werden. Letzteres aber setzt voraus, Gott nicht als allmächtigen Herrscher zu verehren, sondern als den, der im Scheitern präsent ist. Stiehler beschreibt den Abschied von der Illusion auf eine bessere Welt als den sinnvollen Weg auch in unserer Zeit zunehmender Gleichgültigkeit. Er eröffnet damit ein tiefes Verständnis menschlichen Lebens, das für Christen wie Nichtchristen nachvollziehbar ist. www.ist-gott-noch-zu-retten.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Matthias Stiehler
»Ist Gott noch zu retten?«
Matthias Stiehler
Ist Gott noch zu retten?
Woran wir glauben können
Matthias Stiehler, »Ist Gott noch zu retten?«
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
© 2016 Matthias Stiehler
www.matthias-stiehler.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Matthias Stiehler
Umschlaggestaltung: Andreas Tampe
Umschlagbild: Matthias Stiehler,
Ruine der Abtei Saint-Mathieu, Bretagne
ISBN Paperback 978-3-7345-7434-4
ISBN Hardcover 978-3-7345-7435-1
ISBN E-Book 978-3-7345-7436-8
Inhalt
Der Bedeutungsverlust des Christentums für unser Leben
Warum gerade ich dieses Buch schreibe
Teil 1 Die Frage nach Gott
Wer oder was ist Gott?
Religion ist Menschenwerk
Es gibt noch Gewissheiten
Phänomene einer ›Grundordnung des Lebens‹
Der Ursprung von Religiosität
Das Wahre, das Gute, das Schöne
Der Charakter der Grundordnung
Grundordnung, höchstes Prinzip oder Gott?
Das Versprechen eines sinnerfüllten Lebens
Teil 2 Das Christentum als Religion ohne Illusionen
Der Besitz der Wahrheit
Das Volk Israel: Die Bedeutung von Religion als Identität stiftende und Halt gebende Instanz
Die Geschichte der Geburt des Christentums: Das Scheitern einer Sehnsucht
Ein religiöser Paradigmenwechsel
Jenseits von falschen Hoffnungen und resignativer Gleichgültigkeit
Und heute?
Die Entwertung der ›Grundordnung des Lebens‹
Die Begrenzung unserer Lebendigkeit
Die Realität menschlicher Entfremdung
Der Schmerzensmann
Die Tiefe des Lebens
Teil 3 Wege eines gelingenden Lebens
Ist es wirklich (nicht) so schlimm?
Der dritte Weg
Falsches Leben, richtiges Leben
Räume für die Tiefe des Lebens
Individuelle Wege
Gemeinsame Wege
Das weiße Blatt Papier
Literatur zum Weiterlesen
Der Bedeutungsverlust des Christentums für unser Leben
In diesem Buch geht es ums Christentum. Doch was soll das eigentlich? Wissen wir nicht längst genug darüber? Es gibt unzählige Bücher, die sich mit jedem noch so kleinen Detail christlicher Geschichte und christlicher Lehre befassen. Ganze Bibliotheken lassen sich damit füllen. Da werden historische Erkenntnisse beleuchtet, es gibt meterweise Ausarbeitungen und Ausdeutungen zu jeder beliebigen Bibelstelle und Woche für Woche wird in unzähligen Kirchen unseres Landes und weltweit über den christlichen Glauben und das christliche Leben gepredigt. All das ist uns so vertraut, dass wir vermutlich nichts Neues oder gar Überraschendes erwarten. Selbst diejenigen, die sich nicht so sehr mit Einzelheiten der christlichen Religion befasst haben und die sich eher kirchenfern sehen, haben sich eine Meinung gebildet und auch ihr Urteil steht längst fest. Irgendwo zwischen rückhaltloser Bejahung und kategorischer Ablehnung dessen, was uns die kirchliche Tradition vermittelt, hat jeder von uns seinen Platz gefunden und sich darin mehr oder weniger gut eingerichtet.
Dabei stoßen wir in unserer heutigen Gesellschaft auf ein interessantes Phänomen. Einerseits ist unsere Kultur derart vom Christentum geprägt, dass wir irgendwie alle so etwas wie Christen sind – nicht unbedingt in der Religionszugehörigkeit, aber doch im grundlegenden Verständnis unseres Lebens. Unser Ethos basiert auf der christlichen Tradition, unsere Sicht des alltäglichen Zusammenlebens und unserer Gesellschaft ebenso. Und selbst Kirchenkritik argumentiert sehr häufig christlich. Wir leben mit diesem Christentum, ob wir es wollen oder nicht, ob wir Kirche und Glaube ablehnen oder nicht.
Doch trotz dieser Selbstverständlichkeit verliert der gelebte christliche Glaube zunehmend an Faszination. Irgendetwas ist da, was es uns schwer macht, die christliche Religion ernst zu nehmen und ihr über die traditionellen Feste hinaus eine Bedeutung für unser Leben einzuräumen. Dabei sehe ich nicht einmal die bewussten Atheisten als entscheidend für den zunehmenden Bedeutungsverlust des Christentums an. Es liegt nicht an denen, die mit hoher Intellektualität und oftmals auch großer Redlichkeit argumentieren, warum sie an keinen Gott glauben können. Es sind vielmehr die unzähligen Menschen, denen das Christentum gleichgültig geworden ist, die dessen Bedeutungsverlust besonders aufzeigen. Sie bleiben manchmal sogar Kirchenmitglied. Es macht ihnen jedoch zunehmend weniger aus, bei einer sich bietenden Gelegenheit ihren Austritt zu erklären. Und das geschieht dann oft ohne große Emotionen und erstaunlich leicht. Ein christlicher Glaube spielt in ihrem Leben ob mit oder ohne Kirchenmitgliedschaft kaum noch eine Rolle – wenn wir einmal von dem schmückenden Beiwerk für Familienfeiern absehen. Es ist so, als ob der Magnetismus der christlichen Religion längst schwach geworden ist und immer weiter nachlässt. Es ist so, als ob es egal sei, ob man noch Christ sei oder nicht.
Und nun unternehme ich also den Versuch, die Relevanz des christlichen Glaubens für uns gegenwärtige Menschen aufzuzeigen. Dabei verstehe ich die Gleichgültigen doch sehr gut. Ab und an verschlägt es mich in einen Gottesdienst. Wenn ich dann der Liturgie und der Predigt lausche, befällt mich regelmäßig Müdigkeit und ich habe Mühe, wach zu bleiben. Es geht in den Gottesdiensten nicht sehr lebendig zu und mit meinem Leben hat das Gesagte wenig zu tun. Selten, dass ich nach dem Gottesdienst nicht bereue, meine Zeit damit vertan zu haben. Auch ich bin also einer, der mehr aus Gewohnheit denn aus voller inniger Überzeugung Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist. In meinem Alltag spielt Kirche kaum eine Rolle.
Vielleicht haben Sie gemerkt, dass ich gerade von ›Kirche‹ und nicht wie zuvor von ›christlicher Religion‹ gesprochen habe. In der Wahrnehmung vieler Menschen besteht hier kein Unterschied. Kirche als Institution ist der Ort, an dem christliche Religion gelebt wird. Beides gehört zusammen. Dem entspricht übrigens auch die christliche Lehre. Im Glaubensbekenntnis heißt es im dritten Abschnitt: »Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche…«.
Selbstverständlich gibt es auch eine Reihe von Menschen, die sagen: »Ich glaube schon an Irgendetwas. Aber mit Kirche habe ich nichts am Hut.« Aber kann man seinen Glauben wirklich so unabhängig leben? Zumindest besteht dann die Gefahr, dass man sich seinen Glauben so zurechtbiegt, dass er angenehm, nett und belanglos ist. Das Störende, das eine religiöse Überzeugung immer auch bedeutet, geht verloren. Und hier greife ich einmal vor und mache Sie hoffentlich neugierig: Gerade das Störende macht den Ursprung des Christentums aus. Das Sperrige, das Ungewohnte, das Anstößige stand am Beginn dieser Religion und ist tragischerweise in der heutigen Kirche weitgehend verloren gegangen. Daher könnten die persönlichen Glaubensvorstellungen, die sich vermeintlich von der Kirche abwenden, sogar eine Fortschreibung dessen sein, was in der Kirche seinen Ausgangspunkt nahm. Doch dazu später mehr.
Wenn ich hier also eine Unterscheidung zwischen christlicher Religion und Kirche mache, dann deswegen, weil ich die Kirche heutzutage kaum noch als Bewahrer christlicher Religion ansehe. Und dabei mache ich bewusst auch keine Unterscheidung zwischen den einzelnen christlichen Kirchen. Auch das wird später noch deutlich werden. Aber zugleich sage ich auch, dass das schlimm ist – eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Die Institution, die der Gralshüter des Christentums sein sollte, trägt zur allgemeinen Gleichgültigkeit ihm gegenüber bei. Sie verlor gleichermaßen den Kontakt zu den eigenen Wurzeln wie zur Situation der Menschen heute.
Doch ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass sich das einfach so ändern ließe. Zu übermächtig sind die Traditionen und Entwicklungen. Und daher mache ich nun doch eine Unterscheidung zwischen der christlichen Religion und der christlichen Kirche. Von den Kirchen in ihrer jetzigen Ausprägung kann und möchte ich Sie nicht überzeugen. Doch ich möchte Ihnen das Christentum näherbringen – wenn auch anders als unser Bild vom Christentum so allgemein ist. Denn es ist in seinem Wesen wirklich grundlegend anders, als wir es heutzutage wahrnehmen und es uns die Kirchenvertreter – seien sie liberal, evangelikal oder was auch immer – nahebringen.
Ich möchte Sie also einladen, neu über die christliche Religion und den christlichen Glauben nachzudenken. Doch dazu muss ich Sie um etwas Entscheidendes bitten: Versuchen Sie, zunächst all das beiseitezulegen, was Sie über das Christentum zu wissen glauben. Beachten Sie beispielsweise einmal nicht, wie Sie seit Ihrer Kindheit Weihnachten oder Ostern erlebt haben. Besonders diese beiden Feste prägen unser heutiges Bild vom Christentum. Doch hat – wie ich noch zeigen werde – die Art, wie diese Feste begannen werden, kaum etwas wirklich mit dem Christentum zu tun. Provokant ließe sich formulieren, dass unsere Art, diese Feste zu feiern, einen regelrechten Angriff auf das Christentum darstellt. Doch auch, wenn ich es nicht so provokant formuliere und anerkenne, dass manches, wie sich heute christlicher Glauben gestaltet, nicht völlig verkehrt ist, stehen uns die gewohnten Denkmuster im Weg.
Ich möchte Sie daher zu einem Experiment einladen: Stellen Sie sich ein weißes Blatt Papier vor. Der große Raum daneben ist das, was Sie über das Christentum wissen beziehungsweise zu wissen glauben. Und es ist in diesem Moment egal, ob Sie das als falsch oder richtig, gut oder schlecht ansehen und ob es eine Bedeutung für Ihr Leben hat oder nicht. Schauen Sie nur auf das weiße Blatt Papier. Darum geht es jetzt. Das möchte ich beschreiben und Ihnen vorlegen. Am Ende können Sie dann selbst entscheiden, ob Sie lieber zu dem Vertrauten zurückkehren oder ob da auf dem Papier etwas steht, was Sie das Christentum anders sehen lässt.
Warum gerade ich dieses Buch schreibe
Ich möchte noch ein Wort zu mir sagen, zu meinem persönlichen Hintergrund. Denn wieso sollte gerade ich Ihnen etwas Neues über die christliche Religion zu sagen haben? Die Antwort ist einfach: Ich kenne sowohl den traditionellen Glauben als auch die Gleichgültigkeit dem Christentum gegenüber. Mit beiden Seiten musste ich mich in meinem Leben auseinandersetzen, ich kann beides verstehen und doch keinen dieser Wege akzeptieren. Ich musste eine andere Haltung entwickeln, die mir Antworten gibt, mit denen ich etwas anfangen kann. Dabei erkannte ich, dass es oftmals das Offensichtliche ist, das uns näher zur Wahrheit führt. Diesen Weg möchte ich in diesem Buch mit Ihnen beschreiten.
Ich komme aus einem der religionslosesten Gebiete unserer Welt, aus der ehemaligen DDR. Hier war der Atheismus Staatsdoktrin und auch ich wurde in diesem Sinne erzogen. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater mit etwa drei Jahren fragte, ob es einen Gott gibt. Ich hatte davon vermutlich im Kindergarten gehört. Mein Vater erklärte mir daraufhin, dass es Menschen gäbe, die an einen Gott glauben, weil sie Angst vor dem Tod haben. Aber nun seien ja Kosmonauten in das Weltall geflogen und hätten keinen Gott gesehen. Damit sei ein für alle Mal bewiesen, dass es ihn nicht gibt. Damit hatte sich die Frage für ihn und damit auch für mich erst einmal erledigt.
Aber es wäre falsch anzunehmen, dass solch eine schlichte Argumentation, wie sie sich dann in der DDR-Schule fortsetzte, die einzige Ursache für die zunehmend atheistische Gesellschaft war. Die antichristliche Ideologie der DDR hat diese Entwicklung sicher beschleunigt. Aber die alten Bundesländer, deren kirchliche Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg ungebrochen fortgeschrieben wurde, ziehen in dieser Beziehung seit Jahren nach. Auch sie entkirchlichen sich immer mehr. Ostdeutschland ist in der Vorreiterrolle. Der Verlust religiöser Selbstverständlichkeit ist hier weiter vorangeschritten, er ist normaler. Wir ehemalige DDR-Bürger wissen auch, dass dies nicht den Untergang der Welt bedeutet. Und so bin auch ich durch diese Entwicklung nicht beunruhigt. Mir geht es nicht darum, religiöse Traditionen ungefragt zu verteidigen. Ich führe keine Abwehrschlacht.
Zugleich bin ich persönlich jedoch den umgekehrten Weg gegangen. Als Jugendlicher wandte ich mich dem christlichen Glauben zu, war begierig, neue Antworten zu meinem Leben zu finden und mich von der manchmal recht primitiven Art und Weise zu befreien, mit der mir die staatssozialistische Ideologie entgegentrat. Ich ließ mich ganz bewusst taufen und wurde mitten im Sozialismus ein neues Kirchenmitglied. Diesen Weg beschritt ich konsequent weiter und studierte von 1983 bis 1989 am Theologischen Seminar Leipzig Theologie. Mich reizte dabei natürlich das für DDR-Verhältnisse freie Studium. Ich war wissbegierig und wollte die Welt verstehen. Aber ich studierte auch Theologie, weil ich Pfarrer werden wollte. Mir schien der Gedanke, religiöses Leben zu meiner Berufsaufgabe zu machen, sehr reizvoll. Und auch wenn mich immer einmal Zweifel befielen, hielt ich doch an diesem Vorhaben fest. 1990 ging ich mit meiner jungen Familie auf ein Dorf in der Nähe Dresdens und wurde 1991 zum Pfarrer ordiniert.
Nach insgesamt zweieinhalb Jahren musste ich jedoch einsehen, dass ich den Pfarrberuf nicht ausüben kann. Ich musste begreifen, dass die Traditionen zu fest gefügt waren, als dass ich grundlegend etwas hätte ändern können. Gerade in der Wendezeit war auf kirchenstruktureller Ebene und in den Gemeinden das Bestreben groß, traditionelle Formen christlichen Gemeindelebens auch in Ostdeutschland wieder mehr zur Geltung zu bringen. Diesen Weg konnte ich nicht mitgehen. So stieg ich 1993 aus dem Pfarrberuf aus und arbeite seit dieser Zeit als Psychologischer Berater im Gesundheitsamt Dresden. Ich promovierte in Erziehungswissenschaften und spezialisierte mich in den Folgejahren auf das Gebiet der Männergesundheitsforschung und -praxis.
Meine neue fachliche Heimat fand ich im Choriner Institut für Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention, das von dem bekannten Psychotherapeuten Hans-Joachim Maaz geleitet wird. Die tiefenpsychologische Denkweise war mir nicht nur hilfreich für meine berufliche Tätigkeit. Sie gab mir auch Antworten auf wichtige Fragen meines Lebens.
Ich hörte jedoch in all den Jahren nicht auf, mich mit theologischen Themen auseinanderzusetzen. Die Frage nach dem, was uns und unsere Welt im Tiefsten trägt, ließ mich nicht los. Mich beschäftigten weiterhin Zusammenhänge meiner alltäglichen Arbeits-, Forschungs- und Lebensthemen wie Gesundheit, Männlichkeit, Psychologie mit religiösen Fragen. Dabei wurde mir immer deutlicher, dass Wahrheiten auch über Fachdisziplinen hinaus Bestand haben müssen. Im Verhältnis von Physik und Theologie ist uns das traditionell sofort einleuchtend. Dies gilt aber ebenso im Verhältnis von Psychologie und Theologie. Wesentliche psychologische Erkenntnisse dürfen mit theologischen Einsichten nicht in Widerspruch stehen. Und so erkannte ich gerade in meiner kirchenfernen Arbeit, dass ein tiefenpsychologisches Verständnis auf grundlegenden Voraussetzungen basiert, die religiös gedeutet werden können – oder gar müssen. Andererseits wird in Psychotherapien und psychologischen Beratungen nach konkreten Lebenszusammenhängen gefragt, die manche religiöse Formulierung obsolet werden lässt. Ich schrieb hierzu auch Aufsätze und hielt Vorträge. Und so wuchs mit den Jahren mein Bedürfnis, meine Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenzufassen und ein Buch darüber zu schreiben. Jetzt, mit Mitte fünfzig, fühle ich mich reif dafür.
Ich schreibe dieses Buch also als ein christlicher Theologe, dem es nicht darum geht, den Glauben seiner Kindheit zu verteidigen, für den christlicher Glaube bis heute nicht selbstverständlich ist, der an der Kirche gescheitert ist und doch nicht von dem lassen möchte, was er als wesentlich für sein Leben erkannt hat.
Teil 1 Die Frage nach Gott
Wer oder was ist Gott?
Schon die einfache Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, zeigt, wie sehr wir durch unsere Traditionen geprägt und festgelegt sind und dadurch keine gute Antwort finden können. Der Begriff ›Gott‹ gibt uns kaum die Freiheit, einfach so darüber nachzudenken, was damit gemeint sein könnte. Automatisch wird an einen alten Mann mit weißen Haaren und Rauschebart gedacht. Diese Vorstellung geht auf die vielen Altarbilder zurück, aber auch darauf, dass schon in der Bibel von »Gottvater« gesprochen wird. Es mag sogar Sinn machen – oder zumindest gemacht haben – Gott mit väterlichen Eigenschaften zu beschreiben. Ebenso lassen sich ihm jedoch auch mütterliche Eigenschaften zuschreiben, was selbst in der Bibel reichlich geschieht. Aber wenn wir uns in unserer heutigen Zeit ernsthaft fragen, wer oder was Gott eigentlich ist, führen uns die Altarbilder ebenso in die Irre wie die absurden Erörterungen mancher Theologinnen und Theologen, ob Gott nun ein Mann oder eine Frau sei. Wir sollten uns bei solcherlei Diskussionen zumindest vor Augen halten, dass es dabei eher um uns als um Gott geht.
Und genau das ist das Problem. Alles, was wir uns vorstellen und beschreiben, ist an unsere Erfahrungen gebunden und hängt mit unserem Leben, unserer Welt, unserer Geschichte zusammen. Etwas Anderes können wir gar nicht formulieren. Wenn wir jedoch über Gott reden, dann verlassen wir per Definition unsere Erfahrungsebene. Gott ist mehr als unsere Erfahrung, unser Leben, unsere Welt. Wir wollen mit dem Begriff ›Gott‹ etwas beschreiben, was all das erschaffen hat und was damit eben nicht unseren Bedingungen unterworfen ist. Daher können wir Gott nicht wirklich beschreiben. Mit allem, was wir sagen, bleiben wir unserer Welt verhaftet und werden ihm daher nicht gerecht.
Während ich das schreibe, verletze ich diese Regel selbst. Schon indem ich den Begriff ›Gott‹ verwende, erscheint in meiner Vorstellung etwas, was mit Gott nichts, aber alles mit mir zu tun hat. Und das gilt auch für Sie, die Sie diese Zeilen lesen. In Ihnen ploppt bei dem Begriff ›Gott‹ eine Vorstellung auf, die mehr über Sie selbst, Ihr Leben, Ihre Geschichte, Ihre Erfahrungen sagt als über Gott. Der Theologe Paul Tillich schlug daher vor, das Wort ›Gott‹ besser gar nicht mehr zu benutzen. Zu sehr führt uns schon dieser Begriff in die Irre. Er schlug vor, besser vom »Grund unseres Seins«, vom »Sein selbst« oder auch von der »Tiefe unseres Lebens« zu sprechen.
Doch natürlich ist es nicht nur der Begriff ›Gott‹ allein, der die Schwierigkeit ausmacht, von Gott zu sprechen. Auch die Begriffe, die Tillich verwendet, sind unserem Erfahrungshorizont verhaftet. Es sind Bilder aus unserem Leben. Der Psychoanalytiker Wilhelm Reich sprach von »Lebensenergie« und setzte sie mit Gott gleich. Andere sprechen vom »Sinn unseres Lebens« und so weiter und so fort. All das sind Aussagen, die mir durchaus sympathisch sind. Aber es sind vor allem immer Aussagen über uns selbst. Wir versuchen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, etwas auszudrücken, was weit mehr ist als die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Jede Rede von Gott verfälscht das, was sie eigentlich ausdrücken will. Aus dieser Tatsache gibt es kein Entrinnen.
Diese Gedanken sind banal und gehören in die Grundschule der theologischen Wissenschaft. Bedeutsam sind sie dennoch, weil sie viel über die Praxis der Religionen aussagen, in der eben oft nicht über die Grenzen unserer Sprache reflektiert wird. Wenn sich Menschen im Gottesdienst versammeln, welche Vorstellungen von Gott haben sie dann? Was erwarten Sie von dem, was sie da tun? Erschaffen sie nicht Gott nach ihrem Bilde?
Aber umgekehrt ist auch zu fragen: Wenn Menschen sagen, dass sie nicht an Gott glauben, an was glauben sie dann eigentlich nicht? An den alten Mann mit weißem Haar und Rauschebart? An die ›Große Mutter‹ (Magna Mater) mit überdimensionierten Brüsten und breiter Hüfte, der Erdund Fruchtbarkeitsgöttin? Oder glauben Sie nicht daran, dass unser Leben irgendeinen Sinn macht?
Der Philosoph Ronald Dworkin spricht von einem »religiösen Atheismus«. Er lehnt den Glauben an einen Gott ab. Dabei wendet er sich aber keinesfalls gegen den Glauben an etwas ›Höheres‹ oder ›Tieferes‹. Ist das aber wirklich Atheismus, den er vertritt? Oder wendet er sich nicht lediglich gegen eine bestimmte Tradition, der er nicht folgen kann, der Tradition eines persönlichen oder vielleicht sogar vermenschlichten Gottes?
Ich habe versucht, mit der Kapitelüberschrift etwas zu verwirren. »Wer oder was ist Gott?« klingt ungewöhnlich. »Wer ist Gott?« ist die übliche Frage. »Was ist Gott?« klingt unseren Ohren fremd. Und natürlich sind beide Fragen gleichermaßen falsch, weil sie jeweils eine Vorstellung in uns wachrufen, die dem, was mit Gott gemeint ist, nicht gerecht werden kann. Gott ist weder eine Person noch ein Ding. Doch weil es in unserer Vorstellung nichts gibt, das jenseits von ›Wer‹ und ›Was‹, von Person und Ding existiert, ist es vielleicht besser, beide Fragewörter gleichzeitig zu benutzen. Das stört unsere allzu selbstverständlichen Bilder.
Da die Selbstverständlichkeit eines Gottesglaubens der heutigen Zeit verloren gegangen ist, müssen wir uns zwangsläufig die Frage stellen, ob es Gott gibt. Trotzdem kann sie nie wirklich beantwortet werden. Wir reden hier über etwas, was wir nicht erfassen können. Aber natürlich können und müssen wir über das reden, was wir als Auswirkungen einer solchen ›höheren Person‹, eines solchen ›höheren Prinzips‹, einer solchen ›höheren Kraft‹, eines solchen ›höheren Geistes‹ … wahrnehmen beziehungsweise glauben wahrzunehmen.
Religion ist Menschenwerk
Religion ist Menschenwerk. Diese Aussage fordert gläubige Menschen zum Protest heraus. »Gott hat sich uns offenbart.«, »Wir verkünden doch Gottes Wort.« sind Aussagen, die eine objektive Wahrheit aufzeigen sollen und sich dabei auf eine höhere Autorität berufen. Umgekehrt gibt es die Meinung, Religion sei nichts als Irrglaube oder Projektion eigener Wünsche und Sehnsüchte. Ludwig Feuerbach schrieb in seinem Buch »Das Wesen der Religion«: »Das Abhängigkeitsgefühl des Menschen ist der Grund der Religion; der Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühls, das, wovon der Mensch abhängig ist und abhängig sich fühlt, ist aber ursprünglich nichts anderes, als die Natur.« Der Glaube an einen Gott ist daher ein (Selbst)Trug, bestenfalls ein »Seufzer der bedrängten Kreatur« (Karl Marx).
Ich glaube, dass beide Haltungen gleichweit von der Wahrheit entfernt sind. Religionen wollen Erfahrungen mit Gott wiedergeben. Sie wollen zeigen, dass es da ein höheres Prinzip gibt, in das auch unser Leben eingebettet ist. Und sie wollen zudem ein gemeinschaftliches Erleben ermöglichen, eine Verständigung, ein Miteinander. Bei all dem aber – und das müssen wir uns immer vor Augen halten – bleibt jede Religion mit ihren Vorstellungen und Lehren unserer Welt verhaftet. Deshalb ist die Bibel nicht das Wort Gottes. Sie kann es gar nicht sein. Vielmehr sind in der Bibel Texte aufgeschrieben, die vermeintliche oder reale Erfahrungen mit Gott beschreiben. Es findet sich in einem Buch wie der Bibel so gut wie jede mögliche Aussage, die Menschen über Gott überhaupt treffen können. Nicht, weil es ein groß angelegter Betrug wäre, den eine Priesterkaste beging, um das Volk besser ausbeuten zu können – wie die allzu schlichte Aussage im DDR-Staatsbürgerkundeunterricht lautete. Sondern weil alle Aussagen ihr eigenes Leben, ihre Geschichte, ihre konkrete Situation haben. Sicher mag es immer wieder auch politische Interessen gegeben haben, die bestimmte Texte beeinflussten. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass so gut wie alle Texte in der Bibel, so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sein mögen, von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt sind. Mir fällt jedenfalls kein Text ein, bei dem das nicht so ist.
Natürlich gibt es Texte und Geschichten, die uns heute sehr fremd erscheinen. Etwa wenn beschrieben wird, wie Gott tausende Menschen tötet. Aber dann geht es darum, diese Texte in ihrer Geschichte zu verstehen – falls man das überhaupt will. Es ist sicher manchmal nervig, wenn Pfarrer in jeder x-beliebigen Bibelstelle die vermeintlich große Relevanz für uns heute herauszufinden glauben. Deshalb sollten wir uns auch die Freiheit geben, Texte, die schwierig für unser Verständnis sind, einfach beiseitezulegen. Aber bei allen Texten, mit denen wir uns befassen und die wir in ihrer Tiefe zu ergründen suchen, sollten wir uns vor Augen halten, dass diese Geschichten vor allem etwas über die Menschen sagen, die sie erzählt haben. Wer also diese Geschichten verstehen will, sollte sich mit den Menschen von damals befassen.
Natürlich sind sie – die meisten jedenfalls – geschrieben, um Erfahrungen mit Gott wiederzugeben. Das könnte sie relevant für uns heute machen. Aber dabei müssen wir uns im Klaren sein, dass keine dieser Geschichten Gott wirklich gerecht wird. Jede ist Menschenwerk wie die Religionen, die auf diesen Geschichten aufbauen. Jedes Reden von Gott sagt mehr über die Redenden als über Gott selbst. Deshalb kommen wir nicht umhin, die biblischen Geschichten mit unserem eigenen Leben, den eigenen Erfahrungen zu prüfen: Sagt diese Geschichte wirklich etwas für uns heute aus?
Dabei geht es keinesfalls darum, die Geschichten für uns gefällig zu machen. Es geht nicht um ein Den-Glauben-fürsich-zurecht-Biegen. Es geht um einen Erkenntnisprozess, der dem eigenen Leben Tiefe geben kann. Und dazu können selbstverständlich auch biblische Geschichten beitragen. Doch nicht im Sinne einer Buchstabentreue. Sich auf biblische Geschichten oder auch andere Beschreibungen von Gotteserfahrungen einzulassen, ist kein Automatismus nach dem Motto: Wenn du glaubst, was da steht, wirst du Gott nahe sein. Glauben hat nichts mit Fürwahrhalten zu tun, sondern ist etwas, was die Seele ergreift. Wenn beispielsweise Szenen geschildert werden wie Jakobs Kampf beim Jabbok (Gen 32, 23-30), dann geht es weder darum, staunend auf Jakob zu schauen oder sich selbst einen Kampf am Jabbok zu wünschen. Vielmehr geht es um die Frage des eigenen Lebenskampfes (der übrigens bei Jakob eine lange familiäre Vorgeschichte hat). Solche Geschichten sind nicht dafür geeignet, sie in Kirchenbänken zu hören und anschließend – als sei nichts geschehen – in den unveränderten Alltag zurückzukehren. Sonst könnte man es doch gleich lassen und das Papier für dieses Buch sparen.
Das bedeutet jedoch auch, dass die Aussage »Religion ist Menschenwerk« keinesfalls abwertend gemeint ist. Es ist vielmehr eine Tatsache, die als Herausforderung verstanden werden muss: Wie lässt sich Gotteserfahrung für uns heute in unserer Zeit, in unserem Leben angemessen beschreiben? Und genau hier scheinen die Kirchen der Gegenwart für viele Menschen zu versagen. Mit Thomas Münzer lässt sich in seiner drastischen Sprache formulieren: »Die gegenwärtigen Kirchen sind dabei, sich an ihrem honigsüßen Christus tot zu fressen.«
Es gibt noch Gewissheiten
Wenn wir in unserer heutigen Zeit darüber nachdenken, ob es Gott ›gibt‹, dann müssen die Antworten demnach anders ausfallen als noch vor einhundert oder fünfhundert oder gar zweitausend Jahren. Die Selbstverständlichkeit eines Gottes, der persönlich für den einzelnen Menschen da ist, mit dem einfach so geredet werden kann, der unmittelbar in ein Leben eingreift, lässt sich heutzutage nur noch schwer aufrechterhalten. Und wem solch ein Glaube doch gelingt, der muss sich zumindest mit Themen auseinandersetzen, die unsere Weltvorstellung und damit auch den traditionellen christlichen Glauben erschüttern. Die Vernichtungsschlachten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, das industrielle Morden von Auschwitz, die beginnende Klimakatastrophe, das fortwährende Scheitern, eine gerechtere Welt aufzubauen – all das sind nur einige herausgehobene Ereignisse, die unsere gegenwärtigen Erfahrungen prägen und uns von traditionellen Vorstellungen von und Erfahrungen mit Gott trennen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer forderte daher in seinen Briefen aus der Nazihaft, dass wir in der Gegenwart anders als in traditioneller Weise von Gott reden müssen. Paul Tillich, dessen Theologie stark von den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs durchdrungen war, erwähnte ich bereits. Und beispielhaft hat die Theologin Dorothee Sölle nach Auschwitz die Frage gestellt, ob Gott nicht gar als tot für unsere Welt anzusehen sei.
In der heutigen Zeit eröffnet sich noch eine weitere Herausforderung. War bei den drei genannten Theologen und den Diskursen, die sie auslösten, immer die Leidenschaft zu spüren, mit der die Gottesfrage geführt wurde, tritt ihr heute Gleichgültigkeit entgegen. Es mag beeindruckend sein, wie sich Menschen in der Vergangenheit mit Gott auseinandersetzten. Aber was geht uns deren Leidenschaft überhaupt an? Die Frage ist doch, ob wir überhaupt noch eine Gottesvorstellung für unser Leben und unser Weltverständnis brauchen.
Und genau an dieser Stelle ist das Verständnis, das wir haben, wenn wir von ›Gott‹ sprechen, entscheidend. Denn offensichtlich leben sehr viele Menschen recht gut ohne die Vorstellung eines persönlichen Gottes. Zu diesen Menschen gehören auch nicht nur diejenigen, die sich selbst als Nicht-Glaubende ansehen. Ich wage die Behauptung, dass selbst viele Kirchgänger beziehungsweise Kirchenmitglieder Gott in ihrem alltäglichen Leben nicht brauchen.
Es mag vielen schwerfallen, sich den Verlust der traditionellen Religiosität einzugestehen. Aber Tatsache ist er allemal. Und diese Entwicklung schreitet voran, ob wir das beklagen oder nicht. Sie ist mit unserer modernen Gesellschaft verbunden, die durch Globalisierung wie durch Individualisierung gekennzeichnet ist. Traditionen verlieren an Macht. Vor allem aber verliert das Bewusstsein unumstößlicher Wahrheiten und Autoritäten an Kraft.