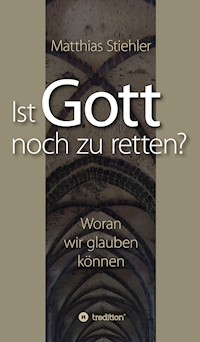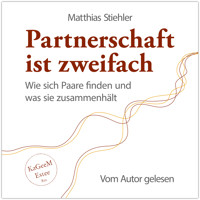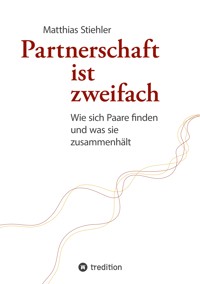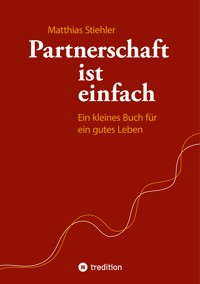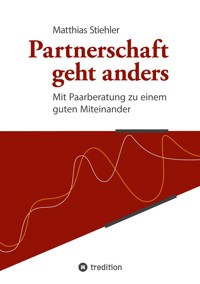19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Mangel an Väterlichkeit und den Konsequenzen für unsere Gesellschaft
Der Mangel an Väterlichkeit ist ein schwerwiegendes Problem unserer Gesellschaft. Prinzipienfestigkeit, Begrenzung, Partnerschaftsfähigkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung – das sind Werte, die in weiten Teilen unserer Gesellschaft fehlen. Dabei wäre es notwendig, Väterlichkeit als komplementäres Gegenstück zu Mütterlichkeit zu entwickeln, um krisenhaften Entwicklungen wie geringer Geburtenzahlen, Schuldenkrise und hilfloser Politik entgegenzuwirken.
Der Männerforscher Matthias Stiehler beschreibt den »unväterlichen Vater« als ein zentrales Merkmal unserer Zeit. Welche Merkmale von Väterlichkeit es stattdessen in den Familien, aber auch in der Gesamtgesellschaft umzusetzen gilt, entwickelt Stiehler in diesem Buch.
- Die »neuen« Väter – und worin sie versagen
- Ein Plädoyer für eine Renaissance »echter« Väterlichkeit
- Ein streitbares Buch, das zur Debatte anregen will
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
FÜR MEINE KINDER SOPHIE KONSTANTIN LISA-MARIE
Alle Beispiele und Darstellungen aus Beratungen, Gruppengesprächen und Workshops sind authentisch. Details, durch die Teilnehmende zu identifizieren wären, wurden jedoch verändert. Aus diesem Grund wurde auch auf die Nennung von Namen verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
RATLOSE VÄTER, ABGELEHNTE VÄTERLICHKEIT
Dieses Buch macht die Väterlosigkeit unserer Gesellschaft zum Thema. Doch diese Aussage meint nicht, dass es zu wenige Väter gäbe. Denn natürlich gibt es sie – schon biologisch gesehen – ebenso häufig wie Mütter. Und betrachten wir uns die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dann fällt zudem auf, dass immer mehr Männer als Väter leben wollen. Es mag zwar noch viele abwesende Väter geben. Sei es, weil die Eltern getrennt sind und das Kind den Vater nicht sieht, sei es, weil der Vater vor allem mit seiner beruflichen Entwicklung beschäftigt ist und sich kaum um seine Kinder kümmert. Aber diese Väter werden zunehmend weniger. Väter entdecken ihr Vatersein. 2011 nahmen etwa ein Viertel der Väter Elternzeit, Tendenz steigend. Und nicht nur daran misst sich die steigende Bedeutung, die die Vaterschaft für Männer gewinnt. Bedeutsam ist auch die politische Kraft, die Vereine wie »Väteraufbruch für Kinder« entwickelt haben. Ein weiteres Indiz ist zudem die Selbstverständlichkeit, mit der Stiefväter ihre soziale Vaterschaft übernehmen. Sicher gibt es weiterhin Entwicklungsbedarf, aber es verändert sich etwas. Gemessen an den vorhergehenden Generationen sind Väter in den Familien wieder präsenter. Es mangelt also nicht an Vätern.
Was aber was fehlt – und das ist die Grundthese meines Buches – ist Väterlichkeit. Väterlichkeit entsteht nicht, indem ein Mann Vater wird. Sie ist auch nicht einfach so vorhanden, weil ein Mann seine Vaterschaft mit den Kindern leben will. Väterlichkeit ist eine Summe von Eigenschaften, die das Spezifische des Vaterseins ausmachen. Und wenn ich behaupte, dass es an Väterlichkeit in unserer Gesellschaft fehlt, dann meine ich, dass über Jahrzehnte, wenn nicht gar über noch längere Zeit das selbstverständliche Wissen über diese Eigenschaften verloren gegangen ist.
Am ehesten definieren wir heute Väterlichkeit über negative Aussagen: Ein Vater sollte nicht herrisch, nicht brutal und vor allem nicht abwesend sein. Mit diesen Eigenschaften bezeichnen wir traditionelle Väterlichkeit, von denen sich heutige Väter abgrenzen möchten. Dagegen sehen wir kaum Positives, das allein mit Väterlichkeit verbunden ist. Liebevolle Zuwendung, Aufmerksamkeit, Umsorgung sind bestenfalls Zeichen guter Elterlichkeit. Sie sind aber keinesfalls Merkmale einer eigenständigen Väterlichkeit. In solchen positiven Beschreibungen wird Väterlichkeit nicht von Mütterlichkeit unterschieden. Und so ließe sich die moderne – oder wie wir heute gern sagen: die neue – Vaterschaft durchaus mit mütterlichen Eigenschaften beschreiben.
Doch ist es wirklich das, was wir brauchen: Väter, die ihre mütterlichen Eigenschaften entdecken und gegenüber ihren Kindern leben? Zumindest weiß unsere Gesellschaft derzeit keine andere Antwort. Und so bleibt für viele Väter die Frage offen, was eigentlich eigenständige Väterlichkeit ist und ob diese heute überhaupt noch gebraucht wird.
Ein Mann, Anfang Dreißig, Psychologe, lernt eine Frau kennen und lieben, die zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger von einem anderen Mann ist. Allerdings hatte sie sich von diesem schon getrennt, als sich die beiden kennenlernen. Nach einer kurzen Zeit der Entscheidungsfindung beschließt der Mann, die neue Situation anzunehmen, mit der Frau eine Partnerschaft einzugehen und damit auch bewusst die soziale Vaterschaft zu leben. Er möchte die neu entstehende Familie nicht allein seiner Partnerin überlassen und dem Kind, das er von nun an als sein Kind bezeichnet, ein zugewandter Vater sein. Als Zeichen dafür möchte er vier Monate Elternzeit nehmen.
Schwierigkeiten ergeben sich dann auch weniger mit dem Kind, sondern mit seiner Partnerin. Zunächst beginnt es mit Auseinandersetzungen um die Kinderversorgung und Kindererziehung. Sie weiß es immer irgendwie besser und meckert herum, wenn er etwas anders machen will oder nicht ihre Ordnung hält. Er sieht das oft ein und bemüht sich auch. Er hat ohnehin den Eindruck, dass seine Partnerin den besseren Überblick hat und schneller weiß, was das Kind braucht. Und doch ist er unzufrieden. Er hat das Gefühl, dass er seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Das entlädt sich dann manches Mal im Aufbrausen – gegenüber dem Kind oder seiner Partnerin. Aber das macht ihn dann noch unzufriedener, denn er will doch ein liebevoller Vater und Partner sein. Schließlich sucht er einen Berater auf. In den Beratungsgesprächen wurde nicht nur die derzeitige Lebenssituation betrachtet, sondern auch die Konstellation der Ursprungsfamilie des Mannes beleuchtet: Seine Mutter empfand er als sehr zugewandt, für sie war er immer »ihr Großer«. Das machte ihn stolz. Dagegen schimpft er noch heute über seinen Vater: »Der war meist nicht da. Und wenn er da war, hat er den großen Maxen gespielt und da war nichts dahinter. Alles sollte nach seiner Pfeife tanzen, aber ich habe mir von dem nichts sagen lassen.« Während er sich also mit seiner Mutter verbunden fühlte, lehnte er seinen Vater ab.
In der Beschreibung der Ursprungsfamilie des Mannes erkennen wir das Dilemma vieler heutiger Väter. Sie leben sehr häufig in einer Polarisierung. Während sie ihre eigenen Mütter positiv sehen, möchten sie sich gegenüber ihren Vätern lieber abgrenzen. Das mag sich im Einzelfall differenziert darstellen, nicht ganz so eindeutig wie bei diesem Mann. Aber die Tendenz ist insgesamt eindeutig und entspricht der Aussage, dass Beschreibungen positiver Elternschaft eher mütterlichen Eigenschaften zuzuordnen sind, während väterliche Eigenschaften vor allem negativ beschrieben werden können.
Nun lassen sich vielleicht auch einige positive väterliche Eigenschaften nennen. Als Erstes ist da das Grenzensetzen zu nennen. Väter müssen ihren Kindern Grenzen aufzeigen. Das ist für die Heranwachsenden unerlässlich. Aber so sehr diese Aussage in ihrer Allgemeinheit von vielen bejaht werden mag, so sehr trifft gerade diese Eigenschaft auf erbitterten Widerstand im Konkreten. Schon das Beispiel des Mannes lässt bei genauer Betrachtung die Frage stellen, ob der Vater wirklich so schlimm war, wie es der Junge empfunden hat. Vielleicht hat der Vater nur versucht, in den Zeiten, in denen er da war, seinen väterlichen Aufgaben zu genügen – und eben beispielsweise dem Jungen Grenzen zu setzen. Der Junge aber empfand das als unangenehm und hat sich dagegen gewehrt. Und die Mutter hat ihn dabei unterstützt, denn er war ja »ihr Großer«. Für diese Deutung der Konstellation in der Ursprungsfamilie spricht die Arbeitssituation des Mannes und die Haltung seinem Chef gegenüber:
Der Mann arbeitet selbst in einer Beratungsstelle. Er ist qualifiziert für den Job und zudem machte er anfangs den Eindruck, dass er die Arbeit und das Team bereichern würde. Doch er erfüllte die an ihn gestellten Erwartungen nicht. Anfangs fiel das nicht so sehr auf, da wurden die Probleme auf die Einarbeitungszeit geschoben. Der Mann war nicht faul. Er erledigte sein Arbeitspensum so, dass es zunächst ausreichte, quasi »Dienst nach Vorschrift«. Aber die an ihn gesteckten höheren Erwartungen erfüllte er auch nach einem Jahr noch nicht.
In Gesprächen mit dem Leiter war er einsichtig, gab die Probleme zu und setzte die in diesen Gesprächen genannten Aufgaben zunächst auch um. Doch schleichend verlief das Engagement dann wieder im Sand. Der Leiter fragte sich, ob er den Mann überschätzt hat und er gar nicht in der Lage sei, die gestellten Erwartungen zu erfüllen. Und auch der Mann selbst fragte sich, wieso er seinem eigenen Anspruch nicht genügte. Einmal wurde ihm die Aufgabe erteilt, einen Arbeitsbereich vor Kooperationspartnern darzustellen und die Aktivitäten des Teams aufzuzeigen. Doch er hatte sich überhaupt nicht vorbereitet und so geriet die Darstellung zum Fiasko. Die Kooperationspartner gewannen den Eindruck, als geschähe auf diesem Arbeitsgebiet nur sehr wenig. Der Leiter hatte alle Hände voll zu tun, um die Arbeit des Teams ins rechte Licht zu rücken.
Die Arbeitssituation scheint zunächst wenig mit dem Thema »Väterlichkeit« zu tun zu haben. Doch bei genauer Betrachtung erkennen wir die Situation der Ursprungsfamilie wieder. Einerseits sehen wir die Überschätzung, die in der Kindheit in der mütterlichen Aussage »mein Großer« zu finden ist. Auch jetzt wurde ihm in seiner Arbeit mehr zugetraut, als er real zu leisten in der Lage war. Andererseits aber findet sich in seiner Arbeitsleistung auch der Widerstand gegenüber seinem Vater wieder. Jetzt aber ist die Vaterfigur sein Chef.
Der Mann befindet sich in einer Zwickmühle. In seiner Familie weiß er nicht so recht, wie er sich auf gute Weise als Vater verhalten kann. Er hat lediglich ein Repertoire an mütterlichen Eigenschaften zur Verfügung, was ihn jedoch nicht befriedigt. Eine Vorstellung von eigenständiger Väterlichkeit aber besitzt er nicht. Das führt letztlich in eine unbefriedigende Situation, die die Partnerschaft auf eine Zerreißprobe stellt. Doch im Job wehrt er sich wiederum gegenüber seinem Chef, der Forderungen stellt und nicht so viel Verständnis hat. Der Ratlosigkeit in der eigenen Vaterschaft entspricht die Ablehnung von Väterlichkeit bei anderen »Vaterfiguren« in seinem Leben.
Dieses Beispiel verdeutlicht die beiden Pole Ratlosigkeit und Ablehnung, von denen nicht nur dieser Mann, sondern unsere Gesellschaft insgesamt ergriffen ist. Einerseits gibt es einen Wunsch nach Vätern und nach einer größeren Rolle, die sie spielen sollen. Dahinter steht die Einsicht, dass Familien Mütter und Väter gleichermaßen brauchen und Mütter allein auf sich gestellt überfordert sind. Zugleich aber fehlt ein Verständnis dafür, was die ganz eigene Aufgabe der Väter überhaupt ausmacht, wenn sie gegenüber ihren Kindern nicht einfach nur mütterliche Eigenschaften kopieren. Auf der anderen Seite findet eine allgegenwärtige Ablehnung von Väterlichkeit statt. Ich werde im ersten Teil des Buches darlegen, wie heftig unsere Gesellschaft von dieser Ablehnung ergriffen ist, wie sehr sie zu ihrem Wesen gehört und wie stark unsere Gesellschaft damit in eine ernste Krise gerät.
Bereits das Beispiel des Mannes zeigt, dass das Thema Väterlichkeit keinesfalls nur die Familiensituationen betrifft. Wenn wir von »Mütterlichkeit« und »Väterlichkeit« sprechen, ist nicht nur das Verhalten von Müttern und Vätern gemeint. Sicherlich nimmt beides seinen Anfang, seine Grundlegung in deren Aufgaben, insbesondere in der frühen Lebenszeit des Kindes. Aber »Mütterlichkeit« und Väterlichkeit« gehen in ihrer Bedeutung weit über die Familien hinaus. Es handelt sich um Prinzipien des Zusammenlebens und der Struktur menschlicher wie gesellschaftlicher Beziehungen.
Unser Leben ist von Mütterlichkeit und Väterlichkeit geprägt. Aber damit ist nicht nur das Verhalten von Menschen gemeint, das auch jenseits von Mutterschaft und Vaterschaft mütterlich und väterlich sein kann. Auch Institutionen, Vereine, Parlamente, ja die Gesellschaft insgesamt wirken mütterlich und väterlich. Überall da, wo sich Personen, Institutionen oder Strukturen um Menschen kümmern, wirken sie damit zwangsläufig mütterlich und väterlich. Es gibt kein Handeln für Menschen, keine Strukturen, die menschliches Leben beeinflussen, jenseits dieser beiden Prinzipien.
Aus dieser Aufzählung wird zudem deutlich, dass die Prinzipien Mütterlichkeit und Väterlichkeit nicht geschlechtsspezifisch zu verstehen sind. Zwar finden sie ihren Ursprung in den unterschiedlichen Aufgaben, die Mütter und Väter in der ersten Lebenszeit eines Kindes haben. Jedoch lösen sie sich dann selbst in den Familien zunehmend vom Geschlecht der Akteure. Mütter müssen auch väterlich, Väter auch mütterlich auftreten können. Die Geschlechtsspezifik zeigt höchstens Tendenzen auf, über die im zweiten Teil, wenn die Merkmale von Väterlichkeit dargestellt werden, noch zu sprechen sein wird. Aber in der Gesellschaft, im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich gibt es kaum noch eine Geschlechtsspezifik. Sehr wohl aber behalten die Prinzipien »Mütterlichkeit« und »Väterlichkeit« ihre Wichtigkeit.
Beide Prinzipien verhalten sich komplementär zueinander. Komplementär heißt, dass sie zwar unterschiedliche Pole des Handelns darstellen, aber das eine nicht ohne das andere sein kann. Vielmehr ist von zentraler Bedeutung, dass beide Pole im Gleichgewicht zueinander stehen. Das Miteinander von Menschen gerät an seine Grenzen und überfordert sich, wenn ein permanentes Ungleichgewicht zwischen dem Mütterlichen und dem Väterlichen besteht. Und auch die Gesellschaft gerät aus dem Lot. Es besteht dann die Gefahr von Einseitigkeiten, die das soziale Gefüge belasten. Autoritäre Familienstrukturen oder – als Gegenstück – mangelnde familiäre Bindung belasten die individuelle Entwicklung und die eigene Zufriedenheit. Repression und Verwahrlosung der Sitten sind die beiden entgegengesetzten Pole, zu denen hin eine Gesellschaft driften kann.
Heute müssen wir eine Störung des Gleichgewichts in unserer Gesellschaft konstatieren. Wir leben in einem Mangel an Väterlichkeit, in einer väterlosen Gesellschaft. Stattdessen ist an vielen Stellen eine überbordende Mütterlichkeit zu konstatieren, die – wie im beschriebenen Beispiel – zu einem falschen, oftmals aufgeblasenen Selbst und zu destruktiver Konkurrenz führt. Das nimmt zunehmend krisenhafte Züge an. Wie ich im weiteren Verlauf darlege, ist in vielen Bereichen unsere gesellschaftliche Ordnung bedroht. Ich sehe unsere Gemeinschaft daher an einem Scheidepunkt: Machen wir weiter wie bisher oder gelingt es uns, das Steuer herumzureißen und uns auf den Weg zu mehr Väterlichkeit zu begeben.
Ich werde in einem ersten Teil den Ernst der Lage aufzeigen. Es geht um kein Spiel und auch keine Beliebigkeit – je nach Laune. Die Existenz unserer gesellschaftlichen Ordnung steht auf dem Spiel und wir sind alle gemeinsam gerade im Begriff, diese Ordnung zu zerstören. Ich werde das an Beispielen aus der Politik, aber auch aus anderen Gesellschaftsbereichen belegen. Dabei möchte ich deutlich machen, dass es nicht um Einzelbeispiele geht, sondern dass sie unsere Grundverfassung aufzeigen, die sich in den angesprochenen Polen »Ratlosigkeit« und »Ablehnung« zeigt.
Doch mir ist es wichtig, nicht bei der Negativbeschreibung stehenzubleiben. Deshalb werde ich in einem zweiten Teil die Merkmale von Väterlichkeit entwickeln. Ich unternehme also den Versuch, das positiv zu beschreiben, was wir derzeit nur als Negativfolie wahrnehmen. Dieser zweite Teil umreißt somit eine Vision. Und es ist zu wünschen, dass sich unsere Gesellschaft auf die Vision einer eigenständigen, der Mütterlichkeit ebenbürtigen Väterlichkeit einlässt.
Wir leben in einer väterlichkeitslosen Gesellschaft. Das ist die erste Möglichkeit, wie der Titel des Buches zu verstehen ist. Es gibt aber noch zwei weitere Verstehensweisen, die mir ebenso passend erscheinen: Da ist zunächst das »Los der Väter«. Aus den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich geworden, dass es heutzutage keine Selbstverständlichkeit väterlichen Handelns gibt. Das werden die folgenden Ausführungen noch plastischer vor Augen führen. Es ist das Los der Väter, sich mit dieser Situation auseinandersetzen zu müssen. Sie sind aufgefordert, sich eine selbstverständliche Väterlichkeit neu erringen zu müssen. Doch dazu gilt es, mehr als bisher in die Offensive zu gehen. Die Zeit ist reif, dass insbesondere Väter einen gesellschaftlichen Prozess gestalten, der die Entwicklung einer eigenständigen Väterlichkeit zum Ziel hat. Auch in diesem Sinne ist der Buchtitel zu verstehen: »Väter, (macht endlich) los!«
1
EINE VÄTERLOSE GESELLSCHAFT
VÄTERLOSE POLITIK
Politik ist der Bereich, in dem für die Gesellschaft verbindliche Entscheidungen getroffen und Regeln aufgestellt werden. Sie wird in unserer parlamentarischen Demokratie durch Parteien getragen, soll jedoch nicht deren Erfolg dienen, sondern das Wohl der Menschen zum Ziel haben. Mit den Prinzipien Mütterlichkeit und Väterlichkeit lässt sich Politik in ihrer jeweiligen Grundhaltung charakterisieren. Sie soll fürsorglich und zugleich grenzensetzend sein, sie soll für Gerechtigkeit sorgen und doch auch Eigenverantwortung fördern, sie soll Freiheiten gewährleisten und zugleich den Gemeinsinn stärken. Die Begriffspaare zeigen unterschiedliche Pole an, die sich jedoch in einem Ausgleich befinden müssen. Politik hat ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Ansprüchen und Interessen herzustellen. Sie ist gefordert – um in der Terminologie dieses Buches zu bleiben – einen Ausgleich zwischen Mütterlichkeit und Väterlichkeit herzustellen.
Die Führungsebenen der Politik sind dabei besonders in ihren väterlichen Kompetenzen gefragt. Sie müssen Entscheidungen befördern, Pläne und Visionen entwickeln sowie die Einzelfragen an grundsätzlichen Wertvorstellungen ausrichten. Deshalb wird beispielsweise einer Bundeskanzlerin oder einem Bundeskanzler »Richtlinienkompetenz« zugeschrieben. Sie beziehungsweise er muss in strittigen Fragen entscheiden und die Regierung führen. Es gibt das Sprichwort »Wie der Herre, so das Gescherre«, was bedeutet, dass dort, wo diese Führungsaufgabe in keiner guten Weise wahrgenommen wird, es zwangsläufig zu Problemen und Schwierigkeiten im jeweiligen Sozialzusammenhang kommen muss, dem der Betreffende vorsteht. Das gilt, wie im Folgenden noch aufgezeigt werden wird, für zahlreiche sozialen Bezüge. Das gilt ebenso und ganz besonders für die Bundesregierung.
Erinnern Sie sich noch an die Affäre um die Doktorarbeit des damaligen Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg im Februar 2011? Als herauskam, dass er große Teile seiner Doktorarbeit aus fremden Quellen abgeschrieben hatte, die er nicht kenntlich machte, reagierte die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Bemerkung, sie brauche einen Minister und keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das war offensichtlich parteitaktischem Kalkül geschuldet. Sie wollte nicht als diejenige dastehen, die gegen den damaligen Hoffnungsträger der Union vorgeht. Die Botschaft ihrer Verhaltensweise ist, dass ihr die eigene Macht höher steht als die Wahrheit. Denn die Wahrheit war recht eindeutig: Guttenberg hat bei der Erstellung seiner Doktorarbeit wissentlich betrogen und damit den bekannten Standards wissenschaftlicher Arbeit zuwider gehandelt.
Dass er sich selbst zunächst durch Ausflüchte zu retten versuchte, ist zu verstehen. Es schien ihm »um seinen Kopf« zu gehen. Fast jeder Schüler, der erwischt wird, wird zunächst alles versuchen, das drohende Unheil abzuwenden. Wichtig aber ist dann, dass der Lehrer – oder in diesem Fall die Kanzlerin – konsequent reagiert und die Lüge aufdeckt beziehungsweise die Verschleierung verhindert. Indem Angela Merkel Guttenbergs Ausflüchte unterstützte, nahm sie ihre Verantwortung nicht wahr. Zudem zwang sie die Öffentlichkeit zu Protesten und schadete in der Konsequenz dem Menschen zu Guttenberg mehr, als dass sie ihm half. Sie setzte ihn der Demontage aus, um ihre eigene Position und die ihrer Partei zu schützen.
Die Kanzlerin stellte sich in »mütterlichem« Schutz vor den bedrohten »Jungen«. Der Schaden, den sie und andere vermeintliche Unterstützer des »Hoffnungsträgers« dabei anrichteten, war beträchtlich. Gesellschaftlich kamen Promotionen plötzlich in einen zweifelhaften Ruf: Bei welchem Menschen, der einen Doktortitel in seinem Namen trägt, kann man nun sicher sein, dass er nicht betrogen hat? Zugleich aber wurde bewusster Betrug für viele zu einem Kavaliersdelikt. Denn sehr viele Menschen waren bereit, zu Guttenberg diesen Betrug zu verzeihen, weil er ihnen sympathisch war. Auf der anderen Seite schützten die Verschleierungstaktik und die Solidaritätsbekundungen dem Menschen Karl-Theodor zu Guttenberg nicht wirklich. Denn weil ihm niemand rechtzeitig Einhalt gebot, glitt er immer mehr in Lügen und Peinlichkeiten ab. Er hätte einer väterlichen Autorität bedurft, die ihm sagt, dass er die Ausflüchte lassen soll und zu seinem Betrug in allen Konsequenzen stehen muss. Sein Ministeramt hat er so oder so nicht retten können. Aber der Mensch zu Guttenberg bliebe in seiner Würde bewahrt.
Ein guter Vater macht seinem Kind deutlich, dass es zu seiner Verantwortung stehen muss. Nicht die Fehlerfreiheit ist höchstes Gebot für einen Menschen, sondern eben diese Verantwortung. Auf der politischen Bühne, auf der sich diese
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagmotiv: © ArTo – Fotolia.com
eISBN 978-3-641-08293-2
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe