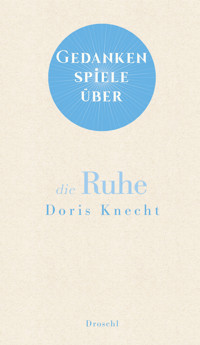Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Raffiniert und bissig schreibt die Bestsellerautorin Doris Knecht über das Leben als Frau, über Freundschaft und über Sinn und Unsinn der romantischen Liebe. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt sie sich wieder frei: Die Kinder sind ausgezogen, in ihrem Dasein zwischen Großstadt und Landleben breitet sich Ruhe aus. Doch dann wird ihre Wohnung von ihrer Schwester besetzt, es droht ihr ein Zahn auszufallen und sie wird mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert. Während sich das eher marginale gesundheitliche Dilemma zu einer kleinen existenziellen Krise auswächst, trifft sie im Supermarkt einen Mann von früher wieder: Friedrich. Eine Begegnung, die sie vor eine Frage stellt, mit der sie sich eigentlich nicht mehr beschäftigen wollte: Ist sie bereit für eine weitere Liebesbeziehung? Oder besser gesagt: Ist sie bereit, ihr gutes Leben zu teilen, ihre innere Zufriedenheit zu riskieren, schon wieder? Ein moderner Roman über das Leben als Frau, der das ewige Primat der romantischen Liebe infrage stellt – unverbittert, witzig, lebensklug
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt sie sich wieder frei: Die Kinder sind ausgezogen, in ihrem Dasein zwischen Großstadt und Landleben breitet sich Ruhe aus. Doch dann wird ihre Wohnung von ihrer Schwester besetzt, es droht ihr ein Zahn auszufallen und sie wird mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert. Während sich das eher marginale gesundheitliche Dilemma zu einer kleinen existenziellen Krise auswächst, trifft sie im Supermarkt einen Mann von früher wieder: Friedrich. Eine Begegnung, die sie vor eine Frage stellt, mit der sie sich eigentlich nicht mehr beschäftigen wollte: Ist sie bereit für eine weitere Liebesbeziehung? Oder besser gesagt: Ist sie bereit, ihr gutes Leben zu teilen, ihre innere Zufriedenheit zu riskieren, schon wieder? Ein moderner Roman über das Leben als Frau, der das ewige Primat der romantischen Liebe infrage stellt — unverbittert, witzig, lebensklug
Doris Knecht
Ja, nein, vielleicht
Roman
Hanser Berlin
1
»Da kann man eigentlich nichts mehr machen«, sagt der Zahnarzt. Ich war in aller Früh in die Stadt gefahren, um mir endlich diesen Zahn anschauen zu lassen. Irgendwas stimmte nicht damit. Wenn ich die Zähne zusammenbiss, fuhr ein Schmerz in meinen Kiefer, und wenn ich mit der Zunge an den Zahn stieß, gab er leicht nach. Ich spürte ihn nachts. Es ist nicht gut, wenn ein Zahn sich bewegt, und es ist nicht gut, wenn man ihn spürt.
Ich saß kurz im Wartezimmer und blätterte mich durch ein zwei Jahre altes Lifestyle-Magazin, als die Assistentin mich zum Röntgen bat und nach ein paar weiteren Minuten in den Behandlungsraum. Ich wusste nicht, ob ich dem Zahnarzt die Hand geben sollte, aber er machte ohnehin keine Anstalten. Er forderte mich auch nicht auf, auf dem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen, stattdessen setzte er sich auf einen Drehhocker vor den Computer, wo er jetzt auf das Röntgenbild starrt, das das Innere meines Mundes zeigt.
Ich stehe etwas ratlos neben ihm und beuge mich runter zum Bildschirm. Mir sagt das nichts, was ich da sehe.
»Wie, man kann nichts machen?«, sage ich.
Der Zahnarzt tippt an der Stelle auf den Bildschirm, an der einer meiner Backenzähne zu sehen ist, oben, der zweite von rechts.
»Der Zahn ist verloren«, sagt der Zahnarzt. »Den kann man nur noch ziehen.«
»Und dann?«, sage ich. »Ein Implantat, eine Krone, eine Brücke, wie wird der Zahn ersetzt?«
»Gar nicht«, sagt der Zahnarzt, »dafür ist es zu spät. Sehen Sie«, er zeigt auf das Röntgenbild auf seinem Bildschirm, »hier hat sich der Knochen schon derart zurückgezogen, da lässt sich nichts mehr einsetzen. Lassen Sie sich das noch von einem Parodontitis-Spezialisten anschauen, mit einer speziellen Behandlung kann man hoffentlich die anderen Zähne retten. Aber diesen nicht.«
»Was?! Und dann?«
»Nichts. Man kann da, wie gesagt, nicht mehr viel machen. In diesem Knochenrest lässt sich kein Implantat befestigen.«
»Gar nichts? Ich werde da eine Lücke haben?«
»Ja, aber Sie brauchen diesen Zahn nicht unbedingt, Sie können auch ohne diesen Zahn kauen.« Der Zahnarzt steht auf. Er ist offenbar fertig mit mir.
»Aber ich werde eine Zahnlücke haben!«
»Das ist ja ziemlich weit hinten, das sieht man wahrscheinlich gar nicht.«
Das erschüttert mich. Es ist nicht so, dass mir meine Endlichkeit nicht bewusst ist. Ich werde sterben, ich weiß das, das Leben, das vor mir liegt, ist kürzer, vielleicht sehr viel kürzer als das Leben, das ich schon gelebt habe. Das Leben, das vor mir liegt, ist zwar immer noch von einem gewissen Aufbruch bestimmt, von Träumen und Zielen, aber auch von Abschieden, kleinen und entscheidenden: von Menschen, von Träumen, vom Jungsein, von Plänen, die ich nicht mehr umsetzen werde.
Es gab, das wird mir bewusst, während ich über diese Sätze nachdenke, schon einmal so einen Punkt in meinem Leben, bald nachdem ich die Kinder bekommen hatte, als mir klar wurde: Ich werde nicht mehr Gitarristin einer Band. Gitarristin einer Band zu sein, das war so lange ein Traum, eine Möglichkeit, die ich nicht verwerfen wollte, nicht einmal im Bewusstsein der Tatsache, dass ich nicht Gitarre spielen konnte. Das kann ich noch lernen! Eines Morgens wachte ich auf, kuschelte, fütterte und kleidete meine Kinder, zog ihnen Schuhe und Jacken an, ging mit ihnen an beiden Händen fünf Stockwerke hinunter auf die Straße, holte ihre Laufräder und Helme aus dem Auto und lief dann hinter ihnen her in den Kindergarten, und als ich wieder heimging, wurde mir, ich weiß nicht mehr, warum, plötzlich klar, in diesem Leben werde ich nicht mehr in einer Band Gitarre spielen. Diesen Abschnitt meines Lebens, in dem eine solche Möglichkeit umsetzbar schien, habe ich hinter mir. Vielleicht kann ich noch Gitarrespielen lernen, vielleicht gemeinsam mit meinen Kindern, aber ich werde mit einiger Sicherheit nie in meinem Leben mit einer E-Gitarre und einer Band auf einer Bühne stehen. Das war mein erster Abschied.
Und das jetzt ist mein zweiter. In dieser Zahnarztpraxis spüre ich zum ersten Mal, dass ich vergehe. Dass ich körperlich abbaue, wie man sagt. Dass ich an manchen Stellen einfach kaputt bin. Das ist auch deshalb schockierend, weil ich, das bilde ich mir jedenfalls ein, bis jetzt eher aufgebaut habe, ich bin gesünder als früher, fitter, bewege mich mehr, habe eine viel besser trainierte Muskulatur als in meinen jüngeren Jahren, ich ernähre mich gesund, rauche schon lange nicht mehr, trinke wenig. Ich gehe zu allen für mein Alter empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen und lasse meine Organe auf ihre tadellose Funktion kontrollieren, und bisher war alles intakt, Darm, Lunge, Leber, Niere, Herz, Aorta, alles super, alle Blutwerte innerhalb der grünen Klammer.
Als ich die Zahnarztpraxis verlasse und zu Fuß zu meiner kleinen Stadtwohnung gehe, bevor ich wieder in mein Haus aufs Land fahre, denke ich ans Sterben. Vielleicht zum ersten Mal. Ich werde alt. Ich bin schon alt, in einem früheren Jahrhundert wäre ich wahrscheinlich längst tot. Es ist nicht so, dass ich nicht merke, dass ich älter werde, dass ich schon weit über fünfzig bin, aber bisher spielte das keine Rolle. Jetzt wird mir plötzlich klar, dass man manche meiner Teile nicht mehr reparieren kann, dass sie, wie dieses Stück meines Kieferknochens, unwiderruflich zerstört und verloren sind und dass ich die nächsten zwanzig, dreißig oder, möglich ist es, vierzig Jahre mit diesen kaputten Teilen leben muss.
2
Zuerst überhöre ich den Anruf meiner Schwester, dann überhört meine Schwester meinen. Ich stelle mein Handy auf laut, während ich überlege, was Paula von mir wollen könnte. Wir haben nicht viel Kontakt miteinander. Von meinen vier Schwestern ist Alexandra die einzige, mit der ich regelmäßig telefoniere und die mich über all den Familientratsch auf dem Laufenden hält, den meine Mutter mir unterschlägt, vielleicht auch ein bisschen als lebenslängliche Bestrafung dafür, dass ich so weit weggezogen bin. Wer von den Familieninterna oder ihren Weihnachtskeksen profitieren will, muss in der Nähe vom Küchentisch der Mutter bleiben, so lautet die Regel, sonst verwirkt man seine Ansprüche. Paula ruft wieder an, als ich gerade mitten in einem Gedanken bin, über einen Dialog, den die Frau in meinem Buch mit ihrer besten Freundin führt, und während ich den grünen Hörer auf meinem Smartphone antippe und dann das Lautsprechersymbol, lausche ich dem Gedanken hinterher, wie er für immer verschwindet.
»Hello, sorry, war vorhin auf lautlos«, sage ich, während ich das Telefon in die Gaffer-Tape-Rolle setze, die zu diesem Zweck auf meinem Tisch liegt.
»Wie läuft’s?«, sagt Paula.
Ich tätschle dem Hund den Kopf, der wie immer mit einem Kläffen aus seinem Dösen hochgeschreckt ist, als plötzlich eine fremde Stimme ins Haus eindrang. Er sollte das allmählich gewohnt sein, ständig sprechen hier körperlose Fremde, aus der Lautsprecherbox, aus dem Fernseher, aus dem Telefon.
»Na ja«, sage ich und schaue hinaus in den knallgrünen Garten und hinunter zum Fluss, der heute von trübem Regen brutzelt. »Der Text ist gerade in diesem Stadium … Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts. Da wird doch nie ein Buch daraus. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Das kann nichts werden. Ich weiß noch nicht, wie ich es dem Verlag sage. Ich werde den Vorschuss zurückzahlen müssen. Ist das Wetter bei euch auch so grausig?«
»Ja«, sagt Paula und lacht. Die Nistkästen, die ich letztes Jahr an die Bäume genagelt habe, scheinen in Betrieb zu sein, in den einen hat sich gerade eine Meise verkrochen. »Geht’s dir zum ersten Mal so?«
»Na ja, nein«, sage ich, »ist jedes Mal so.«
Paula lacht wieder.
»Schreibst du auf dem Land? Bleibst du die nächste Zeit dort?«, sagt Paula, mit einem ungeduldigen Drängen, und das jetzt ist ganz klar die Einleitung für eine weitere Frage, deren Inhalt ich schon erahne. Deshalb ist sie so freundlich, denke ich.
»Die meiste Zeit«, sage ich, und dann sage ich etwas, das ich später noch bereuen werde: »Ich habe morgen einen Zahnarzttermin in der Stadt, aber danach fahre ich wieder aufs Land, wahrscheinlich, bis das Buch fertig ist.«
»Weil …«, sagt Paula, »könnte ich dann vielleicht für ein paar Tage deine Bude in der Stadt haben.«
Ah, da ist es.
»Ja sicher«, sage ich, ohne sicher zu sein, ob ich wirklich sicher bin. Ich muss zum Zahnarzt, zu einer Zahnärztin diesmal, ich habe einen Termin bei einer Parodontitis-Spezialistin, um meinen lockeren Zahn begutachten zu lassen und meine restlichen Zähne, um festzustellen, was noch zu retten ist.
»Matthias hat eine neue Freundin«, sagt Paula. »Bei dem möchte ich momentan lieber nicht aufschlagen.« Das von der Freundin weiß ich schon, wir trafen uns vor ein paar Wochen zufällig in der Innenstadt, er hat sie mir vorgestellt, wie hieß sie nochmal? Lola, glaub ich.
»Ich weiß. Kennst du sie schon?«, sage ich, um Zeit zu gewinnen und mir zu überlegen, wie unaufgeräumt die Wohnung gerade ist und wie intensiv ich neben dem Zahnarzttermin werde aufräumen müssen: Im winzigen Vorzimmer liegen Schuhe rum, der Wohnraum ist so weit ordentlich, bis auf das Durcheinander auf dem großen Tisch, die Küchenzeile ist sauber, in der Bettnische verstecken sich unter der Tagesdecke Fernbedienungen, Bücher, diverse Socken, vermutlich auch ein paar angerotzte Taschentücher, und mehr Wohnung habe ich nicht.
»Noch nicht«, sagt Paula, »aber ich lerne sie wohl bald kennen.«
Das Badezimmer, oje. Ein Badezimmer habe ich auch, und es ist garantiert in keinem Zustand, den eine meiner Schwestern als sauber bezeichnen würde.
»… dachte ich, ich frag mal dich«, sagt Paula. »Du kannst natürlich nein sagen.«
Hahaha, das ist lustig. Ich kann natürlich nicht nein sagen. Würde ich nein sagen, ohne zwingenden Grund, hätte ich wahrscheinlich innerhalb einer Stunde eine meiner anderen Schwestern am Ohr, dann noch eine, dann meine Mutter. Wenn in meiner Familie jemand sagt: Das ist schon okay für dich, oder?, dann sagt man: Ja, klar. So lautet das Gesetz.
Sagt man: Na ja, eigentlich passt es mir nicht so gut, bekommt man die Antwort, dass das selbstverständlich völlig in Ordnung sei, wenn auch, tja, nicht ganz verständlich, aber natürlich okay, klar doch; und während du dich in Sicherheit wiegst, öffnen sich hinter dir langsam und unaufhaltsam die Tore der Hölle. Dort war ich schon, darauf falle ich nicht mehr rein.
»Aber nein«, sage ich, »ich hab ja ohnehin vor, die meiste Zeit auf dem Land zu arbeiten. Wann willst du denn kommen?«
»Ich dachte morgen oder übermorgen«, sagt Paula.
»Oh, so bald schon!«
Das überrascht mich. Normalerweise plant man in meiner Familie längerfristiger, Spontan-Entscheidungen gelten als unüberlegt, wenn nicht verantwortungslos. Zu riskant, man muss die Dinge sorgfältig vorbereiten, sonst fallen sie einem auf den Kopf. Ich frage nicht nach. Paula ist die disziplinierteste meiner Schwestern, und die strengste, jedenfalls mir gegenüber, sie wahrt die Form, gibt nichts von sich preis. Ihre Kleidung wirkt stets wie neu, ihre Haare sehen stets frisch geföhnt aus, sie ist stets wie aus dem Ei gepellt, selbst wenn sie nur mit unseren Schwestern am Tisch der Mutter sitzt. Ich finde sie fast unheimlich, sie ist so ein bisschen wie diese moderne Keramik, die man nicht putzen muss, weil restlos alles daran abperlt. Ich fürchte mich auch vor ihr, ganz ehrlich, sie macht mich komplett nervös, zumindest bis zu ihrem dritten Glas Prosecco, dann wird sie ein bisschen menschlicher.
Ich schweife gedanklich ins Logistische ab: Wie verbinde ich das mit dem Zahnarzttermin, nach dem ich eigentlich gleich wieder mit dem Hund zurück aufs Land fahren wollte, warte ich danach mit dem Schlüssel auf sie, oder kann ich ihr den Zweitschlüssel unten beim türkischen Bäcker hinterlegen? Muss ich das Bett frisch beziehen, oder kann ich sie das selber machen lassen, oder wird mir das innerfamiliär als ungastfreundlich ausgelegt werden? (In meinem Kopf erklingt sofort der Mutter-Schwestern-Chor: Aber das Bett hätte sie ihr schon frisch beziehen können, ich meine, das ist ja nicht so eine große Arbeit; faulfaulfaul, lieblos, lieblos, liiiieblos!) Muss ich noch den Boden wischen, oder genügt einmal durchsaugen? Der Zweitschlüssel ist ja bei Therese, fällt mir jetzt ein, sie wohnt zwar nur ein paar Meter entfernt, ist aber tagsüber im Büro, ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen, oder Paula muss an den Schlüssel kommen, ich muss Therese anrufen. Ich merke, dass ich im Wohnzimmer herumgehe, den Tisch entlang zum Fenster, vor dem Korbsessel retour bis zum Ofen, an der Kücheninsel vorbei wieder zu meinem Schreibplatz am Tisch. Der Hund liegt auf dem Sofa und schaut mir zu, sein Kopf liegt zwischen seinen Vorderbeinen, seine Augen gehen mit mir mit.
»Wann kommst du denn an?«, frage ich. Paula sagt, am frühen Nachmittag. Ich sage, dass das okay ist, erkläre ihr das mit dem Zahnarzttermin und dass ich danach wahrscheinlich in der Wohnung mit dem Zweitschlüssel auf sie warten werde. Es stresst mich, dass sie schon so bald kommt, ich hab’s nicht gern, wenn Pläne sich unvermutet ändern, ich hab die Lage gern stabil, und wenn sich was bewegt, würde ich gern vorher eine Liste machen, mit der die Ordnung gewahrt bleibt. Meine Schwester war schon mal in meiner Wohnung, kurz nachdem ich umgezogen war, ich hatte mich ein bisschen vor ihren Blicken in meiner kleinen Bude gesorgt, aber es schien ihr zu gefallen, die Küche, das neue Sofa, der Blick durch die großen Fenster auf die Bäume im Hof, auch wenn sie sich niemals mit einer Ein-Zimmer-Wohnung zufriedengegeben hätte, vermutlich nicht mal ihre Kinder.
»Ich weiß noch nicht, ob ich es davor schaffen werde, das Bett frisch zu beziehen.«
»Kein Problem«, sagt Paula, »du zeigst mir dann einfach, wo ich alles finde.« Der Hund ist vom Sofa runter und kratzt an der Verandatür, ich stehe auf und lasse ihn raus.
»Du weißt eh, dass da auch ein Hund wohnt.«
»Ich mag Hunde.«
»Ich glaube nicht, dass du Hundehaare magst.«
»Wird schon nicht so schlimm sein. Ich nehme an, du hast einen Staubsauger.«
»Im Schrank im Vorzimmer. Zeig ich dir dann. Ich werde es aber schaffen, nochmal zu saugen, bevor du kommst.« Alexandra hat mir mal erzählt, dass Paula ihr Haus mindestens zweimal täglich saugt, in der Früh vor der Arbeit und am Abend nochmal, und ich glaube ihr.
»Danke, dass ich deine Wohnung benutzen darf«, sagt Paula jetzt. Sie klingt ganz klein und weich und irgendwie porös, das kenne ich gar nicht an ihr.
»Aber klar! Ich wohn dann einfach auch mal bei dir. Witz!«
Erst viel später wird mir bewusst, was ich Paula bei diesem Telefonat alles nicht gefragt habe, vielleicht, weil ein erheblicher Teil meines Gehirns mit dem Zustand der Wohnung beschäftigt war und damit, zu überlegen, wie ich das mit der Zahnärztin hinkriege, wenn meine Schwester meine Wohnung besetzt, und wie staubig es unter meinem Bett ist. Ich hasse telefonieren, ich hasse es. Man hat überhaupt keine Zeit, irgendwas zu überdenken, zum Beispiel ein paar ganz einfache, logische Fragen: Wie lange bleibst du, was hast du vor in der Stadt, wieso kommt Christoph nicht mit? Und: Warum kommst du, ist alles okay bei dir?
Als ich endlich Alexandra anrufe, um mit ihr über diesen überraschenden Paula-Besuch zu tratschen und um ein paar Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist es irgendwie zu spät.
3
Ich bin sauer und frustriert, dass die Sache mit meinem Zahn nicht schon viel früher aufgefallen ist in der Zahnarztpraxis, in die ich seit Jahrzehnten gehe. Das müsste doch jemandem aufgefallen sein, dass es meinem Zahnfleisch so schlecht geht, ich war doch erst vor ein paar Monaten dort, zur großen Mundhygiene, doppelt so teuer wie die kleine, und davor auch regelmäßig, nie hat mir jemand gesagt, dass ich ein Parodontitis-Problem habe, so etwas wie: Übrigens, Sie zeigen da Anzeichen von Parodontitis, machen Sie doch mal unbedingt dies und jenes, putzen Sie öfter, putzen Sie damit, putzen Sie so. Nichts dergleichen wurde mir erklärt, sie sagten nur: hundertvierzig Euro, in bar bitte. Parodontitis, das Wort habe ich immer nur in der Zahnpasta-Werbung gehört, das hatte mit mir gar nichts zu tun. Und jetzt habe ich das plötzlich.
»Warum hat man das nicht früher bemerkt?«, fragte ich.
»Nun, das sieht man nur auf einem großen Röntgen«, sagte der Zahnarzt, »und Ihr letztes großes Röntgen war, lassen Sie mal sehen, vor vier Jahren.« Eine blonde Assistentin wuselte herum, reinigte Dinge, hatte mit diesem Gespräch nichts zu tun.
Es hat nie jemand gesagt, dass ich dringend ein großes Röntgen brauche, ich weiß noch genau, was der Dentalhygieniker letztes Mal bei der Mundhygiene sagte: Alles in Ordnung sonst, beim nächsten Termin machen Sie dann mal ein Röntgen. Nicht: Es sollte dringend umgehend ein Röntgen, ein großes Röntgen gemacht werden, kommen Sie unbedingt schnell, zum nächsten möglichen Zeitpunkt, oder: Wir machen jetzt gleich ein großes Röntgen. Ja, stimmt, ich hätte öfter zum Zahnarzt gehen sollen, man könnte immer öfter zum Zahnarzt gehen, aber nachdem jahrelang so viel in meinem Mund repariert und ersetzt wurde, war endlich mal Ruhe, nichts war kaputt, nichts tat weh, nirgends ein Loch, bis dieser Zahn rechts oben sich zu bewegen anfing. Ich dachte mir erst nichts dabei, beziehungsweise ich dachte: Mist, es ist nicht gut, wenn sich rechts oben ein Backenzahn bewegt. Aber ich dachte auch, das sei sicher dieser wurzelkanalbehandelte Zahn, da hat mich der Zahnarzt mal gewarnt, dass der nicht ewig halten würde. Ich ließ ihn wackeln, weil ich gerade nicht Hunderte Euro für einen neuen Zahn ausgeben wollte, und als ich in der Nacht anfing zu träumen, dass meine Zähne ausfallen, ging ich zum Zahnarzt. Es war nicht der wurzelbehandelte Zahn, leider, es war der gesunde daneben.
Ich hatte meiner engsten Freundin Therese von dem Traum erzählt, in der Früh, in meiner Küche. Therese war mit mir aufs Land gekommen, um mit mir im Haus Sachen zu streichen, Therese liebt es, Sachen zu streichen, und bei ihr in ihrer Wohnung ist alles schon fertig gestrichen. Ich liebe das Malen nicht so, nur mit ihr. Obwohl Therese die sachlichste meiner Freundinnen ist, hat sie eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit, ich mag das an ihr. Es tut mir auch gut. Therese hatte schlecht geschlafen und schlecht geträumt. Mir fiel der Zahn-Traum ein.
»Ich habe was geträumt!«, sagte ich, »Und ich kann mich sogar daran erinnern!«
»Gratuliere«, sagte Therese, aber dann sagte sie: »Um Gottes willen, was für ein furchtbarer Traum, du träumst doch sonst nie.« Therese hat sich erst kürzlich ihre Zähne in einer Spezialklinik reparieren lassen.
Ich sagte: »War ja nur ein Traum, Gott sei Dank.«
War leider nicht nur ein Traum, und jetzt denke ich, ich hätte besser ebenfalls zu so einem Superzahnarzt gehen sollen. Ich hätte mich mehr kümmern müssen. Ist natürlich auch meine Schuld, was heißt: auch. Ist meine Schuld.
Und jetzt bin ich ein beginnender Reparatur-Fall beziehungsweise ein Fall, bei dem sich das Reparieren nicht mehr lohnt. Ich kenne das von meinem alten Volvo. Von außen sieht er noch ganz gut aus, vor allem, wenn ich ihn frisch habe putzen und polieren lassen, aber da und dort fängt er an zu rosten, das lässt sich mit Politur nicht mehr richten. Bei mir ist es jetzt offenbar ähnlich. Da stehe ich nun also. Vielleicht ist der Zahn nur der Anfang. Und offenbar bin ich doch nicht so unsterblich, wie ich mir bisher eingeredet habe.
Es gingen früher schon Sachen kaputt bei mir, mit fünf brach mein Oberschenkel, als ich in ein Auto lief, mit zehn brach ich mir einen Daumen beim Schifahren, später riss mir erst ein Band an einem Knöchel, dann am anderen, dann wurde mir, um meine Babys rauszuholen, der Bauch aufgeschnitten und sehr dilettantisch wieder zugenäht, dann brach ich mir den linken Knöchel, dann … Dann nichts mehr. Das war der letzte Bruch, schon elf Jahre her, seither halte ich mich einigermaßen intakt. Vielleicht gebe ich mehr auf mich acht jetzt, seit ich weiß, dass ich ein paar Autoimmunerkrankungen habe, die sich alle ohne gröberen Aufwand unter Kontrolle halten lassen.
Nicht nur deshalb ist es natürlich lächerlich, wegen einem Zahn ein Fass aufzumachen. Es ist nur ein Zahn. Zwei Zähne, wenn man den Weisheitszahn dazuzählt, den mir der Zahnarzt auch ziehen will. Mein restlicher Körper ist intakt, ordentlich genährt, gut gewartet. Tritt ein Wehwehchen auf, gibt’s dagegen eine Pille, ein Spray oder eine Emulsion. Man muss eine Person mit einem Zahnproblem nicht mal in den Kontext der aktuellen Weltpolitik stellen. Es genügt, den Fokus auf die unmittelbare Umgebung zu richten, auf den eigenen Freundeskreis, um zu sehen, dass es im Vergleich ein sehr kleines Problem ist: Brustkrebs, Prostatakrebs, Diabetes 1, Diabetes 2, COPD, Long Covid, HIV, Herzinfarkt, Herzinfarkt, Lungenkrebs, Lungenkrebs, Arthrose, Arthritis, Blutkrebs in Remission, Multiple Sklerose, ME-CFS, beginnender Alzheimer, Herzinfarkt, Hirnschlag, verstorben, verstorben, tot. Was ist da ein Zahn, dessen Fehlen man kaum bemerkt, nichts ist das. In einem Kubikzentimeter meines Körpers wird eine nicht im Geringsten lebensbedrohliche Lücke klaffen, eine minimale Kauverschiebung.
Es ist wie immer ein Jammern auf allerhöchstem Niveau, aus einem umsorgten, gut versicherten Körper heraus, einem Körper, dem viel Wert zugemessen wird, dieser Körper soll funktionieren, er soll gesund sein, um diesen Körper kümmert sich ein funktionierender, hocheffizienter Medizinapparat, er ist gut abgesichert durch ein funktionierendes Sozialsystem. Für jeden Teil dieses Körpers gibt es eine eigene, fantastisch ausgebildete Spezialistin. Ich habe eine Hausärztin, einen Augenarzt, eine HNO-Ärztin, einen Internisten, der auch meine Vorsorgeuntersuchungen macht und mich gegen alles impft, eine Lungenfachärztin, einen Gynäkologen, eine Rheumatologin in einer Spezialambulanz für meine Autoimmunerkrankung, eine Allergie-Ambulanz, eine Psychotherapeutin. Dieser Körper ist ein Oberste-Zehntausend-Körper, ein Premiumorganismus, im Vergleich dazu gibt es auf der Welt nicht viele Körper, die derart gehegt und gehätschelt werden, vor allem nicht, wenn sie schon so alt sind wie meiner.
Und trotzdem. All das zu wissen verhindert nicht mein Selbstmitleid, meine bizarre Wehleidigkeit. Ich verliere einen Zahn: Es ist eine Katastrophe.
4
Ich saß mit dem Laptop am Tisch meiner aufgeräumten Wohnung und wartete auf Paula. Als es klingelte, stand ich auf, ging ins Vorzimmer und drückte auf den Knopf der Fernsprechanlage.
»Erster Stock!«
»Ich weiß!«
Paula zog einen beeindruckend großen Koffer hinter sich her und blieb dann im Vorzimmer stehen. Wir umarmten uns.
»Hey, Kleine.«
»Hey, Große. Du musst zum Zahnarzt? Armes Schwesterlein.«
»Ja, leider. Zu einer Spezialistin. Meine Zähne fallen mir aus.«
»Was?«
»Okay, nur einer, trotzdem. Erzähl ich dir ein anderes Mal. Schön, dass du da bist! Wie war die Fahrt?« Ich hatte ihr den karamellfarbenen Trenchcoat abgenommen und auf das Etikett gelinst, bevor ich ihn aufhängte. Max Mara, klar. Paula streifte sich die Sneakers von den Füßen, weiße, saubere New Balance mit dicker Sohle.
Ihre Haare hatten sich verändert: Die grauen und weißen Strähnen, die sie und ihr Zwilling Franziska letztes Mal, als ich bei den Eltern zu Besuch war, fast stolz in einem akkuraten Pagenschnitt zur Schau trugen, hatten sich in einem edlen, schattierten Blond aufgelöst, das lockig über ihre Schultern fiel, wie früher, und genau wie früher beneidete ich sie um diese Haare. Ich kommentierte es nicht, fragte mich aber sofort, ob auch Franziskas Grau von ihrem Kopf verschwunden war. Ich würde später Alexandra anrufen müssen, sobald ich wieder auf dem Land war, sie würde alles wissen.
Ich ließ uns zwei Espresso aus der Maschine, während ich Paula das Gerät erklärte, dann zeigte ich ihr die Trockner-Funktion der Waschmaschine, in der sich die Bettwäsche drehte, die ich gewechselt hatte; natürlich. Ich hatte auch die Böden gewischt, die Toilette war makellos, das Bad glänzte bis in die Fugen; ich war dafür schon im Morgengrauen in die Stadt gefahren.
Wir setzten uns mit den Kaffeetassen aufs Sofa, von dem ich sorgfältig die Hundehaare gesaugt und die Hundedecke entfernt hatte, die ich zusammen mit dem Hundebett ins Kellerabteil geworfen hatte, weil es in der Wohnung keinen Winkel gab, in dem man so was verstecken konnte. Der Bund mit den Zweitschlüsseln, den ich von Therese geholt hatte, lag schon auf dem Tisch.
Paula rutschte auf dem Sofa hin und her, die Beine hochgezogen, stellte sie wieder auf den Teppich, trank hastig ihren Kaffee. Sie wirkte nervös. Ich stand auf und stellte uns zwei Gläser mit Wasser auf den Couchtisch. Die Nachmittagssonne fiel durch die großen Fenster.
»Was hast du vor in der Stadt?«, fragte ich.
»Eine Fortbildung. Christoph meinte, ich soll das machen.« Dr. Christoph: Sie arbeitete als Logopädin in der Ordination ihres Ehemannes.
Es kam schnell und klang aufgesagt, und sie hatte dabei an mir vorbeigeschaut.
»Ah, so kurzfristig?«
»Ja, das war zuerst ausgebucht, ich war auf der Warteliste. Offenbar ist jemand krank geworden, und ich konnte kurzfristig einspringen.«
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass meine Schwester mich anlog. Oder mir zumindest etwas verheimlichte: Wieso spendierte ihr die Ordination kein Hotelzimmer für die Fortbildung? So ein Motel One kostete ja wohl nicht die Welt.
»Und ich werde mit Matthias und seiner Freundin essen gehen, und an einem Abend treffe ich mich mit Lisi, meiner Schulfreundin von früher, erinnerst du dich an Lisi? Sie arbeitet hier als Anwältin.«
»Nicht wirklich, ihr wart ja praktisch noch Babys, als ich von zuhause wegging. Wie lange hast du denn vor zu bleiben?«
»Ich weiß noch nicht genau.« Sie schaute an mir vorbei.
Das war nun merkwürdig, warum wusste sie nicht, wie lange ihre Fortbildung dauerte? Und hatte sie nicht noch zwei Kinder zuhause? Okay, Konstantin musste schon bald achtzehn sein, Leonard etwa fünfzehn, aber Paula war ihnen bisher immer eine hingebungsvolle Mutter gewesen, die erst vor wenigen Jahren wieder in Teilzeit zu arbeiten angefangen hatte.
»Wie geht’s den Jungs zuhause?« Paula starrte auf ihr Smartphone, das sie aus ihrer edlen Tasche geholt hatte, deren Label ich nicht erkennen konnte.
»Was? Christoph ist mit ihnen in Frankreich unterwegs, mit so einem Campingbus, zwei Wochen.«
Das hatte ich nicht gefragt.
»Ach ja, es sind ja Ferien. Wieso bist du nicht mit?«
»Ich bin zu alt zum Campen, besser, die fahren ohne mich, ich jammere nur herum, dass mir alles zu eng und zu unbequem und zu dreckig ist.«
»Ginge mir auch so. Alles okay mit Christoph?« Sie fing an, auf ihrem Handy zu tippen.
»Ja. Ja klar. Was soll nicht okay sein?«
Paula ließ das Telefon wieder in die Handtasche gleiten und zappelte auf dem Sofa herum. Ich fühlte mich in meiner Wohnung plötzlich nicht mehr wohl. Ich sollte besser gehen.
Ich zeigte auf den Schlüsselbund. »Die zwei eckigen schließen die Wohnungstür, der runde die Haustür. Die klemmt manchmal ein bisschen.«
»Super, danke.«
»Da am Regal hängt das Internet-Passwort. Wenn du den Markt überquerst, siehst du gleich einen Bäcker, der ist gut. Den kleinen Italiener vis-à-vis kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Musst du sonst noch was wissen?«
»Glaub nicht. Sonst melde ich mich.« Sie stand schon, bereit, mich zu verabschieden.
Ich klappte den Laptop zu und steckte ihn in meine Tasche.
»Viel Spaß in der Stadt, hab’s nett, Grüße an Matthias.« Ich schlüpfte in meine Sneakers, zog meine Jacke an, band mein Tuch um und schnappte mir meine Schlüssel von der Kommode.
»Werd’s ausrichten. Und danke nochmal!«
Dann schloss sich die Tür hinter mir. Ich ging den Flur lang, auf die Straße und zu meinem Auto, das in einer nahen Gasse parkte, ich fuhr zur Parodontologin, in deren Wartezimmer ich nun saß, und wurde das Gefühl nicht los, dass ich aus meiner Wohnung geschoben worden war; auch jetzt noch nicht.
5
Die Parodontologin, die mir mein Zahnarzt empfohlen hat, ist eine große, sehr schlanke Frau. Sie trägt Kopftuch und makelloses Make-up. Sie ist jünger als ich, mindestens zehn, eher fünfzehn Jahre, behandelt mich aber wie ein Kind, das seine Hausaufgaben nicht gemacht und seine Zähne nicht ordentlich geputzt hat. Meine Tasche hängt an einem violetten Kunststoff-Haken, den die Assistentin für mich aus der zartvioletten Wand geklappt hat. Violett, das ist die Leitfarbe hier. Violette Türschnallen, violette Bilderrahmen, auch das Untergestell des Schreibtisches, an den sich die Zahnärztin auf ihrem mit violettem Kunstleder überzogenen Hocker gerollt hat, ist violett.
Die Zahnärztin hat ein neues Röntgenbild anfertigen lassen, schaut in meinen Mund, schaut auf das Röntgenbild, schabt mit einem metallischen Gerät grob an meinen Zahnhälsen herum, es ist sehr unangenehm und irgendwie erniedrigend. Sie schaut wieder auf das Röntgenbild. Ich habe das Bedürfnis, mich und mein Zahnputzregime zu rechtfertigen. Ich putze mir meine Zähne zwei- bis viermal täglich! Nie, absolut nie gehe ich mit ungeputzten Zähnen zu Bett! Die Zahnärztin will nichts davon wissen, sie ist nur an dem interessiert, was sie in meinem Mund sieht, und das scheint ihr nicht zu gefallen.
»Rauchen Sie?«
»Nein.«
»Haben Sie früher geraucht?«
»Ja.«
Die Zahnärztin macht ein Geräusch, das Missfallen ausdrückt.
»Wann haben Sie das letzte Mal geraucht?« Vor, Moment, drei Jahre sind das jetzt. Sie fragt mich nach chronischen Erkrankungen, und ich zähle meine Autoimmunerkrankungen auf, und das besänftigt sie etwas, aha, sie nickt und meint, auch das spiele eine Rolle und begünstige Entzündungen. Ich fühle mich etwas besser, es ist nicht nur meine Schuld.
Schließlich öffnet sie eine Schublade und holt eine kleine Tafel heraus, ein Schaubild, das Zähne in drei Stadien zeigt: gesund, krank, hinüber. Sie rollt auf ihrem Hocker zum Behandlungsstuhl, auf dem ich nun sehr unbequem sitze, meine Beine hängen auf der Seite herunter. Die Zahnärztin blickt ernst zwischen mir und der Tafel hin und her und erklärt mir, meine Parodontitis sei so weit fortgeschritten, dass der Prozess bereits unumkehrbar sei. Ihr Gesicht ist vollkommen glatt. Vor zehn Jahren, da hätte man ihn eventuell noch aufhalten können, sagt sie mit sachlicher leiser Stimme, nun könne man nur noch versuchen, ihn zu verlangsamen. Es müsse mir bewusst sein, dass das Unterfangen, einen Teil meiner Zähne zu retten, nie zu Ende sein werde. Wir würden ab sofort und so lange wie möglich versuchen, mein Gebiss in meinem Mund zu behalten, und das könne nur mit meiner konsequenten Mitarbeit gelingen. Allerdings sei ein Erfolg auch dann keineswegs garantiert, sie könne mir nichts versprechen.
Sie steht auf, ihr Kittel fällt locker über ihre Hose. Sie erklärt mir die kommenden Behandlungen. Ob ich das verstanden hätte? Ich nicke wie die dumme Schülerin, als die sie mich vorführt, ja, das habe ich verstanden.
6
In meinem Haus auf dem Land zieht sich ein Riss quer über die Decke meines Schlafzimmers. Der Riss setzt auf der linken Wand an, dann fährt er schnurgerade mittig über die Decke und verebbt schließlich im oberen Drittel der rechten Wand in einer zarten Verästelung. Auch an der Wand hinter meinem Bett klafft ein Riss, schräg unter der Ecke, etwas krumm und ohne System. Diese Risse sind schon lange da, sie beunruhigen mich nicht besonders, ich rede mir ein, sie seien oberflächlich und bedeutungslos. Ich sage mir, dass die Risse nur die Putzschicht der Wand betreffen, nicht die Mauer, die Mauer ist bestimmt intakt.
Die Risse an der Wand in dem ausgebauten Dachboden, in dem die Kinder und ihre Freunde schlafen, wenn sie auf Besuch sind, beunruhigen mich dagegen schon. Ich glaube, sie sind frisch, jedenfalls sind sie mir nie zuvor aufgefallen. Sie ziehen sich über eine Mauer, hinter der der Kamin verläuft, vielleicht ist er zu heiß geworden und hat nun einen Sprung, ich werde die Rauchfangkehrerin fragen, wenn sie demnächst kommt.
Die Rauchfangkehrerin ist neu, sie hat vom bisherigen Rauchfangkehrer übernommen, der offenbar in Rente ging und der, seit ich das Haus gekauft hatte, einmal im Jahr aufgetaucht war, immer unangekündigt. Er war mir unheimlich, er war riesig und sehr kräftig, seine männliche Präsenz dehnte sich in meiner gesamten Küche aus, während er seinen Auftragsschein ausfüllte und mich dabei ausfragte, mit säuselnder Stimme: Ich habe Ihren Mann schon lange nicht mehr gesehen. Ist er nicht mehr da? Leben Sie jetzt ganz allein hier?
Ich glaube nicht, dass er meinen Lügen glaubte, mein Mann sei gerade in der Stadt, komme am Abend wieder, der Rauchfangkehrer war ja in jedem Haus im Dorf, er wusste alles über jeden, ganz sicher wusste er, dass ich geschieden oder getrennt war, dass mein Mann nicht mehr da war und nicht mehr kommen würde und dass da zwar ein Typ hin und wieder bei mir auftauchte, aber immer nur für ein paar Tage. Die reden doch alle, ich kenne mein Dorf.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rauchfangkehrer harmlos war, trotzdem war ich jedes Mal erleichtert, wenn er mein Haus wieder verlassen und ich die Tür hinter ihm versperrt hatte. Ich fühlte mich erst etwas sicherer, als ich den Hund hatte, der ihn nicht mochte, braver Hund.
Der Rauchfangkehrer säuselte den Hund an und erklärte mir, dass er auch immer Hunde gehabt habe und wie sehr er Hunde liebte, aber mein Hund liebte ihn nicht, er bellte und knurrte, ich musste ihn im Gästezimmer einsperren, bis der mächtige Rauchfangkehrer das Haus und den Garten endlich verlassen hatte und in seinen Wagen gestiegen war, und wenn ich den Hund dann rausließ, galoppierte er nach vorne zur Straße und bellte dem Rauchfangkehrer noch durch den Gartenzaun hinterher.
Ich habe dem Rauchfangkehrer nie einen Kaffee angeboten, ich wollte, dass er so schnell wie möglich mein Haus verlässt, aber seine Nachfolgerin fragte ich gleich beim ersten Mal, ob sie einen Kaffee möchte, Milch habe ich leider nicht da. Während sie mit der Tasse in der Hand in meiner Küche stand, fragte ich sie ein bisschen nach ihrem Leben, und sie erzählte mir, dass sie auf einem Bauernhof lebt, mit ein paar Tieren. Ich fragte sie nicht, ob da auch noch andere Menschen wohnen oder ob sie Kinder hat, geht mich alles nichts an. Aber der Hund mochte die neue Rauchfangkehrerin. Wenn sie kam, bellte er nur sein kurzes Warnbellen, und sobald er sie erkannte, machte er sich rund und wedelte vor ihr herum. Es war der Tanz, den der Hund nur für diejenigen aufführt, die er mag und liebt.