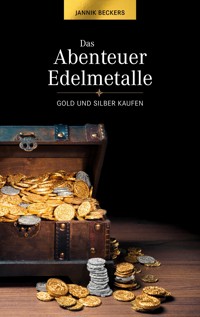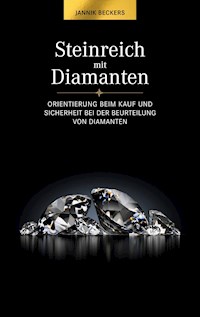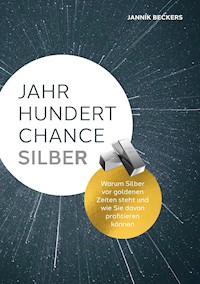
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für viele Privatanleger steht noch immer Gold im Mittelpunkt ihres Interesses, aber Silber stehen goldene Zeiten bevor. Erfahren Sie in diesem Buch, in einem ganzheitlichen Ansatz, warum für Ihr privates Vermögen und Ihre langfristige Altersvorsorge die Chancen von Silber bedeutend größer sind als die des Goldes. »... tiefschürfend, mit viel Historie, auch philosophisch, aber nicht markttechnisch. Man sieht Silber aus einem neuen Blickwinkel.« (Dr. Bruno Bandulet)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tabea Santana Mainitz und Angeliki Efimia Mpardola, zwei Menschen, die mir lieb und teuer sind.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Als Silber noch Geld war und wie es entmonetarisiert wurde
1.1 Rückkehr zum Goldstandard?
2. Die globalen Silberreserven
2.1 ›Glück auf!‹ – von der deutschen Kultur des Silberbergbaus
3. Silberpreismanipulation: Was ist ein fairer Silberpreis?
3.1 Aufgelder und Abschläge am physischen Edelmetallmarkt
3.2 Exkurs: Technische Analyse und Fundamentalanalyse
4. Ist Silber das Gold des armen Mannes?
4.1 Exkurs: Der schnelle (und seriöse) Weg zu einem großen Vermögen
5. Wie in Silber investieren?
5.1 Die wichtigsten Silberlegierungen
5.2 Kann Silber verboten werden?
Schlusswort
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Leute, die dafür ausgebildet, ausgewählt und entlohnt werden, komplizierte Lösungen zu finden, sind nicht motiviert, mit einfachen Lösungen zu arbeiten. Das gilt vor allem für die Finanzberatung, da viele Menschen dazu neigen, sich nicht mit finanziellen Belangen beschäftigen zu wollen, weil sie dem Trugschluss erliegen, dass die Thematik zu umfangreich und damit unübersichtlich ist. Ein Bankberater ist ein Verkäufer, der bei der Produktauswahl an das Angebot seines Arbeitgebers gebunden ist. Sein unausgesprochenes Motiv ist seine sichere Stelle, sein Gehalt, seine an seinem Beratungsumsatz gemessenen Verkaufsprämien und sein Bonus. Während römische Familien einst üblicherweise einen gebildeten Haussklaven als gewissenhaften Verwalter ihrer Finanzen beschäftigten, weil sie ihn bei gegebenem Anlass ohne juristische Mittel sehr viel strenger bestrafen konnten als einen Freien,1 unterliegt ein Bankberater der Gegenwart einem Interessenkonflikt. Daher ist man am besten beraten, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Einen ersten Schritt haben Sie getan, indem Sie dieses Buch erworben haben. Sie werden einige historische Hintergründe erfahren, denn wer Gold und Silber besitzt, versteht vor allem eines: die Geschichte. Bekanntlich wiederholt sich die Geschichte nicht, aber sie reimt sich sozusagen. Indem die Zeichen und Spuren der vergangenen Wirklichkeit entschlüsselt und in einen Zusammenhang gebracht werden, wird dies offenbar. In seinem Grundriss der Historik erklärt der deutsche Geschichtstheoretiker Johann Gustav Droysen (1808–1884): »Wäre das geschichtliche Leben nur Wiedererzeugung des immer Gleichen, so wäre es ohne Freiheit und Verantwortlichkeit, ohne sittlichen Gehalt, nur organischer Natur.« (Droysen 1974, S. 339). Es kommt darauf an, »in den vergangenen Geschehnissen Wirklichkeiten mit der ganzen Fülle von Bedingnissen, die ihre Verwirklichung und Wirklichkeit forderte, zu sehen.« (ebd.). Durch nicht nur deutsche und europäische, sondern auch globale Akzente strebe ich Multiperspektivität an, die in ihrer Darstellung zwar tendenziell schlaglichtartig ist, aber durch den Fokus auf ein globales Phänomen, nämlich die Faszination für Gold und Silber, mittels vergleichender Sichtweisen ein besseres Verständnis für das große Ganze schafft. Gold und Silber sind seit jeher fester Bestandteil menschlichen Wirkens. Sigmund Freud (1856–1939) brachte seinerzeit die Neigung zum Horten von Geld mit Formen der unterbewussten Sexualität des Kindes in Zusammenhang.2 Die unbewusste Sexualität werde durch eine sogenannte Sublimierung von einem besonders starken Hang zum Geld verdrängt, und Freud erhärtet seine durchaus ungewöhnliche Erkenntnis mit den Worten: »Wo immer archaische Denkformen dominieren oder überlebt haben – in alten Zivilisationen, in Mythen, Märchen und Aberglauben, in unterbewußten Gedanken und Träumen sowie in Neurosen – wird Geld in engster Weise mit Exkrementen in Verbindung gebracht.« (Wells 1960, S. 148 f.; zit. nach Anikin 1987, S. 127). Nach Freud ist der Hang zu Gold und Silber in ihrer Urfunktion als Geldmetall also schon im Unterbewusstsein des Menschen gegeben.
Kommen wir mit diesen Gedanken zurück zum wesentlichen Inhalt dieses Buches: Um mit den Worten des Schweizer Kulturhistorikers Jacob Burckhardt (1818–1897) zu sprechen, wollen wir »durch Erfahrung nicht so wohl klug (für ein andermal), als vielmehr weise (für immer) werden.« (Burckhardt 1982, S. 230). Burckhardt meinte mit diesem Auszug aus seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen, dass die historische Erforschung eines geschichtlichen Ereignisses den Menschen zwar nicht befähige, in seiner Gegenwart klüger zu handeln, zumindest aber vergleichende Unterscheidungen anzustellen. Am Beispiel zwischen Edelmetallen und ungedecktem Papiergeld können wir so eine bessere Vorstellung von der Fragilität unseres modernen Finanzsystems bekommen und weiterhin bei der vergleichenden Unterscheidung zwischen Gold und Silber eine erhebliche Unterbewertung von Silber am Markt und damit sein besonders hohes wertsteigerndes Potenzial (reale Kaufkraftsteigerung) erkennen. Darum geht es in diesem Buch, und was Sie mit Ihren daraus gewonnenen Erkenntnissen anstellen, obliegt ganz allein Ihnen. Meinen persönlichen Anspruch als Autor sehe ich im Nachkommen einer dreifachen Verantwortung: gegenüber den Fachinhalten, gegenüber den Vertretern und Institutionen der Wissenschaft und gegenüber einer Öffentlichkeit, deren Bildung und Wohl der ganze Einsatz gilt.
Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper (1902–1994) schreibt in seinem Brief Gegen die großen Worte, dass jeder Intellektuelle eine ganz spezielle Verantwortung habe, weil er das Privileg und die Gelegenheit besitze zu studieren. »Dafür schuldet er es seinen Mitmenschen (oder ›der Gesellschaft‹), die Ergebnisse seines Studiums in der einfachsten und klarsten und bescheidensten Form darzustellen. […] Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.« (Popper 2016, S. 100). In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, eine leicht verständliche und erkenntnisreiche Lektüre.
Viersen im Frühjahr 2022 Jannik Beckers
1Als Silber noch Geld war und wie es entmonetarisiert wurde
Der irische Dramatiker George Bernard Shaw (1856–1950) postulierte in seiner Komödie Zu viel Geld, dass Geld eine Garantie für das sei, was man Kultur nenne (vgl. Shaw 2000, S. 222). In jedem Fall ist Geld keine unbedingte Voraussetzung für Kultur, wenn der Kulturbegriff nach dem deutschen Philosophen Hubertus Busche (*1958) in den folgenden vier Grundbedeutungen definiert wird. Erstens: »Kultur, die man betreibt: vervollkommnende Pflege der individuellen Naturanlagen«. Zweitens: »Kultur, die man hat: gepflegter Zustand oder hoher Grad erworbener Vervollkommnung«. Drittens: »Kultur, in der man lebt: der charakteristische Traditionszusammenhang von Institutionen, Lebens- und Geistesformen, durch den sich Völker und Epochen voneinander unterscheiden«. Und viertens: »Kultur, die man schaffen, fördern und als (nationalen) Besitz verehren kann: die höhere Welt der Werte und Werke in Kunst, Philosophie und Wissenschaft« (Busche 2000, S. 69–90).3 Beispielsweise betrachtete es im vorindustriellen Japan der Kriegerstand der Samurai4 ihrer Kultur nach als Schande, Geld anzurühren. Für die Samurai waren die Wege des Reichtums nicht die Wege der Ehre: »The business of the samurai consists in reflecting on his own station in life, in discharging loyal service to his master if he has one, in deepening his fidelity in associations with friends, and, with due consideration of his own position, in devoting himself to duty above all […] The samurai dispenses with the business of the farmer, artisan, and merchant and confines himself to practicing this Way« (Tsunoda et al. 1964, S. 390). Dabei ist die Trennung von Macht und Reichtum als eine Sozialstrategie zu verstehen, weil sie eine Anhäufung von Reichtum aufseiten der Mächtigen verhindert und für eine in etwa gleichmäßige Verteilung desselben sorgt. Außerdem wurde gerade von den Kriegern strengste Einfachheit des Lebens gefordert, denn als größte Gefährdung der kriegerischen Effizienz und allgemein der menschlichen Natur galt der Luxus, der durch die Einübung von Enthaltsamkeit, oder anders gesagt Sparsamkeit, vermieden wurde. Die Geldangelegenheiten wurden von einem Samurai niederen Ranges oder von einem Priester verwaltet, und sie waren stolz darauf, ihren Mitmenschen zu zeigen, dass sie nicht einmal wussten, wie man mit Geld rechnet. Der deutsche Nationalökonom und Soziologe Ernst Schultze (1874–1943) konstatierte, dass, je größer der Luxus, desto inhaltloser das Werk ist (vgl. Schultze 1940b, S. 248). Man könnte auch polemisch sagen, dass der Luxus eine Erhöhung erfährt: Mit ihm kann auch die Wahrheit, die nicht gut oder schön zu sein braucht, ertragen werden. Der alte Dreiklang vom Wahren, Schönen und Guten als unisono erfahrbarem Ideal ist demnach obsolet.
Im alten Japan nahm der Kaufmann in der Hierarchie der Berufe den niedrigsten Stand ein: Ritter (shi), Bauer (nō), Handwerker (kō), Kaufmann (shō) (vgl. Nitobe 2006, S. 62; vgl. Schwentker 2019, S. 88).5 Vermutlich würde eine ähnliche berufsständische Hierarchie wie das japanische ›shi-nō-kō-shō‹ überall in der Welt bestehen, wenn es keine Beeinflussung von beispielsweise Zunftordnung und -geist wie auch Gilden (Berufsverbänden) als laterale Vergemeinschaftungsformen, vor allem im Westen, geben würde. Der Schotte Adam Smith (1723–1790), seines Zeichens Moralphilosoph und Begründer der klassischen Nationalökonomie, ging sogar so weit, Grundeigentümer und Pächter mit Liberalität, Freimütigkeit und gegenseitigem Helfen zu assoziieren, während er Kaufleuten, Handwerkern und Gewerbstätigen Engherzigkeit, Kleinlichkeit und eine egoistische Einstellung unterstellte, »die allem Geselligen und allem Vergnügen abhold ist.« (Smith 2003, S. 565). Bereits im Alten Ägypten und Alten Indien waren Kaufleute und Handwerker gesellschaftlich am wenigsten angesehen. Zwar wurden Kaufleute um ihre Gewinne beneidet, aber mit einem großen Finanzvermögen ging nicht zwangsläufig gesellschaftlicher Aufstieg einher. Zumindest im Frankreich des 18. Jahrhunderts waren beispielsweise Finanzmakler durchweg von niederer Herkunft, aber dennoch außerordentlich reich und häufig zu stolz, um ihresgleichen zu heiraten. Umgekehrt wurden sie von der Damenwelt des vornehmen Standes verschmäht, sodass sie häufig bewusst Junggesellen blieben. »Ohne eigene Familie und ohne enge innere Bindung zu ihren Verwandten, deren Existenz sie am liebsten leugnen würden, sind sie eigentlich nur daran interessiert, das eigene Leben zu genießen, so daß es sie nicht betrübt, wenn ihr Vermögen mit ihnen untergeht.« (ebd., S. 793).6 Bemerkenswert ist, dass der antike griechische Philosoph Platon (428/427–348/347 v. Chr.) im dritten Buch seiner Politeia die Wertigkeit der Stände mit einem Gleichnis verschiedener Metalle abstuft: Gold für die Herrscher, Silber für ihre Helfer und Eisen für die Ackerbauern und sonstigen Handarbeiter (vgl. Platon 2020, S. 148). Bei Platon handelt es sich jedoch um ein vertikales Organisationsprinzip als Herrschaftsmodell; laterale Vergemeinschaftungsformen sind grundsätzlich genossenschaftlich strukturiert. Beide Formen sind als eine soziale ›Ordnung durch Ungleichheit‹ zu verstehen.
Heute überwiegen die ökonomisch-finanziellen Interessen, die dem verhängnisvollen Umstand der Modernität unterliegen, dass es zunehmend um das Erklären geht und weniger um das Verstehen. Konsumentscheidungen als persönlichen Beitrag zur Förderung des Binnenmarktes, zur Steigerung des Wirtschaftswachstums und zur Sicherung der Arbeitsplätze zu begründen – wie Ökonomen es tun –, kommt einer Verdrängung der unbefriedigenden, frustrierenden und energieraubenden Beziehungen der Menschen in den wirtschaftlich führenden Ländern gleich. Geld als ein völlig leeres, abstraktes Medium ist eine globale Illusion, welche die Welt regiert. Für einen japanischen kaufmännischen Schuldner zumindest der Edo-Zeit waren Integrität und Ehre die beste Sicherheit, die er auf Schuldscheine geben konnte. In den entsprechenden Klauseln hieß es beispielsweise: »Falls ich Ihnen das Geld nicht zurückzahle, dürfen Sie mich einen Narren nennen.« (zit. nach Nitobe 2006, S. 66). Über das Edikt von 1876, das in Japan das Tragen von Schwertern verbot – bereits vor der Meiji-Restauration von 1868 wurde das exklusive Recht der Samurai zum Waffentragen unterlaufen (vgl. Schwentker 2019, S. 109 f.) –, schrieb der japanische Philosoph Nitobe Inazō (1862–1933)7 in seinem Buch Bushido (deutsch: ›Wege soldatischer Ritter‹), das bis heute als Standardwerk zum Verständnis der Ethik und des Alltagsverhaltens der Japaner gilt: »Das Edikt, das […] das Tragen von Schwertern verbot, läutete das alte Zeitalter ›der ungekauften Anmut des Lebens, der gerechten Verteidigung der Nationen, der Pflege männlichen Edelmuts und heroischer Unternehmungen‹ aus und das neue Zeitalter der ›Kasuisten [Wortverdreher – Anmerkung des Verfassers], Ökonomen und Kalkulierer‹ ein.« (Nitobe 2006, S. 143). Mit dem Verlust des Schwertes als Symbol ihres Selbstverständnisses waren die Samurai als Herrschaftsstand formell aufgelöst, denn es galt das Diktum: »Das Schwert ist die Seele des Samurai.« Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts machten die Samurai mit ihren Angehörigen etwa 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung von 25 bis 30 Millionen Menschen aus (vgl. Schwentker 2019, S. 88 f.). Bereits im 17. Jahrhundert verarmte der japanische Kriegerstand zusehends aufgrund des anhaltenden Friedens, und die Studien zur politischen Ökonomie vermitteln hier den Eindruck, als ob die finanziellen Probleme von oben nach unten ›durchgereicht‹ wurden. Der konfuzianische Gelehrte Dazai Shuntai (1680–1747) schrieb: »In der letzten Zeit befinden sich die Fürsten, ob gross oder klein, in äusserster Not, da keinem die Geldmittel reichen. Sie entleihen vom Solde ihrer Vasallen […] Genügt ihnen das nicht, so zwingen sie die Bevölkerung Geld herzugeben, um sich durchzuhelfen. Wenn auch das nicht genügt, macht man jahraus jahrein Anleihen bei den reichen Kaufleuten […] Da sie nur borgen und nur selten zurückzahlen, so häufen sich die Zinsen an, und niemand weiss, wie oft sich die ursprüngliche Schuld verdoppelt.« (zit. nach Ramming 1928, S. 9). So kam es vor, dass sich im 18. Jahrhundert auf der Straße nicht mehr die Kaufleute vor den Samurai verbeugten, sondern umgekehrt, und manche Samurai begannen, sich als Handwerker oder Kleinhändler zu verdingen, um zumindest ein sicheres Auskommen zu haben. Allgemein entstand im Zuge des kapitalistischen Wirtschaftssystems im 19. Jahrhundert der Menschentyp des sogenannten Homo oeconomicus, zu dessen Charakteristika rationales Kalkül, selbstsüchtiges Verhalten und Profitgier zählen. Unzweifelhaft verdanken wir unseren heutigen weitgehend globalen Wohlstand zu großen Teilen der spezifischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des Kapitalismus, welche die feudale Wirtschaftsorganisation überwand, den Krieger in Sold nimmt und von dem freien Arbeiter dessen Arbeitsleistungen einkauft. Allerdings sei am Beispiel der alten Samurai – deren Ideologie8 mitunter in Politik und Wirtschaft des modernen Japan fortlebt – angemerkt, dass zwischen materiellem Wohlstand und immateriellem Wohlbefinden ein offensichtlicher Unterschied besteht. Beides ist von kultureller Bedeutung.9
Adam Smith erkannte im 18. Jahrhundert nach kritisch-intensiver Beobachtung, dass der Mensch in seinem Streben nach materiellem und sozialem Fortschritt Ziele mit einem Eifer verfolgt, der ihn gleichsam blind für das Angemessene seines Tuns werden lässt. In seiner Theorie der ethischen Gefühle hält Smith fest, dass es keine Lebenslage wert sein könnte, »daß wir ihr mit jenem leidenschaftlichen Eifer nachjagen, der uns antreibt, die Regeln der Klugheit oder die Regeln der Gerechtigkeit zu verletzen – oder unsere Seelenruhe für alle Zukunft zu zerstören« (Smith 2021, S. 235). Der freiwillige Verzicht auf Wachstum in unserer kapitalistischen Wirtschaft, einer Überflussgesellschaft, der ein Wachstumszwang inhärent ist, scheint eine bislang ungelöste Herausforderung zu sein. Dabei heißt es bereits im Neuen Testament in den Worten von Jesus Christus – der im Übrigen seinerzeit als Nicht-Schriftgelehrter lediglich eine ›universale Botschaft‹ verbreitete, bis seine Nachfolger (unter ihnen Paulus) daraus später die christliche Religion erschufen: »Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?« (Markus 8:36–37). Nachdem sich der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau (1817–1862) Mitte des 19. Jahrhunderts für zwei Jahre in die Wälder von Massachusetts zurückgezogen hatte, um in einem Daseinsexperiment die menschliche Existenz zu erforschen, übte er in seiner letzten großen Bekenntnisschrift Leben ohne Grundsätze Kritik an der Vorherrschaft des Ökonomischen: »Lehrt uns Gott, uns zu ernähren, indem wir graben, wo wir niemals pflanzten, und wollte Er uns vielleicht mit Goldklumpen belohnen? […] Ein Körnchen Gold vermag eine große Oberfläche nicht so gut zu vergolden wie ein Körnchen Geist.« (vgl. Thoreau 2019, S. 22; zit. nach Thoreau 2009, S. 286). Zu Zeiten Thoreaus nahm Karl Marx (1818– 1883) als Entwicklungsprinzip der Geschichte respektive der sozialen Gegenwart einen dialektischen Prozess an, also einen Prozess, in dem etwas Gesetztem (These) etwas entgegengesetzt wird (Antithese) und in dem sich aus dieser Entgegensetzung etwas Neues ergibt (Synthese). Marx vertrat die Auffassung, dass Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen sei. So verstärken sich in einer bestehenden Gesellschaft die jeweiligen Gegensätze immer weiter, bis es zu einer sozialen Revolution kommt, in der sie gleichsam aufgehoben werden und somit zu einer neuen Gesellschaftsform führen. Auf diese Weise verschärfte sich in der Sklavenhaltergesellschaft der Gegensatz zwischen dem Herren und dem Sklaven durch eine zunehmende Machtfülle der Herren bei zugleich immer größerer Ausbeutung der Sklaven. Deren Unzufriedenheit führte zu einer Revolution, durch die in der Spätantike die Feudalgesellschaft entstand. Auch hier wurde der Gegensatz beider Gesellschaftsklassen immer größer, bis zu Beginn der Neuzeit schließlich der Kapitalismus aus einer Revolution hervorging – den Marx als seine eigene Gegenwart erlebte und der bis heute die vorherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung darstellt.10 Marx erklärt: »Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.« (Marx 1961, S. 9). Dialektisch gedacht bedeutet dies, dass der Mensch über seine Arbeit die Gesellschaft formt und die gesellschaftlichen Beziehungen wiederum ihn. Der heutige Kapitalismus funktioniert allein deshalb, weil ein abwärtsgerichteter sozialer Vergleich – der Erfolg des Einen ist der Misserfolg des Anderen – ein so effektiver Motivator ist.11 In einem Gemeinwesen besteht das natürliche Bestreben jedes Einzelnen darin, die eigene Lage ständig zu verbessern – ein Prinzip der Selbsterhaltung. In diesem Zusammenhang gibt Smith ein anschauliches Beispiel, warum der freiwillige Verzicht auf Wachstum eine bislang ungelöste Herausforderung zu sein scheint: »[W]enn gute Kleidung sehr teuer ist, muß die Vielfalt ziemlich klein sein; sie wird indes ganz von selbst größer, wenn die Kosten eines Kleidungsstücks als Folge verbesserter Produktivität in Handwerk und Gewerbe erheblich geringer werden. Da dann die Wohlhabenden nicht mehr durch Aufwand für Kleidung auffallen können, werden sie dies ganz von selbst durch Vielzahl und Vielfalt ihrer Kleider zu erreichen suchen.« (Smith 2003, S. 581). Den Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus beschrieb der gebürtige Ungar André Kostolany (1906–1999), seines Zeichen Börsen- und Finanzexperte, prägnant als »ein großer Kuchen, der ungerecht, oder ein kleiner Kuchen, der gerecht geteilt wird; mit dem Ergebnis, dass die gerechten Stücke des kleinen Kuchens viel winziger sind als die kleinsten Stücke des großen Kuchens.« (Kostolany 2017, S. 16). Kostolany war der Überzeugung, »dass die Wirtschaft grundsätzlich wachsen will, weil die Triebfeder des Wachstums der Drang des Menschen nach einem immer höheren Lebensstandard ist. Und sind die Reichen faul und satt, gibt es andere, die es auch nach oben schaffen wollen und für weiteres Wachstum sorgen.« (ebd., S. 90). Demnach haben vereinzelte Bewegungen – namentlich die Gegenbewegung zur Konsumwelt – keine spürbaren Auswirkungen auf das große Ganze.
In der menschlichen Geschichte waren Natural- und Geldwirtschaft keine zeitlich aufeinanderfolgenden Wirtschaftsformen. Sie kommen vielmehr nebeneinander vor, ohne dass die eine als Zeugnis primitiver und die andere als spezifischer Ausdruck höherer Kultur zu werten wäre. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass im Alten Indien nach dem Staatsrechtslehrbuch Arthaśāstra der obligatorischen Verstümmelung, also einer Leibesstrafe, durch die Zahlung einer alternativen Geldstrafe entgangen werden konnte. Dies war ein großer Vorteil der Vermögenden gegenüber den Armen. Um beispielsweise der drakonischen Strafe der Blendung zu entgehen, der Strafe für ein Religionsverbrechen, konnten alternativ umgerechnet etwa 2,4 Kilogramm Silber bezahlt werden (vgl. Nath 1924, S. 15 und 38 f.; vgl. Lenzen 1966, S. 66). Überdies ist bemerkenswert, dass Indien im dritten Jahrhundert vor Christus die gleiche wirtschaftliche Entwicklung erreicht hatte wie Europa im 15. Jahrhundert nach Christus (vgl. Nath 1924, S. 12).
Auch im modernen Welthandelsverkehr werden Handelsforderungen zuweilen noch ohne Geldbewegung durch Lieferung von Naturalien respektive Waren und Dienstleistungen ausgeglichen (sog. Bartergeschäfte); beispielsweise Geschäfte zwischen Importeuren und Exporteuren wie deutsche Lastkraftwagen gegen Bananen aus Ecuador oder italienische Personenkraftwagen gegen kubanischen Zucker. Der österreichische Kulturhistoriker Robert Eisler (1882–1949) gibt in seinem Buch Das Geld ein charakteristisches Beispiel für Warentausch ohne Geldbewegung im 20. Jahrhundert: »Böhmische Zuckerfabrikanten senden Rübenzucker nach England, während englische Wollenspinner Schafwollgarne an Webereien in Brünn schicken. Die ersteren ziehen für ihr Guthaben Wechsel auf ihre englischen Schuldner, die den Wechsel akzeptieren. Dieser wird dann einer Prager Bank präsentiert, von dieser indossiert und ausbezahlt. Die Brünner Weberei kauft in Prag diesen Wechsel und verwendet ihn mit ihrer Unterschrift versehen als Zahlung an den englischen Wollenspinner, der das Geld beim Käufer des Zuckers einzieht.« (vgl. Eisler 1924, S. 203; zit. nach Dopsch 1930, S. 254 f.). Das Geld hat sich im Laufe der menschlichen Geschichte, als Erfindung zur Erleichterung des Handels, aus dem jeweils beliebtesten Tauschgut des ursprünglichen Tauschhandels entwickelt. Über den Ursprung und Gebrauch des Geldes schrieb Smith in seinem Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen: »Am Ende haben aber dann die Menschen in allen Ländern aus vernünftigen Gründen Metalle als Tauschmittel allen anderen Waren vorgezogen. Metall läßt sich, da es haltbarer als jede andere Ware ist, nicht nur ohne nennenswerten Verlust aufbewahren, es kann auch ohne Schaden beliebig geteilt und leicht wieder eingeschmolzen werden, eine Eigenschaft, die kein gleich dauerhafter Stoff besitzt und die es vor allen anderen auszeichnet, als Zahlungs- und Umlaufmittel zu dienen.« (Smith 2003, S. 23 f.). Smith bemerkt außerdem, dass es die handeltreibenden Völker mit fortschreitender Entwicklung für sinnvoll hielten, verschiedene Metalle zu Geld auszuprägen: »Gold für größere Zahlungen, Silber für Käufe von geringerem Wert und Kupfer oder anderes grobes Metall zum Zahlen kleinster Beträge.« (ebd., S. 35). Beispielsweise sah in der Blütezeit des römischen Geldwesens, im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus, die Struktur des Münzsystems wie folgt aus:
1 Aureus
25 Denare
200 Dupondien
400 Asse
1 Denar
8 Dupondien
16 Asse
2 Dupondien
4 Asse
1 Dupondius
2 Asse
1 Semis
½ As
1 Quadrans
¼ As
Der Aureus enthielt ursprünglich 8,2 Gramm Gold und der Denar 3,9 Gramm Silber. Aus Messing bestanden der Sesterz mit 27,3 Gramm, der Dupondius mit 13,6 Gramm und der Semis mit 3,4 Gramm; aus Kupfer das As mit etwa 11 Gramm und der Quadrans mit 2,8 Gramm (vgl. Sprenger 1991, S. 27). Das abgestufte Münzsystem war Ausdruck einer hoch entwickelten Wirtschaft, und bereits unter Kaiser Nero (37–86 n. Chr.) zeichnete sich ab 54 nach Christus aus in erster Linie fiskalischen Motiven eine allmähliche Verschlechterung der Edelmetallmünzen ab, indem die Metallgehalte reduziert wurden. Auf diese Weise ließen sich die hergestellten Geldstücke und damit die Einnahmen des Staates erhöhen. Nichtsdestotrotz blieb die römische Währung im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus weitgehend stabil, weil der Wert der Münzen weniger auf dem Sachwert (Metallwert) basierte als vielmehr auf dem staatlichen Wertversprechen des Kaisers, der unterwertiges Geld wie vollwertiges annahm.
Edelmetalle nahmen in der menschlichen Geschichte die optimale Funktion des Geldes ein, weil sie die folgenden Eigenschaften besitzen: Knappheit, Haltbarkeit, Teilbarkeit, Transportfähigkeit und allgemeine Akzeptanz.12 Dabei ist Silber die älteste Währung der Welt. Es ist überliefert, dass im Alten Ägypten der griechisch-römischen Zeit ein Gutsverwalter die Anweisung gab, es solle Heu gegen Saatkorn gekauft werden, woraufhin er die Antwort erhielt, dass niemand gegen Getreide verkaufen will, sondern gegen Silbergeld (vgl. Wilcken 1921, S. 394).13