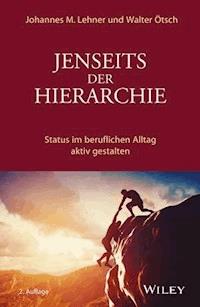
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Status verbinden wir oft mit einem bestimmten Rang, einer Position und der Macht, die eine Person in der Gesellschaft oder in ihrem direkten Umfeld innehat. Jeder strebt nach Anerkennung und sozialer Wertschätzung: Diese zu erreichen und zu sichern ist nicht nur im Privatleben wichtig, sondern auch in der Organisation, in der wir arbeiten. Aber durch den Trend vieler Unternehmen hin zu dezentralen Strukturen - weniger Hierarchie und mehr Teamarbeit - ist der Status des Einzelnen nicht mehr so klar umrissen und eindeutig erkennbar wie früher. Beeinflussen Sprechgeschwindigkeit und -lautstärke meinen Status? Geht Hilfesuchen immer mit einem niedrigen Status einher? Welche Rolle spielt meine Körpersprache? Warum ist Zeit ein Statuselement? Wie inszeniere ich mich richtig? Gibt es im "Statusspiel" einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Johannes M. Lehner und Walter O. Ötsch geben in ihrem Buch Antwort auf diese Fragen. Sie zeigen, wie hoher und niedriger Status entsteht und welche Schlüsse jeder Einzelne daraus für sich ziehen kann. Der Leser wird in die Lage versetzt, sein eigenes Verhalten und das der Personen in seiner Umgebung wahrzunehmen, zu reflektieren und einzuschätzen. Dabei setzen sich die Autoren in erster Linie mit den sozialen Prozessen im Wirtschaftsleben auseinander. Ihr Fazit: Status ist kein Schicksal. Jeder kann durch eigenes Verhalten seinen Status beeinflussen - und zwar jenseits von Hierarchie und festgelegten Rollen oder Positionen. Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage widmet sich den aktuellen Trends zum Thema, welche sich durch die zunehmende Globalisierung und Flexibilisierung der Arbeit ergeben. Außerdem wird die Rolle der Social Media bei der Produktion von Status beleuchtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
2. Auflage 2015
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
© 2015 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung: init GmbH, Bielefeld
Coverfoto: © Photocreo [email protected]
Satz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-50843-3
ePub ISBN: 978-3-527-80036-0
mobi ISBN: 978-3-527-80037-7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort
1 Soziales Kapital: Status, Hierarchie und Macht
Statusverhalten und Statusspiele
Sozialer Status und Hierarchie
Der Matthäus-Effekt
Warum Statusspiele wichtiger geworden sind:das Hierarchie-Paradoxon
Scham
Schamvermeidungsspiele
Statuszuschreibungen
Status und Glück
Eine Warnung
2 Sprache und Status
Kommandos und Hierarchien
Der Name als Befehl
Majestätenplural
Fragen: von harmlos bis bohrend
Kommentare abgeben
Beurteilen
Erwartungen erfüllen und Erwartungen durchbrechen
Sich ins Gespräch bringen
Geschichten erzählen
Sich hilflos stellen
›Schau mir zu ...‹
Der Dumme ist der Gescheitere
Zögern
Adjektive, Absicherungen, Ankündigungen
Hauptwörter
Höflichkeit und geschliffene Sprache
Passive Sprache und Vergangenheit
Charismatisch sein
Positive Sprache
Emotionen und Werte ansprechen
Metaphern und Übertreibungen
Status und Raumbilder
Mehrdeutig
Ignorieren
Die üblichen Killer
Beleidigung
Sich über mögliche Kritik erheben
Bewusst statusneutral bleiben: offene Kommunikation
Schnelle Statuswechsel
Andere zum Statuswechsel bewegen
Die Kunst des Verhandelns und Verkaufens
3 Kleinspielen
Eintritt in die Firma
Meetings
Niedriger Status als Trick: Naivität
Columbo, der kleine Held
Expertenfallen
Hierarchie- und Statusfallen
Führen mit niedrigem Status
Baroni: Kleinspielen als Hoch-Statusverhalten
4 Körpertanz
Alt oder Sopran, Tenor oder Bass
Sprechrhythmen
Wortgewichte
Jenseits der Stimme
Über- und Unterordnungsblicke
Die Macht des Lidschlags
Augen-Ausdruck
Wiedererkennungssignale
Pupillenspiele
Kontrollierte Gesichter
Bedeutsame Körper
Gesten vermitteln Status
Power-Walking
Körperbewusstheit
5 Raum
Statusgeografie
Organigramme und Rangabzeichen
Raum markieren
Der persönliche Raum
Dominanz durch Berührung
Sich Körperraum nehmen
Raumgefühle
6 Kairos: Zeit als Statusinstrument
Zeit ausfüllen
Der oder die Erste sein
Taktische Verspätungen
Termine festlegen
Pläne und Programme
Das ›Timing‹ organisationalen Wandels:Wann ist welches Statusverhalten sinnvoll?
Nicht drinnen und nicht draußen: Liminalität
7 Inszenierung
Eindrucksmanagement
Das Ensemble
Netzwerke
Täter und Opfer
Sekretärinnen und Sekretäre
Organisation
Sei rigide!
Spezialisierung
Große Probleme machen große Leute
Magie
Schönheit
Der erste Eindruck jenseits der Schönheit:Status-Marker
Der äußere Auftritt: Kleidung
Der Titel macht dich »real«
Nuntius: der geborgte Status
Den Matthäus-Effekt inszenieren
Statussignale von Firmen und Gruppen
Die Politische Arena
Geschäftsessen
Statusauktionen
Konfliktmanagement und Verhandlung
Teamrollen
Moderation: Kontrolle des Prozesses
Vermittler, Broker
Improvisation
Organisationsrollen: Stab versus Linie
Rahmenwechsel
Humor
Strategische Positionierung
Feste feiern und Potlatsch: ›Geben ist seligerdenn Nehmen‹
Wohltätigkeit und Ehrenamt
8 Status und Geschlecht
Das soziale Kapital der Frauen
Körpersignale
Jenseits der Damenkränzchen
Sich herunterfeiern
Keine Zeit haben
9 Rankings und Soziale Medien
Der Unterhaltungswert von Status
Preisverleihungszeremonien
Die soziale Tretmühle in Gang halten
Virtuelle Teams
Soziale Medien
Empörungswellen
Online-Status-Spiele
Soziale Medien als Ausstellung
Museums-Freunde
Charity wirkt noch mehr im Online-Universum
Das Museum vom Ich
Literatur
Nachwort
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Die Entscheidung, eine überarbeitete 2. Auflage herauszugeben, fiel uns leicht. Das Thema und alles im Buch Beschriebene ist nicht nur nach wie vor gültig, sondern hat aus mehreren Gründen an Aktualität gewonnen. Auf einen Satz gebracht, erklärt sich das folgendermaßen. Die Bedingungen für unser im Buch postuliertes »Hierarchie-Paradoxon« sind mehr denn je erfüllt: Traditionelle, institutionalisierte Hierarchien bröckeln und werden durch neuartige Ersatzhierarchien abgelöst, für welche alte und zum Teil ungewohnte Formen von Statusverhalten noch wichtiger werden.
In den bestehenden Kapiteln haben wir vor allem aktuelle Forschungsergebnisse berücksichtigt. Die damit beschriebenen Phänomene sind jedoch nicht unbedingt neu – das Meiste existiert seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden und die geschätzte Leserin, der geschätzte Leser werden und sollen vieles davon aus der eigenen Lebenswelt wiedererkennen. Jedoch in manchen Fällen sind diese Phänomene nunmehr besser erforscht, und dies sollte in der neuen Auflage berücksichtigt werden. Um den Umfang gleich zu halten, wurden einige nicht zentrale Stellen gekürzt.
Den wichtigsten neu entstandenen Bereichen für Statusverhalten und Ersatzhierarchien haben wir nunmehr ein eigenes Kapitel am Schluss gewidmet: Soziale Medien, virtuelle Teams und Rankings. Dort verweisen wir auch auf die hohe Veränderlichkeit gerade im virtuellen Raum, womit wir uns der Gefahr aussetzen, dass die konkreten Oberflächenphänomene, die wir beschreiben, in ein paar Jahren bereits antiquiert erscheinen mögen. Auch sehen wir viele weitere statusrelevante Entwicklungen, denen wir nicht entsprechend Rechnung tragen konnten. Etwa jene im Kunstmarkt, wo die Kombination aus Statusverhalten und der Gier nach Sozialem Kapital mit der freien Verfügbarkeit von Finanzkapital zu unglaublichen Preisen bei Auktionen und Kunstmessen führt. Auch dieser »Blase« an Sozialem Kapital könnte ein eigenes Kapitel gewidmet sein. Andererseits: Sie könnte zum Zeitpunkt der dritten Auflage schon wieder geplatzt sein: Zeus verschlingt Metis und gebiert dann Athena.
Vorwort
Status, Hierarchie, Macht, Dominanz und Unterordnung sind allgegenwärtig. Fast jede Begegnung, ob in Firmen, öffentlichen Institutionen und Vereinen, ob in der Freizeit oder auf der Straße, kann als Kampf – oder auch als Spiel – darum verstanden werden, wer wen dominiert oder wer sich wem unterstellt. Status, Hierarchie und Macht bilden den »sozialen Klebstoff« für alle Arten von Organisationen. Davon handelt dieses Buch. Wir sprechen über »das Management«, meinen aber immer viel mehr. Das Buch wird zeigen, wie vielfältig und subtil die Statusspiele sind. Kein Bereich ist davon ausgenommen, unser Arbeitsleben wie unser Privatleben ist davon durchtränkt.
So vielfältig die Anwendungen, so vielfältig sind auch die Quellen, die wir zu Rate gezogen haben. Wir – die Autoren – kommen aus unterschiedlichen Bereichen und die Arbeiten, auf die wir uns beziehen, schöpfen aus der Managementforschung, Ökonomie, Kommunikationswissenschaft, Sozialpsychologie und der Soziologie, um nur einige zu nennen. Wir sind unabhängig voneinander auf dieses Thema gestoßen, als wir uns mit den Büchern von Keith Johnstone beschäftigt haben, einem der Erfinder des modernen Improvisationstheaters. Er entwickelte zuerst als Dramaturg am Royal Court Theater in London und später an der Royal Academy of Dramatic Art seinen ganz persönlichen Stil, der heute weltweit in vielen Theatern zum Einsatz kommt. Keith Johnstone hat eine interessante Entdeckung gemacht: Wenn er seinen Schülerinnen und Schülern den Auftrag gab, auf der Bühne einander zu dominieren oder sich unterzuordnen, wurde ihr Spiel ungemein »echt« und lebensnah.
Aber das, was Keith Johnstone für den Bereich des Theaters entwickelt hat, besitzt eine viel weitere und tiefere Bedeutung. Seine Entdeckung muss unserer Meinung nach als ein eigenständiger Beitrag zur Sozialpsychologie gewürdigt werden. Wirklich klar geworden ist uns das aber erst bei unseren persönlichen Begegnungen mit Keith Johnstone in Seminaren, welche wir ebenfalls unabhängig voneinander besucht hatten. Als wir einmal – in guter österreichischer Tradition – im Cafe über unsere gemeinsamen Erfahrungen mit ihm und seine Schriften sprachen, entstand die Idee zu diesem Buchprojekt. Wir fanden nämlich, dass dieses Thema bisher nirgends in einigermaßen adäquater Weise beschrieben wurde – weder im Bereich des Managements noch in allgemeiner Form. An dieser Einschätzung hat sich auch bei der intensiven Arbeit an diesem Buch nichts geändert. Aber es gibt eine Fülle von einzelnen Studien und Ergebnissen, die wir verarbeiten und zu einem Gesamtbild formen konnten.
Wir hoffen, dem Leser ein geschlossenes Bild zu präsentieren, das der Vielfalt und weitläufigen Bedeutung des Themas »Status« im Alltag gerecht wird. Wir haben viele komplexe Phänomene und zahlreiche Befunde auf möglichst einfache Prinzipien reduziert. Das Buch will lesefreundlich sein – mit nur wenigen Verweisen auf die zugrunde liegenden Untersuchungen und Theorien. Viele Beispiele veranschaulichen den Inhalt. Wo sie aus Publikationen stammen oder bekannte Persönlichkeiten betreffen, haben wir die Namen unverändert gelassen. Im anderen Fall sind Personen und Details verfremdet. Um der Lesbarkeit willen haben wir auch auf einen durchgängigen Verweis auf beide Geschlechter verzichtet. Stattdessen beziehen sich unsere Beispiele abwechselnd auf Männer und Frauen. Auf Vorschlag unserer Lektorin verwenden wir im Folgenden bei allgemeinen Berufsbezeichnungen stellvertretend die traditionelle Form (etwa »Manager« statt »Managerin«). Damit sind natürlich gleichermaßen Frauen wie Männer gemeint.
Dieses Buch beschreibt ganz im Detail, wie hoher Status eingenommen oder zumindest gefördert wird. Die Leserin oder der Leser könnte das leicht missverstehen: als wollten wir sie oder ihn überzeugen, diese Handlungsweisen in breitem Stil in das eigene Repertoire zu übernehmen. Vor allem im Management
1 Soziales Kapital: Status, Hierarchie und Macht
Statusverhalten und Statusspiele
Dominanz und Unterordnung sind notwendige Elemente jeder Kommunikation – und zugleich die größten Tabus. Normalerweise sprechen wir nicht darüber, wie uns andere einschränken und kontrollieren, unsere Kreativität und unseren Ausdruck hemmen – und wie wir dies mit anderen tun. Meist wird uns das nicht einmal bewusst. Nur bei schweren Konflikten platzt es manchmal heraus: »Sie akzeptieren mich nicht.« »Dauernd stellst du dich über mich.« »Sie halten sich wohl für etwas Besseres.« Dieses Buch handelt davon, wie wir uns im Alltag über- und unterordnen, wie wir uns positionieren, wie wir uns über andere erheben oder ihnen untertan sind, wie wir ignorieren, demütigen, erniedrigen, erhöhen: andere mit uns und wir mit ihnen.
Immer wenn zwei oder mehrere Personen miteinander zu tun haben, werden Macht, Einfluss und soziales Gewicht verteilt: Wer hat in der aktuellen Situation mehr zu sagen, wer kann sich Gehör verschaffen, wer setzt sich durch und wem wird etwas aufgedrückt? Wer ist eher aktiv oder passiv, bestimmend oder hinnehmend? Wer setzt die Akzente und wer fühlt sich eingeengt? All diese Dinge geschehen – unmerklich die ganze Zeit, in beinahe jeder Interaktion, in jedem Satz, in kleinsten Gesten. Das wollen wir in vielen Details beschreiben. Wenn zwei Menschen miteinander reden, dann geht es auch – ob sie es wollen oder nicht – um ihre Position, um ihren aktuellen Einfluss. Stellen wir uns vor, wir könnten ihr soziales Gewicht in jedem Moment mit einer Waage messen. Sie ist – wenn wir genau hinsehen – kaum jemals im Gleichgewicht und dauernd in Bewegung: Die eine Person wiegt schwerer, die andere leichter. Über- und Untergewicht dieser Art wollen wir in Anlehnung an Keith Johnstone aktuellen Status nennen.[1]
Status, so verstanden, hat immer mit zwei oder mehreren Personen zu tun. Er bezieht sich auf das, was zwischen ihnen abläuft, und bewertet ihr aktuelles Verhalten, das heißt ihr Statusverhalten oder das Positionieren. Wenn wir sagen: Die Person A besitzt in der Situation X hohen Status, dann meinen wir A in Relation zu einer oder mehreren Personen B. B besitzt (oder besitzen) in der aktuellen Szene X einen niedrigeren Status als A. A dominiert B – sei es auch nur kurz oder unmerklich. Status bezieht sich auf das wechselseitige Verhalten von A und B und wie beide dies wahrnehmen und empfinden.
Dominanz und Unterordnung geschieht in vielen Fällen subtil, den Akteuren wird es nicht unbedingt bewusst. Beschreiben wir Status zuerst aus einem anderen Extrem: aus Erlebnissen, bei denen wir unter anderen Personen nachdrücklich oder anhaltend zu leiden hatten. Dabei fühlten wir uns vielleicht schüchtern oder verlegen. Ereignisse dieser Art können wir Unterwerfungserfahrungen nennen. Lucas Derks hat deren Merkmale so beschrieben:[2]
1. Schüchternheit, Stammeln, Erröten, Herzklopfen, stockender Atem, Unfähigkeit, den Blickkontakt zu halten.
2. Der eigene Ausdruck, die Kreativität und Handlungsfähigkeit sind eingeschränkt. Man fühlt sich unfrei und blok_kiert.
3. Eine Neigung, der Autoritätsperson zu gehorchen – manchmal auch wider Willen.
4. Noch stärker: Man erfährt die Situation mehr von der Warte der Autoritätsperson als von der eigenen, man fühlt, denkt, sieht teilweise wie sie.
5. Eine Neigung, der Autoritätsperson nur positives Feedback zu geben: Komplimente, Zustimmung, Lob.
6. Furcht vor Zurückweisung oder Bestrafung durch die Autoritätsperson.
7. Eine Neigung, das eigene unterwürfige Verhalten auf Eigenschaften der Autoritätsperson zurückzuführen.
Das ist die eine, die bekanntere Seite der Medaille. Die Kehrseite sind Dominanzerfahrungen, in denen wir für andere eine Autoritätsperson dargestellt haben, sei es, dass wir bewundert und angehimmelt wurden oder dass uns gar unterwürfig begegnet wurde. Dominanzerfahrungen äußern sich so:
1. Ein (meist angenehmes) Gefühl von Macht, Stärke und Überlegenheit. Man denkt sich groß und besitzt ein gutes Selbstbild.
2. Die Erfahrung ausgedehnter Ausdrucksfähigkeit, ungehemmter Kreativität und Freiheit im Handeln.
3. Man erfährt ein überwiegend positives Feedback in Form von Lächeln, Geschenken, Höflichkeit, Unterwürfigkeit oder gar Servilität.
4. Wenn dies länger dauert: meist keine schlechten Nachrichten, niemand wagt es, der Autoritätsperson ein negatives Feedback zu geben.
5. Wenn sich dies verfestigt: Man erfährt die Situation nur noch von der eigenen Warte, die Gedanken und Gefühle der anderen spielen keine Rolle mehr.
6. Bei lang anhaltenden Beziehungen dieser Art: Man erfährt einen Mangel an Vertrautheit auf gleichberechtigter Basis, dies kann zu Desorientierung und Isolation führen.
7. Noch stärker: Misstrauen gegen andere und die Furcht, Macht zu verlieren.
8. Manchmal auch starke Zweifel, wer wirklich kontrolliert: Zwingen die Anhänger einen in die überlegene Position oder ist das ein Produkt eigener Leistungen, überlegener Eigenschaften und Aktivitäten?
9. Und: eine große Diskrepanz zwischen dem, was man zu sein glaubt (inklusive den eigenen Zweifeln) und dem, was die unterwürfigen anderen einem signalisieren.
Dominanz- und Unterwerfungserfahrungen sind Extreme auf einer weit gespannten Skala. Ihr mittlerer Bereich ist die Erfahrung von Gleichheit: Über oder unter jemandem zu sein, das spiele, so glaubt man, in dieser Situation keine Rolle. Nach Keith Johnstone ist dies nur in ganz wenigen Fällen möglich, etwa bei Freundschaft. Freunde und Freundinnen necken einander gerne. Die beiden Autoren (sie sind jahrelang befreundet) begrüßen sich: »Guten Morgen, Herr Professor, haben Sie gut geschlafen?« – Redensarten, die Keith Johnstone so kommentiert: Freundschaft bedeute, dass man sich heimlich verständigt hat, mit Status spielerisch umzugehen. Man parodiert gleichsam sein soziales Gewicht. A wertet sich gegenüber B auf oder ab und B macht das Gleiche mit A – und beide wissen, dass es nur ein Spiel ist, das keiner ernst nimmt, und genau in dieser Haltung entsteht Freundschaft.[3]
In allen anderen Fällen hingegen ist die Waage im Ungleichgewicht: A und B weichen von einer gleichberechtigten Mittelposition ab. A geht vielleicht auf der Skala einen Schritt in Richtung Dominanz, was B automatisch einen Schritt in Richtung Unterwerfung bringt. A und B spielen ein Statusspiel.
Frau X: »Gestern hatte ich ein schlimmes Erlebnis. Ich war mit einem Kunden im Restaurant. Als ich auf die Rechnung wartete, habe ich mich auf einmal so komisch gefühlt. Als ob ich ohnmächtig würde.«
Frau Y: »Gestern? Da hätte ich auch gerne in einem guten Restaurant gegessen. In der Kantine war es wieder einmal ungenießbar!«
Frau Z: »Ich weiß, was du meinst. Mir geht es auch manchmal so merkwürdig. Vor einem Monat war es besonders extrem ...«
Die drei Frauen reden in höflichem Ton, ein scheinbar friedliches Gespräch. Aber gleichzeitig versuchen sie die ganze Zeit, ihr soziales Gewicht auf Kosten der anderen zu erhöhen. Frau X beginnt mit einem Hochstatus-Zug: Ein interessantes Ereignis wird berichtet. Y blockt ab und wischt das beiseite. Z macht ein noch aufschlussreicheres Statusmanöver: Sie geht auf Y nicht ein (wertet sie also ab), sondern antwortet auf X und verleiht ihr damit ein größeres Gewicht. Aber im nächsten Satz positioniert sie sich über die beiden: Jetzt schildert sie das viel bemerkenswertere Erlebnis, dem die Aufmerksamkeit aller zu gelten hat. Satz für Satz, Geste für Geste ändert sich die Waage im subtilen Statusspiel: Jede gibt vor, freundlich zu sein, und alle sägen am Stuhl der anderen.
Spiele dieser Art laufen die ganze Zeit, wir achten vielleicht nicht aufmerksam genug darauf. Tatsächlich kann jede Begegnung auch als Statusspiel verstanden werden, man muss nur genau hinsehen. In vielen Fällen ist das Statusmoment wichtiger als der Inhalt der Worte. Im Alltagsleben, in der Firma oder im Verein stellen Menschen unbewusst immer ein Statusverhältnis her. Jede und jeder bringt sich so lange in eine bestimmte Position, ob hoch oder niedrig, bis es »passt«. Wenn das nicht erreicht werden kann, fühlen wir uns unwohl: Irgendetwas stimmt nicht.
Statusgefühle und Empfindungen für Statuslagen sind uns wohlbekannt. Wir sind Statusexperten, ohne das vielleicht zu wissen. Wir besitzen feine Antennen, die auf Dominanz- und Unterordnungssignale ausgerichtet sind. Meist reagieren wir automatisch auf Statusmanöver: Wenn uns jemand kritisiert, große ausholende Gesten macht, uns auf die Schultern klopft, sich abrupt abwendet, uns scharf mustert, in besonders teuren Klamotten auf den Plan tritt oder langsam und pointiert redet (alles Handlungen, die meist hoch positionieren), dann werden wir mit Sprache und Körper Antwort erteilen. Wir werden dem Versuch, uns direkt oder unmerklich »von oben« behandeln zu wollen, auf unsere Weise entgegnen – und sei es auch nur mit einem Stirnrunzeln, einem Achselzucken, einer etwas schärferen Rede – oder mit bewundernden Blicken. Egal wie: Wir leisten so unseren Beitrag im laufenden Statusspiel, und von seinem Ablauf hängt es nicht nur ab, wie wir uns fühlen, sondern auch, welche Erfolge und Misserfolge wir erzielen. Um soziale Interaktionen zu verstehen, muss man Status verstehen.
Mit diesem Buch laden wir ein, den Blick auf die allgegenwärtigen Statusspiele zu lenken: wie wir Worte und Gesten, Raum und Zeit permanent, wenn auch unbewusst, einsetzen, um uns über andere zu stellen oder ihnen klein beizugeben. Wir sprechen von Hochstatus- und Niedrigstatusverhalten und meinen damit Verhaltensweisen, die jeder anwenden kann, egal ob er in der sozialen Hierarchie oben oder unten ist. Aber zuerst muss man sich dessen bewusst werden.
Sozialer Status und Hierarchie
Status wird normalerweise als gesellschaftliche Stellung verstanden, als Stand, auch als der Wert oder die Bedeutung einer Person in den Augen der Öffentlichkeit. Status dieser Art wollen wir sozialen Status nennen. Sozialer Status weist Menschen einen »sozialen Ort« zu und gibt diesem »Ort« zugleich einen sozialen Wert. Damit wird Personen ein Platz in einer sozialen Hierarchie zugewiesen. Oft ist dies durch traditionelle Rollenbilder geprägt wie »Frauen sind weniger tüchtig als Männer«. Organisationen zeichnen sich dagegen durch formale Hierarchien aus, die implizit einen Manager höher bewerten als einen Arbeiter und in denen ein Mitglied des Vorstands dem Aufsichtsrat untertan zu sein hat. Sozialer Status »haftet« an einer Person, er kommt ihr wie ein festes Merkmal zu: jemand ist Vorstand, jemand ist Manager. Die Verteilung der Rangplätze in einer Hierarchie entspricht einem Nullsummenspiel: Was einer gewinnt, verliert jemand anders. Es kann eben nur eine Person den ersten Platz in einer Hierarchie einnehmen.
Frederick Merton hat das im Zusammenhang mit Status in der Wissenschaft als das Phänomen des »einundvierzigsten Sitzes« gekennzeichnet: Wer in die Académie Française aufgenommen wurde, hatte den Platz eines »Unsterblichen« erlangt – aber es gab immer nur 40 Plätze. Waren diese voll, konnte man nicht mehr »unsterblich« werden, auch wenn man sich noch so große Verdienste erworben hatte. Beispiele für »Inhaber des einundvierzigsten Sitzes« sind Leute wie Descartes, Pascal oder Moliere.
Für die Verteilung von Macht gilt Ähnliches. Je mehr jemand Macht über den anderen ausüben kann, umso ohnmächtiger ist der andere. Auch im Statusspiel, das wir als Waage verstehen, geht es um die relative Dominanz über andere: Ein Hochstatus-Zug macht einen Spieler »größer«, auf Kosten des aktuellen Gesprächspartners oder auf Kosten anderer Gruppen in der Umwelt.
Blake Ashforth und Glen Kreiner[4] beobachteten das Verhalten von Arbeitern in Berufen, welche üblicherweise als eher abstoßend, »schmutzig« und von niedrigem sozialen Status angesehen werden: Leichenwäscher, Totengräber, Tänzerinnen in Nachtlokalen und Ähnliches. Diese Leute schaffen es jedoch, sich in ihrer Referenzgruppe eine positive Identität zu geben und damit ihren Status wechselseitig zu heben, indem sie sich gegenseitig versichern, wie notwendig und wertvoll ihre Arbeit für die Gesellschaft ist oder wie viel höher ihre Moral im Vergleich zu der ihrer Kunden ist. Etwa eine Nachtclubtänzerin: »Sie kommen samstagsabends her, betrinken sich und wollen an uns herumtatschen. Dann gehen sie am Sonntag in die Kirche und verdammen das, was wir machen. Im Allgemeinen, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück ehrlicher als die!«[5] Damit beanspruchen sie für sich hohen Status, obwohl sie in jeder sozialen Hierarchie ganz unten sind.
Statusverhalten ist unabhängig von der sozialen Position. Eine Hochstatus-Person kann Niedrigstatus spielen und umgekehrt. Statusverhalten ist kurzfristig, auf die jeweilige Situation bezogen. Es beschreibt die Verteilung sozialer Gewichte im gemeinsamen Handeln aller Beteiligten. Statusverhalten zeigt sich im momentanen Tun. In der kurzen Szene mit den drei Frauen X, Y und Z konnten wir den flüchtigen Wechsel des aktuellen Status beobachten: Jeder Satz hat die soziale Waage zwischen den Anwesenden verschoben. Viele weitere Beispiele finden sich in den kommenden Kapiteln. Unabhängig davon besitzen X, Y und Z sozialen Status.
Nehmen wir an, sie arbeiten in derselben Firma und X ist eine Abteilungsleiterin, Y ihre Mitarbeiterin und Z ein Lehrling, der vor zwei Tagen eingestellt wurde. Mit dieser Information bekommt die Szene eine neue Bedeutung. Im Normalfall würde man erwarten, dass die Abteilungsleiterin (Frau X) von ihrer Mitarbeiterin (Frau Y) nicht unterbrochen wird und schon gar nicht, dass eine junge Anfängerin (Frau Z, ganz unten in der betrieblichen Hierarchie) ein Gespräch dominieren kann. Der aktuelle Status widerspricht dem dauerhaften sozialen Status. In der Regel ist aber der soziale Status ein starker Trumpf im Statusspiel: Die Abteilungsleiterin kommt mit einem anderen »Gewicht« daher als ein Neuling. Als Vorgesetzte hat sie es leichter, dominant vorzugehen, Autorität auszustrahlen und sich Respekt zu verschaffen. Dies gilt immer nur im gegenwärtigen Kontext – in der Disco mag das umgekehrt sein.
Aber sozialer Status ist keine Garantie für das aktuelle Statusgewicht. Wenn es der Abteilungsleiterin nicht gelingt, sich regelmäßig im Betrieb Gehör zu verschaffen, gilt sie als »schwach«. Ihre Autorität wird brüchig und über kurz oder lang läuft sie Gefahr, ihren sozialen Rang und möglicherweise sogar ihren Job zu verlieren. Sie muss sich im Alltag fortwährend behaupten, mit anderen Worten, viele Statusspiele zu ihren Gunsten entscheiden. Ihr Statusverhalten muss ihre Position stützen. Das verlangt nicht immer nach Hochstatus-Verhalten, aber sie kann sich auf Dauer nicht nur niedrig positionieren. Auch darf sie Statusverhalten nicht mit bloßem Machtausüben verwechseln. Sie könnte mit der »Peitsche« agieren, ihre Mitarbeiterinnen durch Belohnungen und Bestrafungen disziplinieren. Aber für Macht gilt Emersons berühmter Satz: »Macht zu haben bedeutet, Macht auszuüben. Und Macht auszuüben bedeutet, Macht zu verlieren.«[6]
Die Macht der Abteilungsleiterin begründet sich aus ihrer Stellung in der betrieblichen Hierarchie, man spricht von Positionsmacht. Der große Soziologe Max Weber bezeichnet dies als rationale Herrschaft. Sie ist an den Glauben an eine rationale Ordnung – eben die Hierarchie – geknüpft. Und dieser Glaube enthält eben auch Vorstellungen von sozialem Status. Status mit Hilfe der Hierarchie ausdrücken kann bis zu einem gewissen Grad jeder Anfänger. Umgekehrt haben wir in untergeordneten Stellungen gelernt, Statusvorgaben »von oben« zu akzeptieren, wollen wir nicht als Querulant oder Revoluzzer gelten. Es hat auch wenig Sinn, eine bestehende Ordnung dauernd in Frage zu stellen – das wäre wenig effizient. Ob bestehende Hierarchien tatsächlich »rational« sind, wie Max Weber gemeint hat, wollen wir nicht untersuchen. Sie begründen jedenfalls – und das ist für uns entscheidend – Status und Macht. Hierarchien weisen Personen Status zu. Gleichzeitig gilt – und das macht die Sache wieder spannend -, dass der mit der Hierarchie verbundene Status in jedem Augenblick verändert werden kann. Weder Status noch Macht bieten Polster, auf denen sich die Inhaber lange ausruhen können. Die Position muss durch Statussignale andauernd abgesichert werden.
Die Hierarchie alleine stattet ein Amt und seinen Träger noch nicht mit der notwendigen Autorität aus. Der Amtsinhaber muss fähig sein, sich im Alltag statusgemäß zu verhalten. Ist er dazu nicht in der Lage, wird er bald an Respekt verlieren. Seine Autorität kann schwinden wie Schnee in der Sonne. Offen oder heimlich werden seine Befehle belacht oder gar hintertrieben. Stärkere oder schwächere Vorgesetzte unterscheiden sich darin, ob sie fähig sind, kraftvolle Statussignale zu senden. Gute und beliebte Vorgesetzte beherrschen intuitiv das Statusspiel. Sie spielen meisterhaft auf der Klaviatur des »Sich-in-eine-Position-Bringens«. Je nach Lage der Dinge übermitteln sie hohe oder niedrige Statussignale.
Gabriele Rolke, eine Filialleiterin bei dm, wurde von einem früheren Chef – bei einer anderen Drogeriemarkt-Kette – vor versammelter Mannschaft angebrüllt. Sie kündigte. Ihre neue Firma und deren Chef charakterisiert sie folgendermaßen: »Bei uns gibt's keine Hierarchien, wir haben keine Angst vor großen Tieren, das hab ich bei den Seminaren gelernt. Der Herr Werner ist nur der Herr Werner.« [7]
Was Frau Rolke bei ihren Seminaren wirklich gelernt hat, wollen wir nicht näher untersuchen. Im Unterschied zu früher soll es angeblich keine Hierarchien mehr geben. Aber für Gabriele Rolke gibt es noch »große Tiere« und eines von ihnen wurde mit Namen genannt. Hierarchie hat – so denkt sie – an Bedeutung verloren, aber ihre Statusabwertung – dass sie da vor allen abgekanzelt wird – ist für sie kein Schall und Rauch. Öffentlich an Status zu verlieren, kann sie nicht hinnehmen. Sie verlässt die Firma. Ihr neuer Vorgesetzter dagegen, der offensichtlich doch etwas mehr als nur der »Herr Werner« ist, verpackt seine Botschaften eleganter. Er will seine Position nicht auf Kosten von Frau Rolke herausstreichen – und genau deswegen akzeptiert Frau Rolke ihn als Autorität.
Abb. 1.1: Wechselwirkung zwischen Statusspielen und sozialem Status
Die Wechselwirkung zwischen aktuellen Statusspielen und sozialem Status können wir wie die zwischen Investitionen und Kapital verstehen. Statusverhalten ist wie eine (soziale) Investition, sozialer Status wie (soziales) Kapital: die noch vorhandene Summe aller in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Soziales Kapital nützt sich ab, etwa durch Veralterung von Wissen oder durch vernachlässigte Kontakte: Es muss dauernd ersetzt werden. Ein Mittel dazu (nicht das einzige) sind Statusspiele. Menschen mit hohem gesellschaftlichem Ansehen müssen im Alltag bei unzähligen Statusspielen bestehen. Jeder richtige Zug ist ein Plus, jeder Fehler ein Minus an sozialem Vermögen. Übersteigt der Wert der so getätigten »Investitionen« den normalen Verschleiß, kann neues soziales Kapital angehäuft werden: Der soziale Status steigt. Im anderen Fall schmilzt das soziale Kapital schnell dahin.
Der Matthäus-Effekt
Statusverhalten verändert nicht nur den Kapitalstand, sondern das soziale Kapital verändert auch den Wert des Verhaltens. Wer bereits viel Kapital hat, dem fällt es leichter, weiteren Kredit zu bekommen, um damit zu investieren und zu expandieren. Genauso verhält es sich mit hohem sozialen Status. Damit lässt es sich leichter dominant auftreten, andere beeindrucken, eigene Interessen durchsetzen und Statusspiele für sich entscheiden. Für jede Form von Kapital gilt der »Matthäus-Effekt«[8], benannt nach einer berühmten Stelle im Evangelium nach Matthäus:
»Wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.« (Mt 13,12)
Hoher Status ermöglicht Dinge, welche aus einer niederen Position verschlossen sind. Wer hohen Status besitzt, bekommt mehr Anerkennung für eine bestimmte Leistung als niedrig Positionierte. Wir können den Matthäus-Effekt in der Firma, in der Wissenschaft und im Privatleben beobachten. Wenn ein Nobelpreisträger einen durchschnittlichen Artikel veröffentlicht , findet er nicht nur mehr Beachtung, sondern seine Arbeit wird auch eher als herausragende Leistung gewürdigt als die vergleichbare Arbeit eines unbekannten Forschers. Universitäten, die als »Eliteuniversitäten« gelten oder zur »Ivy League« gehören, ziehen die intelligentesten und fleißigsten Studierenden an, können daraus die Besten auswählen, sind attraktiv für die renommiertesten Forscher und Lehrer und können so »bessere« Absolventen und Forschungsergebnisse produzieren.
Warum Statusspiele wichtiger geworden sind: das Hierarchie-Paradoxon
In vielen Organisationen haben traditionelle Hierarchien an Einfluss verloren. Unternehmen und staatliche Behörden folgen beispielsweise kaum mehr dem Senioritätsprinzip. Alter und Dauer der Zugehörigkeit bestimmen seltener das Gehalt. »Flache Hierarchien« sind nicht nur ein Schlagwort, sondern vielerorts Realität. Hierarchien sind verfestigte soziale Verhältnisse in Form von Institutionen (zum Beispiel Organisationen oder Bürokratien), möglichst streng abgesichert, oft in Form von Verträgen. Wiewohl Hierarchien viel geschmäht sind und gerne ihr Abbau gefordert wird, haben sie wesentliche Vorteile. Am deutlichsten werden Vor- und Nachteile in einer starren Hierarchie, wie sie die Bürokratie verkörpert. Sie führt oft ein Eigenleben und existiert unabhängig von Personen, welche die Position einnehmen.[9] Die Prinzipien der Bürokratie, wie sie der bereits zitierte Max Weber formuliert hat, sind auch heute noch gültig: Die »oberen« Beamten oder Manager üben kraft ihrer Ausbildung und Expertise rationale Herrschaft aus. Ihr Status muss nicht dauernd neu verhandelt werden, noch ist er an persönliche Eigenschaften gebunden. Individuelle Merkmale und individuelles Verhalten sind weniger von Belang. Personen sind auf jedem Rang der Hierarchie austauschbar. Die Spitze kann sich selbst große Schnitzer und Kommunikationskatastrophen erlauben, Fehler und Unzulänglichkeiten werden ausgebügelt oder vertuscht. Wird morgen eine neue Führungskraft in ihr Amt gehievt, kann sie mit der Gefolgschaft der unteren Ränge rechnen. Statusspiele werden kaum benötigt. Der tägliche Umgang ist ritualisiert, die Ordnung wird durch fixe Umgangsregeln aufrechterhalten. Hier haben wir den wesentlichen Vorteil der Hierarchie. Weil Status nicht permanent verhandelt werden muss, bleiben die dafür nötige Energie und die damit verbundenen Kosten frei für andere Aktivitäten. Gleichzeitig ist es auch ein gravierender Nachteil. Wer einmal eine bestimmte Position innehat, ist schwer davon wegzubringen, auch wenn er sich als unfähig erweist.
Lösen sich traditionelle Hierarchien auf und verlieren Bürokratien (zum Beispiel im Bereich des Staates) an Einfluss, dann verflüchtigt sich Macht in der Gesellschaft nicht (ein großes Missverständnis), sie wird nur anders verteilt, etwa auf anonyme »Marktprozesse« verlagert.
Macht und sozialer Einfluss werden jetzt weniger durch das Amt, einen Titel oder eine Position vergeben, sondern müssen individuell errungen werden. Sozialer Status wird dynamischer und weniger beständig, er muss im Alltag gegen die Konkurrenz mehr verteidigt und beschützt werden. Mit anderen Worten: Er muss mehr und deutlicher durch Statusspiele abgesichert werden. Wir nennen diesen Effekt das Hierarchie-Paradoxon: Je weniger feste, institutionalisierte Hierarchien vorhanden sind, umso wichtiger wird Statusverhalten, das Hierarchien hervorbringt. Flachere Hierarchien und intensivere Statusspiele gehen Hand in Hand.
Dauerhafte hierarchische Strukturen existieren heute weniger als vor zwei Jahrzehnten. Viele Menschen arbeiten in Netzwerken und in Arbeitsgruppen, die kurzfristig bestehen und sich dauernd ändern. Das Arbeitsleben ist ungemein flexibel geworden, mit neuen Belastungen für viele Betroffene. Die Kultur des neuen Kapitalismus hat nach Richard Sennett einen »flexiblen Menschen« geformt:[10] Ein 40-jähriger US-Amerikaner hat heute im Schnitt bereits 40 Jobs hinter sich. Dieser Trend wird verstärkt durch die Aufweichung der Kernfamilie, kürzere Beschäftigungsverhältnisse und zunehmende internationale Geschäftskontakte. Heute sind wir in unseren sozialen Kompetenzen mehr gefordert als frühere Generationen. Prestige, Einfluss und soziale Macht haben den Alltag in stärkerem Maße ergriffen, als dies im Zeitalter lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse und vorgegebener Karrieremuster (die allerdings immer nur für eine Minderheit erreichbar waren) der Fall war. Heute betreiben junge Menschen, die vorankommen wollen, bewusst ein »Curriculum-Design«: Sie suchen sich möglichst viele Anstellungen in prestigeträchtigen Firmen und Projekten, die sie in ihren Lebenslauf schreiben können. Je mehr solcher Eintragungen, desto höher ihr Status und ihr Startvorteil bei der nächsten Bewerbung. Das berufliche Leben ist, so scheint es, mehr von Statusspielen durchzogen. Vereinfacht: Wir beobachten den langsamen Wandel einer Gesellschaft mit eher starren Hierarchien zu einem dynamischeren Gewebe, das durch andauernde Statusspiele hergestellt und aufrechterhalten wird.
Wenn Hierarchien in großen Teilen durch Netzwerke ersetzt werden, dann werden Netzwerke selbst zu sozialem Kapital. Der Vorteil liegt in der Menge und der Qualität der Beziehungen: je mehr jemand eben »vernetzt« ist. Aber nicht nur die Quantität zählt: Einige wenige Beziehungen können wertvoller sein als möglichst viele. Dies trifft etwa auf Beziehungen zu, die »strukturale Löcher« füllen: Das sind Beziehungen zwischen Gruppen, welche sonst nicht miteinander kommunizieren.[11] Aber auch diese Art der Vernetzung kann soziales Kapital alleine nicht erklären. Wer hohen Status im Netzwerk erlangt, wird für andere wertvoller sein als niedrig Positionierte. Soziales Kapital setzt sich also zumindest aus zwei Komponenten zusammen: Vernetzung und Status.
Scham
Status hat nicht nur mit äußerlichem Verhalten, sondern mit tiefen Gefühlen, ja sogar mit dem Selbstwert zu tun. Macht und Status sind oft mit heftigen Empfindungen verbunden. Die Gefühlsreaktionen auf einen bestimmten Status variieren aber durchaus. In unterschiedlichen Kontexten lösen Hoch- und Niedrigstatus andere Eindrücke aus. Manche Dominanzerfahrungen sind uns wohl vertraut, wir können sie mit Freude genießen. Andere wiederum lösen starkes Unbehagen aus. Wer beispielsweise noch niemals eine Sitzung geleitet hat, der wird diese Aufgabe tunlichst meiden. Drängen andere in die Führungsrolle, wird er mit Niedrigstatus-Verhalten kontern, um nur nicht den Stress zu erleben, da vorne zu sitzen, das Gespräch zu leiten und Verantwortung übernehmen zu müssen. Hoher Status kann (muss aber nicht) großen Stolz hervorrufen. Innerlich jubeln wir: »Ich habe es geschafft!« Die Kehrseite von Stolz ist Scham, in abgeschwächter Form auch Verlegenheit. Über Scham zu sprechen ist genauso tabuisiert wie das Reden über die Machtspiele des Alltags.
Scham ist eine ungemein starke Emotion. Sie tritt dann auf, wenn ein »Band« zu anderen Menschen zerrissen ist, die »unsichtbare Brücke«, die uns mit anderen verbindet und die wir für ein stabiles Selbstwertgefühl benötigen.[12] Man fühlt sich ausgeschlossen. Die anderen haben uns angeklagt, eine wichtige Regel verletzt zu haben. Entweder hörten wir das direkt von ihnen oder wir stellen uns diesen Vorwurf innerlich vor. »Schäm dich!« haben wir unzählige Male von unseren Eltern gehört. Mangelnde Erfolge in der Schule, Versagen im Job oder in der Partnerschaft, Fehlschläge im Leben, Peinlichkeiten im Alltag: Tausende Gelegenheiten, Scham und Schuld zu empfinden und zu pflegen. Scham ist ein essenzieller Bestandteil der Beziehungen zu Eltern, zu Kindern, zu Kollegen, zu Vorgesetzten, selbst zu Unbekannten, die uns auf der Straße über den Weg laufen – bis hin zu ethnischen oder politischen Problemlagen.
Das Gefühl von Scham ist mit Status und Statusspielen eng verknüpft.[13] »Scham«, meint der Sozialpsychologe Paul Gilbert, »ist eine unfreiwillige Antwort auf das Bewusstsein, Status verloren zu haben und abgewertet worden zu sein.«[14] Arme schämen sich, arm zu sein, sie verstecken ihre Zwangslage, so gut es geht. Manager schämen sich, wenn sie nicht »richtig« gekleidet sind und sich nicht »korrekt« benehmen. Starke Schamgefühle sind mit Selbstvorwürfen verbunden, wir fühlen uns schuldig – auch ein Phänomen, über das kaum jemand spricht. Innerlich sagen wir uns vielleicht: »Ich bin zu dick«, »Ich bin zu dumm«, »Die sind viel attraktiver«, »Ich habe zu wenig Macht«, »Ich bin zu wenig potent«, »Den anderen gelingt alles.« In den Zeitungen lesen wir die Statistiken, wie viele Menschen von solchen Gefühlen geplagt sind – aber das sind die anderen, nicht wir!
Schamgefühle treten in vielen Situationen auf, immer gibt es einen Bezug zu Image und Ansehen. Viele Menschen werden verlegen, wenn eine Kamera auf sie gerichtet wird. Warum? Weil ihr aktueller Status enthüllt werden könnte. Nicht nur in asiatischen Schamkulturen halten Hochstatus-Personen viel auf ihren Lebensstil. Jeder Fauxpas wird peinlich vermieden, man will nicht beschämt werden. Zu einem Geschäftsessen muss man ein gutes Restaurant auswählen und keiner würde für alle Würstchen bestellen und ein Bier dazu. Man würde sich nicht nur vor den Gästen, sondern sogar vor den Kellnern blamieren. Wenn aber der Vorstand in einer Sitzungspause die genau gleichen Würstchen servieren lässt, muss sich niemand genieren. Es ist ja kein Statusverlust zu befürchten. Im Gegenteil: Man erzählt noch beiläufig, wie gut so etwas schmeckt, wie selten man es bekommt und die ständigen Sushi, Trüffel und Hummer hängen einem ohnehin zum Halse heraus!
Schamvermeidungsspiele
Benimmkurse und Neuauflagen des alten Knigge haben für das Management Konjunktur. Der Grund ist offensichtlich der gleiche wie vor 100 Jahren für die Aristokratie: wer die Regeln der gehobenen Gesellschaftsschicht kennt, beansprucht ihren Status. Er zeigt, dass er »dazugehört«. Mit guten Sitten alleine erringt man aber kaum höheren Status. Ihre Kenntnis beugt vielmehr Statusverlust vor: Man muss sich nicht schämen.
Der Bereichsleiter Ritter hatte einen Sohn, der mit dem Gesetz in Konflikt kam. Vielen wäre dies peinlich, besonders wenn die Kollegen davon erfahren. Nicht jedoch Ritter: Schon beim ersten Kontakt mit der Polizei sprach er freimütig im Betrieb von seinem Sohn, welche Probleme er ihm mache, seine Vergehen und die zu erwartende Strafe. Zu keiner Zeit verteidigte er seinen Sohn, gab aber immer zu erkennen, dass er zu ihm stehe und ihn weiter unterstützen werde. Je schlimmer die Lage seines Sohnes wurde, umso mehr schien er davon zu berichten. Ja, er verwendete seinen Sohn und seine eigenen Erziehungserfahrungen sogar als Beispiel, um klarzumachen, welches Führungsverhalten gegenüber Untergebenen nicht unbedingt zu Erfolg führen wird. Keiner der Kollegen und Mitarbeiter kam zu irgendeinem Zeitpunkt auf den Gedanken, hämisch über Ritter oder seinen Sohn zu sprechen.
Völlig anders hingegen ein Vorstandsdirektor eines großen Konzerns:
Der Vorstandsdirektor war in einem früheren Abschnitt seiner Karriere in illegale Waffengeschäfte verwickelt gewesen. Dafür wurde er verurteilt und musste sogar für kurze Zeit ins Gefängnis. Später gelang es ihm, das Image des Saubermannes aufzubauen. Er machte steile Karriere und wurde schließlich Vorstandsdirektor. Immer aber strahlte er aus, dass er an seine Haftvergangenheit nicht erinnert werden wollte. Jedermann vermied es, in seiner Gegenwart Wörter wie »Gefängnis« oder »Haft« zu verwenden, egal in welchem Zusammenhang.
Der Vorstandsdirektor wollte Scham vermeiden, und genau das wurde für seine Umwelt zum Statustest. Würde es jemand wagen, ihn an die Haft zu erinnern, käme sein Ansehen in ernste Gefahr.
Donner und Anders von der Signal Werbeagentur haben einen Termin bei einem Klienten, um ihr neues Werbekonzept zu präsentieren. Anders verstaut die Folien für die Präsentation in seinem Wagen und folgt Donner, der den Weg zum Kunden kennt. Anders bleibt im Stau stecken, Donner kommt rechtzeitig zum Termin. Ohne die vorbereiteten Unterlagen kann er aber die Präsentation nicht beginnen. Als Anders endlich eintrifft, ist der Kunde am Kochen und die Werbeagentur verliert den Auftrag. Donner ist wütend, Anders fühlt sich traurig und beschämt. Er fühlt sich für den Misserfolg der Firma schuldig.
Welchen sozialen Status besitzen Donner und Anders, wenn sie so reagieren? Wer könnte der Vorgesetzte und wer der Assistent sein? In einer Studie meinten fast 90 Prozent derjenigen, die diese Situation vorgelegt bekamen, Donner hätte den höheren Status als Anders. Wütend zu werden, können sich offenbar nur Menschen mit hohem Status erlauben. Umgekehrt beansprucht man offenbar mit einem Wutausbruch erhöhten Status. Wer sich dagegen schämt, sich schuldig und traurig fühlt, positioniert sich niedrig. Würde umgekehrt hingegen das Missgeschick in einen Erfolg münden und Anders würde sich stolz fühlen (die Kehrseite von Scham) beziehungsweise würde Anerkennung von Donner bekommen, dann meint ein ähnlich hoher Anteil von Befragten, Anders sei die Person mit dem höheren Status.[15]
Scham und Stolz, hoher und niedriger Status sind in unserer Vorstellung untrennbar miteinander verbunden. Positive Gefühle bei Erfolg werden dem Hochstatus-Spieler zugestanden, während sich bei Misserfolg der niedrig Positionierte schämen muss – die emotionale Kehrseite der Leistungsgesellschaft. Umgekehrt ziehen viele daraus den Schluss: Wer sich hoch positionieren will, muss jeden noch so kleinen Erfolg lautstark feiern – und zwar nicht nur privat, sondern mit möglichst viel Außenwirkung. Der Hochstatus-Spieler zeigt seine Freude öffentlich und immer wieder. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Erfolg ihm selbst zuzuschreiben ist. Gerade wenn es unklar ist, wer für den Erfolg verantwortlich ist, oder wenn es vor allem ein Erfolg des Teams ist, bekommt derjenige, der am meisten positive Emotionen zeigt, auch selbst am meisten von den positiven Gefühlen ab. Ein Hochstatus-Spieler agiert dementsprechend bei Misserfolg mit dem Gegenteil. Er ärgert sich, hat vielleicht einen Wutausbruch, vermeidet es aber, Schuldgefühle zu zeigen.
Statuszuschreibungen
Die meisten Menschen erzählen lieber über ihre Erfolge und versuchen nicht zu viele Worte über ihre Misserfolge zu verlieren. Man schämt sich dafür. Manager vermeiden es, riskante Projekte an die große Glocke zu hängen. Wenn es schief geht, muss man sich rechtfertigen. Man fürchtet vermindertes Ansehen und Status. Ein erfolgreicher austro-kanadischer Unternehmer erzählt seine Lebensgeschichte:
Auf die Frage »Sie hatten ja auch mal für ein politisches Amt kandidiert, wurden aber nicht gewählt. Wie erklären Sie sich das?« meint er: »Na ja, ich muss dazu etwas ausholen. Als ich antrat, tat ich das mit sehr klaren Anliegen. Das war Ende der achtziger Jahre. Zu der Zeit hatten wir im Land eines der größten Defizite ...« Er holt tatsächlich weit aus und erzählt eine lange Geschichte von den politischen Verhältnissen damals. Er selbst kommt als Person in seiner Beschreibung kaum vor. Als er geendet hat, forscht der Interviewer weiter: »In der Zwischenzeit hatten Sie die Leitung der Firma abgegeben und es lief dort ziemlich schlecht. Als Sie wieder zurückkamen, gelang Ihnen sofort der Turnaround.« Darauf der Unternehmer: »Wissen Sie, ich habe auch immer viel Glück gehabt, und dann habe ich das Glück einfach ausgenutzt ...«, und lächelt dazu viel sagend.
Es scheint, als würde sich der Selfmademan weit unter seinem Wert verkaufen: Übertrieben lang schildert er seine schlechten Jahre, während er seine großen Erfolge mit einem mehrdeutigen Verweis auf das Glück abtut. Dennoch: So hebt er seinen Status. Denn in der langen Schilderung der gescheiterten Kandidatur wird nur auf die Zeitgeschehnisse eingegangen. Damit wird suggeriert, die Situation oder die anderen – und nicht er als Person – seien für diesen Misserfolg verantwortlich zu machen. Im zweiten Teil dagegen stellt er sich als Person in den Mittelpunkt – und dafür genügt ihm ein Satz. Dabei auf das Glück zu verweisen, macht ihn sympathisch. Trotzdem wird klar, dass er als (glückliche) Person für den Erfolg verantwortlich ist.
Das Geheimnis liegt darin, die beiden unterschiedlichen Arten der Ursachenzuschreibung (Attribution) nicht direkt zu formulieren. Würde er sagen: »Für meine Kandidatur war die Zeit noch nicht reif« oder »Das Wahlkampfteam war schuld« (die Situation war die Ursache des Misserfolgs) und im anderen Fall: »Keiner kennt eben das Geschäft so gut wie ich« (ich bin die Ursache des Erfolgs), würde man ihn als arrogant und eingebildet entlarven. Der kokettierende Verweis auf das »Glück« meint aber nicht die Situation, sondern ihn: »Ich bin die glückliche Person, weil ich es auch verstehe, das Glück auszunutzen.« Indem der Protagonist die Zeit des Misserfolges genau schildert, können wir uns gut mit ihm identifizieren und lernen verstehen, warum die Umstände dafür verantwortlich waren.
Status und Glück
Scham kann sich jedoch auch in einer Hochstatus-Position zeigen, etwa wenn sich jemand in einer Situation wiederfindet, die seinen Erwartungen oder denen der Umwelt widerspricht. Wenn Personen, die aus einer diskriminierten Minderheit stammen, schnell in Amt und Würden gelangen, dann empfinden sie den neuen sozialen Status als ambivalent: man ist »zornig und froh« oder »stolz und beschämt« zugleich – wie eine Studie dies für Frauen in hohen Positionen behauptet.[16] Offenbar macht hoher Status nicht automatisch glücklich, auch Männer nicht. Einiges deutet darauf hin, dass zufriedene Menschen sich weniger mit anderen vergleichen. Menschen, die sich selbst als glücklich einschätzen, freuen sich über ihre Erfolge und ärgern sich über Misserfolge – unabhängig davon, ob der Nachbar besser oder schlechter abgeschnitten hat. Menschen, die sich eher als unglücklich sehen, können sich dagegen kaum über einen Erfolg freuen, wenn jemand in ihrer Nähe einen noch größeren Erfolg errungen hat.[17]
In Experimenten hatten Personen jeweils die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: (A) in einer Organisation 50 000.- US-Dollar pro Jahr zu verdienen, wo die anderen im Schnitt 25 000.- US-Dollar verdienen oder (B) in einer Firma 100 000.- US-Dollar zu verdienen, in der die anderen im Schnitt 200 000.- US-Dollar verdienen. Mehr als die Hälfte der befragten Personen wählte die Option (A).[18] Sie würden offenbar 50 000.- US-Dollar im Jahr verschenken, nur um im unmittelbaren Vergleich vorne zu sein. Der Reiz, im Statusspiel in der Firma zu gewinnen, übertrifft den finanziellen Vorteil. Wahrlich ein hoher Preis für Status!
Eine Warnung
Nochmals: Über hohen und niedrigen Status, über Scham und Freude, über gutes und schlechtes Selbstbild zu reden, darf nicht als Plädoyer missverstanden werden, im Alltag andauernd hohen Status zu spielen oder das auch nur zu versuchen. Das Gegenteil kann der Fall sein und dafür werden wir noch viele Beispiele bringen. Es ist immer eine Frage der Ziele und man sollte sie bewusst vor Augen haben: Will man sich auf Kosten anderer positionieren oder sie selbstlos fördern? Was ist kurzfristig von Bedeutung, was soll langfristig Bestand haben? Lang anhaltende gute Kontakte sind immer eine Balance im Statusspiel. Nicht nur nette Kollegen und Kolleginnen brauchen einen ausgewogenen Mix an Dominanz und Unterordnung, an Hoch- und Niedrigstatus-Erleben.
Der amerikanische Familienpsychologe John Gottman hat in einer Langzeitstudie (sie geht über 20 Jahre) anhand der Befragung von mehr als 700 frisch verheirateten Paaren ein Modell entwickelt, bei dem man nach nur drei Minuten Beobachtung mit 84 Prozent Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, ob die Ehe längerfristig Bestand haben wird oder nicht. Gottman lässt die Partner ein Streitgespräch über ein Thema führen, bei dem sie gegenteiliger Meinung sind, und bewertet die Debatte anhand einer detaillierten Liste. Neben anderen Faktoren wirkt sich vor allem zu starkes Dominanzgehabe gefährdend für die weitere Ehe aus, insbesondere wenn in ihrem Verhalten subtile Anzeichen von Verachtung und Geringschätzung des Partners oder der Partnerin erkennbar sind.[19] Dies bedeute, wie Gottman in einem Interview ausführte, den Ehemann oder die Ehefrau auf »eine niedrigere Ebene« zu stellen, ihn oder sie »hierarchisch« zu behandeln. Signale dieser Art sind nach Gottman die wichtigsten Indizien, dass die Ehe langfristig in Gefahr ist.[20]
Statusspiele zu kennen und sie bewusst einzusetzen kann einen Freiraum eröffnen. Dieses Ziel verfolgen wir mit diesem Buch. Autonomie braucht Praxis. So wie das Baby, das gehen lernt, am Beginn oft hinfällt, so scheitert auch der ungeübte Statusspieler immer wieder. Scham zweiter Ordnung, also sich zu schämen über die Scham des Statusverlustes, mag ein unerwünschter Nebeneffekt solcher Lernbemühungen sein. Aber letztlich kann man sich vielleicht wirksamer gegen unliebsame Zeitgenossen abgrenzen und mehr sein eigenes Spiel spielen. Ein Ziel könnte es ja sein, bei Menschen, die man als wertvoll erachtet, an Ansehen zu gewinnen. Beliebtheit hat in vielen Fällen mit Statusflexibilität zu tun. Sympathisch wirkende Menschen können oft schnell zwischen hohem und niedrigem Status wechseln. Hören wir, wie jemand drei Lehrer aus seiner Kindheit schildert:
»Den Lehrer A konnten in der Schule alle gut leiden. Er war aber unfähig, Disziplin herzustellen. In der Stunde ging es immer drunter und drüber. Viel gelernt haben wir bei ihm nicht. Als einmal der Direktor Schwierigkeiten machte, hat er uns händeringend gebeten, ihm zu helfen. Wie dieser dann in der Klasse eintraf, um seinen Unterricht zu beobachten, saßen wir brav auf unseren Stühlen. Das hielt aber nur fünf Minuten an. Nach einer Viertelstunde herrschte das alte Chaos.
Der Lehrer B hingegen war der Schrecken der Schule. Keiner wagte gegen ihn aufzumucken. Wenn er uns schweigend anschaute, waren wir sofort ruhig. In der Pause haben wir Rachepläne gegen ihn geschmiedet. Was wollten wir ihm nicht alles antun. Im Klassenzimmer haben wir aber dann wie zahme Hunde gesessen. Innerlich fluchend haben wir alles getan, was er verlangt hat.
Am beliebtesten war freilich Lehrer C. Mit jedem Problem konnten wir zu ihm kommen, er war wie ein Kumpel. Nicht ein einziges Mal hat er jemanden bestraft. Bei ihm hat aber immer Disziplin geherrscht. Er hat Witze gemacht und oft herrschte eine fröhliche Stimmung. Wenn es sein musste, saßen wir aber mucksmäuschenstill in der Klasse.«
Was ist geschehen? Lehrer A hat die ganze Zeit Niedrigstatus-Signale gegeben, also die Schülerinnen und Schüler immer – offensichtlich konnte er gar nicht anders – aufgewertet, die dann das Ruder übernommen haben. Lehrer B hingegen tat genau das Gegenteil, vielleicht auch ohne zu wissen, was er wirklich tat. Viele Autoritätspersonen leiden an ihrem allzu dominanten Verhalten. Nur C konnte sein Statusverhalten flexibel den Erfordernissen anpassen. Er wusste, was zu tun war, um den Schülern respektvoll zu begegnen (nicht zu hohen Status zu spielen) und ihnen gleichzeitig Disziplin abzuverlangen (hohen Status zu spielen und durchzusetzen).
Bei Führungskräften in Organisationen sind solche Unterschiede zwar kaum so krass und offensichtlich, die Prinzipien sind aber die gleichen. Ob sie oder auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen, was sie wollen, hängt von ihrer Fähigkeit ab, mit Statusverhalten flexibel umzugehen. Was das genau heißt, beschreiben die folgenden Kapitel.
2 Sprache und Status
Unentwegt teilen wir uns sprachlich mit: Wir sprechen mit anderen, wir schreiben Briefe und E-Mails oder verfassen Texte, die irgendwann jemand lesen soll. Seit der Kindheit haben wir feine Antennen entwickelt, die sorgsam auf Statussignale achten. In jeder sprachlichen Äußerung sind sie zu finden. In der Schule und im Freundeskreis haben wir gelernt, was andere Menschen attraktiv oder unbeliebt macht und wie sie sich im Statusspiel positionieren. Wir sind Statusexperten in Bezug auf Sprache. Watzlawick und seine Kollegen[1] haben einmal gesagt: »Wir können nicht nicht kommunizieren.« In gleicher Weise gilt: Wir können uns nicht nicht positionieren. Bei jeder sprachlichen Äußerung schwingt ein Statuselement mit. Schon wenn sich jemand bei uns in einer gewissen Art vorstellt, erhebt er damit automatisch den Anspruch, ihn so zu behandeln, wie es jemand seiner Art erwarten darf. Alles, was wir mit Sprache ausdrücken, enthält – ob offensichtlich oder verborgen – einen Statuskern. Mit jeder sprachlichen Äußerung positionieren wir uns zu unserem Gegenüber. Bei allem, was wir in der Sprache tun, werten wir uns und andere auf oder ab. Wir möchten mit diesem Kapitel diese Merkmale bewusst machen, die in jeder sprachlichen Äußerung enthalten sind. Damit wird der Weg frei, Positionierung durch Sprache gezielter einzusetzen.
Kommandos und Hierarchien
Ein Team hat sich zu einer Teambesprechung in einem Kreis versammelt. Der Teamleiter Herr Maier fragt seinen Mitarbeiter Herrn Müller: »Herr Müller, würden Sie bitte den Vorsitz übernehmen?«
Auf den ersten Blick haben wir den Eindruck, Maier würde sich freiwillig in eine untergeordnete Stellung begeben, indem er Müller die Leitung anbietet. Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen Hierarchie, Status und Kommandogeben viel verwickelter. Und das zeigt sich in der Sprache deutlich. Hierarchie ist zunächst ein zugewiesener Status. Der Übergeordnete hat die Macht, dem Untergebenen (Mitarbeiter) Anweisungen zu erteilen. Ein militärischer Offizier schreit: »Sprung – vorwärts – decken!« In der Wirtschaft werden Befehle meist höflicher verpackt: »Herr Maier, legen Sie mir bitte morgen den Quartalsbericht vor.« Der Vorgesetzte verschafft sich Maier gegenüber eine höhere Position. Im Gegensatz zum Militär äußern Vorgesetzte in der Organisation ihre Kommandos subtiler. Oft kleiden sie sie in höfliche Fragen, auf die sie keine Antwort erwarten, schon gar nicht ein »Nein«. Die Gratwanderung zwischen Höflichkeit und Bestimmtheit ist schwieriger als simple militärische Befehle. Aber es ist immer noch relativ einfach aus der Vorgesetztenposition. Zum Teil nimmt das pseudodemokratische Züge an.





























