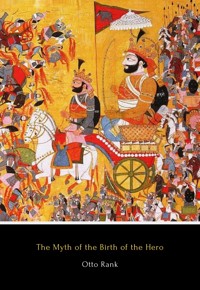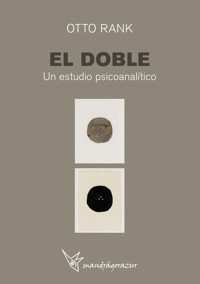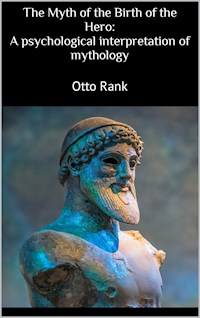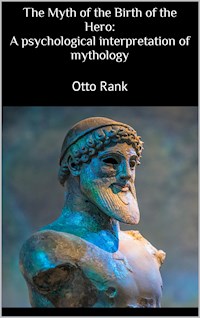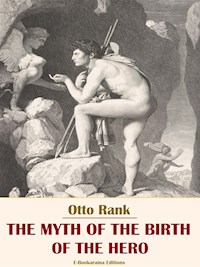Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Otto Rank hatte in der frühen Psychoanalyse das volle Vertrauen von Freud, der ihn in der psychoanalytischen Bewegung eine herausragende Position einnehmen ließ. Das änderte sich grundlegend nach Erscheinen seines Buches Trauma der Geburt, das zu einem Zerwürfnis der beiden führte. Rank ging zuerst nach Paris, dann weiter nach USA und schrieb weiterhin bedeutende tiefenpsychologische Werke, bereichert um Erkenntnisse aus Philosophie, Literatur und Ethnologie. Amerika sollte seine neue Heimat werden, aber auch hier wurde er von seinen ehemaligen Kollegen verschmäht und verleugnet. In dem Buch Jenseits der Psychologie fasst er seine lebenslangen Forschungen über die menschliche Psyche zusammen. Seine Überzeugung war, die Psychologie des Selbst müsse im Anderen gefunden werden. Mein Lebenswerk ist beendet. Die Gegenstände meines früheren Interesses, der Held, der Künstler, der Neurotiker erscheinen nochmals auf der Bühne, und zwar nicht nur als Mitspieler im ewigen Drama des Lebens, sondern ohne Maske, nachdem der Vorhang gefallen ist, unbekleidet und ohne Prunk. Auch nicht als geplatzte Illusionen, sondern als menschliche Wesen, die keines Interpreten bedürfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der Betonung des schöpferischen Menschentums wurde Rank zu einem Vorläufer der "humanistischen Psychologie", die ihn zu ihren wichtigsten Promotoren zählt. Sein Lebenswerk ist ein Dokument des aktiven Humanismus, der Sorge für die menschliche Individualität angesichts der drohenden Vermassung – es lohnt sich, Rank heute und in der Zukunft eingehend zu studieren
Josef Rattner
INHALTSVERZEICHNIS
Die Werke Otto Ranks
Vorwort Estelle Rank
Prolog Otto Rank
Psychologie und sozialer Wandel
Der Doppelgänger als unsterbliches Selbst
Das Aufkommen des sozialen Selbst
Die Entstehung der Persönlichkeit
Zwei Arten von Liebe
Die Erschaffung des sexuellen Selbst
Feminine Psychologie und maskuline Ideologie
Über das Selbst hinaus
Nachwort Klaus Hölzer
Die Werke Otto Ranks (Auswahl)
1884-1939
Der Künstler. Ansätze zu einer Sexual-Psychologie.
Hugo Heller, Wien 1907; erweiterte 2. und 3. Auflage 1918.
Der Mythos von der Geburt des Helden. Versuch einer psychologischen Mythendeutung.
Deuticke, Leipzig 1909; 2., wesentlich erweiterte Auflage 1922; Nachdruck der 2. Auflage: Turia und Kant, Wien 2009, ISBN 9783-85132-498-3.
Die Lohengrinsage. Ein Beitrag zu ihrer Motivgestaltung und Deutung.
Deuticke, Leipzig 1911.
Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des dichterischen Schaffens.
Deuticke, Leipzig 1912.
mit Hanns Sachs:
Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften.
Bergmann, Wiesbaden 1913.
Psychoanalytische Beiträge zur Mythenforschung.
Internationale Psychoanalytische Bibliothek, Leipzig 1919; 2., veränderte Auflage. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1924.
Die Don Juan-Gestalt.
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1924.
Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse.
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1924; Nachdruck: Psychosozial, Gießen 2007, ISBN 978-3-89806-703-4.
mit Sándor Ferenczi:
Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis.
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1924; Nachdruck: Turia und Kant, Wien 2009, ISBN 978-385132-493-8.
Der Doppelgänger. Eine psychoanalytische Studie.
(Imago, 1914) Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1925; Nachdruck: Turia & Kant, Wien 1993, ISBN 3-85132-062-X.
Technik der Psychoanalyse.
3 Bände. Deuticke, Leipzig 1926–1931; Nachdruck: Psychosozial, Gießen 2006.
Erziehung und Weltanschauung. Eine Kritik der psychologischen Erziehungs-Ideologie.
Reinhardt, München 1933.
Beyond Psychology, 1939, deutsche Übersetzung 2023
Traum und Dichtung. Traum und Mythus. Zwei unbekannte Texte aus Sigmund Freuds „Traumdeutung“.
Hrsg. von Lydia Marinelli. Turia + Kant, Wien 1995, ISBN 978-3-85132-070-1.
A Psychology of Difference. The American Lectures.
Princeton University Press, Princeton 1996, ISBN 0-691-04470-8.
Kunst und Künstler. Studien zur Genese und Entwicklung des Schaffensdranges.
Erstveröffentlichung des deutschen Urmanuskriptes von 1932. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2000, ISBN 3-89806-023-3.
Vorwort von Estelle B. Rank
Dieses Buch (Beyond Psychology) das der Autor (1884-1939) immer als sein letztes sehen wollte, und das er, wie er einmal sagte, schreiben würde, wenn er alt genug wäre, eine Sozialpsychologie zu schreiben, war bis auf das letzte Kapitel fertiggestellt, als der Tod sein Werk beendete.
Nach einem viertel Jahrhundert ununterbrochenen Schreibens und Publizierens, ließ er sich 1933 endgültig in den Vereinigten Staaten nieder und beschränkte seine Arbeit sechs Jahre lang auf Therapie und Lehre. Diese „Sabbat-Jahre“, wie er sie nannte, wurden vom allmählichen Entstehen des Buches Beyond Psychology unterbrochen. Es war sein erstes Buch in Englisch, das zwar das Wesentliche seiner europäischen Gelehrsamkeit enthält, aber gleichzeitig das Jenseits eines neuen Lebens enthüllt, das er für sich in Amerika fand.
Prolog zu Ranks Buch (Beyond Psychology, 1939).
Die Idee dieses Buches, wie sie der Titel ausdrückt, entstand vor etwa zehn Jahren (1929/30), und zwar während jener Zeit, als ich drei Bücher publizierte, die mich bereits über die Psychologie des Individuums hinausgeführt hatten. Ich war dabei, den Einfluss zu berücksichtigen, den Ideologien auf das Schicksal von Menschen ausüben.
Damals, als politische Ideologien noch nicht in Mode waren, wollte ich zeigen, wie kollektive Ideologien einer bestimmten Epoche alle Bildungskonzepte und die verschiedensten Stile künstlerischen Schaffens bestimmten, ebenso auch das Streben des Individuums, über sich hinauszuwachsen oder etwas zu schaffen, das über sein natürlich vorhandenes Selbst1 hinausging.
Im dritten dieser Bände Seelenglaube und Psychologie (Wien 1930), der noch nicht ins Englische übersetzt war, betonte ich, wie selbst die Psychologie des Individuums von kollektiven Ideologien bestimmt wurde. Sie hatten ihren Ursprung jenseits des Individuums und entsprangen nicht einem Verständnis des Selbst.
Dieses Buch wurde also nicht von unserer gegenwärtigen sozio-politischen Krise (1939, KH) inspiriert, obwohl diese rätselhaften Ereignisse, die ganz entschieden die Macht der Ideologien im Reich der Realität belegen, mein Unternehmen durchaus zeitgemäß und verständlich machen.
Meine Hauptthese, abgeleitet aus der Krise der Psychologie2, dürfte auf unsere gegenwärtige und allgemeine Verunsicherung recht gut anwendbar sein, insofern sie die irrationalen Wurzeln menschlichen Verhaltens offenlegt. Die Psychologie will das Verhalten rational erklären, um es verständlich und damit akzeptabel zu machen.
Als mir erstmals klar wurde, dass Menschen zwar rational sprechen, denken und handeln, jedoch irrational leben, dachte ich, dass Jenseits der Psychologie des Individuums einfach Sozialpsychologie oder Psychologie des Kollektivs bedeuten könnte. Dann ging mir aber auf, dass dieses Konzept ebenfalls rationale Begriffe verwendet.
Demnach war meine Berücksichtigung der Ideologien, einschließlich derjenigen, die unsere psychologischen Theorien bestimmen, ungenügend, um unser Verständnis individuellen Verhaltens zu vervollständigen; denn auch sie wurden in Begriffen formuliert, die den rationalen Aspekt des menschlichen Lebens betonten. Mehr als andere Faktoren scheinen diese Ideologien die gesamte Rationalisierung zu transportieren, die der Mensch braucht, um irrational leben zu können.
Paradoxerweise präsentieren sich die neuen kollektiven Ideologien der Gegenwart nicht selten in individualisierter Form. Dahinter steckt offenbar die Idee, sie verständlicher auszudrücken. Nicht nur der durchschnittliche Journalist unserer Tage, sondern auch die profilierten Kommentatoren der aktuellen politischen Ereignisse erliegen leicht der Versuchung, idealisierte Porträts von Nationen als Erfolgsgeschichten zu schreiben und von Gangster-Nationen düstere Bilder zu malen. Damit betonen sie unabsichtlich das irrationale Element menschlichen Verhaltens, anstatt es zu erklären.
In diesem Sinne bedeutet das Jenseits“ der Psychologie des Individuums nicht, wie ich ursprünglich dachte, einen Rückgriff auf kollektive Ideologien als Gegenstand der Sozialpsychologie. Tatsächlich ist damit die irrationale Wurzel der menschlichen Natur gemeint, die jenseits aller Psychologie liegt, sei sie individueller oder kollektiver Art.
Diese Erkenntnis, umfassend bestätigt von den soziopolitischen Bewegungen der letzten Jahre, ermöglicht es diesem Buch, das ursprünglich als Herausforderung an die Psychologie des Einzelnen und der Gruppe geplant war, eine eigenständige Erfahrung zu werden, die letztendlich in Worte gefasst wurde; leider, denn Worte erweisen sich als unangemessen, gerade diese Erfahrung auszudrücken, nicht weil dies mein erster Versuch ist, in Englisch zu schreiben.
Der tiefere Grund liegt darin, dass Sprache, jede Sprache, Gedanken weitergeben und Handlungen verständlich machen soll, und zwar in rationalen Begriffen. Was wir also benötigen, ist eine irrationale Sprache mit neuem Vokabular, das dem ähnelt, was die moderne Kunst für den Ausdruck des Unbewussten zu finden hoffte.
Dieses linguistische Unvermögen, das Irrationale in Worte zu kleiden, spiegelt das tiefste menschliche Problem, den Spalt zwischen zwei Welten, in denen der Mensch gleichzeitig zu leben versucht, in der Welt der Natur und der von Menschen gemachten. Indem er die Zivilisation schuf, hat der Mensch die Erde umgestaltet, nur um schließlich daran zu scheitern, sein Selbst für die von ihm geschaffene Welt umzuformen.
Deshalb benötigen wir eigentlich für alles zwei Arten von Wörtern, um zu unterscheiden zwischen dem Naturding und dem vom Menschen gemachten „Ersatz“-Ding.
Während ich mit der englischen Orthographie kämpfte, hatte ich die Idee, wir könnten dasselbe Wort zweimal unterschiedlich buchstabieren, um das Natürliche vom Menschengemachten zu unterscheiden (also Kontrolle natürlich und Kontrolle willentlich). Wenn ich aber auf die Freiheit des Künstlers nicht verzichten will, muss ich damit zufrieden sein, das vorhandene Medium der Kommunikation zu nutzen, um bloß einen Eindruck des Irrationalen zu vermitteln, das in direkter Weise nur mit neuen künstlerischen Mitteln ausgedrückt werden kann.
Selbst der modernen Kunst mit ihren verschiedenen Ismen gelang es nicht – trotz aller Proteste ihrer Theoretiker – das Irrationale direkt auszudrücken. Mit äußerster und bewusster Anstrengung verfolgten moderne Maler und Schriftsteller das Ziel, das Unbewusste darzustellen. In ihrem Bemühen folgten sie jedoch nur der modernen Psychologie und ihrem verzweifelten Versuch, das Irrationale rational zu erfassen.
Diese Paradoxie offenbart sich in der Grundannahme der Psychoanalyse, einer mechanistischen Theorie des Lebens, wonach alle geistigen Prozesse und emotionalen Reaktionen vom Unbewussten bestimmt sind. Also von etwas, das selbst unbekannt und unbestimmbar ist.
Die moderne Kunst hat sich dieser rationalen Psychologie des Irrationalen berechtigterweise angenommen, denn die Kunst selbst, wie die Psychologie, war von Beginn an ein Versuch, das Leben rational zu fassen, indem man es in den Begriffen der aktuellen Ideologien beschrieb. Man wollte also Leben wieder erschaffen, um es zu kontrollieren.
Die heutigen soziopolitischen Ereignisse (1939, KH) rechtfertigen in hohem Maße etwas, das „über“ unsere Psychologie hinausgeht, denn sie hat sich als ungeeignet erwiesen, diese undurchschaubaren Geschehnisse zu verstehen. Wie oft hören wir in letzter Zeit „Ich verstehe nicht, was passiert.“ Und damit deutet man an, dass unsere Konzeption des Menschen ungenügend ist, um etwas zu begreifen, was letzten Endes doch menschlich ist. Wir müssen es aber als „irrational“ auffassen, weil es in unser rationales Schema der Dinge nicht hineinpasst.
Während wir uns immer mehr bewusst werden, dass wir das Jenseits der Psychologie bereits überschritten haben, wurde mir immer klarer, dass der Mensch vermöge seiner angeborenen Natur immer jenseits der Psychologie gelebt hat, also irrational. Wenn wir diese paradoxe Tatsache verstehen wollen und als die Basis unseres eigenen Lebens akzeptieren können, werden wir auch in der Lage sein, neue Werte statt der alten zu entdecken, die gerade vor unseren Augen zu verfallen scheinen, vitale menschliche Werte, nicht bloß psychologische Interpretationen, die von unseren bevorzugten Ideologien im Voraus festgelegt wurden.
Diese neuen Werte, die immer wieder entdeckt werden müssen, sind in Wirklichkeit alte Werte, natürliche menschliche Werte, die im Laufe der Zeit durch alle möglichen Rationalisierungen verloren gingen.
Um das natürliche Selbst des Menschen wieder zu entdecken, genügt es allerdings nicht, die irrationalen Elemente im Menschenleben wahrzunehmen und rational darzustellen. Sondern es ist notwendig, sie zu leben. Dazu scheinen aber in jeder Epoche nur wenige Individuen fähig zu sein. Sie sind Repräsentanten des heroischen Typus – im Unterschied zum kreativen – denn der ursprüngliche Held war jener, der es wagte, die allgemein akzeptierte „Psychologie“ oder Ideologie seiner Zeit zu überschreiten. In diesem Sinne ist er der Prototyp des rebellischen Menschen der Handlung.
Er ist jener, der die ewigen menschlichen Werte bewahrt, indem er die verlorenen Werte, die als neue erscheinen, wiederbelebt. Denn meistens ist das, was wir irrational nennen, bloß das natürliche. Unsere Begründungen sind so unnatürlich geworden, dass uns alles Natürliche als irrational erscheint. Demnach ist unsere Psychologie als der Höhepunkt der menschlichen Selbstrationalisierung ungeeignet, um Änderungen zu erklären, weil sie nur den Typus der bestehenden sozialen Ordnung, deren Ausdruck sie ist, rechtfertigen kann.
Obwohl dieses Buch für eine Anerkennung und damit Akzeptanz des irrationalen Elementes als des vitalsten Teiles des Menschen plädiert, sollte dennoch klar sein, dass die rationalen Strukturen, die der Mensch sich seit ewigen Zeiten in Religion und Kunst, in Philosophie und Psychologie geschaffen hat, ebenso ein wesentlicher Teil der menschlichen Existenz sind. Es geht lediglich um eine gerechte Verteilung und eine abgewogene Bewertung des Natürlichen im Vergleich zum Künstlichen.
Dass der Mensch so leicht sein natürliches Selbst aus den Augen verliert, womit er die Wirklichkeit bis zum Wahnsinn verdreht, ist tief in seiner Angst vor den natürlichen Kräften verankert, die ihn nicht nur von außerhalb sondern auch in seiner eigenen inneren Natur bedrohen. Vor allem ist es seine Angst, von diesen elementaren Kräften zerstört zu werden, die ihn dazu brachte, eine Sicherheit gebende eigene Welt aufzubauen.
Seinen Bemühungen um Kontrolle sind aber Grenzen gesetzt, solange der Tod auf den Menschen, den anmaßenden Eroberer der Natur, wartet. Deshalb kann der furchtlose Held, während er den Tod herausfordert, diese elementaren Kräfte in sich selbst nutzen, um den ewigen menschlichen Werten treu zu bleiben. Indem er das tut, wird er allerdings selbst das Opfer seiner heroischen Unternehmungen, weil die Erfahrung dieser irrationalen Kräfte in der einen oder anderen Weise katastrophale Folgen haben muss.
Die Angst, hervorgerufen von destruktiven Lebenskräften, die gelegentlich in den aktiven Ausdruck neuer Werte umgewandelt werden können, erlaubt dem gewöhnlichen Menschen nur eine indirekte Beteiligung. Und das ist schon alles, was ich bestenfalls von meinem Bemühen erwarte, nämlich meine Erfahrungen anderen mitzuteilen. Ich bin nicht daran interessiert, andere zu überzeugen oder zu bekehren noch irgendjemand von seinem Weg zum Glück abzuhalten. Weder kann ich ein Patentrezept anbieten, noch sonst eine Lösung unserer menschlichen Probleme, die für mich zum Leben dazugehören. Wir wurden unter Schmerzen geboren, und wir sterben unter Schmerzen. Wir sollten Lebensschmerzen als unvermeidlich akzeptieren. Tatsächlich sind sie ein notwendiger Teil unseres Erdenlebens und nicht nur der Preis, den wir für Lust zu bezahlen haben.
Dieses Buch ist ein Versuch, das menschliche Leben darzustellen, nicht nur, wie ich es in mehreren Jahrzehnten studiert habe, sondern auch, wie ich es für mich erfahren und gestaltet habe, ohne von irgendwelchen Ideologien dazu gezwungen worden zu sein. Der Mensch wird jenseits der Psychologie geboren und stirbt auch jenseits von ihr. „Jenseits“ zu leben kann er aber nur durch vitale eigene Erfahrungen, in religiösen Begriffen ausgedrückt: durch Offenbarung, Bekehrung oder Wiedergeburt.
Mein Lebenswerk ist beendet. Die Gegenstände meines früheren Interesses, der Held, der Künstler, der Neurotiker erscheinen nochmals auf der Bühne, und zwar nicht nur als Mitspieler im ewigen Drama des Lebens, sondern, nachdem der Vorhang gefallen ist, ohne Maske, unbekleidet und ohne Prunk. Auch nicht als geplatzte Illusionen, sondern als menschliche Wesen, die keines Interpreten bedürfen.
Juni 1939, Otto Rank
1Modern Education, N.Y. 1930. Art and Artist, N.Y. 1930
2 Karl Bühler, Die Krise der Psychologie, 1927, die u.a. eine Auseinandersetzung mit Freuds Psychoanalyse enthält.
1
Psychologie und sozialer Wandel
DIE RELATIVITÄT PSYCHOLOGISCHER SYSTEME
In der Geschichte der Menschheit wirken zwei alternierende Prinzipien der Veränderung, die offenbar ein ewiges Dilemma aufzeigen: die Frage, ob eine Veränderung der Menschen selbst oder eine Veränderung ihrer politischen Systeme die bessere Methode zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ist. In unserer eigenen Zeit sozialer Not, in der sich die beiden Prinzipien des Wandels tatsächlich überlappen, werden wir uns immer mehr der beiden dynamischen Kräfte in diesem menschlichen Konflikt bewusst, wo das Individuum gegen die sozialen Einflüsse der Kultur, in die es zufällig hineingeboren wurde, ankämpft. Dieser ewige Konflikt einer Menschheit, die nach willentlicher Kontrolle unkontrollierbarer Zustände strebt, wird in unserer Zeit auf dramatische Weise durch zwei gegensätzliche Bewegungen verkörpert. Sie prallen in der Zeit vor und nach dem ersten Weltkrieg aufeinander: der gesteigerte Individualismus der Vorkriegszeit, der sich im Aufstieg und in der Entwicklung einer Psychologie des Individuums manifestiert - konzipiert als pädagogisches und therapeutisches Instrument - und die darauf folgende Reaktion spontaner Massenbewegungen, die in den für unsere Nachkriegszeit charakteristischen sozialen und politischen Ideologien einen starken Ausdruck fanden.
Während Politiker, Pädagogen und Psychologen Lösungen der drängendsten Probleme dieses Konflikts vorschlagen, geschieht, wie so oft in der Geschichte, Unvorhergesehenes, das ihnen die Entscheidung entreißt und Systeme wie Menschen in einer Weise formt, die sich niemand vorstellen konnte. Das Beste, was wir unter diesen Umständen tun können, ist, mit den spontanen Entwicklungen, denen wir und unser individuelles und soziales Leben ausgesetzt sind, Schritt zu halten. Dieses Schritthalten ist meiner Meinung nach nicht bloß ein Nachdenken über das, was gerade passiert und was dagegen jetzt getan werden sollte, sondern in der Tat ein Leben im und mit dem Fluss der Ereignisse. Im Schwimmen folgen wir den wechselnden Strömungen und sind uns der gefährlichen Unterströmungen voll bewusst.
Zeiten sozialer Krisen, wie wir sie jetzt durchleben, erlauben nicht viel Nachdenken, sondern verlangen nach schnellem Handeln. Die hohe Zeit des Intellektualismus im 19. Jahrhundert, die während des Weltkriegs schwand, hat seither einer Periode hektischer Aktivität Platz gemacht, in der wir nicht ohne Verlegenheit feststellen, dass unser Geist trotz seiner sprichwörtlichen Schnelligkeit nicht mit der Flut der sich überschlagenden Ereignisse Schritt halten kann.
Gebunden an die Ideen einer besseren Vergangenheit, die vorbei ist, und einer besseren Zukunft, die kommen wird, fühlen wir uns in der Gegenwart hilflos, weil wir ihre Bewegung nicht einmal für einen Moment anhalten können, um sie intelligenter zu gestalten. Wir müssen noch lernen, dass ein Leben, das sich behaupten will, immer wieder mal gegen die unaufhörlichen Versuche des Menschen revoltieren muss, seine irrationalen Kräfte mit dem Verstand zu beherrschen. Ganz gleich, in welcher Form dieses vermessene Ziel versucht wird, früher oder später setzt eine Reaktion ein, sei es in Form von intellektueller Skepsis und Pessimismus - durch den beispielsweise die Griechen untergingen - oder in der tatsächlichen Rebellion unserer frustrierten menschlichen Natur.
Ob wir es zugeben wollen oder nicht, es bleibt eine Tatsache, dass in der bisherigen Geschichte die radikalsten und wirkmächtigsten Veränderungen durch Kriege und Revolutionen zustande kamen, durch aktive Änderung der bestehenden Ordnung, nach der sich das Volk verändert hat oder vielmehr gezwungen war, sich zu verändern.
Nachdem die neue Ordnung einmal durch Gewalt etabliert ist, bleibt Bildung - im weitesten Sinne des Wortes verstanden - immer das wesentliche Mittel, um Menschen zu verändern. Die Stärke, aber auch die Schwäche einer solchen Einflussnahme liegt in ihrer mangelnden Flexibilität; Bildungssysteme als Teile politischer Ideologien neigen dazu, ebenso absolutistisch zu werden wie religiöse Systeme, die früher die Grundlagen der Erziehung waren.
Seit Aristoteles die Notwendigkeit des Staates proklamierte, die Jugend im Geiste seiner Verfassung zu erziehen, ist dieses Prinzip in Vergangenheit und Gegenwart die Leitlinie einer starken Staatsführung gewesen. An entscheidenden Punkten der modernen Geschichte finden wir ein wachsendes Bewusstsein für die politische Bedeutung der Erziehung, wie es die deutsche Tradition des "Schulmeisters" demonstriert hat, die 1866 den Sieg über Österreich errungen haben soll, und wie in jüngster Zeit gesagt wurde, dass die Jungs aus Eton dem Drill und der Disziplin der Hitler-Jugend nicht standhalten könnten.
Tatsächlich scheint der sprichwörtliche militaristische Geist des deutschen Volkes nichts anderes zu sein als eine Fortsetzung der Unterrichtsdisziplin ins Erwachsenenalter. Selbst die viktorianischen Engländer gaben trotz ihrer Abneigung gegen Systeme und Theorien zu, dass die Schlacht von Waterloo an einer Schule gewonnen wurde; und die individualistischen Franzosen zogen nach ihrer Niederlage 1870 den Schluss, das deutsche "Gymnasium" müsse ihrem eigenen "Lycee" überlegen sein.
In unserer Zeit jedoch versuchten die modernen Pädagogen, verwirrt durch die Instabilität unserer Gesellschaftsordnung und das Fehlen allgemein akzeptierter Ideale, die auf Konformität ausgerichtete Philosophie der traditionellen Erziehung durch eine auf das Individuum bezogene, auf der wissenschaftlichen Psychologie basierende Philosophie zu ersetzen. Anstatt das Individuum an eine sich ständig verändernde, also in ihrem Fundament bedrohte Gesellschaftsordnung anzupassen, proklamierten progressive Pädagogen die Veränderungsfähigkeit des Individuums als Hauptziel der heutigen Erziehung.
Damit erklärten sie stillschweigend den Bankrott der traditionellen Erziehung, die ihrem Wesen nach nur zur Indoktrinierung und damit zur Aufrechterhaltung kollektiver Ideologien diente, aber nicht die Entwicklung des individuellen Selbstseins förderte. Daher erwiesen sich die individualistischen Ergebnisse dieser psychologischen Experimente, die von einer Gruppe von Progressiven durchgeführt wurden, als konträr zum Ideal der amerikanischen Massenerziehung.
Tatsächlich war es eine fortschrittliche Erziehung, oder eher waren es gewisse progressive Schulen in diesem Land (USA, KH), die man kritisierte, und zwar wegen ihrer antidemokratischen Versorgung einer „privilegierten“ Gruppe, die sich eine "Kinder-zentrierte" Schule für ihren Nachwuchs leisten konnte.
Während eine erzieherische Stärkung des Selbstseins für den Einzelnen in Zeiten sozialer Umwälzungen wünschenswert sein mag, wenn er mehr innere Sicherheit braucht, um die bedrohlichen Stürme in seiner sich wandelnden Umgebung zu überstehen, trennt sie den Einzelnen von den sozialen Einflüssen, die auf die eine oder andere Weise nach Einförmigkeit streben.
Es bedurfte jedoch der Bedrohung durch fremde Ideologien, um die fortschrittlichen Pädagogen in diesem Land auf die Gefahren aufmerksam zu machen, worauf ich 1930 in der Zeitschrift Modern Education3, hingewiesen hatte. Die Konferenz der Progressive Education Association in Detroit im Jahr 1939 hielt es für notwendig, das Ideal des Individualismus neu zu definieren. Gegenüber der "Kinder zentrierten" Schule legte man die Betonung auf eine Erziehungstheorie, die auf die Förderung demokratischer Werte ausgerichtet war.
Wie die traditionelle Erziehung auf die Errichtung und Festigung der bestehenden sozialen Ordnung und des sie repräsentierenden psychologischen Menschentyps abzielt, so ist gleichzeitig wahr, dass die Selbstentwicklung des Individuums zur Differenzierung neigt und somit Veränderungen bewirkt. In diesem Sinne neigen Erziehungsphilosophien, egal wie radikal sie sind, dazu, konservativ zu werden, wenn das sie unterstützende Gesellschaftssystem Bestand haben soll.
Andrerseits wirkt gleichzeitig mit der traditionellen Charakterpsychologie, die gelehrt wird, eine andere, realistischere, die aus spontanen Entwicklungen gelernt und auf die eigene Veränderung sowie auf die Veränderung anderer angewendet wird. Bei all unseren Bildungsbemühungen müssen wir den entscheidenden Einfluss lebendiger Kräfte außerhalb der etablierten Gesellschaftsordnung anerkennen, also die Erziehung des Einzelnen außerhalb des Klassenzimmers.
Dieser Zustand, allgemein als unglückliche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis beklagt, dient in Wirklichkeit dem menschlichen Bedürfnis, ein Extrem mit seinem Gegenteil auszugleichen. Anstatt eine einseitige, also absolute Lösung anzustreben - was in der Praxis Stagnation bedeuten würde - sollten wir erkennen, dass ein dynamischer Dualismus im Menschen als eine Kraft des Gleichgewichts und nicht nur als eine Quelle von Konflikten wirkt.
Wenn diese grundlegende Dynamik der menschlichen Natur vernachlässigt wird, erzielt jede Erziehung, insbesondere die unserer westlichen Zivilisation mit ihrer Abhängigkeit von politischen Ideologien, früher oder später keine Einförmigkeit, weil sie unwissentlich das Wachstum und die Entwicklung der entgegengesetzten Art von Erziehung fördert, anstatt derjenigen, die sie sich vorgenommen hatte.
Wir haben gesehen, wie in Europa der Vorkriegsimperialismus den Sozialismus ausbrütete und wie eine demokratische Ideologie in Regierung und
Erziehung zu Faschismus und Kommunismus führte. So gesehen können die auf diesen extremen politischen Ideologien basierenden Erziehungssysteme wiederum zu individualistischen Reaktionen führen.
Wie dem auch sei, wir sehen derzeit, was die Methode der Indoktrination und das Ergebnis der Uniformität betrifft, ein starkes Wiedererstarken der traditionellen Erziehung, nicht nur in den totalitären Staaten, sondern auch in den USA, wo man noch nicht das wirkliche demokratische Gleichgewicht zwischen individualistischer Freiheit und der Freiheit politischer Gleichheit gefunden hat.
Dennoch bleibt dieser wesentliche Unterschied zwischen demokratischer Regierungsform und der Erziehungsphilosophie totalitärer Staaten bestehen: Während die einen die Menschen verändern wollen, um sie zu einem besseren Leben zu erziehen, drängen die anderen die Menschen zu einem Systemwechsel, der dem Einzelnen einen ultimativen Vorteil verspricht.
Hier wird deutlich, dass die erste Methode evolutionären Prinzipien folgt, während die andere notwendigerweise revolutionärer Natur ist. Diese beiden Prinzipien folgen oder kopieren die zwei natürlichen Prozesse, die für die Aufrechterhaltung des Lebens offenbar notwendig sind.
So gesehen schließen sich Evolution und Revolution keineswegs gegenseitig aus - als "natürlich" versus „menschengemacht“ - sondern sie sind Konzepte, die den beiden antagonistischen Prinzipien entsprechen und das Leben selbst sind.
Daraus folgt, dass alle Entweder-Oder-Gegensätze, die in einer Sackgasse enden, letzten Endes auf die Unfähigkeit oder den Widerstand der Menschen zurückzuführen sind, die gleichzeitige oder alternierende Wirkung beider Prinzipien anzuerkennen, die das Leben lenken und sein Schicksal bestimmen.
Doch es geht nicht nur darum, die beiden Seiten zu sehen oder sie intellektuell zu akzeptieren, was schwierig zu sein scheint, sondern um ein Erleben beider Seiten im täglichen Leben. Denn Leben besteht aus Handeln, und Handeln muss einseitig sein, jede andere Alternative ausschließend. Daraus folgt, dass unser Beharren auf einer einseitigen Interpretation oder Lösung eines bestimmten Problems das Ergebnis unserer Übertragung des Hauptmerkmals des Handelns, seiner Einseitigkeit, auf das Denken ist, das im Gegenteil in einer wechselseitigen Betrachtung beider Seiten besteht.
In unserer Kultur ist das Denken immer mehr zum Ersatz für das Handeln geworden, während wir selbst immer untätiger und immer geschwätziger geworden sind.
Dies erklärt, warum wir in Zeiten, wo Handeln gefragt ist, uns mit dialektischen Interpretationen von Ereignissen begnügen, anstatt das dynamische Zusammenspiel der lebendigen Kräfte hinter dieser logischen Denkweise zu erkennen. Dieses Überwiegen des Denkens findet seinen Ausdruck darin, dass wir die gleichzeitige Wirkung dynamischer Lebenskräfte als "irrational" bezeichnen, während wir die dialektische Abfolge von These, Antithese und Synthese als rationale Darstellung verstehen.
Da die willensmäßige Seite der menschlichen Natur keine spontanen Ereignisse zulassen kann, die sich ihrer Kontrolle entziehen, verfälschen wir die gesamte Sichtweise und den Sinn des Lebens, indem wir spontane natürliche Entwicklungen als irrational ansehen und entgegen allen Beweisen glauben, das Willentliche sei das rationale.
Dieser paradoxe Zustand spiegelt sich in dem widersprüchlichen Kampf verschiedener Ideologien, seien sie politischer, pädagogischer oder psychologischer Natur.
Durch die Betonung eines Aspekts des Problems auf Kosten des anderen, d.h. des Willens oder des Spontanen, bzw. des Rationalen oder Irrationalen, im Sinne von Evolution versus Revolution, streben die verschiedenen politischen Glaubensrichtungen, Bildungssysteme und psychologischen Schulen eine Dominanz an, die durch keinen absolutistischen Dogmatismus erreicht werden kann. Jede dieser Ideologien behauptet zwar, die eigentliche Wahrheit gefunden zu haben, drückt aber in Wirklichkeit nur vorübergehende Bedürfnisse und Wünsche der einen Seite der menschlichen Natur aus und zwingt so die andere, frustrierte Seite dazu, sich abwechselnd in gewalttätigen Reaktionen durchzusetzen.
Wir haben also den ewigen Kreislauf der sich wandelnden Ideologien, angesichts derer wir uns immer noch an den Glauben an eine absolute Lösung klammern. Das wirkliche Problem scheint unser Bedürfnis nach oder unser Beharren auf dem Absoluten zu sein - ein allgemein menschliches Problem, das jenseits der Psychologie liegt. Doch unser "Jenseits der Psychologie", bedeutet nicht einfach die Akzeptanz der modernen Betonung anderer Faktoren, wie Wirtschaft, Politik oder Technik, die das menschliche Verhalten bestimmen. Dazu müssen wir über die Individual- und Sozialpsychologie hinausgehen und uns der Gruppen- oder Massenpsychologie zuwenden, denn auf lange Sicht ist es die Masse, die entweder die Psychologie schafft oder auf die sie gewaltsam angewendet wird. Es bedeutet eher mehr als weniger Psychologie, aber ist von anderer Art. Es ist eine Betonung der dynamischen Kräfte, die das Leben und das menschliche Verhalten bestimmen, mit einem Wort, das Irrationale, während unsere heutige Psychologie als eine rationale Erklärung des menschlichen Verhaltens konzipiert ist - bestenfalls als eine Rationalisierung des Irrationalen - aber nicht als eine Akzeptanz des Irrationalen als wesentliche Triebkraft.
Tatsächlich scheint mir die Tendenz unserer Zeit, die Bedeutung aller psychologischen Erklärungen des menschlichen Verhaltens zu minimieren, ein Hinweis auf das Versagen unserer rationalistischen Psychologie zu sein, die zunehmende Macht der irrationalen Kräfte zu erklären, die im modernen Leben wirken. Daher müssen für das Fehlgehen der rationalistischen Psychologie andere rationale Erklärungen des menschlichen Verhaltens gefunden werden, unter denen die wirtschaftliche am ehesten logisch zu sein scheint. In Wirklichkeit aber funktioniert sie genauso irrational wie jedes andere rationale Prinzip, das auf die Praxis übertragen wird.
Es sei betont, dass wir mit irrationalen Kräften nicht die blinden biologischen Kräfte meinen, mit denen die Analytische Psychologie zu tun hat. Wir meinen eher gewisse mächtige Ideologien, die als rein rational akzeptiert oder interpretiert wurden. In Wirklichkeit sind sie emotional, während die natürlichen Kräfte, die im Menschen wirken, als irrational stigmatisiert wurden, weil sie als unkontrollierbar erscheinen.
Man muss also wirklich mit zwei Arten von Psychologie rechnen: die eine, die tatsächlich vom Individuum oder vom Volk gelebt wird, ist „irrational“, sofern sie aus einem gleichzeitigen Ausdruck zweier opponierender Prinzipien besteht; die andere, die rationale Psychologie, gilt als Erklärungswissenschaft, die wissenschaftliche Methoden für pädagogische und therapeutische Zwecke bereit stellt.
Während die irrationale Psychologie automatisch eine Lebenseinstellung schafft, die zu Handlungen führt, entwickelt sich die scheinbar rationale Psychologie leicht zu einer Ideologie, die weit davon entfernt ist, Ausdruck des Lebens selbst zu sein, sondern als Mittel zur Veränderung des Lebens im Sinne einer bestimmten sozialen Ordnung gedacht und benutzt wird. Alle Versuche, eine solche Ideologie nach und nach in die Praxis umzusetzen - sei es in pädagogischer oder politischer Hinsicht – können leicht von spontanen Entwicklungen der irrationalen Elemente überholt werden.
Insofern als Ideologien von dem sensibleren Typus geschaffen werden, der bestimmte dringende Bedürfnisse und Wünsche vorwegnimmt und auf den Punkt bringt, bleiben sie immer etwas unzeitgemäß oder aus dem Takt geraten, entweder in ihrer voreiligen Vorwegnahme oder in ihrer verspäteten Anwendung.
Der rasche Aufstieg und plötzliche Niedergang unserer eigenen psychologischen Epoche ist ein schlagendes Beispiel für die fatale zeitliche und inhaltliche Diskrepanz zwischen dem unmittelbaren Streben einer bestimmten Epoche, ihrem ideologischen Ausdruck oder ihrer Formulierung durch eine kreative Persönlichkeit und ihrer systematischen Anwendung.
Der Psychologie des Individuums, die darin versagte, uns die heutigen Massenbewegungen verstehen zu lassen, ging eine von Nietzsche eingeleitete kulturelle Gruppenpsychologie voraus. Angeregt vom französisch-preußischem Krieg von 1870 analysierte er die unterschiedlichen Reaktionen der verfeindeten Gruppen in ihrem ewigen Kampf um Vorherrschaft.
Dieser dynamischen Konzeption kultureller Typen folgte in einer Ära vergleichbarer Stabilität Freuds medizinischer Ansatz einer wissenschaftlichen Psychologie pathologischer Individuen, die in einer offenbar gesunden Gesellschaft leiden.
Die therapeutische Psychologie schien während ihrer rasanten Entwicklung vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Weltkrieg das lang ersehnte Wundermittel des neunzehnten Jahrhunderts für alle menschlichen Übel zu sein. Das humanistische Ideal des 19. Jahrhunderts, das die Individuen durch rationale Erziehungs- und Umerziehungs-Methoden ändern sollte, erschien praktisch erfüllt.
Auch die reine Psychotherapie, die das persönliche Glück des Einzelnen im Auge hatte, war nur ein Teil dieses idealistischen Erziehungsprinzips, wonach ihre zugrunde liegende Philosophie darin bestand, Abweichler an die akzeptierte Norm anzupassen.
Das pädagogische Ziel der Psychoanalyse wurde jedoch von Anfang an von einem attraktiveren Aspekt - der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit – überlagert. Dementsprechend wurde die Erfahrung des Individuums im therapeutischen Prozess zu einer allgemeinen Theorie ausgearbeitet, die den Anspruch erhob, eine universelle Erklärung für das gesamte menschliche Verhalten zu sein, unabhängig von Zeit und Ort.
Ich erkannte die Relativität dieser Psychologie aus meiner eigenen Erfahrung, bevor andere durch gesellschaftliche Ereignisse davon überzeugt wurden, dass die moderne Psychologie weit davon entfernt ist, eine allgemein gültige, d.h. absolute Wissenschaft zu sein. Spontane Entwicklungen, die weite Teile der Bevölkerung betrafen, haben die soziale Ordnung, aus der diese psychologischen Theorien entstanden sind, erheblich erschüttert. Krieg und Nachkriegsrevolution mit ihrem materiellen und seelischen Leiden, gefolgt von sozialer Reglementierung der einen oder anderen Art, veränderten die Lebensweise radikal, bevor psychologische Methoden eine Chance hatten, die Menschen zu verändern.
Tatsächlich war es Freud selbst, der die gesamte psychoanalytische Bewegung diskreditierte, als er sein Lebenswerk mit der pessimistischen Erkenntnis beendete, dass er es nicht mit neurotischen Individuen, sondern mit einer kranken Zivilisation zu tun habe. Solch eine Aussage, wie freimütig auch immer, bleibt bedeutungslos, wenn ihr nicht eine Aufforderung zum Wechsel der Ordnung folgte, die ihrerseits mit den Begriffen einer im Vorhinein bedachten Ideologie, also mit Psychologie, verteidigt wird.
Außerdem hat jede Gesellschaft ihre Übel, ihren Niedergang und ihre Dekadenz; und nur, indem er unser gegenwärtiges Leiden übertreibend als neurotisch darstellte, konnte Freud ihm eine therapeutische Interpretation geben, die keine psychologische war. Denn wenn unsere Gesellschaft neurotisch ist, gibt es immer noch Hoffnung auf Heilung, und das Böse ist nicht verhängnisvoll; tatsächlich sind solche Krisen Teil des Lebens und müssen als solche akzeptiert werden. Jedenfalls können sie in einer Beratungspraxis nicht geheilt werden, sondern werden durch spontane Reaktionen des Volkes selbst behoben.
Solche unwillkommenen Reaktionen, gepaart mit Freuds Enttäuschung über seine therapeutischen Ergebnisse, veranlassten ihn, unsere Zivilisation als krank zu diagnostizieren - eine Schlussfolgerung, die Nietzsche ein halbes Jahrhundert zuvor in seiner "Kultur-Psychologie" zog. Darin ging es um die Ressentiments der Unterdrückten und um den Machtwillen der herrschenden Klassen.
Inmitten eines dieser ewigen Kämpfe finden wir die wissenschaftliche Psychologie mit ihrem Anspruch, ein absolutes Kriterium für menschliches Verhalten liefern zu können, das aber unzulänglich ist, den bestehenden Menschentypus zu verstehen und zu erziehen. Was wir in der Praxis tatsächlich vorfinden, ist eine Vielzahl psychologischer Theorien, die von verschiedenen Denkern vertreten werden. Sie beschuldigen sich gegenseitig, nicht wissenschaftlich zu sein, ohne zu erkennen, dass ihre psychologischen Systeme, wie sie in der Praxis interpretiert und verwendet werden, in Wirklichkeit Ideologien sind, die für bestimmte Klassen und Typen repräsentativ sind. Ihr unwissenschaftlicher Aspekt ist meines Erachtens ihr wirklicher Wert, da sie lebenswichtige Bedürfnisse und Wünsche einer bestimmten Art oder Klasse innerhalb eines bestimmten Zeitraums und einer besonderen Umgebung zum Ausdruck bringen. Sie überlebten ihre Bedeutung, als sich die Dinge änderten, aber sie waren zu ihrer Zeit und an ihrem Ort nützlich.
Anstatt zu versuchen, diese verschiedenen psychologischen Denkschulen im Namen einer objektiven Wissenschaft in Einklang zu bringen, sollten wir aus wiederkehrenden Ereignissen lernen, dass eine realistische Psychologie als lebendiger Ausdruck des Volkes sich wie alles andere auch verändert und dass sie sich verändern muss, um lebendig zu bleiben.
Eine solche lebendige Psychologie, die wir nicht im Labor studieren und aus Lehrbüchern lernen, sondern die wir selbst haben und in unserem täglichen Leben praktizieren, kann niemals streng wissenschaftlich, d.h. mechanistisch sein; sie kann daher niemals das absolute Kriterium sein, für das wir sie gehalten haben und nach dem wir noch immer zu suchen scheinen.
Sie verändert sich nicht nur in Zeit und Ort, sondern variiert auch innerhalb ein und derselben Gesellschaft Die menschliche Psychologie wird ständig von all den Kräften beeinflusst, die die jeweilige Gesellschaft, aus der sie hervorgegangen ist, aufbauen und formen.
Jedes System der Psychologie ist ebenso ein Ausdruck der bestehenden sozialen Ordnung und des sie repräsentierenden Menschenypus wie eine Interpretation desselben. Mit anderen Worten: Die Psychologie ist kein objektives Instrument wie ein Teleskop oder Mikroskop, das zur Beobachtung der Reaktionen von Einzelpersonen oder Gruppen von Menschen eingesetzt werden könnte; sie ist keine Wissenschaft jenseits, beziehungsweise oberhalb der Gesellschaft, die sie zu erklären vorgibt. Im Gegenteil, diese psychologischen Theorien müssen als Teil des gesamten sozialen Systems erklärt und als Ausdruck eines bestimmten Typus verstanden werden, der eine bestimmte Schicht davon repräsentiert.
Dadurch werden die verschiedenen Schulen der Psychologie, die wir gleichzeitig innerhalb ein und derselben Kulturschicht finden, verständlich. Jedes dieser widersprüchlichen Systeme behauptet, die absolute Wahrheit zu präsentieren, während sie in Wirklichkeit verschiedene Typen, Gruppen und Klassen repräsentieren und die Verschiebung der menschlichen Bedingungen entlang der Linien der Veränderung registrieren.
In diesem Sinne verändern sich Theorien der Psychologie, man könnte fast sagen, wie Moden, und sind zwangsläufig gezwungen, sich zu verändern, um den bestehenden Menschentypus in seinem dynamischen Kampf um Erhaltung und Fortbestand auszudrücken und verständlich zu machen.
DIE IRRATIONALE BASIS DER MODERNEN PSYCHOLOGIEN
Um die sozialen Implikationen unserer psychologischen Kontroversen zu fokussieren, müssen wir lediglich die umstrittensten Theorien der modernen Psychologie einander gegenüberstellen. Vor etwa einem halben Jahrhundert begann die Psychoanalyse als eine rein individuelle Therapiemethode und war als solche für einen bestimmten Patiententypus hilfreich. Je mehr Freud und seine Anhänger ihre therapeutische Erfahrung zu einem allgemeinen psychologischen System weiterentwickelten, desto deutlicher wurde die Kluft zwischen dieser vermutlich universellen Theorie von psychologischen Fakten und ihrer therapeutischen Verwendung für die Interpretation des Verhaltens eines bestimmten Typs im Sinne einer bestimmten sozialen Ideologie.
Daher wurde jede Abweichung von der theoretisch vorgeschriebenen "Norm" bald als "neurotisch" bezeichnet, selbst wenn es sich nicht um eine ausgesprochene Krankheit handelte, sondern lediglich um eine Frage des unterschiedlichen Temperaments, Charakters oder sozialer Standards. Die wissenschaftliche Grundlage der Psychoanalyse war zwar die auf die persönliche Entwicklung des Individuums angewandte Evolutionsbiologie, aber diese naturalistische Theorie wurde in den Dienst einer Erziehungsphilosophie gestellt, die die Bedürfnisse und Wünsche dessen ausdrückt, was man als bürgerlichen Typus oder obere Mittelschicht bezeichnen könnte.
Freud interpretierte also automatisch bestimmte grundlegende Triebe im Menschen im Sinne einer therapeutischen Ideologie, die die Psychologie eines damals erfolgreichen Typs mit seinen sozialen und moralischen Normen rechtfertigte. Der scheinbar revolutionären Tendenz, welche die Berufskonservativen der Psychoanalyse zunächst vorwarfen, stand das eigene therapeutische Ziel entgegen, das abweichende Individuum an die herrschende Gesellschaftsordnung anzupassen.
In einer solchen pädagogischen Konzeption kann ich den lebendigen Wert einer praktischen Psychologie sehen - solange diese nicht als absolutes System proklamiert wird, das auf alle Arten anwendbar ist, die von der standardisierten Norm abweichen.
Dass Freuds Psychologie, die eher eine Interpretation als eine Erklärung der menschlichen Natur ist, nicht für alle Ethnien gültig ist, betonte Jung; dass sie nicht auf verschiedene soziale Umfelder zutrifft, betonte Adler; aber dass sie nicht einmal Individuen derselben Ethnie und desselben sozialen Hintergrunds erlaubt, vom akzeptierten Typ abzuweichen, führte mich über diese Unterschiede in der Psychologie hinaus zu einer Psychologie der Differenz. Diese spontanen Reaktionen innerhalb der psychoanalytischen Bewegung selbst sind ein hervorragendes Beispiel für diese Entwicklung. Freuds Tendenz, seine Psychologie zu verabsolutieren, wurde schon früh (vor dem Ersten Weltkrieg) durch zwei diametral entgegengesetzte Reaktionen konterkariert: Adlers Antithese und Jungs Synthese, die sozusagen die dialektische Vollendung des gesamten Systems erfüllen und damit die Bewegung zum Stillstand bringen.
Freud erklärte bekanntlich den Sexualtrieb zur treibenden Kraft des Individuums, während Adler den Ego-Trieb des Individuums nach Macht, Dominanz und Überlegenheit betonte. Wir wollen ihren Unterschied in der Sichtweise nicht dadurch erklären, dass wir annehmen, dass jeder von ihnen nur eine Seite der menschlichen Natur sieht; es ist wichtiger für uns zu erkennen, warum jeder die besondere Betonung zeigt, die für sein Denken charakteristisch ist. Es erscheint mir nicht irrelevant, dass Adler, bevor er sich für die Psychoanalyse interessierte, ein praktischer Arzt in den ärmeren Stadtteilen Wiens war und politisch der Sozialistischen Partei angehörte. Dass alle seine Patienten an einem Minderwertigkeitskomplex litten, während Freuds Fälle schuldbewusst schienen, könnte sehr wohl darauf zurückzuführen sein, dass ihre jeweilige Klientel aus unterschiedlichen Klassen stammte. Wie dem auch sei, das Leiden an Unterlegenheit und das Streben nach Dominanz ist zweifellos die Psychologie eines unterdrückten Typs oder eines Zukurzgekommenen.
Freuds Vorstellung von der Neurose als Folge biologischer Verdrängung drückt dagegen geradezu die Psychologie des "Arrivierten" aus, also des Typus, der seine instinktiven Kräfte aufgebraucht hat, um Macht zu gewinnen und um seine Position zu behaupten. Jung erkannte zwar, dass sowohl Freud als auch Adler sich nur mit einem besonderen Typus beschäftigten, sah aber nicht die sozialen Folgen im dynamischen Kampf der beiden gegnerischen Kräfte. Er versuchte, den Streit zwischen den beiden Psychologen zu versöhnen, indem er seine Theorie der zwei "psychologischen Typen", des introvertierten und des extrovertierten, entwickelte.
Diese statischen Typen, das Produkt der Abstraktion, sind von geringem praktischen Wert, weil der unterdrückte Typ im wirklichen Leben in Aktion treten kann, d.h. dazu neigt, extrovertiert zu werden, während der erfolgreiche Typ wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen entwickelt und auf dieser Grundlage in sich selbst hineinschaut.
Was wir durch die gesellschaftliche Analyse dieser widersprüchlichen Theorien aufgedeckt haben, ist ein psychologischer Dualismus, der sich durch die Geschichte der Menschheit zieht. Nietzsche war der erste, der ihn formulierte, indem er die Psychologie des Herrschers mit der des Beherrschten kontrastierte. Diese Doppel-Psychologie gilt nicht nur für das Kämpfen von Gruppen, Klassen oder Nationen gegeneinander, sondern auch für individuelle Beziehungen, wie z.B. jene zwischen Führer und Anhängern, Meister und Schüler, Therapeut und Patient, Eltern und Kind, und, wie Nietzsche es sah, auch Mann und Frau.
Indem er den menschlichen Wert einer solchen realistischen Psychologie der Differenz vernachlässigte, ließ Freud Rousseaus sentimentale Auffassung von der fundamentalen Ähnlichkeit der natürlichen Menschen wieder aufleben, eine humanistische Idee, die seit der Französischen Revolution das Tempo für soziale Experimente vorgab. Der grundlegende Trugschluss dieser politischen Theorie der Gleichheit liegt in der psychologischen Annahme, dass wir auch gleich geboren werden. Tatsächlich variiert der Geburtsvorgang selbst, wie ich in Das Trauma der Geburt dargelegt habe, bei verschiedenen Personen in einem solchen Maße, dass dies an sich, unabhängig von erblichen Faktoren und Umwelteinflüssen, für eine Vielzahl von Temperamenten und Verhalten verantwortlich sein dürfte.
Doch auf der Annahme einer grundlegenden Ähnlichkeit des Menschen ruhen alle unsere Bildungssysteme; und alle Widersprüche der modernen Psychotherapie lassen sich durch unseren zweifachen Versuch erklären, sowohl den individuellen Unterschied in Persönlichkeiten als auch gleichzeitig die soziale Ähnlichkeit mit dem gewünschten Typ zu stärken. Unterstützt durch eine scheinbar universelle Psychologie des menschlichen Verhaltens, fühlten sich Politiker und Erzieher gerechtfertigt, die Massen nach ihren Zielen oder Idealen zu formen, anstatt ihre gleichen Rechte und Chancen als Bürger offen anzuerkennen und zu respektieren.
Da Menschen nicht gleich sind und tatsächlich nicht gleich sein können, wollte die Psychologie sie zumindest als gleich erklären, mit dem mehr oder weniger unverhohlenen Zweck, sie gleich zu machen - durch Indoktrinierung mit pädagogischen, therapeutischen oder politischen Ideologien. Bei diesem kühnen Unterfangen dient der Zweifach- oder vielmehr der Dreifach-Aspekt der Psychologie als "nützliches Werkzeug“; als Ausdruck der Mentalität eines bestimmten Typus verleiht er genau diesem Typus Dauer und kann daher schließlich bequem zur Erklärung verwendet werden. Doch dieser "inspirierenden" Psychologie, die darauf abzielt, Menschen zu beeinflussen, steht eine andere, realistische Psychologie als spontaner Ausdruck der Menschen gegenüber; nicht die Psychologie, die wir schaffen, um zu verändern, sondern diejenige, die spontan Veränderung schafft - in anderen wie auch in uns selbst .
Dieses Überlappen beider Arten von Psychologie, der spontanen und der geplanten, der irrationalen und der rationalen, spiegelt den tieferen Kampf zwischen dem evolutionären und dem revolutionären Lebensprinzip, wie es vom Menschen interpretiert wird. Unser Konzept der Evolution verleugnet den uralten Glauben an die Unveränderlichkeit der Arten, der in dem Dogma zum Ausdruck kommt, dass Gott alle Lebewesen so erschaffen hat, wie sie heute existieren. Indem Darwin diese Schöpfungslehre durch die Lehre von der progressiven Evolution ersetzte, etablierte er eine mechanische Vorstellung von organischem Leben, die dem Maschinenzeitalter entsprach. Sie führte weit über die Biologie hinaus zu einer neuen Konzeption von Bildung und Regierung. Doch was ihm und anderen als revolutionäre Idee erschien, war in Wirklichkeit das Eingeständnis, dass der Mensch nicht sein eigener Schöpfer ist, und dass er unkontrollierbare Geschehnisse akzeptieren muss, die sein Schicksal bestimmen.
So akzeptierte der Mensch mit Darwin eine natürliche Entwicklung, deren Schöpfer er nicht ist, sondern deren Geschöpf, nicht der Herr, sondern der Untergebene. Die bekannte Tatsache, dass der Wissenschaftler sein epochales Werk erst nach zwanzig Jahren zweifelhaften Zögerns veröffentlicht hat, erklärt sich nicht aus seiner Angst, die Welt zu schockieren, sondern aus seinem inneren Widerstand, der Kreativität des Menschen zu entsagen, während er selbst sein eigenes, von Menschen geschaffenes Universum schuf.
Ebenso scheint die lebenslange Gebrechlichkeit, die ihn daran hinderte, mehr als drei Stunden pro Tag zu arbeiten und die für diese Verzögerung verantwortlich gemacht wurde, eine Folge seines inneren Konflikts gewesen zu sein. Wie dem auch sei, ein Mensch, den die geringste Aufregung, wie etwa ein Besuch bei Freunden, mit einem "Schüttelfrost und nervösem Erbrechen" ins Bett schickt, widerspricht sicherlich seiner Theorie vom Überleben des Stärkeren im biologischen Sinne des Wortes.
Was Darwin überleben und schließlich auch über physische Hindernisse und innere Widerstände triumphieren ließ, waren sein Schaffensdrang und seine gesellschaftliche Stellung. Ersteres verneinte er in seiner Theorie der "natürlichen Auslese", die lediglich erklärt, warum Formen ausgestorben sind. Sie sagt aber nichts über das Geheimnis der neuen Schöpfung. Letztere, seine soziale Stellung und sein Klassenbewusstsein bestätigte er positiv in seiner Theorie, mit der man den Erfolg der siegreichen Klasse in der industriellen Revolution rechtfertigen wollte - das bedeutet nicht, dass die Stärksten überleben, sondern dass diejenigen, die überleben, als die Stärksten angesehen werden sollten.
Es stimmt zwar, dass Darwins Theorie dazu benutzt wurde, die Doktrin des Laissez-faire zu stärken und damit den Wettbewerbskapitalismus zu verteidigen, aber es ist ebenso wahr, dass er selbst, nicht anders als Nietzsche, mit seiner Theorie seine körperliche Schwäche kompensierte und gleichzeitig seine privilegierte Stellung mit seinem Werk rechtfertigte.
Dasselbe gilt für den großen Sozialtheoretiker seiner Zeit, Karl Marx, in dessen Schlachtruf gegen den Kapitalismus die Opfer der industriellen Revolution ihre Würdigung fanden. Dieser Verkünder eines klassenlosen Staates wuchs als individualistischer Bourgeois in einem liberalen Deutschland auf, wo die humanitären Auswirkungen der Französischen Revolution fühlbar wurden. Besonders die Emanzipation der Juden, die Napoleon in seinen Befreiungskampf einbezogen hatte, muss Marx, den Sohn eines erfolgreich assimilierten Juden, dazu angeregt haben, das jahrhundertealte Streben seiner Ethnie nach gleichen Bürgerrechten wieder zu beleben. Obwohl es im Deutschland jener Tage eine gewisse Berechtigung für diese Hoffnung gab, begnügte sich Marx, wie die meisten anderen großen Theoretiker, nicht mit einfachen "Realitäten", sondern ist für einen vollkommen egalitären Staat auf der Erde eingetreten. Damit hat er nichts anderes getan, als die Besonderheiten des Wirtschaftszeitalters in die allgemeinen Elemente der Menschheitsgeschichte einzubauen1
Es scheint, dass alle epochalen Theorien, egal ob sie sich mit biologischen, soziologischen oder psychologischen Phänomenen befassen, ihre Popularität der Idee von Universalität verdanken. Aus diesem Grund und indem sie über die wissenschaftliche Vorhersehbarkeit hinaus in den Bereich der dogmatischen Gewissheit reichen, werden sie leicht zu Ersatz für religiöse Überzeugungen. Ähnlich wie die Propheten in ihren apokalyptischen Visionen scheinen diese intellektuellen Führer genau zu wissen, wie die Zukunft aussehen wird.
Indem sie die Vergangenheit interpretierten und die Zukunft im Sinne ihrer säkularen Religion vorhersagten, projizierten sie spezifische Bedingungen eines bestimmten Zeitalters, die gewiss verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens erhellten - in ein zeitloses und ortloses Universum.
Darwin und Marx, die sich jeweils mit den erblichen und ökologischen Bedingungen für das Überleben und die Selbsterhaltung befassten, machten sich beide Gedanken über die unterschiedliche Ausrüstung des Individuums in seinem Überlebenskampf. Freud, der psychologisch so deterministisch war wie Darwin biologisch und Marx wirtschaftlich, machte einen weniger entschuldbaren Fehler. Indem er sowohl Darwins biologischen als auch Marx' sozialen Determinismus auf die Persönlichkeit selbst anwandte, nahm er ihr genau die Eigenschaften, die das Leben des Menschen menschlich machen: Autonomie, Verantwortung und Gewissen. Letzteres musste er in wahrhaft alttestamentlicher Weise als Ergebnis einer der Erbsünde gleichwertigen Vergangenheit erklären, anstatt im Bewusstsein des Menschen den dynamischen Kampf dieser menschlichen Eigenschaften gegen jede Art von Determinismus zu erkennen. Denn wenn sich auch der Determinismus auf biologische und sogar wirtschaftliche Einflüsse anwenden lässt, kann er sicherlich nie die psychologische Antwort auf das menschliche Problem sein, denn er leugnet das menschliche Phänomen schlechthin: den individuellen Willen. Selbst wenn die menschliche Natur und das Verhalten des Menschen determinierend sind, wäre der Glaube des Menschen an seinen freien Willen, seine Wahlfähigkeit und seine individuelle Verantwortung immer noch seine "Psychologie" und der wahre Gegenstand der menschlichen Psychologie.
Aber solche "unrealistischen" Vorstellungen wurden von Freud in den Bereich der ethischen Kontroverse und theologischen Spekulation verbannt, ohne dass er erkannte, dass Religion und Philosophie über Jahrhunderte hinweg, lange bevor die "wissenschaftliche" Psychologie den Menschen zu einer rein rationalen Marionette reduziert hatte, die wirkliche Psychologie von Menschen und Individuen war.
So wie es ist, muss diese mechanistische Theorie der "Psyche", wird sie auf den schöpferischen Aufbau der Persönlichkeit angewandt, notwendigerweise wie die Religion Schuld produzieren. Sie wird dies aus dem einfachen Grunde tun, weil sie nicht nur den individuellen Willen als etwas dem deterministischen Willen Gottes entgegenstehend versteht, sondern - als inspirierende Psychologie – vom Individuum erwartet, dass es sich an dieses unrealistische Bild der menschlichen Natur anpasst. Insofern macht es keinen großen Unterschied, ob der Einzelne nach einem religiösen, sozialen oder gar einem Selbstideal beurteilt wird; auf jeden Fall kommt er schlecht dabei weg, sei es als Sünder, Schuldiger oder Minderwertiger.
Aber während die Religion immer noch die Annahme der Sünde, also der menschlichen Natur, als konstruktives Heilmittel anbietet, akzeptiert die Psychoanalyse, trotz ihrer naturalistischen Terminologie, die menschliche Natur nicht, weil sie auf einer sozialen Ideologie basiert, die darauf abzielt, dass sich das Individuum den gültigen Vorstellungen von gut und böse anpasst.
Moderne Psychologen dachten, ihre Philosophie über diesen biologischen Überlebenskampf und das soziale Streben nach Vorherrschaft zu erheben, indem sie die grundlegende Ähnlichkeit aller Menschen wieder betonten, nur um herauszufinden, wie sehr sie sich untereinander unterscheiden. Während Freud feststellte, dass wir in unserem Unbewussten - als von Instinkten beherrscht - alle gleich sind, sagte Jung, dass wir uns gerade darin unterscheiden. In diesem Sinne scheint Jungs ethnisches Unbewusstes" - das für Freud allgemein menschlich ist - das psychologische Äquivalent zu Freuds "Überich" zu sein, und zwar insofern, als es den Einfluss der Umwelt darstellt, der die individuelle Persönlichkeit formt und ihr Verhalten bestimmt. So stellt der eine den wesentlichen Unterschied der Persönlichkeitsstruktur nach oben, der andere nach unten.
Hier erkennen wir, dass sich ihre unterschiedliche Interpretation auf eine bloße Verlagerung des Schwerpunkts in Bezug auf das grundlegende Problem der Ähnlichkeit und Differenz reduziert. Während Freud alle Menschen als grundlegend gleich versteht, sind sie bei Jung unterschiedlich (wenn auch ethnisch ähnlich); dagegen behauptet Adler, dass ihr Verhalten zwar unterschiedlich ist, aber gleich sein sollte. Obwohl Adlers therapeutisches Ziel die Entwicklung "sozialer Gefühle" ist, bezeichnet er sein System als "Individualpsychologie" und verrät damit die janusköpfige Tendenz der gesamten modernen Psychologie, die zwar in der Theorie psychologische Ungleichheit nachweist, aber gleichzeitig das Dogma der Gleichheit predigt, das durch Therapie und Erziehung erreicht werden soll.
Was Adler in seinen Studien über menschliches Verhalten als "neurotischen Charakter" beschrieben hat, ist eigentlich Individualpsychologie; denn für ihn muss übertriebener Individualismus in unserer Gesellschaft zwangsläufig zu "neurotischen" Reaktionen führen. Mit seinem Heilmittel, der Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls im Individuum, strebte Adler eine Art Ausgleich vom eigenen Inneren ausgehend an, während Freuds "Anpassung" auf eine äußere Uniformität abzielt.
Jung, als Sohn eines Geistlichen weniger realistisch auf die Umwelt des Individuums achtend, kommt näher an eine subjektive Psychologie des Individuums heran als Freud oder Adler. Seine frühen Erfahrungen mit psychotischen Typen, deren Hauptmerkmal der völlige Rückzug aus der Realität und der Aufbau einer eigenen Innenwelt ist, führten ihn zu der Überzeugung, dass das grundlegende Problem des Individuums im Gefühl der Isolation liegt, unabhängig davon, wie seine Umwelt aussehen mag. Folglich suchte er das Heil des Individuums nicht in dessen Verhältnis zur Realität, sei es Rebellion oder Unterwerfung, sondern in einer Sublimierung dieser inneren Kräfte, die frustriert waren. In diesem psychologischen Prozess der Sublimierung bedient sich das Individuum, so Jung, der Symbolik in seinem kollektiven Unbewussten und erreicht damit sozusagen eine Art Kollektivität innerhalb des eigenen Selbst. Ein solches Streben nach einer fast mystischen Verbindung zwischen dem Selbst und seinem ethnischen Hintergrund soll das isolierte Individuum mit einem größeren Ganzen verbinden, von dem es sich als wesentlicher Teil fühlen kann.
Für Jung ist Sexualität nur eine Annäherung an diese kosmische Vereinigung, für Adler ein Kampf um Macht und für Freud nur ein allgemeines Ventil für alle möglichen Emotionen.
In ihren verschiedenen Versuchen, eine Psychologie des Individuums zu erarbeiten, scheinen alle drei zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gekommen zu sein, nämlich, dass das Übel, unter dem unsere Persönlichkeit leidet, eine Überindividualisierung ist; daher sind sie sich im Ziel der Heilung einig, dass sie in emotionaler Einheit sehen, verbunden mit etwas, das über das Selbst hinausgeht. Freud sieht, dass in der Sexualität, Adler im Gemeinschaftsgefühl und Jung in der Kollektivität des Unbewussten.
So gesehen sucht die Psychologie nach einem Ersatz für die kosmische Einheit, die der Mensch der Antike im Leben genoss und in seiner Religion zum Ausdruck brachte, die der moderne Mensch aber verloren hat - ein Verlust, der zur Entwicklung des neurotischen Typs führte.
In dieser Hinsicht ist es interessant, dass all diese psychologischen Systeme ab Nietzsche entweder direkt eine Psychologie der Überlegenheit befürworten oder zumindest eine solche sich vorstellen. Durch eine rationale Nutzung verdrängter Energien versprechen sie Kraft und Macht, kurz gesagt, männliche Qualitäten. In diesem Sinne ist Psychologie nicht nur von Männern gemacht wie die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern maskulin in ihrer Mentalität. Folglich erklärt sie die Frau in Begriffen des Mannes.
Die verschiedenen Psychologien, die durch die bloße Tatsache ihrer Existenz beweisen, dass es dem Mann nicht einmal gelang, verständlich zu machen, alle Männer seien gleich, scheinen bei ihrem Erklärungsversuch der Frau darin übereinzustimmen, dass der Frau männliche Eigenschaften fehlen oder dass ihre Eigenschaften sich von denen des Mannes unterscheiden.
Adlers "maskuliner Protest" und Freuds "Kastrationskomplex" sind Hinweise auf jene maskuline Psychologie, die alle Unterschiede sexuell erklären will. Diese beiden versuchen, die Rebellion mit Begriffen der sexuellen Ungleichheit zu erklären. Freuds berühmter "Ödipus-Komplex", der den angeblichen Wunsch des Kindes bezeichnet, seinen Vater zu töten und mit seiner Mutter zu schlafen, symbolisiert die natürliche Rebellion des Jungen gegen die Beschränkungen von Brauch und Konvention. Jung, der keine ausgearbeitete Sexualpsychologie hat, legt den Unterschied ins kollektive Unbewusste und definiert ihn damit als von der Ahnenreihe bestimmt (im Englischen racial).
In unserem Versuch, die Diskussion über die Kontroversen der verschiedenen Psychologien hinaus zu einer Psychologie der Differenz zu führen, müssen wir sowohl das Individuum als auch Unterschiede im Sozialen und im Volkscharakter berücksichtigen und darüber hinaus die Frau und das Kind als zwei weitere wichtige Gruppe betrachten, die eine eigene Psychologie benötigen. Gegenwärtig führt die Definition dessen, was mit "männlich" bzw. "weiblich" gemeint ist, zwangsläufig zu einer hoffnungslosen Verwirrung, wie wir es in der Kulturanthropologie sehen, es sei denn, sie wird auf eine breitere Basis gestellt und nicht nur auf biologische Fakten, psychologische Interpretationen oder kulturelle Muster bestimmter Gesellschaften. Letztlich handelt es sich, wie bei allen Fragen der Differenz, um zwei unterschiedliche Weltanschauungen, zwei entgegengesetzte Lebenseinstellungen, die aus dem Überwiegen entweder rationaler oder irrationaler Tendenzen im Menschen hervorgehen.
EINE PSYCHOLOGIE DER DIFFERENZ
Nietzsche war der erste, der in einer Studie über Kultur den menschlichen Wert irrationaler Kräfte im verdrängten Selbst beschrieb. Das konnte Freud in seinem rationalistischen System nur als Ursache der Neurose sehen. Daher konnte die psychoanalytische Kur dem Individuum keinen kreativen Ausdruck dieser Energien bieten. Freuds therapeutische Methode zielt lediglich darauf ab, dem Individuum sein irrationales Selbst bewusst zu machen und es damit zu überzeugen, dass die Unterdrückung zurecht geschah und jetzt auch rational verurteilt werden müsste.
So entstand die berühmte Theorie des "Unbewussten, ein Begriff, der die vitalste Kraft des menschlichen Verhaltens als bloße Abwesenheit von Bewusstsein bezeichnet. Eine solch negative Konzeption als Grundlage des ganzen psychoanalytischen Systems zu setzen, verrät nicht nur Freuds rein rationalistischen Ansatz, sondern auch seine moralistische Philosophie.
Ursprünglich gedacht als das Gefäß für die "Schlechtigkeit" des Individuums, wurde das Unbewusste zu einer Art privater Hölle, die das böse Selbst beherbergt. Erst nachdem Jung den Inhalt des Unbewussten über das verdrängte Material des Individuums hinaus erweitert hatte, wurde es mit dem breiteren, aber ziemlich neutralen Begriff Id getauft – von Nietzsche und seiner intuitiven Philosophie des Selbstausdrucks geborgt: Id denkt in mir