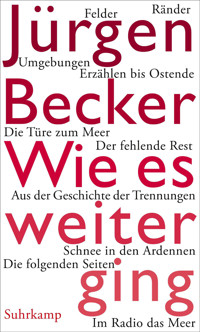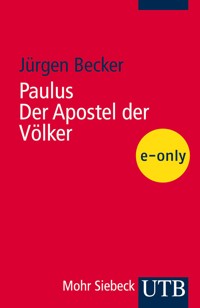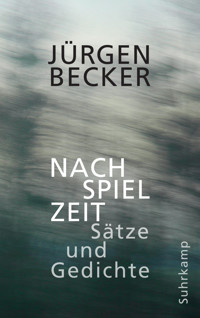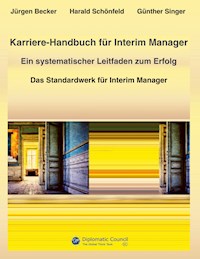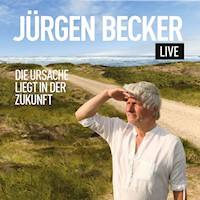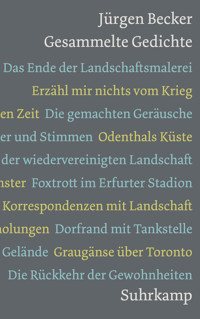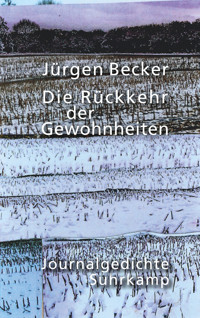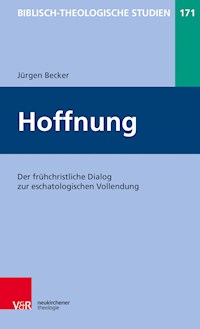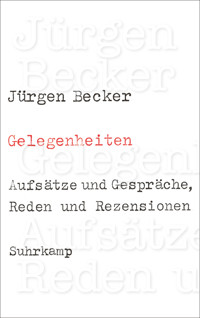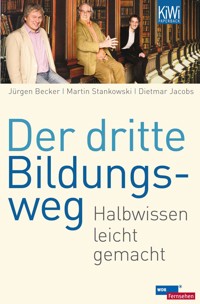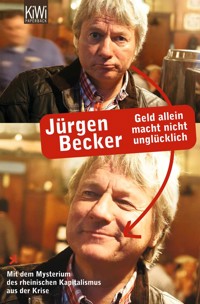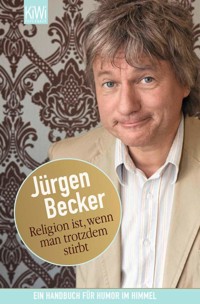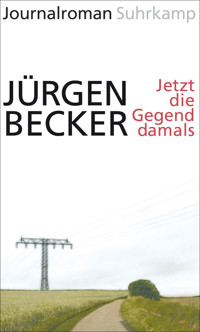
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das neue Werk des Büchner-Preisträgers »An mein Leben denkend und die Erinnerungen daran, fallen mir immer bloß Sätze ein, manchmal nur noch einzelne, manchmal ein paar mehr.«Jörn Winter sagt diesen Satz am Ende des Buches, in dem aus einzelnen Sätzen und ganzen Geschichten ein Journal der Augenblicke und Erinnerungen entsteht. Beides, die Erfahrung des Augenblicks und die Erinnerung ans Früher, stellt den Raum der Gleichzeitigkeit her, in dem sich Jörn fortwährend aufhält. Man kennt ihn aus früheren Büchern: Der fehlende Rest (1997), Aus der Geschichte der Trennungen (1999), Schnee in den Ardennen (2003), und manches Motiv daraus findet man hier wieder, als Spur, als Schatten, als Wiederholung, die im bereits Erzählten nach dem Nicht-Erzählten, nach dem Vergessenen, dem Verschwiegenen sucht. Jörn folgt dabei den Wahrnehmungen und Erlebnissen, den biographischen Wegen des Verfassers; sie gehen zurück in die dreißiger Jahre, in Kriegs- und Nachkriegszeit, in die fünfziger Jahre, in die Gegenwart, und Jörn spricht davon, als wäre es sein eigenes Leben. Der Verfasser beschäftigt ihn als Alter Ego, um die Distanz zum eigenen Lebenslauf zu wahren; als Korrespondenten, der von Orten und Personen, Landschaften und Gegenden die Geschichten erzählt, die vom Jetzt und vom Damals handeln. Dieses Buch setzt das Prosawerk Jürgen Beckers eindringlich fort; es erneuert die Art seiner offenen Schreibweise; es ist eine Chronik der angehaltenen und zugleich vergehenden Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
»An mein Leben denkend und die Erinnerungen daran, fallen mir immer bloß Sätze ein, manchmal nur noch einzelne, manchmal ein paar mehr.« Jörn Winter sagt diesen Satz, am Ende des Buches, in dem aus einzelnen Sätzen und ganzen Geschichten ein Journal der Augenblicke und Erinnerungen entsteht. Beides, die Erfahrung des Augenblicks und die Erinnerung ans Früher, stellt den Raum der Gleichzeitigkeit her, in dem sich Jörn fortwährend aufhält. Man kennt ihn aus früheren Büchern: Der fehlende Rest (1997), Aus der Geschichte der Trennungen (1999), Schnee in den Ardennen (2003), und manches Motiv daraus findet man hier wieder, als Spur, als Schatten, als Wiederholung, die im bereits Erzählten nach dem Nicht-Erzählten, nach dem Vergessenen, dem Verschwiegenen sucht. Jörn folgt dabei den Wahrnehmungen und Erlebnissen, den biographischen Wegen des Verfassers; sie gehen zurück in die dreißiger Jahre, in Kriegs- und Nachkriegszeit, in die fünfziger Jahre, in die Gegenwart, und Jörn spricht davon, als wäre es sein eigenes Leben. Der Verfasser beschäftigt ihn als Alter ego, um die Distanz zum eigenen Lebenslauf zu wahren; als Korrespondenten, der von Orten und Personen, Landschaften und Gegenden die Geschichten erzählt, die vom Jetzt und vom Damals handeln. Dieses Buch setzt das Prosawerk Jürgen Beckers eindringlich fort; es erneuert die Art seiner offenen Schreibweise; es ist eine Chronik der angehaltenen und zugleich vergehenden Zeit.
Jürgen Becker, geboren 1932 in Köln, lebt, nach zahlreichen Ortswechseln, in Köln und in Odenthal im Bergischen Land. Für sein Werk hat er zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. 2014 wurde ihm der Georg-Büchner-Preis zuerkannt. Jürgen Becker ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Zuletzt erschienen: Wie es weiterging. Ein Durchgang – Prosa aus fünf Jahrzehnten, 2012; Im Radio das Meer. Journalsätze, 2009; Dorfrand mit Tankstelle. Gedichte, 2007.
Jürgen Beckers Werk hat »die Gattungsgrenzen von Lyrik und Prosa immer wieder neu bestimmt und die deutschsprachige Dichtung nachfolgender Generationen bis heute maßgeblich geprägt«.
Jürgen BeckerJetzt die Gegend damals
Journalroman
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner, unter Verwendung einer Collage von Rango Bohne
eISBN 978-3-518-74179-5
Jetzt die Gegend damals
1
Die Zeit vergeht, und Jörn wird alt. Er sagt, daß er in diesen Jahren noch einen Roman schreibt, vielleicht auch zwei oder drei, und jeder Roman besteht aus einem einzigen Satz, vielleicht auch aus zweien oder dreien.
Jetzt sitzt er auf einem Stuhl einer Bank gegenüber, die leer ist. Steht er auf und wechselt auf die Bank, sitzt er einem Stuhl gegenüber, der leer ist.
Überm Kopf ein Rauschen, wie von Flügelschlägen eines Kranichschwarms, der sich von den Wiesen am Bodden erhoben hat.
Dann wieder unterwegs auf der Straße, die hinauf ins Hügelland führt, unterwegs durch Vororte, denen man noch ansieht, daß es früher Dörfer waren, um den Stadtrand sich herumziehende Siedlungen, zwischen denen flaches Land lag mit Wäldern, Feldstücken, Bachläufen, Mühlen, Gutshöfen, Herrensitzen, alle ein paar Hundert Jahre alt. Vertraute Gegenden, trotz fortwährender Veränderungen, trotz aller Vernichtung von etwas, das nur in der Erinnerung noch vorkommt. Es hat angefangen zu schneien, aber der Schnee bleibt nicht liegen.
2
Jörn Winter kennt man aus früheren Erzählungen. Er ist eine Person, die der Verfasser mit seinen eigenen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Gewohnheiten versehen hat. Dennoch ist er kein Spiegelbild. In den Vorstellungen des Verfassers hat Jörn eine eigenständige Identität. Was er denkt und sagt, was er tut und wie er sich verhält, dafür hat der Verfasser keine Muster parat. Er korrespondiert mit Jörn, und wenn es mitunter so aussieht, als äußere sich Jörn im Sinne des Verfassers, dann weiß er im voraus doch nicht, was sein Korrespondent alles so mitzuteilen hat. Natürlich gibt es ein Netz von Spuren, aus denen Jörn nicht herauskommt, die biographischen Spuren des Verfassers. Jörn weiß das und richtet sich danach, indem er sich an die Möglichkeiten hält, die seiner Existenz, einer imaginären Existenz, gegeben sind.
3
Sätze, die dir bekannt vorkommen. Gib acht. Es könnten Zitate sein, die eigenen. Wenn es Wiederholungen sind, sind es absichtliche Wiederholungen, in der Annahme, daß etwas nicht angekommen oder begriffen worden ist, daß es nicht gewirkt hat, daß es um den Rest des Ungesagten geht.
Der Schnee bleibt nicht liegen, aber es schneit weiter und weiter, und irgendwann bleibt er liegen.
4
Einen Film sehen, in dem man sich selber auf der Wiese am Rand des Wäldchens stehen sieht und hört, was man dem Mann hinter der Kamera sagt. Jörn weiß, wie der Film zustande gekommen ist, wie er darin mitgewirkt hat als Darsteller eines Verfassers, den der Film porträtiert. Als Rezensent würde Jörn über die Bilderfolge rein Professionelles sagen, und sie käme dabei gut weg. Als Beteiligter wundert sich Jörn, daß er in diese Rolle überhaupt hineingeraten ist. Er sagt, mir ist alle Öffentlichkeit so fremd geworden, daß ich darin gar nicht mehr auftreten möchte, und nun mache ich doch mit wie ein altes Zirkuspferd, das gleich angetänzelt kommt, sobald die Manege ruft. Daß er so oft im Widerspruch mit sich selbst lebt, ist für Jörn nicht neu, aber eine Konsequenz ist ihm bislang nicht eingefallen. Jörn sagt auch, daß er Leute, die stets und eindeutig auf Spur bleiben, ebenso bewundert, wie er ihnen mißtraut, wenn er sie nicht gar fürchtet.
5
Gestern abend hat ein Schulfreund angerufen. Er schlägt ein Wiedersehen vor, vielleicht mit ein paar anderen aus der Klasse. Aber nicht unten in der Stadt, wo sie alle hingezogen sind, sondern oben hinter den Hügeln, zwischen den Dörfern, wo die Schule war.
Ein paar Jahre nach dem Krieg, als ich in die Klasse kam, bald nach der Thüringer Zeit. Ein großer Haufen Bauernjungens, die in der Frühe alle noch im Stall gestanden hatten. Neue Klamotten gab es noch keine, und so saßen alle in ihren alten Jungvolkuniformen da, braune Hemden, schwarze Blousons, Überfallhosen; einer, der Älteste, hatte Reitstiefel an.
Abgebrochene Stuhlbeine, zerkratzte Tische, zerbrochene Spiegel, eingedrückte Schranktüren. Viele der Möbel hatten die Flucht über die Zonengrenze nicht gut überstanden. Lastwagen, Fuhrwerke, Güterwaggons. Zuletzt, beim Ausladen im Fabrikhof des Onkels, ging Mutters Barocktisch aus dem Leim.
Wochentags Rübenkraut, sonntags Apfelkraut.
Die Mädchen in der Klasse hatten Zöpfe. Einige drehten sie zu Schnecken oder flochten sie zu einem Haarkranz.
In der Schlafkammer zwei Betten und vier Kinder.
Spät, wenn wir uns was zu erzählen hatten, schüttete die Tante noch einmal eine Kanne Kaffee auf.
Einer aus der Verwandtschaft kam aus englischer Kriegsgefangenschaft heim. Seine Haut war gelb, er hatte im Afrikakorps gekämpft. Um das Abitur nachzumachen, ging er noch mal in unsere Schule mit. Als er später von der Brücke sprang, hieß es, komisch war er schon immer, der Fritz, und jetzt, eine Art von Wüstentrauma vielleicht.
6
Wenn hier einer ich sagt, sagt Jörn, dann bin ich es.
7
Die Rückenschmerzen. Im Sommer hatte es wieder angefangen. Kaltes Meer, harter Sand; es wurde schlimmer. Nach der Operation die Wochen in der Klinik, schön gelegen zwischen Bodden und Meer. Herbststürme, Spazierwege. Die Stellen am Strand, wo wir im Sommer gezeltet hatten, von der Brandung überrollt. Möwen, ohne die Flügel zu bewegen, lassen sich treiben vom Wind. Einzelne Kormorane flattern aufs Meer hinaus.
Berliner Flaksoldaten. Das wäre ein Zitat, oder eher eine Anspielung, die nicht aus dem eigenen Repertoire kommt. Wo Jörn sie hergenommen hat … er sagt, wer will, kann ja im Internet danach suchen. Das Entstehen, der Verlauf von Assoziationen folgt Signalen, die man so bewußt nicht wahrnimmt. Sicher ist, daß unterhalb des Hohen Ufers im Strandgeröll zwei Betonkolosse liegen, Reste von Geschützbunkern, die zu den Stellungen der Küstenbatterie gehörten; Ende der dreißiger Jahre sind sie auf dem Kliff angelegt worden. Jörn, als er mit Lene Anfang der neunziger Jahre zum ersten Mal aufs Fischland kam, entdeckte die von der Dünung umspülten Relikte bei seinen Erkundungen einer Gegend, die ihn Jahr für Jahr aufs neue anzieht und beschäftigt. Sicher ist auch, daß in den alten Fischerdörfern viele Berliner ein Zuhause haben, für immer, für die Ferien, fürs Wochenende. Jörn seufzt ein bißchen, wenn er sagt, lebten wir in Berlin, zum Wochenende kämen wir auch hierher. Wie alle die Freunde, die er in Käthe Miethes Haus besucht, mit denen er sich im Dünenhaus, im Baltischen Hof, bei Saatmann oder oben in der Buhne 12 trifft. Manchmal findet er in Lenes Collagen Motive aus der Gegend wieder, und einmal ist zu einem dieser Bilder ein Text entstanden mit Wörtern, die aus dem Tagebuch von Felix Hartlaub stammen, seit Kriegsende verschollen in Berlin, im September 39 in der Nähe hier bei der Flak.
Alte Leute danach fragen, ob sie aus der Kindheit noch die Häschenschule kennen. Nachdem in einer Berliner Bombennacht Wohnung und Atelier ausgebrannt waren, siedelte Fritz Koch-Gotha, der Urheber unserer Kinderfibel, endgültig über in seine Büdnerei an der Fulge. Dora Koch-Stetter, seine Frau, malte Bilder, die nicht nur besser waren … im Grunde, sagt Jörn, überragen sie alles, was die ganze Ahrenshooper Künstlerkolonie an Bilderwerk hervorgebracht hat. Aber unter den Malweibern war sie ja eine Verheiratete, und so kam sie wegen Haus und Hof, Kind und Mann nur wenig zum Malen. Jörn spaziert alle paar Tage an der Fulge vorbei und bringt einen Packen Zeitungen mit. Der Enkelsohn und seine Frau haben sich einen Namen als Keramiker gemacht, und die junge Frau Klünder ist immer ganz glücklich, wenn Jörn die überregionale Presse in der Werkstatt ablädt. Zum Einwickeln taugen die großen Formate besonders gut, und so kommt es, daß sich in seiner Ferienbleibe die Zeitungsknäuel wieder häufen, wenn Jörn mitgenommen hat, was er an Bechern, Schalen, Tellern und Teetassen eingekauft und Frau Klünder eingewickelt hat.
Jörn versucht sich zu erinnern. Aber es gibt für ihn keine Erinnerung an Jahre und Tage, als Gesine Cresspahl, ein paar Häuser weiter, in den Ferien hier war.
Wir waren ja als Flüchtlinge gekommen, sagte die alte Dame, aber das durften wir nicht laut sagen, weil es immer hieß, daß wir als Umgesiedelte gekommen waren.
Abends flattern die Kormorane, einzeln oder zu zweit, landeinwärts zurück.
Der Architekt, der die kleine Holzkirche entworfen hat, lebt wieder im Ort, nicht sehr lange, dann wird Hardt-Waltherr Hämer auf dem Friedhof, der gleich hinter seiner Kirche ansteigt, begraben.
Die Reichweite der Geschütze ging landeinwärts über den Saaler Bodden hinaus bis zur Meiningenbrücke, und nach einem Schwenk bis zur Chaussee zwischen Ribnitz und Stralsund.
8
Suchst du Lene im Haus, findest du sie im Garten. Sie kniet zwischen den Beeten, oft verzweifelt, der Wühlmäuse und Schnecken wegen. Zweimal, dreimal hat sie Bohnen gelegt, Salatpflänzchen gesetzt. Jörn schlägt Maßnahmen vor, die Lene längst kennt, nutzlose Maßnahmen. Lene macht weiter. Würde sie aufgeben, für die Menschen gäbe es keinen Salat, keine Bohnen mehr.
Vor der Schule die Hühner gefüttert, die Schafe gemolken. Im Winter das Eis in der Waschschüssel aufgebrochen. Zur Schule durch den Steiner Siefen, den engen Schluchtweg durch den Wald hinab ins Tal, ins Dorf. Im Sommer, wenn die Mutter mit dem Fahrrad nicht selber unterwegs war, das Fahrrad. Nach der Schule mit der Sense auf die Wiese, mit der Hacke in die Kartoffeln. Ein Mädchen mit hellen Zöpfen.
Lene am Tisch, der unterm Fenster steht. Die Daten für die Fotos für die Hauschronik. Lene schreibt auf, was nicht nur im Haus passiert, und was sie nicht aufschreibt, erzählen die Bilder. Draußen, vor dem Fenster der alte Kirschbaum; es ist Jahrzehnte her, daß er angefangen hat, sich zur Seite zu neigen und, abgestützt von kräftigen Ästen, fast in der Horizontale liegend, mit Wachsen aufzuhören. Inzwischen ist er abgestorben; im kahlen Geäst wuchert Efeu hoch; Moos hat dick den Stamm überwachsen, der kaum mehr sichtbar ist im zweimal mannshohen Dornengestrüpp der Heckenrosen. Vorn am Rand der kleinen Wildnis steht auch das Futterhaus, und das ist der Grund, warum das Gesträuch alle die Vögel anzieht. Sicher vor der Katze, vor dem Wanderfalken, sitzen sie im Geäst, nur einen Hüpfer entfernt von ihrem Futterplatz. Brutvögel, Durchzügler, Wintergäste, Lene kennt sich in dem Vogelvölkchen aus, das sich da vor dem Fenster versammelt, mitunter in Turbulenzen verwickelt, wenn die großen Rabenvögel dazwischenkommen, Elstern, Krähen, oder wenn das Eichhörnchen so tut, als gehöre ihm das Futterhaus allein. Lene erzählt, wie damals im April, am Ende der Kämpfe, amerikanische Soldaten unter dem Kirschbaum lagen, um ein Funkgerät herum, aus dem Funkgeräusche kamen, die sich mit dem Flöten der Amsel vermischten.
Kinder, Leiterwagen, Kinderschwester. Im Hintergrund ein Wäschestück auf der Leine. Der Junge, auf dem nächsten Foto, hat jetzt die Flakhelferuniform an.
Jörn war damals mit dem Fahrrad in die Gegend gekommen; zuletzt, die Serpentinen hoch, mußte er es schieben. Lene hatte die Lage des Gehöfts so genau nicht beschrieben, und er mußte eine Weile suchen, bis er das abgelegene Fachwerkhaus fand.
Von den beiden Frauen, die vor der Scheune in der Sonne saßen, gehörte die eine, ausgebombt in der Stadt, zum Haus.
Seit ein paar Tagen ging die Geschichte, die jetzt seit fünfzig Jahren geht.
Jörn nahm Lene die Sense aus der Hand, aber richtig mähen konnte er nicht.
Dienstag. Noch im Dunkel kommt die Müllabfuhr. Kurz danach rollen die ersten Frühaufsteher die leeren Tonnen zu ihren Häusern zurück. Es hört sich holprig, leicht und hohl an. Abends zuvor haben wir die vollen Tonnen übers Weggeröll zum Stellplatz gezogen, keuchend, schwere Tonnen, dumpfes Rollen.
9
Die eine Frau wendet sich ab, als Jörn die andere Frau zuerst begrüßt. Beide hat er lange nicht gesehen; er sieht sie überraschend und gleichzeitig wieder an einer Kreuzung; die eine ist von rechts, die andere von links gekommen. Wenn beide ein und dieselbe Frau sind, kann es nur eine Begegnung sein, wie sie im Traum zustande kommt.
Vielleicht wollte er einschlafen, vielleicht wollte er auch nur eine Weile nichts sehen, jedenfalls hatte er die Augen zugemacht.
Soso, das habe ich also gesagt. Aha, so schrundig sieht mein Gesicht aus. Richtig, ich habe ein weißes Hemd an. Nanu, ich rauche doch nicht mehr, und ich sehe mich eine Zigarette rauchen.
Finde heraus, was du nicht kannst. In deinen Mängeln liegen deine Möglichkeiten. Steige im Haus die Treppe hinauf, oben fühlst du dich anders als unten. Komm zurück, wenn du oben den Schraubenzieher suchst, obschon du weißt, daß er oben nicht liegt. Drehe den Lichtschalter, der so alt ist, wie du bist; staune, daß es in der Küche gleich hell wird.
10
Der Strunder Bach. Die Strundener Straße.
Die Mutter schob den Kinderwagen hin und her zwischen Gipsmühle und Sägemühle. Die Großeltern im Haus, sie fuhren niemals in die Ferien; einmal Thüringen, dann Coburg, aber das war schon die Evakuierung.
Immer der Garten, die Einmachzeit, vierzig Obstbäume und vier Kinder, zwei Töchter, zwei Söhne. Dem einen sah ich beim Schlittschuhlaufen zu auf den vereisten Uferwiesen; der andere saß unterm Dach und malte, was die Gegend hergab an Motiven zwischen Gierath, Refrath und den Mielenforster Wiesen.
Lange der Heimweg. Das Haus sieht unverändert aus. Es kann nichts sagen. Es kann nicht sagen, wie wir lebten, wie es anfing und zuging, bis keiner mehr da war.
11
Es gibt Zeiten, Orte, Vorgänge, von denen nichts anderes existiert als die Gedächtnisbilder, in denen sie aufgegangen sind. Und zwar so vollkommen, daß die Erinnerung nur das noch findet, was in den Bildern erscheint. Und das stimmt eben nicht, sagt Jörn, denn alles Vergangene hat mehr zu bieten, als was mein Gedächtnis festgehalten hat. Es geht darum, daß die Erinnerung sich in Unbekanntes aufmacht; daß sie über die Grenzen ihrer Reichweite hinauskommt; daß sie vergißt, was sie alles schon kennt.
Der Schulweg, einige Jahre lang, ging an Häusern vorbei, von denen ich nicht sagen kann, wie sie ausgesehen haben.
Spätabends das letzte, frühmorgens das erste Quietschen der Straßenbahn.
Mädchen, Frauen in Uniform. Die Uniform der Schaffnerin.
Bis vorige Woche noch gewußt, was das Thema des Abituraufsatzes war.
Filme, die man zum fünften Mal, sechsten Mal sieht, und jedesmal eine Szene, die man wie zum ersten Mal sieht.
Ein offener Lastwagen, auf dem dicht gedrängt Männer stehen, einige Frauen darunter, von allen nur die Rücken zu sehen, Wintermäntel.
Jörn kann nicht sagen, seit wann genau er weiß, wie sein Vorname und sein Nachname lauten, wie die Straße heißt, in der er wohnt, die Stadt, das Land. Wann das Kind zum ersten Mal ich gesagt und dabei gewußt hat, wer das ist.
12
Die Krähen oben im kahlen Geäst, sie haben die Köpfe zum Haus hin gerichtet; es sieht aus, als beobachteten sie das Haus, die Tür zum Hof und zum Garten, als warteten sie darauf, daß ein zweibeiniges Lebewesen heraustritt mit einem blauen Blechteller, auf dem eine tote Maus liegt, ein paar Suppenknochen, Wurstpellen, der Inhalt einer Fischdose jenseits ihres Haltbarkeitsdatums. Alle paar Tage kommt das auch vor, und kaum liegt der Teller, immer an derselben Stelle, am Wiesenrand, stürzt die erste Krähe auch schon herab. Oder, wenn sie nicht oben im Wipfel gesessen hat, kommt sie von irgendwoher angekreist; irgendwo, auf einem Zaunpfahl, einem Scheunendach, in einer entfernten Baumgruppe sitzt immer so ein schwarzer Vogel, der, sieht man ihn nicht, offenbar selber doch alles mitbekommt, was im Gelände vor sich geht. Ist es Instinkt, der die Krähe spüren läßt, wo etwas zu holen ist … vielleicht wissen es die Ornithologen. Sicher scheinen die Krähen ein Gedächtnis zu haben. Denn warum bleiben sie immer in der Nähe des Hauses, sitzen und warten sie ewig in den Bäumen … harr, harr, sie rufen ja auch, wenn sie sehen, daß wir nach Zeiten der Abwesenheit wieder vorm Haus stehen und die Tür aufschließen.
13
Heller, zeitweise sonniger Nachmittag, aber der Mond steht schon am Himmel, und eine dunkle Wolkenfront zieht heran, die Schnee mitbringt, aber es schneit nicht, es tänzeln nur einzelne Flocken herab, die der Wind hin und her treibt, bis es dunkel wird und der Mond hinter der dichten Wolkendecke verschwindet, und nun schneit es richtig, am nächsten Morgen wird man sehen, ob der Schnee liegengeblieben ist.
Gestützt auf die beiden Skistöcke, versuchte Gisela hochzukommen, aber die Füße hatten sich mit den Skiern zwischen den Latten des Zauns, in den sie auf dem abschüssigen Weg hineingerast war, verklemmt, und sie kam nicht hoch. Als Jörn das Mädchen aus dem Nachbarhaus wiedersah, nachmittags an einem sonnigen Frühlingstag, lehnte sie, auf zwei Krücken gestützt, am Vorgartenzaun; er sah, daß ihr der linke Fuß fehlte.
Hartgefrorene Straßen, und außer der kleinen Lastwagenkolonne, die mit ihrer Koksladung aufs Kasernentor zurollte und im nachts gefallenen Neuschnee ihre Spuren hinterließ, waren keine Fahrzeuge unterwegs. Vor der Haustür schnallte sich Jörn seine Schlittschuhe an und machte sich auf den Weg zur Schule. Lautlos gleitend folgte er der Lastwagenspur; an Stellen, wo das Eis aufglitzerte, hörte er das Klirren der Kufen.
Jörn konnte seine Skier behalten, sie waren nur einen Meter siebzig lang, der Wehrmacht halfen keine Kindergrößen, und auch der Vater war dem Aufruf nicht gefolgt, seine Skier beim Winterhilfswerk abzugeben; er hatte den Leuten weisgemacht, daß er bei seinen kriegswichtigen Fahrten in den Thüringer Wald ein Paar Skier brauchte.
Es ist noch dunkel, als er aufwacht und das Scharren der ersten Schneeschaufel hört.
März in der Eifel. Der Besitzer des kleinen Hotels zeigt in die Gärten, wo nach den Granaten der Amerikaner kein Baum mehr stand. Nur der Schneemann stand noch da, und er hatte auch noch seine Nase, die leuchtend rote Möhrennase.
Angst vor Schneebällen. Einmal am Kopf getroffen, der auch gleich blutete; im Schneeball hatte ein Stein gesteckt.
Einmal, in Wiepersdorf, erzählte Herr Demuth, wie die russischen Offiziere den ganzen Abend in seinem Dorfkrug saßen und zechten. Als er mitbekam, daß draußen im Wagen der Chauffeur saß, wollte er ihn hereinholen in die warme Gaststube, aber nix da, Chauffeur ist Chauffeur, hat draußen zu bleiben. Draußen minus zwanzig Grad. Die Bockwurst wollten sie mich auch nicht rausbringen lassen, da bin ich durch die Hintertür hinaus, und so glücklich, sagte Herr Demuth, hab ick lange niemand ne Bockwurst essen jesehn.
Wir konnten nicht weiterfahren, aber wir mußten weiterfahren, sonst wären wir endgültig steckengeblieben.
14
Tagebuch, er führe doch sicher regelmäßig Tagebuch, wird Jörn schon mal gefragt. Er verneint dann heftig, vielleicht ein bißchen zu heftig; gelegentlich notiert er ja etwas in ein kleines schwarzes Heft, in letzter Zeit sogar öfters, seit er gemerkt hat, wie rasch er das in den vergangenen Tagen Erlebte, das Gehörte und Gesehene, all das durch den Kopf Gegangene, wieder vergißt. Aber nichts wirklich Formuliertes, schon gar nichts für die Nachwelt. Jörn sagt, es ist mir immer peinlich, wenn ich spüre, wie einer sein Tagebuch auf die postume Veröffentlichung hin geschrieben hat. Als wolle er beweisen, daß er von früh bis spät, auch außerhalb seiner literarischen Produktion, jederzeit ein Schriftsteller auf der Höhe seiner künstlerischen Fähigkeiten gewesen sei. Nein, er habe dafür gesorgt, daß nichts von seinen Notizen jemals unter die Leute komme. Und mit Briefen, wie steht es damit? Es sollte genügen, sagt Jörn, wenn der Briefpartner allein erfährt, was ich ihm sagen will. Darüber hinaus geht das keinen etwas an. Nur, das gebe ich zu, kann so ein Brief im nachhinein auch für andere Leute ganz lesenswert sein … vielleicht wird da etwas richtiggestellt, kommt ein Schwindel, eine Wahrheit heraus. Briefe sind ja nicht ganz so privat wie das Selbstgespräch im Tagebuch; mit dem Adressaten fängt ja schon etwas wie Öffentlichkeit an. Trotzdem, es kommt mir wie ein Selbstverrat vor, wenn ich jemandem das öffentliche Aushängen eines Briefes erlauben soll. Dafür habe ich ihn weiß Gott nicht geschrieben. Und darum führe ich auch nicht, was man eine Korrespondenz nennt, womöglich wieder mit Blick auf den Nachlaß. Und so gern ich mitunter einen Brief bekomme, wer mich kennt, weiß, wie selten ich darauf antworte.