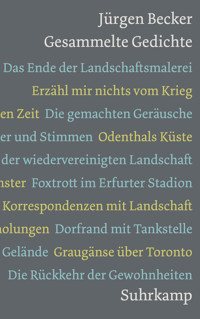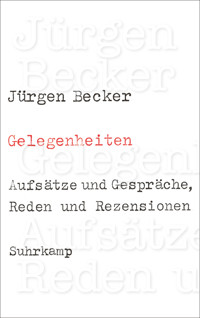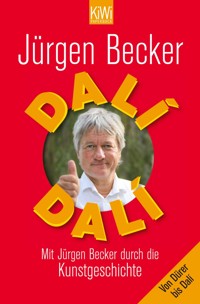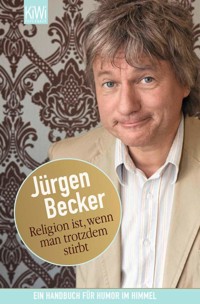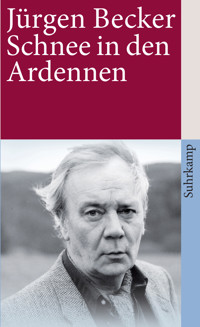
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Dachkammer in einem abgelegenen Gehöft ist der Raum von Imaginationen und Erinnerungen. Hier beginnt der Erzähler sein »Journal«, und was er aufzeichnet, sind Vorgänge in nächster Umgebung und in ferner Vergangenheit, im Traum und in der Wirklichkeit. Jürgen Beckers Beobachtungen streifen die Hügellandschaft seiner rheinischen Heimat, wandern nach Berlin und in den deutschen Osten, richten sich auf Bilder der ersten Jahre nach dem Krieg, erinnern sich an einen Karmann Ghia und an lange Fernsehabende, daran, wie man vor dem Radio saß, um Welt zu empfangen, an Möbel und Bilder. Indem sich der Autor seiner Wahrnehmungen vergewissert, geht er ihren Spuren nach, reflektiert sie, variiert ihre Motive, schreibt sie – und damit sein wie das Leben anderer – fort.
In Schnee in den Ardennen vermischt Jürgen Becker die Formen von Tagebuch, Reiseerzählung und Roman. Täuschende Wahrnehmungen, ironische Berichte, lakonische Mitteilungen, poetische Notate – im Wechsel der Schreibweisen hält er seinen Lesern einen Spiegel vor, in dem jeder sich selbst, seine Erfahrungen und Geschichten erkennen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jürgen Becker
Schnee in den Ardennen
Journalroman
Suhrkamp
I
Winterkämpfe. Es ist das Foto von Robert Capa, das ich, ohne danach gesucht zu haben, beim Blättern plötzlich wiederfinde. Winter 1944. Zwischen dem Fichtengehölz auf dem Hügelkamm und den Weidezäunen in der Talsenke bewegen sich über das abschüssige Feld Dutzende kleiner, dunkler Gestalten. Sie halten in den Armen herabgesenkte Waffen und werfen, die tiefstehende Sonne im Rücken, Schatten, die um ein Dreifaches länger als die uniformierten Körper sind. Der Trupp geht locker in offenen Reihen vor; die großen Abstände, die sie untereinander halten, lassen die Mannschaften der 101. US-Luftlandedivision wie Einzelgänger, wie Verstreute erscheinen. Sie sehen nicht aus wie von der 15. Panzergrenadierdivision Umzingelte. Ob sie alle überleben oder nicht, mitbeteiligt ist der Trupp daran, daß die letzte deutsche Winteroffensive im Westen scheitert.
Zurückgekommen ist der Schnee, jetzt in den letzten Tagen des Januar. Der Frost hält ihn auf den Dächern und für eine Weile sogar auf den Straßen fest. Die frühlingshafte Luft im Dezember hatte die Schneeglöckchen, ganze Gruppen auf der Wiese, vorlaut gemacht; sie meinten, ihre kurze Zeit als Avantgarde finge schon zu Weihnachten an. Die Kälte läßt die Halme dünn und spitz zusammenfrieren, und mit der Ausbreitung des Schnees wird klar, wer hier noch dominiert. Mehrmals am Tag wiederholen sich die Turbulenzen im Futterhäuschen unterm Kirschbaum. Ein Pulk Stare drängelt sich lärmend auf die Futterrampe und erdrückt fast das angstvoll fiepende Rotkehlchen. Unfreundlich hüpfen Elstern und Krähen aufeinander los und verjagen sich gegenseitig hoch in die Kirsche, hinüber ins Geäst des Birnbaums. Die schwarzweißen und die schwarzen Vögel haben unterschiedliche Strategien. Krächzend und geckernd warten sie zunächst einmal ab, dann verstummen sie und scheinen einander nicht mehr zu beachten. Die Elstern sitzen dem Vogelhäuschen näher; sobald die ersten herunterflattern und ins Innere einzudringen versuchen, schießt eine Krähe heran und vertreibt sie. Die Elstern fliehen vor jeder direkten Konfrontation. Beginnt eine Krähe, und die Krähen fangen damit immer einzeln an, den Besetzungsversuch – wobei die Dimension des Vogelhäuschens der Körpergröße beider Vogelarten überhaupt nicht entgegenkommt; trotzdem, sie schaffen es immer wieder –‚ entschwirrt der ganze Elsternschwarm in eine Baumgruppe, deren dichtes Gezweig die Vögel mit den messerlangen Schwanzfedern unsichtbar macht. Die Krähen haben das Vogelhäuschen für sich allein. Nicht lange. Zwei Eichelhäher haben ihr Versteck unter der Fichte verlassen und äugen mit schiefem Kopf vom Kirschbaum auf den Futterplatz herab. Dann lassen sie sich mit aufgespreizten Flügeln fallen, mitten unter die Krähen, die zwischen den Standhölzern des Häuschens nach heruntergefallenen Körnern picken. Kurzes, heftiges Durcheinander, bis plötzlich, wie auf Kommando, die Streitenden auseinanderstieben und einzeln sich auf fernen Wipfeln niederlassen. Und schon, als hätten sie auf den Moment der Räumung gewartet, sind die Elstern wieder da, und jetzt lassen sie sich auch nicht vom Buntspecht beirren, der die ganze Zeit, unbeteiligt, am Meisenknödel hängt und rasch und konzentriert seinen Schnabel ins harte Fett der Kugel schlägt.
Hausgeschichte. Die beiden Kammern über dem ehemaligen Stall sind früher der Heuboden gewesen. So lange das her ist, die Räume haben ein Gedächtnis bewahrt, das sich dem Bewohner öffnet, wenn er mit ganzer Intensität seinen Sinnen, seinen Einbildungen vertraut. Gerüche und Geräusche werden wahrnehmbar, die das frühere Landleben vergegenwärtigen … Der Schwung der Heugabel hoch zur Giebeltür, das Geschepper morgens der Milchkannen, das Aufklatschen der Kuhfladen. Die näherkommende Industrie holte die Männer vom Hof weg; der Luftkrieg brachte Evakuierte ins Haus. Ledermäntel fahndeten nach Verstecken. Die beiden Mädchen, die in der dunklen Winterfrühe von ihren Bettgestellen herunterkletterten, zerbrachen als erstes das Eis in der Waschschüssel. Unterwegs war kilometerweit die Mutter; sie hatte den Vater in seinem stillgehaltenen Refugium zu versorgen. Meine Herkunft, meine Anwesenheit berührt nicht länger nur den Rand der Geschichte. Nachts, in der kalten Schlafkammer, höre ich den Marder, wie er zwischen den Dachbalken herankriecht.
Angaben über Schneehöhen. Sie werden vom Deutschen Wetterdienst veröffentlicht und betreffen Gebiete, in denen Skilaufen Sport oder Ferienvergnügen ist. Als ich einmal das Wort Schneehemden benutzte, fragte mich eine Dreißigjährige, was das für Hemden seien. Nein, selber hatte ich keins getragen. Ich kannte nur die Berichte aus dem finnisch-russischen Winterkrieg 1939. Obschon truppenmäßig weit unterlegen, errangen die Finnen zeitweilig ihre Überlegenheit, indem sie ihre Soldaten auf Skier stellten und mit schneeweißen, über die Uniformen gestreiften Hemden tarnten. Wie Gespenster flitzten sie durch die Wälder, während der russische Koloß, mit seiner feldfarbenen Schwerfälligkeit, in den Schneemassen nicht vorankam. Der Film, in dem deutsche Einheiten in ihren Schneeanzügen durch die endlosen russischen Ebenen ziehen, zeigt eher einen Leichenzug. Vom Harz dehnt sich über Thüringer Wald, Erzgebirge, Bayerischer Wald bis ins Allgäu und Berchtesgadener Land eine im Flachland unterbrochene Schneedecke, die heute in einer Höhe zwischen dreißig und hundertzwanzig Zentimetern liegt. Talfahrten sind streckenweise möglich auf Kunstschnee.
Nachmittags um drei. Die Glocken, die bis zu unseren Höhen hinauf zu hören sind, läuten für eine Beerdigung. Wer da gestorben ist, keine Ahnung. Die Einwohnerzahl des Ortes nimmt in dem Maße zu, wie in der Gemeinde ein Siedlungsgebiet nach dem anderen entsteht. Im Einkaufsmarkt fragt man sich, ob man den Einkaufswagen überhaupt durch den heimischen Einkaufsmarkt schiebt, so vielen unbekannten Gesichtern begegnet man alle Tage. Das märkische Zweihundert-Seelen-Dorf, das ich im Sommer besuche, hält seine Einwohnerzahl konstant. Oder sie nimmt eher ab. Wenn jemand gestorben ist und beerdigt wird, läuten die Glocken dort den ganzen Tag stündlich.
Die Hoflampe, die in der Nacht von allein aufleuchtet, reagiert auf den Bewegungsmelder. Ich lehne mich weit aus dem offenen Fenster. Der Hof liegt im Hellen, aber ich sehe nichts, was das kleine, unauffällig angebrachte Instrument zu seiner Meldung veranlaßt hat. Es kann ein Tier gewesen sein, das an der Scheune, am Haus vorbeigehuscht ist, eine Katze, der Marder, ein Reh. In windigen Nächten, wenn das Licht mehrmals nacheinander angeht, sind es Zweige, die, hin- und hergeweht, in die Wahrnehmungszone geraten sind. Aber es geht kein Wind. Kein Tier sichert aus dem Schatten hervor. Der Bewegungsmelder ist eine Installation des Mißtrauens, und lange stehe ich hinausgelehnt im Fenster.
Radiogeschichte. Jetzt sind es vier Jahrzehnte her, daß ich die beiden Kammern bezog, die früher der Heuboden waren. Manchmal drehte ich abends am Radio, ein kleiner cremefarbener Philips, eines der ersten Nachkriegsgeräte. Einmal blieb ich im Bereich der Langwelle, wo sonst keine Sender zu empfangen waren, an einer weiblichen Stimme hängen, die Zahlen aufsagte, in unregelmäßiger Reihenfolge, vorwärts und rückwärts, zwischen eins und zehn. Es war eine merkwürdig tonlose Stimme, die mechanisch, fast maschinenhaft in einem gleichbleibenden Rhythmus sprach. Auffallend war, daß sie die Zahl fünf mit einem eingefügten e artikulierte: fünnef. Irgendwann brach die Stimme ab, und man hörte nur noch das kaum merkliche Rauschen des Nichts, das am Ende der Skala beginnt. Mehrere Abende lang, in der Stunde vor Mitternacht, wartete ich auf die geheimnishafte Stimme, die sich nicht regelmäßig meldete; dann wohnte ich wieder woanders und dachte nicht mehr daran.
Fernsehabende, wie man sie zerstreut und die Programme wechselnd verbringt. Vor kurzem blieb ich in einem Spielfilm hängen, in einer Szene, die eine junge Frau in einer Küche sitzend zeigte, gebeugt über ein in der Backhaube verborgenes Sendegerät, für das sie Zahlen vorlas, genau in der Art, wie ich sie von der Radiostimme damals kannte. Und ein paar Szenen weiter war es ein jüngerer Mann, der in der Küche vor dem verborgenen Gerät saß und einer weiblichen Stimme lauschte, die Zahlen aufsagte, in unregelmäßiger Reihenfolge, vorwärts und rückwärts, zwischen eins und zehn, merkwürdig tonlos, mechanisch, fast maschinenhaft, und nicht lange mußte ich warten, dann kam auch die fünnef vor. Der Mann, während er lauschte, schrieb die Zahlen auf einem Zettel mit, dann grübelte er einen Moment, wobei er die Zahlen, den Zahlencode, in etwas zu übersetzen schien, was eine Information war, eine Anweisung für sein weiteres Vorgehen, Handeln und Tun. Es gilt inzwischen als verjährt, im Unterschied zum Verhalten der jungen Frau, die aus Liebe zu dem Mann, einem Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, eine Spionin geworden und dafür vor Gericht gekommen war.
Das Holz, der Himmel. Kaminholz soll mindestens ein Jahr lang trocken gelegen haben. Eines der beiden Mädchen von damals wohnt mit im Haus. Komm, erzähle doch. Die Geschichten sind abgewandert, aber so weit entfernt liegen die fernen Städte nicht. Ihr Widerschein, vor allem in den Schneenächten jetzt, färbt rot den Himmel im Westen. In den Kinderjahren war der Himmel immer ganz schwarz. Jede Nacht? Nein, wenn es in den Städten brannte, machte der Widerschein der Brände den Himmel rot, im Westen den Himmel. Das Holz, das im Kamin nicht hell auflodern will, habe ich im Dezember geschlagen und vor dem Schneefall hereingeholt. Reste von Eis und Schnee bedeckten die Scheite, die ich, ein Holzfrevler als kleiner Junge, aus den Wäldern heranschleppte; die Kälte in den Räumen ließ keine Zeit zum Warten, bis das Holz, vorschriftsmäßig, trocken war.
Dorische Toccata. Dann, als das Kaminfeuer brennt, verlasse ich den Raum. Dabei fällt mir ein, daß ich eine CD aufgelegt habe mit Orgelstücken aus dem nahen Altenberger Dom. Draußen meine ich zu hören, wie sich das erste der Stücke seinem Ende nähert. Danach wird die CD noch fast eine Stunde lang laufen. Aber ich gehe nicht hin, um das Gerät abzustellen. Ich beschäftige mich im Haus, und der leere Raum ist jetzt allein für das Spiel der Orgel da.
Am Fenster stehend. Im Elternhaus verkehrte auch ein Malerfreund, der wenig malte, aber viel von Kunstgeschichte wußte. Er sagte, die meisten Bilder sind schon alle gemalt, und es passiert selten, daß ich auf eines komme, das noch nicht gemalt ist. Er sagte, ich verstehe mich als Maler, der überflüssiges Malen verhindert. Und wenn er zum Fenster ging und eine Weile in den Garten schaute, sagte er, dies für heute ist mein Gartenbild, und mein Gedächtnis ist die Galerie, in der es hängen wird.
Die Scheune. Ich habe Zeit, ich kann warten. So ähnlich scheint Hannchen, unsere Katze, zu denken, die in der Scheunenecke vor dem Mauseloch sitzt. Sie sieht nicht aus, als befinde sie sich in einer Situation, in der es auf Konzentration, auf angespannte Wachsamkeit ankommt. Sie lauert nicht, sie sitzt einfach da. Das Scheunentor steht offen; man kann hinaus in den Hof schauen und den Elstern zusehen, die sich im Schnee um ein paar Käserinden balgen, die eben aus dem Küchenfenster geflogen sind. Im Inneren der Scheune ist es still und trocken, und in den Schwalbennestern, die an der Wand unter den Deckenbalken kleben, tut sich jetzt im Winter nichts. Die Katze leckt sich die Pfote und fährt mit der Pfote ein paar Mal über den Kopf; sie gähnt, sie schaut nach oben und dann nach draußen; lange Zeit sinniert sie vor sich hin. Aber dann liegt sie plötzlich flach und starrt in die Öffnung des Mauselochs; langsam spannt sich der Körper hoch, vibrierend zieht er sich zusammen für den Sprung, der aber doch ausbleibt, denn offensichtlich ist es noch nicht so weit … Gleich tut die Katze wieder gelangweilt; der Schwanz kommt zur Ruhe, und obschon sie blinzelnd die Augen, die auf das scheinbar leere Loch gerichteten, schließt, sie weiß, nicht lange, und der Moment ist da.
Ortsgeschichte. Die Stadt ist heute schon dort, wo man sie gar nicht vermutet. So sagt es der Städteplaner. Zwischen Maisfeldern, Weideland und bewaldeten Hügeln, auf beiden Seiten der Dorfstraße, folgen dicht aufeinander Tankstelle, Zweirad-Händler, China-Restaurant, Sonnenstudio, Fahrschule, Einkaufsmarkt, Försterei, Postgebäude, Kirche, Bürgerhaus, französisches Restaurant, Gemeindeverwaltung. Die Angestellten der Gemeindeverwaltung, die sich auf mehrere Dorfgebäude verteilt, mit ihren Mappen unterm Arm stehen oder gehen sie, je nach Ampelphase, im Regulierungssystem der Straßenkreuzung, für die jetzt eine Round-about-Lösung in der Planung ist. Nach dem Stauzentrum in der Ortsmitte reihen sich beidseitig Landhaus-Moden, Blumenladen, Frisiersalon, Hotel, Bistro, Gourmet-Restaurant, Altenpflege, Eissalon, Pizzeria, Hair-Studio, Brotkörbchen, Imbiß, Getränkemarkt, Kindermoden, Versicherungsagentur, Apotheke, Kreissparkasse, Arztpraxen, Drogeriemarkt, Postfiliale samt Geschäft für Schreibwaren, Zeitschriften, Spielzeug und Annahmestelle für Kleiderreinigung, Fotoarbeiten, Lotto und Toto. Nach einer unbebauten Obstwiese folgen Raiffeisenbank, Kunstschmiede, Tankstelle. Der Städteplaner sieht sein Stadtkonzept als universelles Phänomen, für das, konkretisiert in unserer Dorfstraße, ein paar hundert Dorfbewohner fünf Minuten Fußweg brauchen. Das ist so bequem, daß die Dorfbewohner es vorziehen, viele ihrer Besorgungen im Dorf zu machen und auf lange Fahrten in die umliegenden Städte zu verzichten. Insofern entspricht unser Dorfleben dem marktbeherrschten System, das der Städteplaner in seinen Städten funktionieren sieht. Insofern gingen die Leute vom Dorf der Stadt aber verloren, wäre nicht längst die Stadt ins Land hinein unterwegs. Der Städteplaner sieht und sagt das so. Er rechnet mit der Faszination, die vom Magnetismus der Metropolen ausgeht. Den aber haben wir doch auch, sagt der Gemeindevertreter, indem er auf die Anziehungskraft unserer Dorfstraße verweist. Das in Spitzenzeiten dort herrschende Verkehrschaos spiegelt en miniature das Chaos der Ballungsgebiete in Lagos, der nigerianischen Hauptstadt, wider, ein Chaos übrigens, das auf wundersame Weise funktionieren soll. Der Städteplaner sieht darin ein Beispiel für seine Idee von Ville contemporaine. Ist er ein verkappter Anarchist? Die Stadt als schützenswerte Monade hält er für einen städtebaulichen Irrtum. Ihn zu beseitigen, folgt er Konzepten, die hinauslaufen auf völliges Auslöschen von Geschichte, auf das Entstehen artifizieller Stadtgebilde. Die alte Försterei steht auf einer Wiese, die der Eigentümer, ein ortsansässiger Adelsherr, als Bauland für den Einkaufsmarkt, Parkplätze und das dazugeordnete Wohngebäude hergegeben hat. Das villenhafte Gebäude zu erhalten war zunächst nicht die Absicht, nach ortsinternem Hin und Her aber die Auflage des Bauherrn. Er bewohnt das kleine Schloß, das man hinter den Maisfeldern, am Ende einer Allee, zu Füßen der Waldhügel hochragen sieht. Vor langer Zeit war der Ortsname bekannt für alle die Frauen, die als Hexen hier verbrannt worden sind. Zum Gedenken ist im Schatten der Kirche ein Brunnen errichtet worden, im Ortskern, wo der Trödelmarkt und die Dorffeste stattfinden. Festlegen lassen will sich der Städteplaner nicht; gerne entwirft er eine Boutique, ein Casino für Las Vegas.
Leitstelle. Spuren sind keine mehr zu sehen, und warum das Gebäude in den letzten Kriegstagen noch hart umkämpft worden ist, weiß keiner mehr. Ein paar alte Leute, die noch Erinnerungen haben, wissen auch nichts Genaues; sie sagen, daß damals in der ganzen Gegend eben gekämpft worden ist, Blödsinn, hat auch nichts mehr genützt. Das Gebäude liegt vereinzelt auf einem Hügel, der am Ende der Ortschaft sich hochzieht und nach allen Seiten hin abfällt. Auf dem Dach befindet sich ein kleiner Turm, durch dessen Fenster sich die Landschaft rundum erfassen läßt. Flach dehnen sich die Felder aus, bis sie den Rand der Waldungen berühren. Deutlich erkennbar ist der Verlauf des Flusses, die Lage der Brücke, die beide Ufer verbindet. Die Landstraße, die über die Brücke geht, nimmt unterwegs ein paar Nebenstraßen auf. Man kann beobachten, wie sie weit aus dem Westen kommt, und nachdem sie die Ortschaft durchquert hat, sich in die östlichen Ebenen fortsetzt. Eine halbhohe Mauer umgibt den Garten und den weiträumigen Hof des Gebäudes. Hinter der Mauer wachsen Buschwerk und Bäume hoch, die den Einblick von außen verwehren.
Heute Apfelpfannekuchen. Der junge Bestattungsunternehmer, der jedes Jahr den Karnevalsprinzen abgibt, kommt Geld sammeln für den Karnevalszug. Im August hat er in der Sarghalle angefangen, mit seiner Truppe die neuen Lieder der Saison einzuüben. Ein frostiger Tag, der von morgens bis abends dunkel bleibt. In den Häusern tut sich nichts, und man hört auch nichts, außer dem Geräusch des Abladens, das vom Lieferwagen des Sargtischlers kommt.
Wetterfronten. Tiefausläufer ziehen vom Westen nach Deutschland und bringen mildere Luftmassen mit, deren Ausbreitung der Hochdruckkeil aus dem Norden verhindert. Über Nacht hat Tauwetter eingesetzt, und der nachfolgende Regen zerstört die Schneedecke auf den kleinen Seitenwegen. Der gelbe VW des Postboten dreht sich jaulend im Schneeschlamm und kommt erst nach langwierigen Rückwärts-Vorwärts-Manövern wieder frei. Ein Matsch wie in russischen Dörfern, schimpft der junge Mann. Er muß es wissen; sein Großvater hat in den Wintern an der Ostfront gestanden und liegt da irgendwo begraben. Die Schneemänner in den Vorgärten, damals bekamen sie für die Nase eine rote Rübe ins Gesicht gesteckt, und ihre Augen waren aus Kohle.
Drüben und drüben. Unser Berliner Malerfreund ist oft im Brandenburgischen unterwegs. Seine Fahrten, auf denen wir ihn gelegentlich begleiten, gelten Motiven, die der Landschaftsmaler nach Öffnung von Mauer und Grenzen entdeckt hat: Chausseeverläufe, märkische Dorfflecken, die Taubenhäuser in den großen Höfen, Schleusen überall dort, wo schmale Kanäle und die dünnen Arme der Spree das Land durchziehen. Jetzt hat er Gelegenheit, seine Bilder im rheinischen Düsseldorf auszustellen. Er zögert. Er fragt sich, wer soll denn im Rheinland Interesse haben an brandenburgischen Topografien. Gewiß, worauf es ankommt, das ist Farbe und Form, Komposition und Struktur. Aber dann vielleicht doch Sujets aus der Toscana oder der Provence. Auf den schönen Alleen der Mark Brandenburg, so seine Beobachtung, sieht er kaum noch westdeutsche Autonummern auftauchen, Kennzeichen D aus Düsseldorf schon seit Jahren nicht mehr. Er glaubt auch zu wissen, daß die westdeutschen Limousinen allenfalls auf den Parkplätzen der neuen Landhotels willkommen sind. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Da kamen alle die altgewordenen Westdeutschen die Dörfer ihrer Kindheit entdecken, den Charme der stehengebliebenen Zeit, das rumpelige Kopfsteinpflaster. Wo dies alles verschwunden ist, rollt auch die Nostalgie durch keine Dörfer mehr. Vielleicht, so spottet der geborene Lausitzer, soll man nach Westdeutschland mit ein paar Holzlatten gehen, mit Installationen, denen sieht man ja nicht an, wo sie herkommen, wo sie gemacht sind.
Kunstmuseum Bonn. Am Telefon erzählt eine Freundin, daß sie am Wochenende mit ihrem Mann eine Ausstellung besucht hat. Danach haben sie in der Cafeteria gesessen, und ihr Mann hat sich eine Linsensuppe bestellt. In der Suppe schwimmen die Scheiben einer Bockwurst. Mißtrauisch schiebt der Mann mit dem Löffel die Wurstscheiben hin und her und äugt zu der Kellnerin hoch. Sie hebt die Schultern und sagt, ich hab das Tier nicht gesehen, ich würde die Suppe nicht essen.
Die Truhe. Es kommt vor, daß tagelang Gesuchtes verschwunden bleibt und man statt dessen Unerwartetes entdeckt. Die kleine verstaubte Schachtel hat jahrelang in einer Truhe gelegen, die aus einer nach Kriegsende geräumten Wohnung stammt. Ich finde in der Schachtel einige Fotos, die in der alten Wohnung entstanden sind. Da sehe ich sie nun wieder, die Interieurs, von denen das Kind längst Abschied genommen hat und die im Gedächtnis des Erwachsenen stehengeblieben sind. Freilich bringen die Fotos den Nachweis, wie oft das Gedächtnis täuscht, daß seine Aktivistin, die Erinnerung, gern von der einstigen Realität abweicht, wenn sie durch die Räume der Kindheit geht. Vor allem, wenn die Bilder im Gedächtnis verblaßt sind, handelt die Erinnerung eigenmächtig und erfindet Bilder, die dann, verglichen mit den dokumentarischen Mitteilungen der Fotos, nicht so recht authentisch sind. Aber auch die Fotos sind für Irritationen gut. Ich schaue mir näher das Lichtbild an, das vor der Wand des Wohnzimmers eine große antike Truhe zeigt. Es ist die Truhe, in der ich die verstaubte Schachtel mit den Fotos gefunden habe. Auf wundersame Weise sind ein paar Möbelstücke aus der alten Wohnung nicht nur gerettet worden, sie haben auch alle die Jahrzehnte, alle familiären Umbrüche, Ortswechsel und Umzüge überstanden. So steht die Truhe jetzt im Haus, und nachdem ich ihr Abbild betrachtet habe, schaue ich mir das Möbel selber an. Es ist eine kleine Truhe. Jedenfalls ist sie kleiner, als sie auf dem Foto aussieht. Täuscht also auch das Foto? Nein, der Betrachter ist es, der sich täuscht, indem er nämlich die Truhe auf dem Foto wieder mit den Augen, das heißt, aus der Blickhöhe des Kindes sieht. Er kommt sich als das Kind vor, das vor der Truhe steht. Anfangs hat es nicht einmal die Fläche des Truhendeckels überschauen können; heranwachsend ist es ihm später gelungen, den Deckel über die Kopfhöhe hinaus hochzustemmen. Das Foto sagt mir noch einmal, wie groß, fern und schwer, unüberwindbar und unerreichbar die Möbel, die Gegenstände, Straßen, Häuser und Plätze, die Ziele, Wünsche und Ängste in der Kinderzeit gewesen sind. Jetzt fällt es mir leicht, nichts einfacher als das, den Deckel hochzuheben. Aufatmend schaue ich die Truhe an; sie erlaubt es, für einen Moment lang erleichtert zu sein.
Russischer Tee. Heute morgen trinke ich Tee aus einem Becher, den ich im kleinen Tee-Contor des Berliner Bahnhofs Friedrichstraße gekauft habe. Den oberen und unteren Rand des Bechers umlaufen zwei aus Rechtecken und Dreiecken gebildete Friese, die senkrecht verlaufende Linien verbinden. Ein blauweißes Muster, das auf allen Geschirrstücken der Teehandlung wiederkehrt: Tassen, Tellern, Eierbechern, Kannen. Gelegentlich bringe ich ein Stück nach Hause mit. Inzwischen hat die Teehandlung eine Filiale im Kölner Hauptbahnhof; ich könnte also in der Nähe einkaufen. Mir geht es aber um den Bahnhof Friedrichstraße, in Erinnerung an Jahre, als dort ein unübersichtliches Zwangssystem aus endlosen Korridoren, Sperren und Kontrollen eingerichtet war. Die Zeiten scheinen vergessen zu sein; heranwachsende Kinder kennen den Bahnhof nur in seinem glänzenden, weiträumigen, basarhaften Zustand. Mein Becher ist nicht dazu da, das Trostlose, den Schrecken des früheren Zustandes zu vergegenwärtigen. Im Regal stehen aber Becher, von denen ich vergessen habe, wie sie da hingekommen sind.
Der Trend. Es hört sich an, als schimpften die Meisen. Ewig hängt der Buntspecht am Meisenknödel. Von den größeren Vögeln ist er der einzige, der sich an der Futterkugel festkrallen kann. Krähen, Elstern, Häher flattern hilflos um die Kugel herum; sie sind ja auch nicht imstande, am Baumstamm hochzuklettern und rücklings an einem Zweig zu hängen. Jetzt kommt Gelächter aus dem Birnbaum, aber das ist der Grünspecht, der sich selten im Vogelhäuschen sehen läßt. Wir haben Futterringe hinausgehängt, obschon das Tauwetter Bäume, Büsche, Wiese langsam von den Schneemassen freimacht. Die Konflikte konzentrieren sich nicht länger auf die Plätze im Vogelhäuschen. Schauerbildung im Tagesverlauf, vereinzelt Bodenfröste nachts, Hundeschlitten auf dem Ladogasee.
Lärmschutzfristen. Der Korb steht voll leerer Flaschen; ich fahre über die Höhenstraße zum Glascontainer. Der silbergraue Behälter, versehen mit Einwurfmöglichkeiten für weißes, grünes und braunes Leergut, steht allein am Rand einer Weide, an der die Straße vorbeiführt. Zaunpfähle verlaufen quer über das Wiesenstück, das sich wellenförmig hinab in eine tiefe und weite Talsenke staffelt. Sie gibt den Blick frei auf die riesige Ebene, in der das Stadtgebilde von Leverkusen nach allen Seiten auseinanderfließt. Es ist ein klarer Vormittag. Der Blick reicht bis zum Horizont, vor dem sich, nach den letzten Ausläufern der Eifel, kulissenhaft Schlote, Abraumhügel, Kühltürme und mächtig weiße Gewölkmassen hinziehen, die aus den Kühltürmen der Elektrizitätswerke herausquellen, bei Tag und bei Nacht. Lautlos nähern sich in großer Höhe winzige Maschinen, deren verwehende Kondensstreifen noch in die Niederlande reichen. Die Weide wird von Wohnhausreihen eingegrenzt; die eine Reihe zieht sich um Schuppen, Stall und Scheune des kleinen Bauernhofs herum, dem das Wiesenland gehört. Der Bauer hat die Landwirtschaft aufgegeben. Steht die Schuppentür offen, kann man im Schuppen noch einiges Gerät aufbewahrt sehen, den Heuwagen, den alten Traktor. Mitten im Hof steht breit und neu ein schwarzgeschiefertes Wohnhaus. Der Bauer unterhält im Stall noch drei, vier Kühe, die im Sommer das Gras der Weide kurz halten. Manchmal kommen sie zum Weidezaun und schauen einen an. Die Weide ist zugleich eine Obstwiese; nach Sturmnächten liegt immer einer der alten, hochstämmigen Birn- und Apfelbäume umgestürzt da; das Erdreich ist nur geringfügig aufgebrochen, und die abgerissenen Wurzeln, die in die Luft ragen, sind kurz. Irgendwann sind die umgestürzten Stämme verschwunden, und der Bauer hat neue, niedrigstämmige Bäumchen gepflanzt. Im Frühling steht die Obstwiese in voller Blüte; die Massen von Äpfeln und Birnen, die im Sommer heranwachsen, fallen im Herbst, spätestens Ende November, von den Ästen; dann hüpfen Amseln, ein paar Krähen und Elstern, bevor es verfault, im Fallobst herum. Jetzt bedecken Schneereste die Wiese. Am Rand, wo der Container steht, glitzert im plötzlichen Sonnenstrahl das Meer der Glasscherben auf. Sperrfristen, die dem Lärmschutz dienen, regeln den Flascheneinwurf; das Geräusch des Polterns und Zerspringens, das aus dem Container dringt, ist in den Häuserreihen nicht zu hören.
Auf den Abend warten. Hochschauend sehe ich, wie verstaubt die Fensterscheiben sind. Vor Tagen sind sie doch gewienert worden, ja, vor Tagen, als keine Sonne draußen stand. Jetzt sticht die Wintersonne gnadenlos in die Kammer hinein, und mit dem Staub auf den Fensterscheiben kommt er überall zum Vorschein, der Staub auf dem Tisch, auf der Bank, auf den Stühlen, in der Zimmerluft, wo in den Sonnenstrahlen wirbelnde Staubsäulen stehen. Nie saubermachen, wenn die Sonne scheint, hat früher die Mutter gesagt, sauber sieht die Wohnung erst im Dunkeln aus.
Am Tisch, der mit der Truhe alle Transporte im und nach dem Krieg überstanden hat, haben die Eltern beim Abendbrot Gespräche geführt. Wenn dem Vater dabei ein Name nicht eingefallen ist, dann war immer vom Dingskirchen die Rede. Mit der Zeit schien das Gedächtnis des Vaters zunehmend schlechter zu werden, so häufig tauchte der Name Dingskirchen auf. Der Name betraf aber wechselnde Personen; mitunter, wenn der Vater vom Telefon zurückkam, schienen sie sich auch fernmündlich gemeldet zu haben. Der Junge, in seiner Tagtraumwelt unterwegs, schenkte den Gesprächen der Eltern nur wenig Aufmerksamkeit, doch auf die Dauer blieb ihm nicht verborgen, daß der Vater die Stimme senkte, wenn es um einen Dingskirchen ging. Einmal, als der Vater wieder vom Telefon kam, war ein Dingskirchen abgeholt worden, und danach hatte die Mutter den Jungen gleich ins Bett geschickt. Und einmal, als er im Korridor vor der angelehnten Tür des Eßzimmers stand, wunderte er sich, daß der Vater die Personen, um die das Gespräch sich drehte, alle mit Namen kannte. Erst nachdem der Junge das Zimmer betreten hatte, befiel den Vater sein Gedächtnisverlust, und sie hießen wieder Dingskirchen, die im Gespräch vorkamen.
Ortsgeschichte. In einem der Nachbarhäuser ist die Tochter ausgezogen, nach der Arbeit nachmittags, ohne Ankündigung, nur mit der Tasche. Sie ist Mitte dreißig und hat bislang mit der Mutter zusammengelebt. Die Mutter ringt um Fassung; sie erzählt, daß die Tochter jetzt, im nächsten Ort, mit einer anderen Frau zusammenlebt.
Ein selten benutztes Zimmer. Ein völlig verspinnwebtes Fenster.
Und wo war ich. Das Foto, auf dem die alte Truhe zu sehen ist, zeigt auch ein Ölgemälde, das über der Truhe an der Wand hängt. Nicht, daß ich es übersehen hätte. Daß ich es jetzt erst erwähne, liegt an der verzögerten Wahrnehmung dessen, was dem Gemälde inzwischen fehlt. Es kommt oft vor, daß man etwas sieht, aber nicht richtig zur Kenntnis nimmt. Das Gemälde ist ein Porträt der Großmutter; in einem blauen Kleid sitzt sie vor dem Hintergrund einer weiträumigen Hügellandschaft. Das Bild hat lange zu den Interieurs der Kinderzeit gehört; jetzt hängt es in der Kammer gegenüber in der Fensternische. Nachdem ich das wiedergefundene Foto noch einmal betrachtet habe, sehe ich, daß ein breiter Rahmen das Bild umgibt. Wie es gegenüber in der Nische hängt, fehlt dem Bild der Rahmen; es kommt allein mit seiner auf das Lattengeviert des Keilrahmens genagelten Leinwand aus. Auch das Porträt hat, wie Truhe und Tisch, die Geschichte von geräumten Wohnungen, Umzügen, Transporten, familiären Auseinandersetzungen hinter sich; es ist eines der wenigen Stücke, das von der verschwundenen Hinterlassenschaft des Malers übriggeblieben ist. Ich weiß nicht, warum dem Bild der Rahmen fehlt. Ganz banale Umstände vielleicht. Die Erinnerung bietet ein paar Möglichkeiten an, die den Verlust des Rahmens erklären könnten, aber das wären wieder Erfindungen, die den wirklichen Sachverhalt nicht treu rekonstruierten. Mein Nichtwissen ist ja auch kein Beispiel für Gedächtnisschwund. Eher ist es so, daß ich einfach nicht dabeigewesen bin, wenn das Bild von Wohnung zu Wohnung, von Möbelwagen zu Möbelwagen, von Waggon zu Waggon, von Lager zu Lager unterwegs war. Es gibt viele andere Vorkommnisse und Orte, wo ich nicht dabeigewesen bin. Inzwischen kann ich niemanden mehr befragen. Der Maler des Porträts ist aus dem Krieg nicht heimgekommen. Die Großmutter ist bald drei Jahrzehnte lang tot. Seitdem, fällt mir jetzt ein, bin ich im Besitz des rahmenlosen Bildes.
Im Traum habe ich ein Flugzeug verpaßt. Der Flughafen liegt im Ausland; vergeblich versuche ich, an Auskünfte heranzukommen; ich spreche und verstehe die Landessprache nicht. Hilflos und ratlos irre ich umher; in einem Gang komme ich nicht weiter; vor einer Tür geht es nicht weiter; die Situation wird so drangsalös, daß ich wach werde, keuchend, verstört.