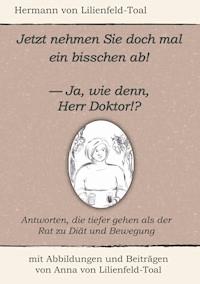
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Endlich eine praktische Einführung, wissenschaftlich begründet, wie man sein Gewicht auf Dauer reduzieren kann: Es ist inzwischen in der Fachwelt unumstritten, dass nicht die vielen Kalorien in unserer modernen Ernährung für das Übergewicht verantwortlich sind. Fett im Essen macht nicht dick. Es sind die überall enthaltenen Kohlenhydrate, die das Übergewicht bewirken. Will man aber eine Kohlenhydrat-arme Kost zu sich nehmen, was schwierig ist, da wir ja mit Kartoffeln und Brot groß gezogen wurden, dann wird man bald diese Art von Diät aufgeben. Unser Gehirn, das allein auf Kohlenhydrate in Form von Zucker angewiesen ist, toleriert dies nämlich in der Regel nicht. Den so entstehenden Hunger, der uns in verschiedenen Formen plagt, kann man nicht beherrschen. In diesem leicht lesbaren und unterhaltsamen Buch wird das Zusammenspiel von Psyche und Körper herausgearbeitet, das sich bei einem solchen sinnvollen Ansatz, das Gewicht zu reduzieren, entwickelt. Es werden die Möglichkeiten beschrieben, wie man auf beide einwirken kann, um das Ziel der Gewichtreduktion dauerhaft zu erreichen. Dazu werden zahlreiche verschiedene Wissensgebiete zusammengeführt. Endlich wird es so möglich, ohne ständige körperliche und dietätische Anstrengungen auf Dauer Gewicht kontinuierlich zu reduzieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die sich aus dem Text ergebenden Empfehlungen sind nach dem augenblicklichen Stand der Diskussion im wissenschaftlichen Umfeld gegeben. Es könnten für den Einzelnen aber individuelle Abweichungen von den Empfehlungen nötig sein, gegebenenfalls mit einer speziellen Behandlungstherapie. Jeder Leser ist aufgefordert, in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob und inwieweit die in diesem Buch gegebenen Empfehlungen für ihn einen alternativen, weil besonderen Weg zu herkömmlichen Abnahmestrategien darstellen. Ein Gewährleistungs-Versprechen oder Garantie werden von den Autoren nicht gegeben.
Über die Autoren
Hermann von Lilienfeld-Toal, Prof. Dr.med., ist Internist mit den Schwerpunkten Hormonlehre, Verdauungskrankheiten und Diabetes (Endokrinologie, Gastroenterologie und Diabetologie). Er war lange Jahre Chefarzt in einem Krankenhaus und ist Mitglied der Medizinischen Fakultät der Univ. Bonn. Er hat sich den Blickwinkel des Betroffenen zu eigen gemacht. Er ist in der Selbsthilfe aktiv, war viele Jahre Landesvorsitzender des Deutschen Diabetiker Bundes Hessen (jetzt Diabetiker Hessen e.V.) und stellv. Bundesvorsitzender des Deutschen Diabetiker Bundes e.V.. Er ist im Beirat des Vorstandes der Deutschen Diabetes Föderation e.V.
Anna von Lilienfeld-Toal ist Dipl. Psychologin und psychologische
Psychotherapeutin. Sie arbeitet in der
Klinik für Psychosomatik der Universität Giessen.
Ich bin vielen dankbar, die mir halfen, die Gedanken lesbar zu machen. Dazu gehören besonders I. Becker, W.M. Becker, K.Gärtner-Petersen, L. Grube, J. Kischkat, G. Klausmann, P. v. Korff, A. v. Lilienfeld-Toal, O. v. Lilienfeld-Toal, S. v. Lilienfeld-Toal und M. Tränkmann.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1: Was sich im Körper beim Essen und infolge des Essens abspielt
Kapitel 2: Das Denken
Kapitel 3: Bewusstsein und Gehirn.
Kapitel 4: Stimmungen und Gefühle
Kapitel 5: Die Mahlzeit
Kapitel 6: Erscheinungsbilder der Adipositas
Kapitel 7: Was können wir denn essen?
Kapitel 8: Einkaufen
Kapitel 9: Getränke
Kapitel 10: Die Menschen sind alle verschieden
Kapitel 11. Hunger
Kapitel 12: Körperliche Bewegung
Kapitel 13: Bildschirmarbeit, Kino, Fernsehen und PC-Games
Kapitel 14: Essen außerhalb
Kapitel 15: Schlafen
Kapitel 16: Seelische Reaktionen und Übergewicht
Kapitel 17: Operation, endoskopische Verfahren, Medikamente
Kapitel 18: Noch etwas Interessantes: Die Fruktose, die Harnsäure und die Bakterien.
Kapitel 19: Industriell hergestellte Nahrungsmittel und Sonder-Ernährung
Kapitel 20: Was machen wir denn nun?
Literatur
Glossar
Einleitung
Es ist schrecklich, man wird mehr oder weniger direkt von jemand aufgefordert, vielleicht dann doch etwas abzunehmen: „Jetzt nehmen Sie doch mal ein bisschen ab!“ Oder der quälende Gedanke, dass es gut wäre, das zu tun, fährt von allein in unseren Kopf. Dabei haben wir es doch schon so oft versucht, ohne richtigen Erfolg.
Dies Buch ist für Menschen geschrieben, die etwas abnehmen wollen oder auch viel. Insbesondere ist es für die geschrieben, die an sich und ihrem Körper verzweifeln, weil es nicht geht.
Das Gebiet ist offensichtlich schwierig. In diesem Buch werden viele Zusammenhänge unter dem Blickwinkel „was kann ich tun“ dargestellt. Es ist nötig, das Wissen der verschiedensten Gebiete einmal in einen Zusammenhang zu stellen, damit das Gefühl des Ausgeliefertseins verloren geht. Dieses beschleicht uns, weil wir auf der einen Seite nicht wirklich erfolgreich sind mit dem Abnehmen, auf der anderen Seite immer wieder neue Aspekte auftauchen, die wir vorher nicht kannten. So soll auch manche überbetonte Sichtweise, in der der eine oder andere Autor sich eben auskennt, vermieden werden.1
Im Internet kann man sich viele sowohl sinnlose als auch vielleicht richtige Empfehlungen ansehen. So gibt es auf ‚you tube‘ viel Interessantes. Wer damit umgehen kann, soll das unbedingt tun. Die Hauptsache, auch hier, ist der Erfolg. Vielleicht half ja auch eine der zahllosen Abnehme-Pillen oder Diäten, die noch heute in Journalen mit ihren Anzeigen auftauchen.
Aber irgendwie gelingt es vielen Menschen trotzdem nicht, erfolgreich abzunehmen und schlank zu bleiben.
In diesem Buch wird erklärt, wie solche Enttäuschungen zustande kommen und was man dann machen kann. Nicht jede Überlegung passt zu jedem und nicht jede Maßnahme ist bei jedem gleich wirksam. Jeder muss selbst ausprobieren, was wirkt und ob man es selbst durchhalten kann. Dazu muss ich aber wissen, was überhaupt sinnvoll ist.
Viele kluge Bücher stellen ein Motto vorweg, das den Leser in die richtige Stimmung bringen soll. Ich habe auch Mottos gewählt. Sie beschreiben den wichtigsten Impuls, den wir angesichts einer Änderung unserer Gewohnheiten und der Lebensführung brauchen, denn darauf wird unser Projekt Abnehmen hinauslaufen:
Sokrates sagt etwa:
Wenn man weiß, was das Richtige ist, heißt es nicht, dass man es dann auch tut.
Und dazu Erich Kästner:
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Wir müssen also die Kraft aufbringen, wissen zu wollen, was das Richtige ist, und es dann auch tun.
Also, Sie wollen abnehmen? Sie würden gern abnehmen? Da möchte ich Ihnen zeigen, was hinter den Schwierigkeiten steckt und wie Sie es angehen können. Es hat besonders Sinn, wenn Sie sich wirklich darauf einlassen wollen und dran bleiben. Schnell geht es nicht, wenn es halten soll. Aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen.
Ich stamme von meinem beruflichen Denken her aus dem Teil der Medizin, der sich mit Stoffwechselprozessen beschäftigt. Das beinhaltet auch den Blick darauf, wie es eigentlich kommt, dass wir dick werden. Bei dem Thema Übergewicht hatte ich mich kundig gefühlt und meine Kenntnis verbreitet. Wenn ich ehrlich bin, allerdings mit keinem großen Erfolg. Das Thema Abnehmen ist nämlich vielschichtiger als die Betrachtung von Stoffwechselvorgängen. Daher bin ich denen, die meinen Blick für das Thema dieses Buches erweitert haben, sehr dankbar. Zu ihnen gehörten anfangs die Autoren und Wissenschaftler G. Taubes, R. Lustig, A. Peters und D. Ludwig, später in fruchtbaren Diskussionen U. Weitz, J. Scholl, H. Rüddel und E. Langer.
Der Gedanke von Sokrates, dass es nicht ausreicht, wenn man nur weiß, worum es geht, sollte uns wecken. Er kann uns bewegen, nun auch anzufangen, denn durch Verschieben würden wir ja unnötig Zeit verlieren. Um dem Gefühl, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, was sich abspielt, und was man da machen soll, entgegenzuwirken, ist dieses Buch geschrieben. Dann können wir nämlich loslegen und Erich Kästner folgen: Nur wenn wir es tun, wird es etwas Gutes!
Ja, es gibt Programme zum Abnehmen, durch die man schlanker wird. Ja, es stimmt, wenn man ganz wenig isst und das Richtige trinkt und dabei auch ganz wenig Kalorien zu sich nimmt, wird man dünner. Aber irgendwie funktioniert es so bei mir selbst und offensichtlich bei vielen, vielen anderen nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bekomme bereits Hunger, wenn ich nur daran denke, dass ich nun weniger essen will, um abzunehmen. Wenn ich Monate später nachsehe, nachdem ein oft mit großer Kraft eingehaltenes Programm ein paar Kilos weniger bewirkt hatte, bin ich nicht selten so dick wie am Anfang.
Gelegentlich sitze ich als Arzt einem Patienten, einer Patientin gegenüber, bei denen ich aus ärztlicher Sicht wirklich begrüßen würde, wenn sie abnähmen. Es gab nicht selten dann die Situation, dass nach kurzer Zeit die Arzthelferin herein kam, um diskret und unauffällig darauf hinzuweisen, dass ich nicht so viel Zeit mit diesem Patienten verbringen dürfe, die anderen warteten ja bereits. Das heißt, es war nicht „nach kurzer Zeit“, sondern ich hatte angefangen über das Übergewicht zu sprechen und schon war unbemerkt die knappe Zeit überzogen. Da blieb dann nur noch, schon mal zu einer kleinen Aufgabe in die richtige Richtung anzuregen und das Thema auf den nächsten Termin zu vertagen. Aber es gibt doch so viel dazu zu sagen!
In diesem Buch sind Ausführungen und Gedanken enthalten, die ich gern vor demjenigen, der nun abnehmen will, in einem Gespräch ausbreiten würde. Das geht aber im Alltag einer Praxis und so direkt im Gespräch nicht so schnell. Ohne einen zumindest im Ansatz umfassenden Blick auf das Vorhaben Abnehmen scheint es mir ziemlich aussichtslos. Wer bereits erfolgreich war, braucht dies vielleicht nicht zu lesen. Oder doch, wenn Angst vor einem Rückfall besteht!
Es gibt wohl niemanden mit erhöhtem Körpergewicht, der nicht bereits versucht hat, das Gewicht zu reduzieren. Das ist verständlich. Nicht nur sind wir ständig von gesundheitsfördernden guten Ratschlägen umgeben, die jedem gleich ein schlechtes Gewissen machen (Da hab ich schon wieder …. gegessen, was ich doch nicht soll!!), sondern wir fahren statt zu gehen –beratungsresistent, wie wir sind – immer weiter Fahrstuhl, Rolltreppe und mit dem Auto. Und auch der umweltbewusste Gebrauch von Nahverkehrsmitteln ersetzt die erforderliche Bewegung nicht. Gleichzeitig ist es eindeutig, dass nicht nur die Gesundheit fordert, weniger Gewicht zu haben, sondern auch unser Ansehen unter den Menschen, die schlank und rank durchs Leben gehen. Gut angesehen wollen wir sein, auch wenn es nicht nötig ist, eine Hungerfigur zu haben, wie sie uns in den Modezeitschriften und Reklamen entgegentritt.
Abb. 1: Übergewichtige fühlen sich kritisiert
Übergewichtige finden sich auch einer kritischen Umwelt gegenüber, die ihr Gewichtsideal gnadenlos auf die anwendet, denen das Schicksal nicht die mühelose Fähigkeit beschert hat, ihre Figur in heutzutage modisch ansprechenden Bereichen zu halten (Abb. 1). Dass dies zutiefst ungerecht ist und in keiner Weise irgendjemanden berechtigt, mit dem Zeigefinger zu zeigen, muss wirklich endlich von allen erkannt werden. Hier wird unangemessen eine Schuld zugewiesen („selbst schuld, du musst dich halt ‚ein wenig‘ zusammenreißen“). Hiervon werden wir noch reden. Nur, wer übergewichtig ist, dem hilft der Gedanke, dass eine solche Aufforderung taktlos und fehl am Platze ist, oft auch nicht. Solche Beurteilungen bleiben in der Regel auch unausgesprochen, sind mehr gefühlt als diskutiert.
Warum noch so ein Buch über das Abnehmen?
Etwa 16% der hiesigen Bevölkerung sind krankhaft übergewichtig (medizinischer Ausdruck für die Krankheit: Adipositas). Viele, die übergewichtig sind, sind im Sinne einer Krankheitsdefinition allerdings nicht krank. Es geht leise und langsam mit dem Übergewicht. Der deutsche Einzelhandel hält im Schnitt größere Bekleidungsgrößen bereit als vor einigen Jahren. Auch wenn ein solches Übergewicht nach Ansicht der Krankenkassen keine Krankheit ist, sind Übergewichtige vermehrten Krankheitsrisiken ausgesetzt.
Es ist erstaunlich, dass es so viele übergewichtige Menschen gibt. Wir brauchen nur in eine der bunten Zeitschriften hineinzusehen: Nach wenigen Seiten stoßen wir auf eine Anzeige, in der wir auf einen einfachen Weg gewiesen werden, das Gewicht zu reduzieren. Und wer keine Zeitschriften liest, wird bei einer Suchanfrage „wie nehme ich Gewicht ab“ im Internet klare Anweisungen erhalten, was er machen muss (>600.000 Eintragungen!). Und – zumindest wenn man die zum Beweis mitgelieferten Lebensschicksale ansieht, die ja nicht alle erlogen sein müssen –, scheint das jeweils vorgeschlagene Verfahren auch zu wirken.
Trotzdem führen so viele Menschen ein Leben mit Übergewicht, was zu dem Schluss zwingt, dass irgendetwas mit den dort angebotenen Verfahren nicht stimmen kann.
Ehrlicher- und für mein ärztliches Empfinden auch traurigerweise muss man eine Parallele sehen zu dem, was von der medizinischen Fachwelt als Abnehme-Verfahren über lange Zeit angeboten wurde. Seit Jahren werden Programme entwickelt, die auch bei einzelnen Teilnehmern für einen bestimmten Zeitabschnitt zu einer Gewichtsreduktion führen. In wissenschaftlichen Untersuchungen wird im Allgemeinen der Effekt der Maßnahmen nach ein oder zwei Jahren bewertet. Der Mensch lebt aber glücklicherweise länger als nur diese zwei Jahre Beobachtungszeit. Über diesen zweijährigen Zeitraum wurde nun vielleicht das Gewicht in der Tat reduziert.
Allgemein wird bereits eine Gewichtsreduktion von 5 % als Erfolg bewertet. Es sind aber 5% doch nicht sehr viel, oder? Hat das wirklich einen Einfluss auf das Aussehen, auf das Auftreten von Schäden an Knien, Hüften und der Wirbelsäule? Oder, noch wichtiger, auf das Auftreten von Herzinfarkt und Schlaganfall?
Und, was ist danach? Ist nicht nach 2 weiteren Jahren alles wieder beim Alten?
Es gibt nur eine einzige große Studie, in der über 10 Jahre hin beobachtet wurde, wie sich die üblicherweise in der medizinischen Fachwelt empfohlenen Maßnahmen
Reduktion der Kalorien in der Nahrung,
fachkundige Begleitung und Beratung in Gruppen,
und körperliche Bewegung
auf das Körpergewicht ausgewirkt haben. Hierbei beobachtete man eine große Zahl von im Mittel 100 kg schweren Diabetikern über 10 Jahre. Alle waren motiviert. Ihre Körpergewichtsentwicklung wurde verglichen mit der von Mitgliedern einer Vergleichsgruppe, denen der Hausarzt oder jeder beliebige behandelnde Arzt immer mal wieder – wir kennen das – sagte: „Also, jetzt nehmen Sie doch mal ein bisschen ab!“ Ergebnis: Nach 10 Jahren Programm, Bemühen, diätetischer Aufmerksamkeit etc. war der Gewichtsunterschied zwischen diesen Gruppen 3 kg! Das ist bei einem Ausgangsgewicht von 100 kg sozusagen nichts, nicht einmal die angestrebten 5%. Ja, es gab eine Reihe von positiven Effekten, es waren weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Medikamente etc. nötig, aber wir reden ja hier über das Gewicht: Dies bedeutet, dass die von der medizinischen Wissenschaft bis jetzt in der Trias Ernährungsumstellung, Beratung und Förderung der körperlichen Bewegung überwiegend empfohlene Therapie nicht besonders wirksam ist.
Dem entspricht die Tatsache, dass die Vielen in unserem Lande, die sich um Beiträge zur Verminderung des Körpergewichtes bemühen, leider bei allem Engagement nicht sehr großen Erfolg haben.
Ich plädiere hier für einen neuen Anlauf, wie er so bisher nicht stattgefunden hat.
Es muss anders gemacht werden.
Ich schildere in diesem Buch Maßnahmen, die zu Gewichtsreduktion führen und die im Leben auf Dauer durchgehalten werden können.
Eine wichtige Lehre aus den vielen Bemühungen, das Gewicht zu reduzieren, ist die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hat, die vernünftigen Ratschläge nur für einen kurzen Zeitraum (wie lang der auch sein mag) zu befolgen. So ist nämlich der Rückschlag vorbestimmt. Bei Diäten hat dieser Rückschlag den Namen Jo-Jo-Effekt. Wir werden die Gründe ansehen, warum es nicht gelang, die erfolgreichen kurmäßigen Bemühungen auf Dauer auszuhalten. Bei anderen Maßnahmen als der Auswahl der Nahrung, z.B. bei der körperlichen Bewegung, über die wir auch nachdenken werden, existiert ein Jo-Jo Effekt übrigens auch!
Wir werden also etwas ändern in unserem Leben und das, was wir ändern, möchten wir auf Dauer beibehalten. Das stellt gewisse Anforderungen an das, was uns vorgeschlagen wird:
Die Maßnahmen, die wir uns vornehmen, müssen einhaltbar sein.
Ja, natürlich, mit irgendeiner Vitamin-Eiweiß-Präparation als einziger Nahrung über einige Wochen können wir sehr gut abnehmen, aber wer wird das dann auf Dauer durchhalten? Soweit man sieht und hört, ist dies kaum möglich.
In einem Heft der Komik-Serie Asterix und Obelix (Asterix im Morgenland) findet sich eine kleine Szene, die sehr gut auch unser Empfinden den Bemühungen gegenüber widerspiegelt, nun über weniger Essen etwas zu erreichen: Obelix, der ja nur mit genug Wildschwein auf dem Tisch existieren kann, fällt in Ohnmacht, als er hört, dass es der indische Fakir zwanzig Tage ohne Essen aushalten konnte. Uns beschleicht ein ähnliches, unbestimmtes, aber tief sitzendes Angstgefühl, dass es mit dem wenigen Essen, das wir uns nun vornehmen wollen, eigentlich nicht geht.
Es reicht nicht, nur Bescheid zu wissen, was gut ist zu essen. Es gehört dazu zu wissen, wie man es auch durchführen kann. Dazu müssen wir das Bewusstsein stärken, das uns den für den Körper richtigen Weg zeigt. Wir wollen nämlich die ungute innere Stimme überhören, die es verhindern will, zu verstehen, warum man dann und wann über die Stränge schlägt. Und wir wollen dabei ein gutes Verhältnis zu dem eigenen Körper haben. Und so gehört es dazu, Umstände zu kennen, die unser Vorhaben, das Gewicht zu vermindern, bedrohen.
Auch wenn dieses banal klingt, es gibt noch ein wichtiges Phänomen, das beim Anhören von weisen Ratschlägen, wie man es denn nun machen soll, eine große Rolle spielt: Wir Menschen sind verschieden. Wir sehen verschieden aus, wir haben verschieden große Nasen, Ohren etc. und - das ist hier entscheidend -, auch die Stoffwechselvorgänge in unserem Körper sind verschieden. Alles ist unterschiedlich: Wie heftig der Körper auf einen Infekt reagiert, wie stark der Alkoholspiegel nach einem Glas Bier ansteigt, wie stark der Blutzuckerspiegel ansteigt nach einem Stück Kuchen, wie schnell unser Blutdruck sich ändert, wenn wir uns erschrecken, und so weiter. Und: Wir unterscheiden uns eben auch darin, wie leicht wir dick werden.
Es muss einmal laut ausgesprochen werden: Es ist oft kein wirkliches persönliches Verdienst, wenn jemand schlank bleibt. Die Person hat „nur“ eine günstige Konstellation von Eigenschaften der beteiligten Organe des Körpers, die verhindert, dass sie übergewichtig wird. Wir anderen, die wir darunter leiden, dass das Gewicht sehr schnell ansteigt, können uns nicht an ihr orientieren. Es ist daher meist sinnlos, den Ausführungen der Schlanken zu lauschen, was sie nun gemacht haben, um schlank zu bleiben. Dies bedeutet auch: Ein Missionsdrang der Schlanken - vielleicht auch aus eigener Erfahrung - mitzuteilen, wie denn der Dicke schlank werden oder bleiben kann, ist fehl am Platze. Der Dicke hat eine andere Problematik, einen anderen Stoffwechsel, einen anderen Denkmechanismus, was das Essen betrifft. Das mag insbesondere für den erfolgreich schlank gewordenen schwer zu verstehen sein, hat er es doch geschafft! Bei ihm hat der Körper die Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, die vielleicht eingetretenen Hungersituationen waren nicht so schlimm und ein geringer Aufwand hat ohne Probleme ausgereicht, ein günstiges Gewicht zu erreichen. Häufig kann man sogar hören: Es war doch gar nicht so schlimm.
Bei den Übergewichtigen sind die Situationen, Umstände und Bedingungen, die es ihnen im Einzelnen so schwierig machen, auch sehr unterschiedlich. Das bezieht sich sowohl auf die körperlichen Voraussetzungen als auch auf das Problem der zentralen Regulation im Gehirn. Wir kennen das aus der Lebenserfahrung: Da gibt es Leute, die strahlend erzählen: „Ich war auch dick und habe es ganz einfach geschafft, dünn zu werden!“ Die neugierige Gegenfrage – vielleicht kann ich das ja auch machen??- : „Wie hast du das denn fertiggebracht?“ wird dann beantwortet mit einer Maßnahme, die wir schon x-mal versucht haben, ohne Erfolg: z.B esse ich abends nichts mehr; ich habe einfach die xxxxx weggelassen (Kartoffeln oder Wurst oder die Butter oder die Nachspeise oder den Zucker im Kaffee); ich habe seit einem halben Jahr einen Hund, der mich zwingt zu laufen; ich gehe seit einem halben Jahr in ein Fitness-Studio und so weiter und so weiter. Aber fast alles haben wir schon einmal versucht und der Effekt war flüchtig, wenn überhaupt.
Der Inhalt dieses Buches stellt dar, wie und wo man etwas erreichen kann. Es ist zu erwarten, dass aufgrund dieser großen Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen natürlich nicht jede Maßnahme bei jedem Effekte hat. Der Grundgedanke angesichts des großen Spektrums von Dingen, die einen Einfluss auf Übergewicht haben, ist es, Verschiedenstes anzuwenden und dabei herauszufinden, was speziell zu einem selbst passt. Dabei gilt natürlich der Spruch: Wenn man etwas nicht sucht, findet man es auch nicht. Also muss man schon suchen wollen und ausprobieren wollen, was nun das ist, was einem hilft. Vieles hat man ja schon ausprobiert, aber vielleicht nicht in der Art, wie es hier präsentiert wird.
Das heißt, wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, im Text auf etwas stoßen, von dem Sie denken, das geht mich nun wirklich nichts an, dann kann das durchaus so sein. Aber bitte berücksichtigen Sie es trotzdem, da es im Zusammenhang des fortschreitenden Lebens und der anderen Maßnahmen, die Sie nun ergreifen, vermutlich eine andere Wirkung bekommt als früher. An so einer Stelle mag Ihnen auch dieses Buch etwas langatmig vorkommen, aber nur Mut: Lesen Sie weiter, gleich wird es wieder interessanter für Sie.
Man unterliegt in Wirklichkeit keinem moralischen Druck, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ihn gibt es nämlich nach meiner Überzeugung auch gar nicht, wie Sie in diesem Buch lesen können. Dazu kommt der schöne Aspekt, dass man durchaus essen kann, man muss nicht leiden! Kein moralischer Druck und keine asketische Anforderung sind erforderlich. Die Aufgabe ist, sich an Anderes zu gewöhnen.
Gelegentlich gibt es Augenblicke, in denen man selbst feststellt: Eigentlich bin ich zu dick, ich will gar nicht so dick sein. So ein Augenblick ist sehr schön beschrieben in einem Lied der Musikgruppe „Torf Rock“, die in vielen Liedern das Leben des Wikingers Rollo besungen hat: „Rollo guckt an sich runter und kriegt einen Schreck, auf’m Mal waren seine Füße weg.“ Der Refrain des Liedes: „Manchmal hab‘ ich den Verdacht, die Wampe hat mich dick gemacht“
Da hat er recht, der Wikinger Rollo: Die „Wampe“ ist ja hauptsächlich die Vermehrung des Fetts im Bauchraum. Dieses Fett spielt eine Rolle bei der Insulinresistenz (siehe im Folgenden), die zu unserem Übergewicht beiträgt.
Ergreifen wir einen solchen Augenblick und nehmen wir ihn zum Ausgangspunkt, um nun einen neuen Weg zur Gewichtsverminderung einzuschlagen.
1 Manches will man gar nicht so genau wissen. Ich habe daher Ausführungen zu Einzelheiten, die man für den Gedankengang auch auslassen kann, als Exkurs in einen Rahmen gesteckt. Dies sollten Sie lesen, wenn dieser Aspekt Sie besonders interessiert.
Kapitel 1: Was sich im Körper beim Essen und infolge des Essens abspielt.
Zusammenfassung
Was macht uns dick? Alles in der Nahrung, was zu einem Anstieg von Zucker im Blut führt. Dieser hat nämlich eine Vermehrung von Insulin zur Folge, das den Einbau von Zucker, aber auch von Fett in das Gewebe bewirkt. Die Vorstellung von einer Kalorien-Bilanz (es wird weniger Energie verbraucht, als in den Körper eingeführt, und daher wird man dick) ist falsch. Nicht die Menge, sondern die Art der Kalorien und die Zusammensetzung der Nahrung entscheidet über das Gewicht. Eine Insulin-Resistenz hat zur Folge, dass bereits geringer Zucker im Blut eine starke Vermehrung von Insulin hervorruft. Sie ist daher für unser Ziel, Gewicht zu verlieren, besonders ungünstig. Sie wird insbesondere bei Fettleber und viel Fett im Bauchraum beobachtet.
Lassen Sie uns mit einer Frage, die uns vielleicht schon lange beschäftigt, anfangen: Was im Essen macht uns eigentlich dick? Um das zu verstehen, werde ich Stoffwechselvorgänge, die durch das Essen ausgelöst werden, darstellen. Sie sollen diese Frage beantworten und uns helfen zu verstehen, was wir letztendlich machen können, um diesen Dick-Mach-Effekten zu entgehen.
Einen solchen wichtigen Vorgang, auf den ich mich in dem Text immer wieder beziehen werde, wollen wir an den Anfang stellen.
Unsere Nahrung besteht hauptsächlich aus den drei Stoffgruppen Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett (Siehe Kapitel 7). Wenn wir etwas essen, wird der Kohlenhydratanteil von dem Enzym Amylase2 im System des Verdauungstraktes in einzelne Zucker-Moleküle zerlegt. Diese können dann durch die Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden, sodass sie ins Blut übertreten. Unter allen Zuckermolekülen, die so resorbiert werden, ist für uns die Glukose der in seiner Wirkung bedeutsamste Zucker. Er ist beispielsweise Teil des Haushaltzuckers, den wir in der Küche verwenden oder vielleicht, um bei Tisch unseren Kaffee oder Tee zu süßen, und er ist in der Stärke in Kartoffeln und Brot enthalten.
Abb. 2: Zuckermoleküle sind in der Nahrung meist als lange Ketten vorhanden. Diese Ketten, auch als Polysaccharide bezeichnet, bilden die Stärke in Kartoffeln oder Brot. Die Moleküle werden durch das Enzym Amylase abgetrennt und können so einzeln ins Blut aufgenommen werden.
Der Haushaltszucker besteht aus zwei miteinander verbundenen Zuckermolekülen, der Glukose und der Fruktose. Haushaltszucker wird auch mit den Begriffen Sucrose oder Saccharose bezeichnet, es handelt sich um dieselbe Substanz. Auch er wird durch das Enzym Amylase gespalten. Die Konzentrationen dieser beiden Zuckermoleküle steigen nach dem Essen im Blut an, da sie nach dieser Spaltung von der Dünndarm-Schleimhaut in den Körper aufgenommen werden können. Die Fruktose werden wir in einem eigenen Kapitel beschreiben (s. Kapitel 18). Konzentrieren wir uns hier auf Schicksal und Wirkung der Glukose. Diese nach dem Verzehr von Kohlenhydraten, z.B. Brot, im Blut ansteigende Glukose stellt den Blutzucker dar. Etwas Glukose ist allerdings bereits vorher im Blut. Wenn sie nicht aus der Nahrung gerade aufgenommen wurde, wird sie von der Leber zur Verfügung gestellt. So hat man auch eine normale Blutzuckerkonzentration, wenn man lange nüchtern war, beispielsweise am Morgen vor dem Frühstück. Der nach dem Essen einsetzende Anstieg des Blutzuckers erzeugt einen sofortigen Insulin-Anstieg im Blut. (s.Abb.3) Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse aus in das Blut abgegeben wird.
Je nach Geschwindigkeit und Höhe des Blutzuckeranstieges erscheint Insulin mehr oder weniger schnell und stark im Blut. Insulin hat die Wirkung, Zellen und damit Gewebe aufzubauen. Wir nennen dieses eine „trophe“ (griechisch: nährend) Wirkung, da es Wachstum und Ernährung des Gewebes bewirkt. Es werden Nahrungsmoleküle in die Zellen der Gewebe hineingeschafft. Für unser Thema hier ist wichtig, dass Insulin die Wirkung hat, die Glukose, die als Blutzucker im Körper unterwegs ist, sehr effizient in die Zellen hineinzubringen.
Glukose ist für alle Gewebe und damit für unser ganzes Leben eine bevorzugte Energieform, die für die Leistungen der Zellen sehr gut verwendet werden kann. Insulin schleust auch andere Nahrungsmoleküle wie Fettmoleküle und Eiweißbausteine, die Aminosäuren, in die Zellen.
Das Insulin, das durch den Blutzuckeranstieg hervorgerufen wird, bewirkt dieses Einschleusen von Glukose in die Zellen fast des gesamten Körpers. Eine Ausnahme bildet hier unter anderem das Gehirngewebe, das für die Verwendung der Glukose gar nicht auf Insulin angewiesen ist. Die Folge der Insulinausschüttung ist ein Abfall der Blutzuckerkonzentration. Infolgedessen hört die Insulinausschüttung bald auf und die Konzentration des Insulins im Blut mindert sich, da ja mit Abfall der Glukose der Reiz, Insulin freizusetzen, nachlässt und immer weniger Glucose einzubauen ist
Abb. 3: Regulation des Blutzuckerspiegels: Mit Anstieg des Zuckers im Blut nach der Verdauung erscheint Insulin im Blut und senkt den Blutzucker wieder auf normale Werte. Mit der Senkung des Zuckers geht auch die Insulinkonzentration zurück.
Für das Verständnis unseres Projektes der Gewichtsreduktion ist es von großer Bedeutung, dass Insulin nicht nur Glukose, sondern auch Fett-Moleküle in die geeigneten Gewebe einbaut. Das ist physiologisch sinnvoll, denn mit den aufgespaltenen Kohlenhydraten werden in der Regel auch Fleisch und Fett verdaut und ihre molekularen Bestandteile, nämlich Aminosäuren und Fettsäuren, erscheinen im Blut. Hier zeigt sich eine Verbindung zwischen Fett und Kohlenhydraten:
Wenn durch einen starken Blutzuckeranstieg viel Insulin im Blut erscheint, dann wird dieses Insulin neben Zucker auch Fett in die entsprechenden Gewebe, insbesondere das Fettgewebe, einbauen.
Dies ist der Hintergrund der uns betrübenden Beobachtung, dass besonders viel Fett ins Fettgewebe gelangt, wenn man Süßes und Fett zusammen isst (Sahnetorte, Schokolade u.ä,), und man durch etwas so Schönes dick wird. Wenn dagegen wenig Insulin da ist, kann das aus der Nahrung aufgenommene Fett kaum zu Übergewicht führen.
Große Insulinmengen im Blut aber können auch ohne Fett in der Nahrung zu einem Anhäufen von Fettgewebe führen, da Fett immer im Blut vorhanden ist; es kann ja aus anderen Nahrungsmitteln, wie etwa Kohlenhydraten, vom Körper selbst hergestellt werden.
Die Frage, was in der Nahrung uns eigentlich dick macht, kann nun beantwortet werden: Es ist jede Nahrung, die zu einem Anstieg von Insulin führt. Und das ist die Nahrung, die den Blutzucker ansteigen lässt.
In einem Kapitel über die Unterschiedlichkeit der Menschen (Kapitel 8) werden wir lernen, dass die Stoffwechselregulation von uns Menschen sehr verschieden ist. So ist zu erwarten, dass die Menschen einen sehr unterschiedlichen Insulinanstieg bei gleichen Blutzuckerwerten haben. Außerdem kann sich der Blutzuckeranstieg nach gleicher Nahrung zwischen einzelnen Menschen sehr unterscheiden. So kann man sich gut vorstellen, warum bei gleicher Nahrung die Stoffwechselsituation (uns interessiert hierbei der Aspekt: Macht etwas dick?) so verschieden sein kann.
Aus der Diabetes-Betreuung kann man lernen. Bei vielen Diabetikern steht der Mangel an Insulin im Vordergrund der Erkrankung. Klar, wenn kein Insulin wirkt, bleibt der Blutzucker hoch. Eine sehr häufige Schwierigkeit besteht darin, die richtige Insulin-Dosis, d.h. -Menge zu finden, die der Diabetiker sich spritzen muss. Wenn diese bereits ein wenig zu viel ist für das, was in Wirklichkeit der Bedarf ist, nimmt der Mensch häufig zu. Insulin macht dann dick!
Über viele Jahre wurde uns allen aber gepredigt, dass Kalorien in der Nahrung möglichst niedrig gehalten werden müssen, um abzunehmen. Was hat es wohl damit auf sich? Lassen Sie uns Überlegungen zu diesen Kalorien (siehe Einschub) anstellen. Kalorien sind besonders in fetthaltiger Nahrung vorhanden. Pro Gramm Fett finden sich ja praktisch doppelt so viele Kalorien, wie in Kohlenhydraten und Eiweiß.
Exkurs
Was ist die Energie der Nahrungsmittel, gemessen in Kalorie?
Der physiologische Brennwert von Lebensmitteln ergibt die Energiedichte, die bei der Verstoffwechselung im Körper verfügbar ist. Die Energie, die der Körper dafür selbst aufwenden muss, geht nicht in die Rechnung ein. Bei der Berechnung spielt das individuell unterschiedliche Verdauungssystem eine Rolle, dessen Funktion abgeschätzt werden muss. Die Werte sind aus wissenschaftlicher Sicht sehr unzuverlässig. Aber nach der EU - Lebensmittel-Informationsverordnung von 2014 ist der Brennwert der Nahrungsmittel anzugeben. Wegen der Unzuverlässigkeit der Abschätzung ist nach ernsthafter Kritik ein auch nur halbwegs plausibler physiologischer Brennwert überhaupt nicht wissenschaftlich herleitbar.
Leider gibt es keinen besseren Begriff, um die Energie zu beschreiben. Daher verwenden wir das Wort Kalorie notgedrungen weiter.
Folgendes Experiment mit der Nahrung ist zur Illustration des Gesagten geeignet: Unter der Vorstellung, dass diese zu Gewichtsabnahme führt, wurde die Atkins Diät entwickelt. Angesichts der eben dargestellten Wirkung von Kohlenhydraten nahmen sich die Menschen dabei vor, vollständig – soweit es möglich ist – auf Kohlenhydrate zu verzichten und hauptsächlich Fett und Eiweiß zu essen. Sie wurden in der Tat nicht dick, obwohl sie insbesondere mit dem Fett sehr viele Kalorien zu sich genommen hatten. Nach der Menge der Kalorien zu urteilen, hätten sie eigentlich entsprechend der alten Vorstellung, dass die Kalorien in der Nahrung darüber entscheiden, ob man dick wird, zunehmen müssen.
Eine ähnliche Beobachtung gilt auch für Menschen, die sich natürlicherweise ganz überwiegend von Fett ernährten, z. B. die Eskimos. Sie haben über Jahrtausende im Wesentlichen das fettige Fleisch der gefangenen Fische und Wale gegessen, Getreide und Kartoffeln kannten sie nicht. Sie waren schlank und wurden erst übergewichtig, als sie die “westliche“ Nahrung übernahmen, die reich an Kohlenhydraten ist.
Nach dieser Beobachtung müssen wir folgenden Schluss ziehen:
Die Kalorien, die wir zu uns nehmen, sind nicht der entscheidende Gesichtspunkt. Die Wirkung der Nahrung auf Insulin und damit auf seinen Fett speichernden Effekt spielt eine viel größere Rolle.
Ich möchte mich auch für mich und meine gesamte Branche der verständigen ärztlichen Kittelträger an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass über eine lange Zeit diese offensichtlich falsche Vorstellung aufrechterhalten wurde. Ich habe es ja selbst getan, weil doch die Vorstellung, dass die Kalorien, nämlich Fett in der Nahrung, direkt in unserem Fettgewebe landen würde, so einleuchtend erscheint. Aber es ist nicht so!
Natürlich haben Kalorien für das Gewicht eine Bedeutung. Wenn er keine Kalorien zu sich nimmt, verhungert der Mensch. Er kann aber nicht allein mit sehr vielen Kalorien, die in Form von Fett gegessen werden, dick werden. Entscheidend dafür ist die An- oder Abwesenheit von Insulin, das auf Kohlenhydrate reagiert. Wenn der Körper gerade auf die Kalorienaufnahme( z.B. es bestehen hohe Insulin-Spiegel) eingestellt ist, dann macht es sicher einen Unterschied, ob viele oder wenige Kalorien in Form von Fett gegessen werden. Vielleicht aus diesem Grunde wird empfohlen, Kalorien zu „verdünnen“, wenn man sie isst. Für eine Verdünnung der Kalorien sorgen Gemüse, Pflanzenprodukte, Salat und ähnliches, ja auch reines Fleisch, aber keine Kohlenhydrate. Diese hier angesprochene Wirkung entsteht durch ein Zusammenspiel verschiedener Effekte, die durch die Strukturen wie Fasern der Gemüse, Obst und Ähnliches, ja sogar durch die Fasern des Fleisches ausgeübt werden. Die Wirkung der Fasern im Gemüse wird in Kapitel 7 dargestellt.
Es sind also nicht einfach die Kalorien, die uns dick machen. Man kann auch Beispiele für Nahrungsmoleküle finden, die zwar chemisch gesehen Kalorien enthalten, die aber trotzdem vom Stoffwechsel nicht ohne weiteres als Energielieferant verwendet werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Fruktose. Aus chemischer Sicht enthält sie genauso viele Kalorien wie die Glukose, der wichtigste Energielieferant. Zu Verfügung steht die Fruktose aber nicht. Sie muss in einem völlig anderen chemischen Weg verstoffwechselt werden, durch den schädliche Stoffe Fetttröpfchen in der Leber entstehen lassen (so bildet sich eine Fettleber) und Harnsäure entsteht. Und dies spielt sich nur in der Leber ab, alle anderen Energie-bedürftigen Gewebe (unser Gehirn, unsere Muskeln) haben keine Enzyme, um Fruktose zu nutzen (siehe auch Kapitel 18). Es ist daher unsinnig, sie als Kalorie in einer möglichen Bilanzberechnung aufzuführen. Kalorie ist eben nicht gleich Kalorie, was die Wirkung im Körper betrifft.
Das Beispiel der Fruktose zeigt, dass es auf die biochemische Reaktion des Körpers ankommt, welche Wirkung ein aufgenommenes Molekül in der Nahrung hat.
Und so wollen wir auch auf die anderen Nahrungsbestandteile neben den Kohlenhydraten sehen: Wie ist die Reaktion auf Fett? Die große Masse von Fett wird ja in Form von Fettsäuren aufgenommen. Verdauungssäfte, die ein dafür wirksames Enzym enthalten, bewirken, dass die Fettanteile in der Nahrung durch die Darmwand geschleust werden. Von hier werden die typischen Fettmoleküle, nämlich die Fettsäuren, verpackt in kleinen fetthaltigen Bläschen, in das Lymphsystem des Verdauungstraktes gebracht, von wo sie in das zirkulierende Blut gelangen. Nun können Organe wie Muskeln oder Leber das Fett herausfischen und hieraus beispielsweise Energie gewinnen. Oder aber diese Fettsäuren können ihren Weg in das Fettgewebe finden, wo sie zu Speicherzwecken eingebaut werden. Wichtig für unser Anliegen ist, dass dieser Schritt durch die Aktivität eines Enzyms an der Oberfläche der Fettzellen erreicht wird. Nicht die Menge der im Blut zirkulierenden Fettsäuren (die von der Menge der gegessenen Nahrung beeinflusst wird) entscheidet darüber, ob das Fett in die Fettzellen eingebaut wird, sondern die Aktivität dieses Enzyms an der Zelloberfläche, sei es eine Leberzelle, eine Muskelzelle oder eine Fettzelle. Und hier ist der Ort, an dem Insulin wirkt. Die Aktivität dieses Enzyms hängt von der Höhe des Insulinspiegels im Blut ab. Wenn viel Insulin da ist, wird von dem zirkulierenden Fett viel in die Fettzellen eingebaut. Fehlt Insulin, kann das Fett kaum in das Fettgewebe eingebaut werden. Wir bleiben schlank!
Wenn der Blutzucker schnell ansteigt, z.B. nach dem Essen von Süßigkeiten, in denen Glukose und Fruktose einzeln vorhanden sind, wird Insulin besonders schnell freigesetzt. Wenn andere Formen von Kohlenhydraten in der Nahrung vorhanden sind, dauert es länger, bis die Enzyme des Verdauungstraktes diese sogenannten Polysaccharide zu einzelnen Zuckermolekülen, also Glukose, abgebaut haben (s. Abb. 2, S.→). Aber auch diese Glukose wird in ihrem langsamen Konzentrationsanstieg zu einem dann langsamen und geringeren Insulinanstieg führen. Man kann die Nahrungsmittel dann unter der Frage, wie schnell eigentlich die Glukose nach dem Essen im Blut erscheint, klassifizieren, siehe dazu siehe Exkurs Kapitel 8.
Man muss also annehmen, dass die Vorstellung von der Kalorienbilanz nicht richtig ist, da es ganz unsicher ist, wieviele von den eingenommenen Kalorien tatsächlich im Fettgewebe gehortet werden (siehe Exkurs). Dies hängt ja von der Menge Insulin ab, die wirkt, und nicht von der Kalorienanzahl des Gegessenen. Fett in der Nahrung ohne begleitenden Insulinanstieg führt zu keiner Gewichtszunahme.
Aber es scheint doch so einleuchtend, dass die Bilanz zwischen Einfuhr und Ausfuhr die Menge der im Fettgewebe gehorteten Kalorien bestimmt. Da gibt es sogar das Energieerhaltungsgesetz der Thermodynamik: Es kann keine Energie verloren gehen. Das ist korrekt, allerdings ist der menschliche Körper kein physikalischer Raum, in den, energetisch genau berechenbar, etwas hinein- und hinausgeht. Dies Bild führt in die Irre, da wir als Lebewesen einer komplexen biochemischen Regulation aller Vorgänge unterliegen. Am Zugang zu unserem Fettgewebe steht gewissermaßen ein Wächter, der Fett herein- und herauslässt, je nach dem Kommando des Insulins. Wenn viel Fett erscheint (nach dem Essen) interessiert ihn das nicht, erst wenn viel Insulin da ist, lässt er das Fett in die Speicher.
Exkurs:
Problem Kalorienbilanz
Seit einiger Zeit halten viele Wissenschaftler die Vorstellung, dass es eine Kalorienbilanz gäbe, über deren Beeinflussung man sein Gewicht reduzieren könne, nicht für sinnvoll. Kalorienbilanz bezieht sich hier auf den gesamten Körper, der dadurch, dass Kalorien verbraucht werden (Grundumsatz, körperliche Bewegung), an Gewicht abnehmen könnte. So würde bei entsprechender Verminderung der Einfuhr von Kalorien die Bilanz negativ.
Einmal abgesehen davon, dass körperliche Bewegung Hunger macht ebenso wie weniger zu essen, worauf im Folgenden ausführlich eingegangen wird, gibt es eine Reihe von Fragezeichen zu diesem Gedanken. Dazu gehört, dass unglaublich wenige Kalorien durch körperliche Anstrengung verbraucht werden. Wenn Sie sich z.B. vornehmen, mit 10 000 Schritten Kalorien zu verbrauchen, dann schaffen Sie bei 80 kg Körpergewicht gerade einmal etwas mehr als einen Verbrauch von 300 Kalorien. (Siehe Abb.4)
Abb. 4: Auf dem Begleit-Zettel zu einem Schrittzähler kann man Angaben finden, wie viele Kalorien verbraucht werden, je nachdem, welches Körpergewicht Sie haben. Ich brauche 45 Minuten für 8000 Schritte. Mein Kalorienverbrauch mit meinem Körpergewicht von 80 kg ist mit 300 Kilokalorien deprimierend gering. Mit Umziehen und Duschen verbrauche ich dafür 1 Stunde!
Ich finde unbedingt, dass es sehr schön wäre, wenn Sie solche Bewegungen in einen Tagesablauf hineinbekämen, wie es in Kapitel 12 beschrieben ist. Hier geht es um die Kritik an dem Konzept der Kalorienbilanz. Es ist kaum zu schaffen, auf diese Weise wirklich nennenswerte Mengen Kalorien regelmäßig abzutrainieren.
Soweit die „Ausgaben-Seite“ der Kalorienbilanz. Die andere Frage ist, welche Wirkung die Nahrungsmittel haben, die als Kalorien auf der „Einnahmen-Seite“ der Kalorienbilanz gezählt werden.
Die Kalorien, die über unseren Mund in den Körper hineinkommen, sind unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten nicht identisch mit dem, was an Kalorien als Fett in unseren Fettzellen ankommt:
Beispiel: Die Menge der Kalorien, die ein Molekül unter chemischen Gesichtspunkten darstellt, kann nicht vom Körper nutzbar gemacht werden und kann nicht vom Körper in speicherbares Fett umgewandelt werden, z.B. viele Moleküle in Pflanzen. Sie werden unverändert ausgeschieden.Beispiel: Nur wenn der Verdauungstrakt die Stoffe auch so zerlegen und resorbieren kann, dass alles im Körper ankommt, kann schließlich speicherbares Fett entstehen. Das könnte beispielsweise durch eine Krankheit behindert sein, die die Verdauung behindert. Weniger dramatisch: Im normalen Alltag kann man sich diesen Mechanismus in folgender Situation zu Nutze machen: Wenn man vor dem Essen von Kohlenhydraten, die ja nach der Resorption als Blutzucker erscheinen, viele Ballaststoffe isst (der Salat vor dem Essen), wird man einen viel flacheren Blutzuckeranstieg beobachten. Es wird Glukose verzögert in den Körper aufgenommen. Der Effekt auf den Insulinspiegel wird geringer sein und die Gewichtszunahme entsprechend unterschiedlich trotz formal gleicher Kalorienaufnahme beim Essen.




























