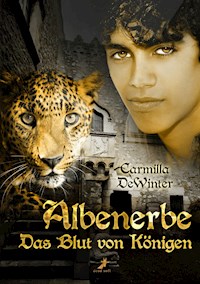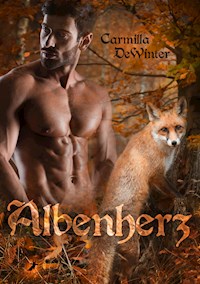Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Roter Drache
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Vor fünfundzwanzig Jahren haben die Helgen aus dem Norden das Land Iradoun eingenommen, doch dessen Reichtümer sind ihnen nicht mehr genug: Die nordischen Besatzer gieren nach den Schätzen südlich der Wüste. Gleichzeitig bereiten königstreue Verschwörer einen Aufstand vor und verbünden sich dafür mit einem Jinn. Dieser Jinn jedoch verfolgt seine eigenen Ziele. Währenddessen wünscht sich die Hure Maya nichts sehnlicher als eine eigene Familie, Politik ist ihr gleichgültig. Erst als sie dem entlaufenen Zwangsarbeiter Khamer bei der Flucht vor den Besatzern ihrer Heimat hilft, begreift sie, dass sie sich den Intrigen nicht länger entziehen kann. Noch ahnt niemand, dass in ihr ein Geheimnis schlummert, auf das es einer der Verschwörer besonders abgesehen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARMILLA DEWINTER
Jinntöchter
K_ EIN ORIENTALISCHES MÄRCHEN
Edition Roter Drache
1. Auflage Februar 2018
Copyright © 2017 by Edition Roter Drache.
Edition Roter Drache, Holger Kliemannel, Haufeld 1, 07407 Remda-Teichel
[email protected]; www.roterdrache.org
Titelbild- und Umschlaggestaltung: Jörg Schlonies, www.dojoerch.de
Buchgestaltung: Holger Kliemannel
Lektorat: Isa Theobald
Gesamtherstellung: Wonka Druck
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (auch auszugsweise) ohne die schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-964260-32-1
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Erster Abend
Zweiter Abend
Dritter Abend
Vierter Abend
Dankeschön
Die Autorin
Weitere Bücher
ERSTER ABEND
Eine Geschichte? Dann kommt näher. Meine Stimme reicht nicht bis in den hintersten Winkel dieser Taverne.
Verzeihung, Herr Wirt. Gasthaus.
Natürlich wäre ein Mann lauter, aber keiner von euch braven Handwerkern – wenn dein Geselle ungezogen ist, dann kann ich gern mit einer großen Schere aushelfen – wie gesagt, keiner von euch kennt Geschichten aus Ländern, wo die Leute eine andere Sprache sprechen als ihr.
Was? Es ist ein Unterschied, ob ich es erzähle oder jemand, der Helgisch mit der Muttermilch aufgesogen hat, finde ich.
Ab und an werde ich auch Schmiermittel brauchen.
Ein Tee aufs Haus? Vielen Dank, Herr Wirt. Ich sehe, du erinnerst dich an meinen letzten Besuch hier.
Aber nun zu meiner Geschichte. Es ist eine Geschichte aus meinem Heimatland und einer weit entfernten Zeit – und trotzdem wird es euch manchmal so vorkommen, als sähet ihr in einen Spiegel. Wer mutig ist, blickt länger hinein und ist nachher vielleicht ein kleines bisschen weiser.
Jetzt macht es euch bequem, schließt für einen Moment die Augen. Spürt ihr den Wüstenwind, der euch heiß ins Gesicht bläst und jede Feuchtigkeit stiehlt? Spürt ihr, wie die winzigen Sandkörner über eure Haut schmirgeln?
Eure Haut, eure Lippen spannen. Und seht ihr, wie der Sand rot schimmert?
Dann folgt mir jetzt in das Land südlich des Meeres.
Es war einmal – vielleicht aber auch nicht – dass die Helgen dort ungern gesehen waren. Jenes Land hieß, und heißt auch heute noch, Iradoun – was Fruchtbares Land bedeutet. Die Bewohner nennen sich selbst die Dawanin, die Leute aus dem Doun. Nach Süden begrenzt wird das Iradoun durch die Roten Berge, und dahinter beginnt die Wüste.
Zu jener Zeit lag es erst eine Generation zurück, dass die Helgen die einzelnen Fürstentümer des Iradoun durch List und Verrat erobert hatten. Kein Tag verging, dass nicht irgendein Einheimischer die Helgen wenigstens in Gedanken Shubkhin schimpfte – die gespenstischen Leute.
Die Dawanin glauben nämlich, dass in der Wüste im Süden nachts Gespenster umgehen, Gespenster mit bunten Augen. Und jeder zweite Helge hat grüne oder blaue Augen, nicht wahr? Die anderen haben hellbraune, und das ist den Dawanin so gut wie gelb.
Noch zwei Jahrhunderte bevor die Helgen kamen, war das Iradoun ein Königreich gewesen, doch der König war ohne Erben gestorben, als ein hungriges Volk aus dem Osten einfiel. Jenes Volk brachte Pferde, Tee und gefalteten Stahl mit. Es fand Gefallen am sesshaften Leben, ließ sich nieder und vererbte seine Adlernasen weiter. Nach einigen Streitigkeiten unter dem neuen Adel zerbrach das Land in Fürstentümer, Efiras genannt.
Die alte Königsstadt, Taqat, liegt am Fuß der Roten Berge. Umgeben von einer vier Mann hohen Stadtmauer, die an jeder Ecke ein Rondell mit Geschützen hat, erstrecken sich an einem nur leicht ansteigenden Hang Lehmhäuser mit flachen Dächern, eins am anderen. Die Fenster und Türen sind blau gestrichen, denn das hält die Fliegen fern. In den Innenhöfen, sofern sich die Bewohner einen leisten können, wachsen Dattelpalmen, Maulbeer- und Pomeranzenbäume. Wo es keinen Garten gibt, stellen die Menschen sich im Sommer wenigstens ein Zelt aufs Dach, in dem sie nachts schlafen.
Bevor die Helgen kamen, war Taqat eine stolze Stadt gewesen, mit einem prächtigen Palast und zahlreichen Tempeln für die drei Gottheiten, die die Dawanin verehrten. Doch die Helgen hatten alle Tempel zerschlagen, sodass die Brachen wie Lücken in einem ansonsten weißen Gebiss wirkten. Nur an manchen Stellen hatten die Eroberer stattdessen ein Heiligtum für Harr errichtet, aus Fachwerk, das Holz mit Fratzen beschnitzt, dass einem vor so viel grobem Handwerk gruselte. Und wenn ich die Ruinen mit Zahnlücken vergleiche, dann waren die Heiligtümer wie verfaulte Zähne.
Ein weiterer Frühsommermorgen zog wolkenlos auf, über dieser Stadt ohne eigene Götter, als eine junge Frau mit dem gelben Schleier einer Hure aus einem Seiteneingang des Palasts des Statthalters schlüpfte.
Maya überholte eine Dienerin, die fünf flatternde, gackernde Hühner trug, wollte um die nächste Ecke auf den Blutplatz vor dem Palast und prallte vor einer Mauer aus Menschen zurück.
Die Leute waren still, einige standen auf den Zehenspitzen. Dann erklang das eintönige Trommeln, mit dem die Helgen oft ihre Truppenbewegungen begleiteten. Eine Hinrichtung?
Besser, Maya nahm einen Umweg. Doch die Dienerin mit den Hühnern war stehen geblieben, und von hinten drängten noch weitere Schaulustige heran.
In diesem Fall blieb Maya nur die Flucht nach vorn. Sie senkte den Kopf und zwängte sich durch die Menge zur Palastmauer, von der man üblicherweise einen Schritt Abstand hielt.
Dank der Aussicht auf ein Spektakel beachteten die anderen weder den gelben Schleier noch das blaue Auge. Sintram hatte sich entschuldigt, ihr vier Silbereschen zusätzlich bezahlt und ihr einen ganzen Sack Zuckermandeln überlassen. Es war wirklich nicht seine Schuld, dass sie bei Dunkelheit über seine, hm, Spielzeugtruhe gestolpert war und sich den Kopf an der Bettkante gestoßen hatte, aber das alles konnte natürlich keiner ahnen.
Die Trommeln waren verstummt, jemand las mit eintöniger Stimme auf Helgisch die Liste der Verbrechen vor: Schmierereien am großen Harrsheiligtum und anderswo, Verschwörung gegen die Staatsgewalt.
Mittlerweile war Maya hinter der hüfthohen Tribüne aus Holz angelangt, auf der die Mächtigen und Reichen der Stadt sich zu solchen Anlässen niederließen. Dicht an dicht saßen sie da und reckten die Hälse. Die Sonne spiegelte sich in Juwelen, Goldschmuck und Seidenstoffen aus dem Osten.
Noch fünfzig Schritte bis zur nächsten Gasse.
Der Angeklagte, eine junge Stimme, brüllte: »Der König wird zurückkehren! Und es wird euch allen leidtun!«
Maya runzelte die Stirn. Schon wieder einer dieser Königstreuen. Hatten die Halbwüchsigen nichts Besseres zu –
Etwas Hellblaues flog ihr entgegen, sie zuckte zurück, trotzdem fand der kleine Knubbel ihr Auge; einer, wie sie an den Streben eines Schirmes zu finden waren.
»Zift«, fluchte sie leise und wischte danach, etwas riss mit einem stumpfen Ton wie eine ungestimmte Saite.
Tränen liefen über ihr Gesicht, ihr Auge brannte. Wie das Schicksal es wollte, hatte es ausgerechnet das Gute erwischt.
Die Frau, der der himmelfarbene Schirm gehörte, stand auf und drehte sich zu Maya um. Es war gar keine Shubkha, sondern eine von hier, in einem geschnürten nordischen Kleid. Ihre schwarzen Locken hatte sie mit einem Netz voll blauer Glasperlen gebändigt, passend zu dem Schirm, der jetzt einen Knubbel weniger hatte und somit einer Reparatur bedurfte.
Maya presste die Lippen aufeinander und schickte die Verachtung zurück. Zu einem gelben Schleier kam manche Frau viel schneller, als ihr lieb war.
Die Dame warf einen bedeutungsvollen Blick auf die nackte Strebe des Schirms.
Und? Letztes Jahr hatte ein Kunde Maya einen aus rosafarbener Seide geschenkt, mit kleinen Schleifchen dran. Maya hatte ihn genau einen Nachmittag lang benutzt und dann verkauft. Immer brauchte sie eine Hand, um ihn festzuhalten, und in den engen Gassen blieb sie dauernd hängen. Wer zu einer Hinrichtung so ein Ding mitbrachte, war selbst schuld.
Die andere kniff die Augen zusammen, als sie merkte, dass Maya sich nicht entschuldigen würde. »Das wirst du mir bezahlen.«
Der Mann rechts neben ihr drehte sich um und die Götter zogen Maya den Boden unter den Füßen weg, ihr Magen wurde flau.
Gekleidet in ein dunkelblaues, golddurchwirktes Gewand, sah Rhulib u Gayb auf sie herab. Er war, glaubte man den Gerüchten, der reichste Mann Taqats – und ihr Onkel.
Seinem Lächeln nach zu urteilen, hatte er sie ebenfalls erkannt und weidete sich nun an ihrem Unglück.
Jetzt erhob sich auch der Helge links neben der Frau mit dem Schirm und griff nach seinem Schwertknauf. Irgendein höherer Beamter am Hof des Statthalters.
Maya wich einen Schritt zurück.
»Hat dieses Weib dich belästigt, meine Liebe?«
»Dieses Flittchen hat meinen Schirm zerstört!« Akzentfreies Helgisch.
Der Beamte schien die Augen verdrehen zu wollen. Wahrscheinlich hielt er von Sonnenschirmen genauso wenig wie Maya.
»Es war keine Absicht, mein Herr.« Sein Verständnis galt es zu nutzen, sofern ihn Mayas Akzent nicht beleidigte. Da war sie zur Hälfte helgisch, wenn auch Bastard, und hatte nichts davon, brachte weder das H noch das R richtig heraus. »Es tut mir sehr leid.«
»Oder vielleicht war es nur ein missglückter Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erregen«, sagte Mayas Onkel. »Vielleicht findet Ihr es in Euch, diesem bedürftigen Weib zu verzeihen, meine Dame.«
Oh. Dieser … Wie konnte er es wagen! Maya hob ihr Kinn, und dennoch brannte die Scham auf ihren Wangen.
Dann stieg Rhulib über die Bank, was Gemurmel und Unruhe unter den anderen Zuschauern verursachte. Der Shubkhi, der rechts neben ihm saß – ein kräftiger, blonder Krieger mit wasserhellen Augen, der für Rhulib arbeitete, seit Maya sich erinnern konnte – drehte sich, schenkte Maya ein zahniges Grinsen und wandte sich dann wieder der Hinrichtung zu.
Ein Schauer lief ihr über den Rücken, denn noch weniger als Männer, die zu oft auf ihre Brüste starrten, konnte sie Männer leiden, die gar nicht auf ihre Brüste starrten.
Erstaunlich geschickt für einen Mann um die fünfzig sprang Rhulib von der Tribüne zu Maya auf den Boden. Der Beamte griff seine Frau am Arm, sie setzten sich wieder.
»Was sollte denn das?«, zischte Rhulib auf Dawan. »Bist du schon so verzweifelt, dass du mich in der Öffentlichkeit anbetteln musst?«
Mayas Hände ballten sich zu Fäusten. Sollte er doch glauben, was er wollte.
»Wie du aussiehst, scheint es mit der bestbezahlten Hure von Taqat nicht mehr weit her, hm?« Aus einer Tasche förderte er einen Goldraben zutage. »Ich kann einen davon im Monat erübrigen, wenn du mich von nun an in Frieden lässt.«
Einen Augenblick lang war Maya versucht, das Angebot anzunehmen, denn so käme sie kurzfristig über die Runden, falls – wenn – sie sich entschloss, ein Kind zu haben. Aber dann erinnerte sie sich an die gebrochenen Augen ihrer Mutter, die vor zehn Jahren bei ihm vorgesprochen hatte, damit er Mayas Mitgift aufstockte, und noch in der gleichen Nacht einen ganzen Scheffel Petersiliensaat gegessen hatte.
Wäre er damals großzügig gewesen, müsste sie sich heute nicht verkaufen. Sie zog den Rotz hoch und spuckte ihrem Onkel nach Nordmannsart vor die Füße. »Und wenn ich in der Gosse schlafen müsste, ich wollte dein Geld nicht.«
Damit richtete sie ihren Schleier und stolzierte davon, so aufrecht, wie es nur die bestbezahlte Hure von Taqat fertigbrachte.
Nun bemerkte Maya nicht, dass der Krieger mit den wasserhellen Augen ihr hinterhersah. Er lächelte. Natürlich wusste er, dass die junge Frau nicht so dringend Geld brauchte, wie der Onkel glaubte. Aber daran, wie sie ihre Finger bewegte, wie sie beinahe nach der Münze gegriffen hatte, zeigte sich, dass das Warten sich gelohnt hatte. Jetzt kam es nur noch darauf an, Rhulib u Gayb von der Leine zu lassen wie einen gefräßigen Hund.
»Hört Ihr, wie verhalten die Menge diesen Tod begrüßt hat?«, flüsterte er seinem Mitverschwörer ins Ohr, als dieser wieder auf die Tribüne geklettert war.
Rhulib wackelte mit dem Kopf.
»Es ist Zeit, den Eindringlingen zu beweisen, dass der wahre König lebt.«
»Heute haben sie auch nicht weniger gejubelt als das letzte Mal.«
»Trotzdem. Etwas ist anders.« Der Krieger hob den Kopf und schnupperte. »Ich kann es riechen.«
»Das liegt nur daran, dass dieser Loheschopf Sintram und sein stinkender Köter nicht hier sind.«
Der Mann mit den wasserhellen Augen lachte auf und fing sich einige ungehaltene Blicke der anderen Zuschauer ein. Rhulib schaute zum Himmel, als bitte er um einen besser erzogenen Begleiter. Da wusste der Krieger, dass er den anderen überzeugt hatte.
Mit einem siegessicheren Lächeln beobachtete er, wie zwei Wächter den Leichnam des Aufständischen und den Kopf dazu in eine Kiste hoben und wegtrugen.
Jedoch ahnte er nicht, dass die Abwesenheit des rothaarigen Hauptmanns Sintram und dessen Hund Einfluss auf seine sorgfältig gesponnenen Pläne haben würden.
Aber hört ihr nicht schon am Namen, dass der Hauptmann Sintram ein Helge ist? Oder besser gesagt, ein Gander, aber zu jenem Zeitpunkt machten weder helgisches Recht noch die Sprache einen Unterschied zwischen diesen beiden Völkern, waren sie doch die ersten, die sich zu Harr bekannt hatten.
Jedenfalls würde kein Dawani, der etwas auf sich hält, sich in Begleitung eines Hundes zeigen. Hunde sind keine Tiere für Städte wie Taqat, wo sie weder jagen noch Vieh hüten können. Wenn Streuner doch einmal Abfall auf den engen Gassen finden, durchwühlen sie den, ansonsten bleibt ihnen nichts an Nahrung als die Haufen ihrer Artgenossen. Deshalb sind Hunde in den Städten des Iradoun nur geringfügig beliebter als Ratten und Mäuse und schlechter geachtet als Schaben.
Aber von Hauptmann Sintram werden wir später noch hören.
Nur zwei Tage nach Mayas Begegnung mit ihrem Onkel näherte sich eine Karawane den Roten Bergen von Süden. Es war eine Karawane der Yeldun, jenes Volkes, das in den Schwarzen Bergen inmitten der Sandwüste lebt. Die Sandwüste heißt Qaldoun.
Obwohl beide Völker Dialekte der gleichen Sprache benutzen, finden die Dawanin die Yeldun äußerst rätselhaft.
Warum sind wir jetzt in der Wüste? Was ist das für eine Frage?
Ist nicht eine gute Geschichte wie ein Teppich? Hunderte einzelne Fäden werden verknotet und ergeben in ihrer Gesamtheit ein Bild, dessen Schönheit dir, wenn die Knüpferin oder die Erzählerin etwas taugt, den Atem raubt.
Du wirst also schon noch sehen, warum ich hier anfange, von den Yeldun zu berichten, während in Taqat Maya und Rhulib u Gayb ihren Geschäften nachgehen.
Jene Karawane bestand aus dreißig Lastkamelen, die schwer an Indigo, feinem Baumwolltuch, Zucker, Kaffeebohnen, Safran und Tonflaschen mit Arganöl trugen. Ah, ich merke schon, ihr wisst, von welchen Köstlichkeiten ich spreche.
Fünfzehn Menschen begleiteten die Karawane auf weißen Kamelen. Dreizehn dieser Menschen trugen ungefärbte Kleidung, die anderen beiden waren in Blau gewandet, doch außer der Farbe gab es keinen Unterschied in der Tracht. Ein wadenlanges Hemd, darunter eine Hose, darüber ein weiter Mantel, so wie meiner. Er wird zum Reiten mit einem Gürtel gehalten, damit der Säbel immer griffbereit ist.
Die Mäntel der Dawanin dagegen sind eng und haben eine Kapuze. Die Frauen tragen ein Kleid unter ihrem Mantel, die Männer Hemd und Hosen.
Auf dem Kopf hatten die Yeldun, die unsere Karawane begleiteten, ein – nein, eben keinen Turban.
Es ist mir gleich, was unter der Wandmalerei im Ratskeller steht. Allein, dass es ein Turban heißt und nicht ein Turab oder Turb, sollte dir verraten, dass es sich hierbei nicht um ein Wort aus meiner Heimat handelt. »an« hinten ist immer die weibliche Mehrzahl, bei uns.
Die Männer der Yeldun tragen immer ein Shekh auf dem Kopf, und dieser Brauch ist so alt, dass das Wort aus einer Sprache stammt, die lange vor dem letzten König des Iradoun gestorben ist. Die Frauen der Yeldun tragen nur ein Shekh, wenn sie auf Reisen sind – und ich bin eine Frau auf Reisen, genau.
Ein Shekh ist ein fast zwei Ellen breites, bis zu zwanzig Ellen langes Tuch aus Baumwolle, das kunstvoll um den Kopf geschlungen wird – der vorstehende Rand schützt die Augen vor dem schlimmsten Sonnenlicht wie eine Hutkrempe, und das eine Ende ist lose, hier, seht ihr? Ich kann es entweder rechts über die Schulter hängen lassen, dann ist das Shekh offen, oder den einen Zipfel links hineinstopfen, sodass nur noch die Augen zu sehen sind, dann bin ich verschleiert. Wer im Qaldoun mit offenem Shekh unterwegs ist, verbrennt sich das Gesicht, also hatten sich alle Reisenden verschleiert.
Einer der zwei Menschen in Indigoblau ritt am Ende des Zuges und betrachtete den Flug eines einsamen Adlers über den Roten Bergen. Vorne ritt, auf einem besonders stattlichen Kamel mit einem außergewöhnlich prächtig bemalten Holzsattel, die Karawanenführerin.
Es war jedoch nicht der Adler, der dazu führte, dass sie ihr Kamel mit einem scharfen »Qif!« zum Anhalten brachte.
Das Kamel – ein kastriertes Männchen – nahm die Pause zum Anlass, ein paar Zweige von einem einsamen Kameldornbusch zu zupfen.
Fayruza beschützte ihre Augen vor der tiefstehenden Sonne. Rauch stieg von weiter oben am Hang des Quellbergs auf, genau da, wo die sicherste Lagerstelle war. Von dem flachen Fels hatte eins den besten Ausblick in den ganzen Roten Bergen.
Hinter ihr grunzte ein anderes Kamel.
»Qif, du blödes Vieh!«
Fayruza drehte sich um und starrte die Kamelstute ihres Bruders nieder, sodass die neben ihr anhielt.
Khamer straffte die Schultern, als hätte er das ganz alleine bewerkstelligt. Dabei war sein Verhältnis zu Kamelen noch nie das beste gewesen – jedes dieser edlen Tiere wusste wohl allein vom Hinsehen, dass er lieber daheim bleiben wollte und behandelte ihn entsprechend. »Sieht aus, als wäre uns wer zuvorgekommen.«
»Hm«, machte Fayruza. Unwahrscheinlich, in diesen unsicheren Zeiten.
»Oder an der Sache mit dem irren Nordmann ist doch was dran«, meinte Khamer weiter. »Nana Titrit behauptet, dass da einer dieser Shubkhun lebt, um seinem Gott näher zu sein.«
Fayruza verzog die Nase. Schon seit Jahren half Nana Titrit bei ihren Visionen mit Hanf nach. »Du solltest lieber reiten üben, statt solchem Gewäsch zu lauschen.«
Khamer sah weg und zupfte seinen Schleier zurecht. »Wenn es nur einer ist, wäre genug Platz für uns alle.«
Wenn es nur einer war, ja. Aber wenn nicht? Fayruza würde in jedem Fall eine Späherin vorschicken müssen. »Wir haben keine Zeit.« Abgesehen davon hatten sie auch nicht die Kraft, sich mit irgendwem anzulegen. Seit siebzehn Tagen waren sie unterwegs, drei mehr als üblich, denn ein verspäteter Sandsturm hatte sie gezwungen, sich zu verkriechen – ausgerechnet im Aschental, wo es nur zur Regenzeit alle paar Jahre Wasser gab und nichts für die Kamele wuchs. Als sie sich hinausgewagt hatten, mussten sie feststellen, dass das Tal eine gute Tagesreise nach Südosten gewandert war. Elende, gottverlassene Wüste, der die Zauberei aus jeder Lücke zwischen den Sandkörnern quoll.
»Wir übernachten im Augental«, beschloss Fayruza. Dort konnten die Tiere so viel fressen, wie sie wollten, und Wasser wäre auch genug da.
»Wenn ich wen in einen Hinterhalt locken wollte, würde ich es genauso machen«, bemerkte Khamer.
Als wüsste Fayruza das nicht selbst. Aber es war die zweitbeste Stelle. Sie warf ihrem Klugscheißer von Zwilling einen giftigen Blick zu, was einen neuerlichen Griff zu seinem Shekh verursachte.
»Los, du Fettwanst«, sagte sie zu ihrem Kamel. Mit einem unlustigen Brummen setzte sich der Dicke wieder in Bewegung.
Fayruza führte die Karawane um den Quellberg herum und lenkte den Dicken schließlich nach links in das Tal, das der Augenfluss Richtung Norden gefressen hatte. Zwar versickerte er nicht einmal eine Stunde Wegstrecke nördlich zwischen den Felsbrocken, die sich von hier bis zu den Roten Bergen erstreckten, doch im Schutz des Berges gluckerte der Fluss beruhigend vor sich hin. An seinen Ufern wuchs sogar Gras.
Fayruza ließ die anderen an sich vorbei und starrte nach Norden, wo der Sonnenuntergang die Berge in märchenhafte Farben tauchte, orange, rot, rosa. Die schrägen grünen Streifen im Fels leuchteten. Weiter im Osten thronte der Alte Mann über den restlichen Gipfeln wie eine Greisin über ihrer Nachkommenschaft, doch die Kappe aus weißem Schnee, die dem Berg seinen Namen gab, fehlte. Im dritten Jahr jetzt. Gewöhnlich taute sie erst zur Sonnenwende.
Offenbar stand dem Iradoun ein weiterer heißer Sommer ins Haus. Fayruza konnte das herzlich gleich sein, sie würde, sofern alles gutging, erst im Herbst wiederkommen. Aber zuerst mussten sie diese Reise beenden. Noch ein Tag über das Steinfeld, dann über den Pass, und am Mittag des dritten Tages würden sie Taqat erreichen, die Hauptstadt des Iradoun. Oder Iradunland, wie die Nordmänner sagten.
Sogar dem Qaldoun hatten sie ihr »Land« schon angehängt, und das konnte nur bedeuten, dass sie sowohl das Qaldoun als auch die Schwarzen Berge mitten darin besitzen wollten. Warum sonst waren im letzten Herbst nur zwei von zehn Karawanen zurückgekehrt?
Diese hier war der erste Versuch nach den Frühjahrssandstürmen. Um sich sicher zu fühlen, hätte Fayruza doppelt so viele Begleiterinnen benötigt, aber die fünfzehn hier waren die Ausbeute von drei Tälern – alle anderen hatten sich nicht mehr nach Norden getraut. Sie mochte es ihnen nicht verübeln, obwohl sie Salz brauchten und ihnen der Tee langsam ausging.
So nah an der Grenze kribbelte es ihr nun ebenfalls im Nacken. In den wachsenden Schatten zwischen den Findlingen des Steinfeldes konnte sich alles Mögliche verbergen. Heute Nacht würde sie vier Wachen aufstellen, eine für jede Himmelsrichtung.
Als Fayruza sich aus ihren Betrachtungen löste und zum Lager ritt, hatten die anderen die Lastkamele vom Gepäck befreit, über dem Feuer kochten Tee und Hirse. Hier im Tal war es schon sehr dunkel.
Khamer schenkte den Tee aus, während Fayruza die ersten vier Wachen auf ihre Posten schickte. Weil die Hirse noch nicht gar war, forderte eine von Fayruzas Kameltreiberinnen eine Geschichte von Khamer.
An dem Leuchten in seinen roten Augen erahnte Fayruza das breite Lächeln unter seinem Schleier.
Sie nickte ihm zu, also zog er am langen Ende seines Shekhs und ließ es sich über die Schulter fallen. Nicht, dass ohne den Schleier viel zu sehen gewesen wäre – Khamer war noch ein bisschen schwärzer als Fayruza, was sie ihrem Erzeuger verdankten, einem Hirsebauern der Mande, die südlich des Qaldoun lebten.
Die anderen in der Gruppe hatten sich daran gewöhnt, dass Fayruza ihrem Bruder erlaubte, seine Geschichten ohne Schleier zu erzählen. Ganz abgesehen davon stellte das Essen mit Schleier eine wirkliche Anforderung an die Geschicklichkeit dar. Ihre Kameltreiberinnen schielten mehr oder minder auffällig, während jene Krieger neidisch schauten, die niemanden dabeihatten, der ihnen erlauben konnte, in der Öffentlichkeit mit offenem Shekh aufzutreten.
Khamer schien das alles wie immer nicht zu bemerken; er räusperte sich und begann die Geschichte vom ehrgeizigen Ziegenhirten, der sich eine Jinn fangen wollte, indem er Wassergräben baute. Denn alle wussten, dass die Jnun in körperlosem Zustand kein Wasser überqueren konnten.
Weil Fayruza diese eine Geschichte selbst beinahe auswendig kannte, beobachtete sie lieber ihre Mitreisenden. Khamer hoffte auf einen Antrag, sobald sie wieder daheim waren, und Fayruza sollte ihn nicht dabei unterstützen, indem sie ihm gestattete, den Schleier abzulegen. Zwei, drei der Frauen schienen interessiert und hatten sich in einer Handvoll Stelldicheins von seinen Qualitäten überzeugt.
Nicht, dass Mutter ihm erlauben würde, zu heiraten. Zu Fayruzas Familie zählten nur Mutter, deren jüngere Schwester, deren zwei Söhne, Fayruza, Khamer und ihre gebrechliche Großmutter Mirya. Sechs gesunde Erwachsene, das waren zu wenige für eine Familie, die verpflichtet war, das Zwei-Töchter-Tal zu beschützen. Aus den Nachbartälern äugten die anderen Richterinnen herüber, und die reichen Bäuerinnen belauerten sich gegenseitig, welche zuerst den Griff nach der Macht wagte. Khamer konnten sie nicht entbehren, und wenn er noch so unglücklich dabei war.
Wobei das auch nur helfen würde, wenn Fayruza für eine Erbin sorgte. Sie schob ihre Fingerspitzen unter ihr Shekh und kratzte sich den Haaransatz, denn die Drei wussten, dass sie keine Lust hatte, ein Kind großzuziehen.
Ihr Leben ohne Kamelrennen, Jagden, Kämpfe? Langweilig.
Nicht, dass sie nicht gerne im Liegen tanzte – Khamer warf ihr oft genug ihren unersättlichen Appetit vor, und dass sie reihenweise Herzen brach. Als hinge das Lebensglück irgendeines Kerls daran, dass eine bestimmte Frau ihn begehrte.
Vielleicht konnten sie von Nana Titrit einen Zauber kaufen, der eine rollige Jinn anlockte, die sich dann auf Khamer stürzte.
Fayruza seufzte und fing Safrs neugierigen Blick ein. Der hatte die zweite Wache oben und ein gewisses Talent mit der Zunge. Sie zwinkerte ihm ein Versprechen zu, woraufhin die Falten um seine gelben Augen ein erwartungsfrohes Lächeln verrieten.
Jetzt habe ich euch völlig verwirrt, nicht wahr? Mit meinem Gerede von Flaschengeistern und Trugdisenaugen. Sagte ich doch vorhin, die Dawanin glauben, dass im Qaldoun Gespenster umgehen, die sie Jnun, oder Shibakhin, nennen. Diese Gespenster, meinen sie, verursachen Krankheiten und Wahnsinn, vergiften Brunnen und machen die Spiegelungen über dem Sand, die schon manche Reisende ins Verderben geführt haben.
Aber eins müsst ihr wissen – nämlich, dass die Jnun sich von den Shibakhin unterscheiden. Die Jnun sind lebende Seelen, und die Shibakhin sind die bösartigen Geister Verstorbener. Ein Jinn kann Staub aus der Luft sammeln und sich einen Körper machen. Nur ihre Augenfarbe können die Jnun nicht bestimmen. Und ja, manchmal überkommt es ein Jinn, und dann sucht er, oder sie, sich einen Menschen für eine Nacht, bevorzugt einen Menschen von den Yeldun. Manchmal entsteht sogar Nachwuchs dabei, aber nur eine von zehn Töchtern hat nachher die vollen Zauberkräfte. Alle anderen bleiben bei ihren menschlichen Verwandten und werden sehr für ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten verehrt.
Je näher ein Mensch mit den Jnun verwandt ist, desto ungewöhnlicher ist die Farbe seiner Augen.
Meine sind hellbraun, wenn ihr schielt. Macht daraus, was ihr wollt.
Fayruza, gesegnet sei ihre einfallslose Frau Mama, hieß nach dem Türkis, denn genau dieses helle grünliche Blau war die Farbe ihrer Augen.
Nein, ich glaube nicht, dass der arme Safr sein Talent mit der Zunge von einem Jinn geerbt hat, aber wir können sicher sein, dass er und Fayruza eine angenehme Verabredung am Hang oberhalb des Lagers hatten …
Safr döste noch, als Fayruza ihn etwa eine Stunde nach Beginn der zweiten Wache verließ, um auszutreten und die Einlage mit dem Beerensud zu erneuern. Die alte würde sie morgen früh bei Tageslicht suchen müssen und sie dann im Fluss waschen – Safr hatte den Baumwollbausch in männlichem Ungestüm sonst wohin befördert. Im blassen Licht des Mondes ertastete Fayruza sich einen Weg bis hinter den nächsten Akazienbusch, keine zwanzig Schritte entfernt. Irgendwann verriet ein Rascheln, dass auch Safr sich wieder anzog.
Gerade, als sie aufstehen wollte, surrte etwas über sie hinweg. Jemand – es musste Safr sein – keuchte und ging zu Boden.
Fayruza sprang auf, ein Einschlag in ihren Oberschenkel ließ sie stolpern. Einen Augenblick lang betrachtete sie den Pfeil, der aus ihrem Fleisch ragte, die Federn unheimlich weiß in der Nacht. Ein Pfeil, der offensichtlich für ihren Kopf bestimmt gewesen war.
Fayruza ließ sich fallen. »Aufwachen!«, schrie sie. »Zu den Waffen! Esalakh, esalakh!«
Über helgische Flüche hinweg rief sie weiter Warnungen, dann schälte sich ein Mensch aus der Nacht, und Fayruza konnte nur noch ahnen, wie ein Stiefel auf sie zu rauschte.
Khamer blinzelte in die Dunkelheit, denn irgendwer brüllte. Fayruza? Er griff nach seinem Säbel, sprang auf und versuchte, sich einen Überblick zu verschaffen. Unruhe, als alle auf die Füße kamen und Muñiya die Reste des Feuers löschte. Die Krieger um ihn starrten ähnlich verwirrt in die Dunkelheit, plötzlich stak ein Pfeil aus Githabis Kehle.
»Zu den Kamelen«, befahl Khamer. Niemand schoss auf Kamele, dazu waren die Tiere zu wertvoll. Die anderen rannten los, den Kameltreiberinnen hinterher, direkt in einen neuerlichen Pfeilhagel.
Wie waren derart viele Schützen an vier Wachen vorbeigekommen?
Khamer schlug Haken, fiel zweimal über irgendwen am Boden, bis er die Herde erreichte. Muñiya war schon da, überredete die Lastkamele, sich im Kreis niederzulassen, während die Reitkamele mit zusammengekniffenen Augen nach außen schauten, als wären sie auf einen Kampf aus.
Der Feind löste sich leise aus den Schatten – bleiche Helgen, aber ohne die Panzer aus Metall, die Soldaten gewöhnlich trugen. Vielleicht waren es auch Gespenster. Ihre Klingen glänzten im Mondlicht, die Schwerter fast so lang wie ein Kamelbein.
Dann war der erste heran, hieb von oben auf Khamer ein – er blockte mit dem Säbel, spürte die Erschütterung bis in seine Füße. Die Klinge des Feindes rutschte ab, Funken sprühten. Der Nordmann nahm eine Hand von seinem Schwertheft, griff an den Knauf. Khamer musste sich unter dem nächsten, waagerechten Schlag wegducken.
Bei den Drei. Was für eine Waffe.
Khamer parierte die nächsten paar Hiebe, obwohl seine Arme müde wurden.
Der andere setzte einen Schlag zu hoch an, bot seine Achsel, Khamer würde blocken und –
Sein Säbel zerbrach unter dem Hieb. Den Stumpf fallen lassen, nach den Messern greifen.
Eine kühle Klinge an seinem Hals hielt ihn auf, von hinten hatte sich ein zweiter Nordmann angeschlichen.
Um Khamer war es still, viel zu still. Nur die Kamele brummten, klangen verwirrt. Irgendwer griff ihn an den Armen, zwang ihn auf die Knie und rupfte ihm das Shekh vom Kopf, nur um ihm die Augen zu verbinden und Hände und Füße zu fesseln.
Jemand flüsterte auf Helgisch, etwas von Würmern. Meinten sie Khamers Haare? Weiterhin kniete er, zwang sich, nicht in sich zusammenzusinken, während um ihn herum Fackeln entzündet wurden, deren Teer stank. Eindeutige Geräusche wiesen darauf hin, dass die Helgen Leichen herbeischleppten und durchsuchten. Hoffentlich, hoffentlich waren die meisten entkommen, hatten sich vielleicht zu dem Einsiedler geflüchtet.
Doch die Geräusche hörten nicht auf. Obwohl Khamer sich verbat zu zählen, wusste er, dass es außer ihm nur zwei oder drei Überlebende gab. Aber warum hatten sie ihn nicht getötet? Was wollten sie von Khamer?
Fayruza war mit Safr unterwegs gewesen. Von ihr spürte er wenig, aber immerhin, sie lebte noch. Bewusstlosigkeit wie ihre wäre besser als das Entsetzen, das Khamer zittern ließ wie eine frostige Winternacht.
Die Drei mochten sie alle beschützen.
Noch in der Nacht musste Khamer den Helgen folgen, die alle Kamele beluden, um ihn und das Diebesgut nach Norden zu führen, wo ihre Pferde warteten. Während Fayruza, tja …
Fayruza erwachte. Es war heiß und hell, ihr Kopf fühlte sich an, als wäre ein Kamel darauf gestiegen.
»Sch«, machte irgendwer und murmelte beruhigende Worte in einer unbekannten Sprache.
Fayruza schloss die Augen wieder.
Als sie das nächste Mal zu sich kam, war es dunkel und kühl, aber ihr Kopf tat immer noch weh, pochte, als klopfte darin jemand nach Edelsteinen. Überhaupt sah sie nur aus dem linken Auge. Bei allen von den Jnun verlassenen Höhlen!
Fayruza hob eine Hand, um nach …
»Halt!«, rief eine Männerstimme. Schwielige Finger griffen nach ihrem Arm. Sie gehörten zu einem hellen Schemen, bleich wie ein Shibakhi. Fayruza blinzelte einige Male. Wohl eher ein Helge als ein Gespenst. Er trug einen Kittel aus gräulichem Stoff, hatte wirre weiße Haare und braune Augen in einem Gesicht, das faltig und rot wie gebrannte Erde war.
Als er ihren Blick bemerkte, lächelte er. »Harr shatazesik, je naha’it.«
Was? Fayruza öffnete den Mund, ihre Kehle war rau. Etwas zog in ihrer rechten Wange, dass es ihr Tränen in ihr offenes Auge trieb.
Der Nordmann seufzte. »Ich habe genäht«, sagte er, »hier«, er deutete an seine rechte Augenbraue, »hier«, er zog eine Linie vom Wangenknochen nach unten, »und hier.« Stirn. »Deine Nase ist gebrecht – gebrochen.«
Das erklärte die Kopfschmerzen. Vermutlich hatte Fayruza Glück gehabt, dass die Nase nur gebrochen war und ihr nicht der Knochen im Hirn stak. Wenn ihre dicke Zunge sie nicht trog, dann hatte sie noch alle Zähne, und der Kiefer war auch noch ganz. Insgesamt gar nicht schlecht nach einem Tritt an den Kopf, also machte Fayruza »hmm.«
»Wasser?«, fragte er.
Fayruza nickte, ganz vorsichtig.
»Bitte, setz dich«, sagte er.
Das würde wehtun. Sie atmete zweimal tief durch, nahm Anlauf und stemmte sich hoch. Ein Grunzen ersetzte die Flüche, mit denen sie den Schmerzen Luft machen wollte. In ihrem Schädel schien sich die Handvoll Bergarbeiter zu vermehren und endgültig nach draußen durchbrechen zu wollen, außerdem stach es in ihrem rechten Bein, da, wo der Pfeil sie getroffen hatte.
Bemerkenswert, wie dringend sie ihre Beine brauchte, um überhaupt aufrecht sitzen zu können.
Der Helge griff sie am Oberarm und zog sie den Rest des Weges hoch. Danach zwang sie sich zu tiefen Atemzügen, bis ihr Herz sich beruhigte.
Derweil murmelte der Fremde in seiner abgehackt klingenden Sprache und reichte ihr einen Becher aus Ton, mit Wasser und einem Halm darin.
Herrlich kühl. Trotzdem ermahnte sich Fayruza, in kleinen Schlucken zu trinken.
Er füllte ihr zweimal aus einem Krug nach, dann fragte er: »Suppe?«
Hm. Fayruza wollte nur noch schlafen. Aber in der Wüste war es reiner Wahnsinn, eine Mahlzeit auszuschlagen, also zeigte sie mit zwei Fingern eine kleine Menge. Der Helge nickte und verschwand in einen felsigen Durchgang.
Während er draußen mit Holzgeschirr klapperte, schaute Fayruza sich um. Das Zimmer schien aus dem Fels des Berges gehauen zu sein, außer dem Durchgang gab es nur hoch oben in der Wand ein winziges Fenster. Blaue Kleidung und Ledertaschen – ihre Sachen – stapelten sich an der gegenüberliegenden Wand.
Irgendwann brachte der Nordmann eine Schale mit einem ausgehöhlten Stöckchen und setzte sich wieder auf den Schemel neben dem Bett, wo er Fayruza untergebracht hatte.
In der Schale war Brühe mit winzigen Stücken, die nach Hammel, Zwiebeln und Linsen schmeckte. Suppe mit Fleisch, einer Gästin würdig. Irgendwann würde Fayruza ihren Mund hoffentlich wieder so weit aufbekommen, dass sie auch feste Nahrung zu sich nehmen konnte.
Danach half der Helge ihr, sich wieder hinzulegen. Als sie ihm hinterhersah, entschuldigte sie sich still bei Nana Titrit, die wegen des Einsiedlers am Quellberg Recht behalten hatte.
Während Fayruza sorgsam gepflegt wurde, war ihr Zwillingsbruder auf dem Rücken eines Maultiers festgebunden, eine halbe Nacht, einen Tag und noch eine halbe Nacht lang. Noch ahnte Khamer wegen seiner verbundenen Augen nicht, dass er es mit Soldaten zu tun hatte und keinesfalls mit einer Räuberbande.
Für die Reise hatten sie Khamer sein Shekh zurückgegeben, damit er keinen Sonnenstich bekam. Aber einmal angekommen, nahmen sie es ihm wieder, schnitten seine Zöpfe ab und schlossen ihn in einer unterirdischen Zelle ein, die nach der Angst und den Verdauungsbeschwerden seiner Vorgänger roch. Dort harrte Khamer aus, voller Sorge um seine Schwester und die eigene Zukunft, bis Hauptmann Sintram ihn am nächsten Morgen zu sprechen wünschte.
Zuerst hatte Sintram geglaubt, dass der Wüstenmann, den sie bei ihrem Überfall aufgelesen hatten, ein Glücksgriff gewesen war, obwohl seine Hautfarbe nassem Torf ähnelte und seine Augen leuchteten, als hätten Feuerriesen eine Glut dahinter entfacht. Hellrot wie der Carneol, nach dem er hieß.
Kein Wunder, dass das Volk hierzulande von den Wüstenleuten als Jnun sprach. Kein Wunder, dass Rot eine Unglücksfarbe für sie war.
Aberglaube, natürlich, und in noch größerem Maß als der Unsinn, der den Helgen geblieben war, nachdem Harr die niedrigen Götter in die Erde verbannt hatte. Dennoch nannten Sintrams Männer die Überfälle auf die Karawanen eine Trugdisenjagd und ließen immer nur einen blau gewandeten Mann am Leben.
Der Junge, der nun Sintram in dem Verhörzimmer gegenübersaß, nuschelte nicht so wie seine Landsmänner, bestand aber trotzdem darauf, von ihnen als Frauen zu sprechen. Die Richterinnen hatten ihn geschickt, seine Begleiterinnen stammten aus diesem oder jenem Tal, und so weiter. Anders als die Männer, die sie vorher gefangen hatten, konnte er sogar einige Brocken Helgisch. Trotzdem hatte dieser Khamer genauso wenig an Auskünften zu bieten wie die anderen.
»Dir wird das ganze Tal gehören.«
Ein Blinzeln.
»Und du wirst so viele Frauen haben, wie du magst.«
Der Junge zog die Brauen zusammen, schien verwirrt und traurig. Seine rechte Hand fuhr an seine Schläfe, auf der Suche nach dem Turban. Die Männer aus der Wüste schliefen sogar in ihren Schleiern und wirkten dementsprechend hilflos ohne sie.
»Nein«, sagte der Junge schließlich.
Zugegebenermaßen konnte Sintram ihm die Ablehnung nicht verübeln, denn er hätte dieses Angebot ebenfalls nicht verlockend gefunden. Aber es war der letzte Versuch gewesen, mit einem Gespräch etwas zu erreichen.
Fehlten einem die Druckmittel, um einen Gegner zum Sprechen zu bringen, musste man bei lockerer Plauderei herausfinden, worüber er unglücklich war und da nachbohren. Dummerweise schienen alle Wüstenmänner vollauf zufrieden und nicht geneigt, für Reichtümer und Weiber ihr Volk zu verraten. Es half auch nicht, dass die Stadtbevölkerung fast nichts über diese Menschen wusste, das einen Ansatzpunkt liefern konnte.
Oder man versuchte es mit einer Zermürbungstaktik, Verhöre zu den unmöglichsten Zeiten. Doch jemanden, der es gewohnt war, nachts zu reiten oder tagsüber auf seinem Kamel zu schlafen, den zermürbte man nicht einfach.
Was wollten diese Leute?
»Du bekommst«, wie hieß es noch gleich, »dein Shekh zurück.«
Wieder diese verräterische, hilfesuchende Bewegung zu dem Stück Stoff, das fehlte.
Sintram unterdrückte ein Lächeln.
Dann seufzte der Junge und schüttelte den Kopf. »Ehrlos wäre ich so oder so.«
Immerhin hatte Khamer dafür nachdenken müssen, das lohnte sich zu merken. Mit einem Nicken verabschiedete Sintram sich.
Vor der Tür der Kammer saß Golda, seine Hündin, und wedelte mit dem Schwanz. Sintram tätschelte ihr den Kopf, bevor er sich den beiden Wächtern zuwandte. »Bringt den Gefangenen zurück in seine Zelle.« Dann machte er sich auf, um Statthalter Gotlieb von seinem Misserfolg zu berichten.
Golda folgte ihm hechelnd die ausgetretenen Stufen nach oben auf den Übungsplatz, wo die Luft vor Hitze Schlieren warf. Schon nach dem ersten Atemzug brach Sintram der Schweiß aus, kitzelte in seinem Nacken und unter den Armen, deswegen bemühte er sich um einen gemessenen Schritt – Hast machte alles nur schlimmer. Die Einheimischen wussten schon, warum sie durch die Gassen schlenderten und nicht liefen.
Trotzdem schien es jeden Sommer wärmer zu werden.
Endlich erreichte Sintram die Arkaden vor den Unterkünften der einfachen Soldaten. Von da aus konnten er und Golda sich im Schatten zum öffentlichen Teil des Palastes bewegen, durch zahlreiche begrünte, rechteckige Innenhöfe. Rosen, Jasmin und Pomeranzenblüten verbreiteten ihren schweren Duft, einige Springbrunnen plätscherten.
Früher einmal hatte der Faris von Taqat hier gelebt, und, bei Harr, der Mann hatte gewusst, wie man sich bei diesem Wetter einrichten musste. Daher wurden Außenwände und Dächer weiterhin jedes Frühjahr geweißt, Bäume und Palmen waren in den Höfen geblieben. Die Mosaiken an den Wänden und auf den Böden strahlten sowohl durch ihr Material als auch durch die Farbwahl angenehme Kühle aus, genau wie der verspielte Stuck unter der Decke, der Eiszapfen glich. Dass die schweren helgischen Holzmöbel mit ihren Tierschnitzereien nicht dazu passten, scherte wahrscheinlich niemanden außer Sintram und die einheimischen Bediensteten.
Im vorderen Teil des Palasts mit den Amtsstuben stieg er die Treppe nach oben. Die Tür zu Gotliebs Vorzimmer war nur angelehnt, also betrat Sintram es, ohne zu klopfen.
Gotliebs Schreiber sah auf. »Geht nur hinein. Er erwartet Euren Bericht.«
Der Mann wedelte mit seiner Hand auf eine Weise, die Sintram bei anderen vielleicht ein verschwörerisches Lächeln abgerungen hätte. Nur wusste er eben, dass selbiger Schreiber seinen Mund nicht halten konnte.
Eine Geste zu Golda, die sich in einer Ecke unter dem üblichen Stuhl niederließ, dann tat Sintram wie geheißen.
Hinter einem Schreibtisch aus Eichenholz, der ähnlich schwerfällig wirkte wie der Statthalter, saß Gotlieb in seinem Sessel und hatte die Hände vor seinem Schmerbauch gefaltet. »Lass mich raten – unser Gast zeigt sich genauso verstockt wie die anderen vorher.«
»Unglücklicherweise, Herr Statthalter.«
»Wirklich? Man sollte meinen, dass du darauf brennst, deine bevorzugte Waffe einzusetzen.« Gotliebs Blick blieb milde, beinahe mitleidig, und flackerte nur einmal zu der aufgerollten Peitsche an Sintrams Hüfte. Als würde er die freiwillig mit herumtragen, statt als Zeichen seines Ranges und des zugehörigen Rechts, unter seinen Männern für Ordnung zu sorgen.
Jetzt durfte Sintram bloß keine Miene verziehen. Allein Harr wusste, wie viel die Huren der Stadt untereinander tratschten und welche ihre Berufsehre verletzt hatte, indem sie dem Statthalter von Sintrams kranken Vorlieben erzählt hatte. Jedoch war Gotliebs Wissen gleichzeitig der untrügliche Beweis dafür, dass er in Abwesenheit seiner jungen Gattin eine Hure aufgesucht hatte – womit Sintram zumindest darauf vertrauen konnte, dass der Statthalter nicht vor Zuhörern davon anfing.
Im Herbst war nämlich auch die edle Frau Biserka hier eingetroffen, ein zartes Geschöpf mit blonden Locken, noch blasser als Sintram, fast lichtelfengleich – zumindest, bis sie den Mund aufmachte und zu keifen anfing. Derzeit war sie mit dem ersten Kind der Ehe schwanger, was ihre Laune noch einmal verschlechtert hatte. Kein Wunder, bei der Hitze.
»Ich denke nicht, dass wir mit Schlägen viel erreichen werden«, sagte Sintram schließlich.
»Dann versuch es anders. Großdiar Heidhrik« – der neue Hohepriester – »liegt mir in den Ohren, wann wir den Völkern im Süden endlich Harrs Wort bringen, und der König fragt in jedem seiner Briefe nach den Entwicklungen.« Gotlieb griff nach der Armspange mit den Kugeln an den Enden, die ihn als Gläubigen auswies. »Wenn ich nur glauben könnte, dass es ihnen tatsächlich um die verlorenen Seelen dieser Menschen geht.«
Sintram nickte. Wussten die Gefallenen in Harrs Halle, wie Gotlieb es mit dieser Frömmigkeit bis zum Statthalter gebracht hatte, denn ihn allein schienen die Seelen der Wüstenleute zu kümmern. Alle anderen, die Diarn eingeschlossen, hörten nur die Geschichten von den Edelsteinminen in den Schwarzen Bergen und begannen, vor Gier zu sabbern.
»Ich werde mein Bestes tun, Herr. Wie sollen wir verfahren, wenn er nichts weiß?«
Gotlieb legte den Kopf schräg. »Sieh zu, dass er es überlebt, dann können wir ihn ins Bergwerk schicken. Auf diese Weise besteht wenigstens eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er zu Harr findet.«
Wie die anderen vorher. Gotlieb räumte diesen dahergelaufenen Kamelhirten wohl mehr Aussichten ein, Harr zu finden, als Sintram. Obwohl er gute Lust hatte, Gotlieb seine eigene Armspange an die Stirn zu werfen, verbeugte er sich und verließ das Arbeitszimmer. Wenn er die Tür etwas zu laut ins Schloss zog, dann musste der Statthalter das schon selbst deuten.
Abgesehen davon gingen Sintram langsam die Bergwerke aus, zu denen er die überlebenden Wüstenleute verschicken konnte.
Heute Abend, wenn es abkühlte, würde er sich einen Gegner suchen und mit einem der erbeuteten Säbel üben, auch wenn Gotlieb vielleicht glaubte, dass Sintram solch eine Laune lieber an einer Hure ausließ.
Und wo wir gerade dabei sind …
Kann ich etwas dafür, dass Sintram nicht fromm war? Und zu Recht, meine ich. Auch wenn es nirgendwo geschrieben steht, scheint es doch niemandem richtig, wenn einer irgendwen zu seinem eigenen Vergnügen quält. Harr würde so jemanden nicht in seiner Halle wollen.
Ihr nickt. Ihr mögt Sintram nicht besonders, das sehe ich. Trotz all seiner Fehler hatte er jedoch Maya einige Freizeit spendiert, deswegen genoss diese derweil einen Tag zu Hause. Sie übte mit der Laute und den Zimbeln und kramte dann eines ihrer Tanzkleider hervor, an dessen Saum einige Glasperlen fehlten.
Sobald der Schatten es zuließ, nahm Maya ihre Flickarbeit mit in den Garten hinter ihrem Haus, der genau genommen zu Rhinayas Bordell nebenan gehörte. Mayas Hintereingang war nach rechts durch ein Gitter verborgen, an dem Jasmin rankte. Die gerade Sicht auf ihre Tür versperrte ein Zitronenbäumchen in einem Topf.
Einige ihrer Nachbarinnen saßen auf den Bänken unter den Arkaden herum, plauderten, webten Borten oder nähten. Ein Mädchen, die noch so neu im Geschäft war, dass Maya ihren Namen nicht kannte, zupfte eine zögerliche Melodie auf einer Laute. Offenbar übte sie einen helgischen Tanz.
Aus der Gruppe löste sich eine Gestalt und schlenderte zu Maya herüber. Zahir der Spielzeugjunge besaß ein untrügliches Gespür dafür, wann Maya Süßigkeiten zu verschenken hatte. Ohne Rücksicht auf die hellen Kleider, mit denen Rhinaya ihn zum Arbeiten ausstattete, flegelte er sich vor Maya auf den gefliesten Boden und grinste zu ihr hoch. Seine offenen, schulterlangen Locken glänzten schwarzblau von dem Indigo, mit dem er sie färbte.
Obwohl Rhinaya ihm erst im Winter neue Sachen hatte schneidern lassen, spannte das Hemd an den Schultern. Wenigstens war er nicht weiter in die Höhe geschossen, sodass die Hose noch passte. Seitdem Maya ihn das letzte Mal genauer betrachtet hatte, war Zahir zu einem unglaublich schönen Mann geworden.
»Dein Auge ist schon fast wieder gut«, unterbrach er ihre Gedanken.
»Gelb, meinst du wohl.«
Noch ein Grinsen. »Vielleicht.« Er wischte sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Obwohl ich wetten würde, dass es deinem Hauptmann nichts ausmacht, wenn du seine Male zur Schau stellst.«
Maya runzelte die Stirn. »Was soll das heißen?«
»Hast du eigentlich noch Kunden außer ihm?«
Sintram rief etwa einmal im Monat nach Maya, und danach war sie eine Woche lang außer Gefecht. Eine Woche, die er ihr hervorragend bezahlte. Meistens hatte sie Glück und er erwischte die Tage, in denen sie sowieso unpässlich war. »Selbstverständlich. Ein paar Männer wissen noch zu würdigen, dass ich tanzen und Laute spielen kann.«
Zahir legte den Kopf zurück und lachte. »Verzeih mir mein lückenhaftes Gedächtnis, je siyada’it.«
Frau Abendgesellschafterin. Das war etwas, das die Helgen den Männern und den Huren hier nicht hatten nehmen können und woran sie sich schnell gewöhnt hatten. Mittlerweile luden sie Maya manchmal sogar zu Festen in helgische Häuser ein, um die Gäste zu unterhalten – unter denen gelegentlich auch Frauen waren!
Dann blinzelte Maya, denn an Zahirs Kehle prangte ein mundförmiger Schatten, obwohl Rhinaya bleibende Spuren nicht einmal gegen großzügige Bezahlung duldete. Oder, besser gesagt, den zu kompensierenden Verdienstausfall Zahirs konnten sich in Taqat allerhöchstens zehn Männer leisten. »Jemand hat dich gebissen.«
Er zuckte mit den Schultern, sein Ausdruck verdüsterte sich. »Rhinaya muss mich einmal die Woche enthaaren, damit ich jung genug aussehe. Glaubst du, dass sie wegen eines blöden Knutschflecks einen Kunden vergrault?«
Der Kunde würde Rhinaya länger erhalten bleiben als Zahir. Obwohl Maya ihre Freundin verstand, wollte sie diese doch schütteln. »Ach, Kind.« Zahir lachte wieder. »So jung bin ich nun auch wieder nicht.« Nein. Aber sechzehn, sechzehn war auch nicht alt.
»Komm mit rein. Ich habe Salbe von Nana Seyda.« Sie senkte ihre Stimme. »Und Zuckermandeln.«
Zahir ließ sich umsorgen, den blauen Fleck einreiben und mit Zuckermandeln, Datteln und süßem Tee bewirten.
»Du hast auch keinen Kaffee mehr, hm?«, fragte er.
Maya schüttelte den Kopf. Im Herbst hatten die Bohnen schon ein Vermögen gekostet. Mittlerweile gab es in ganz Taqat keinen Kaffee mehr zu kaufen – von Mayas Kunden hatte nur Sintram noch welchen – und der Zucker kostete seit dem Winter das Doppelte des üblichen Preises. »Die Yeldin scheinen den Karawanenverkehr ganz eingestellt zu haben.« Wussten die Götter, warum.
»Und da fütterst du einen Streuner wie mich mit Zuckermandeln?« Wie zum Beweis zerbiss Zahir eine, dass es krachte.
Maya neigte den Kopf und sagte nichts dazu. Süßkram schmeckte in Gesellschaft einfach besser.
»Du bist so lieb«, sagte Zahir schließlich. »Wenn ich nur ein winziges bisschen auf Frauen stünde, dann würde ich dich vom Fleck weg heiraten.«
»Du –!« Maya warf ein Kissen nach ihm. Schon die Vorstellung, dass ein halbes Kind für sie sorgen wollte, war lächerlich.
Zahir lachte. »Ich habe gespart, weißt du.«
Alle Huren sparten. »Was wirst du tun, wenn Rhinaya dich entlassen muss?« Die Helgen schickten ab und an Wachen vorbei, nur um zu sehen, ob Rhinayas junge Männer nicht zu alt für ihren Beruf waren.
»Ich werde mich wohl an den Namen erinnern, den meine Eltern mir gegeben haben und irgendwo als Schreiber anfangen. Wenn ich es richtig anstelle, muss ich nicht zum Heer, als nachgewiesener Ergi.« Er seufzte und starrte die gegenüberliegende Wand an, als halte das Mosaik dort eine bessere Antwort bereit.
Maya versuchte ein aufmunterndes Lächeln. »Es wird schon gutgehen. Die Drei haben für jeden einen Platz vorgesehen.«
»Pfft.« Zahir verdrehte die Augen. »Erzähl mir nicht, dass es einen Platz gibt für Männer, die sich gern vögeln lassen. Ob hier oder sonst wo.«
Es musste einen Platz geben. Die Drei setzten jeden Menschen an seinen Platz, jede Seele dorthin, wo sie am besten geeignet war, das Gleichgewicht zu erhalten. Aber dennoch, es war manchmal schwer zu ertragen, wenn man Wünsche hatte, die dem Platz nicht entsprachen. Maya wollte ein Kind, aber Hurentöchter fanden keine Ehemänner. Und Zahir wollte einen Mann, was hieß, dass er noch weit ungehörigere Wünsche hatte als Maya.
Und so rückte Maya zu ihm und legte ihm einen Arm um die Schultern. Männer, im Gegensatz zu Jungen, durften sich nicht nehmen lassen, da waren sich die Dawanin und die Helgen einig. Mittlerweile gab es nur noch Peitschenhiebe, aber früher hatte der Faris allen solchen warmen Brüdern die entscheidenden Teile abschneiden lassen. Manche hatten es sogar überlebt und den Rest ihrer Tage weggesperrt bei seinen Frauen verbracht. Nana Seyda behauptete, dass diese Sünde des Faris gegen die Drei der Grund war, warum die Helgen das Land erobert hatten.
Heutzutage gibt es keine Schläge mehr für solche Männer, nicht wahr? Nur noch einen Zwölftag Zuchthaus?
Ach, nur noch zehn Tage? Verzeih mir.
Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das lieber wollte als Schläge, wenn ich ein Mann wäre.
Wieso denke ich darüber nach? Weil ich gelegentlich nichts gegen eine Vorstellung hätte, deswegen.
Dann hast du keine Ahnung, was in alten Weibern wie mir vorgeht, Herzchen. Oder wird es dir nicht heiß, wenn du an zwei hübsche nackte Frauen denkst, die sich miteinander vergnügen?
Jedenfalls scheinen mir weder Schläge noch Zuchthaus geeignet, die warmen Brüder abzukühlen, und ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Abkühlung überhaupt brauchen.
Wo wir es gerade von warmen und kalten Dingen haben …
Ah. Met? Der teure süße sogar. Danke. Aber davon wird die Geschichte auch nicht lieblicher.
Jedenfalls hätte Maya Zahir allzu gerne geholfen oder wenigstens einen klugen Rat erteilt. Doch die Helgen hatten damals alle Priester der Drei getötet und die Tempel zerstört, sodass ihr nur die Geschichten blieben, die sie von ihrer Mutter oder Nana Seyda kannte.
»Vor langer Zeit«, fing Maya an, »war das Qaldoun hinter den Roten Bergen fruchtbares Land.«
Zahir brummte. Sie wusste, dass er ihr gern zuhörte, doch es gab ihr einen Stich ins Herz. Lieber hätte sie einen kleinen Menschen im Arm gehalten, der den Erzählungen mit großen Augen lauschte. So, wie sie damals ihrer Mutter zugehört hatte.
»Jeder weiß, dass Muqih, der Mondgott, ein gerechter Herrscher ist. Wenn die guten Menschen sterben, dann nimmt Tarhri, der Herr der Dämmerung, ihre Seelen mit unter die Erde, wo sie in Muqihs Garten leben, in dem das ganze Jahr die Rosen blühen und honigsüßes Wasser fließt. Die Seelen der schlechten Menschen schickt er in eine Ödnis, wo sie allezeit dürsten müssen. Manchmal entkommen Muqih solche Seelen, das sind die Jnun oder Shibakhin. Die sehnen sich nach einem Garten, deswegen hielten sich viele von ihnen dort auf, wo heute das Qaldoun ist.
Nikra, die Sonnengöttin, ist Hitze und Feuer und Unordnung, deshalb liebt sie den Krieg. Einstmals sammelte sie von einem Schlachtfeld die Schädel aller Gefallenen, verwandelte sie in klare Edelsteine, jeden von einer anderen Farbe, und fädelte sie zu einer Kette auf.
Nun ergab sich, dass ein vorwitziger Jinn, Liss, diese wunderschönen Steine gerne besitzen wollte. So schlich Liss sich eines Nachts, als Nikra schlief, zu ihr unter die Erde und stahl ihr die Kette. Doch als er zurück an die Oberfläche kam, überfielen ihn andere Jnun, die Kette zerriss, und seine Angreifer trugen jeder einen Schädel davon.
Als Nikra erwachte und bemerkte, dass ihre Kette fehlte, war sie außer sich vor Wut. Sie gab sich keine Mühe, den Übeltäter zu finden, sondern verbrannte den gesamten Garten der Jnun, bis nur noch Sand und felsige Täler übrig blieben, und die Jnun sich mit ihrer Beute in karge Höhlen flüchten mussten. Da sitzen sie nun im Qaldoun, vergehen fast vor Hitze und haben nur toten Stein als Trost.«
Eine Weile lang sagte Zahir nichts zu Mayas Geschichte. Schließlich löste er sich von ihr. »Ach, mein Mond in der Nacht, du warst aufmunternd wie immer.«
Maya musste lächeln und wuschelte ihm durch die Haare. »Ich tue mein Bestes, das weißt du doch.«
Warum Maya ausgerechnet diese Geschichte erzählte? Weil sie von ihren Gedanken an das Gleichgewicht an einen Anlass erinnert worden war, der das Gleichgewicht gestört hatte.
Und wo wir schon beim Qaldoun sind, wenden wir uns der einen zu, die dort geblieben war …
Fayruza erwachte von kaltem Stahl an ihrer Kehle. Ihr Schädel schmerzte, als hätte ihr jemand soeben alle Haare ausgerissen.
Sie fuhr hoch und blinzelte in die Dunkelheit, doch sie war allein. Eine Weile saß sie, wartete, bis ihr Herzschlag sich verlangsamte. Währenddessen trocknete der Schweiß auf ihrer Haut und ließ sie frösteln. Wie lange hatte sie schon keinen Albtraum mehr gehabt?
Andererseits hatte es sich echt angefühlt, und – sie schlang sich die Arme um den Leib – vielleicht, vielleicht waren es Erinnerungen, aber nicht ihre. Khamer? Sie horchte in sich hinein, horchte nach ihrem Zwilling, doch mehr als die Gewissheit, dass er noch lebte, hatte sie nicht.
Nikra mochte ihn und auch die anderen beschützen, wo immer sie steckten. Ob die Männer aus dem Norden sie verschleppt hatten? Die Kamele und die Ware, die würde sie gewiss in den Händen der Shubkhin finden.
Es war die letzte einer langen Reihe von Beleidigungen. Wenn Fayruza daheim war, dann würde sie alles daransetzen, die Täler zu vereinen, einen Überfall auf Taqat zu organisieren und die Stadt zu plündern. Das letzte Mal, dass ein solch großes Rets stattgefunden hatte, war über hundert Jahre her, und damals war es nur um den Preis für Salz gegangen. Aber all das musste warten, bis Fayruza den Mund wieder weit genug aufbekam, um den Einsiedler zu befragen. Immerhin konnte sie jetzt klare Gedanken fassen und fühlte sich nicht allein vom Aufsitzen zerschlagen.
Gegenwärtig drückte ihre Blase, also würde sie den Abtritt suchen. Mindestens einmal hatte der alte Helge ihr mit einer Bettpfanne geholfen, derlei wollte sie in Zukunft lieber vermeiden.
Das Aufstehen gestaltete sich schmerzhaft. An die Wand gelehnt machte Fayruza eine Bestandsaufnahme. Sie trug ihr langes Hemd, und der Rest befand sich hoffentlich in dem Stapel, an den sie sich zu erinnern glaubte. Als sie das Hemd hochkrempelte, bewiesen Binden, dass die Pfeilwunde ordentlich versorgt war. Ein paar mehr Taster weiter oben versicherten ihr, dass niemand ihre Bewusstlosigkeit ausgenutzt hatte. Gut. Sie hätte es sehr bedauert, den Einsiedler töten zu müssen.
Dann humpelte Fayruza an der Wand entlang bis zu dem Durchgang im Fels. Die weitere Sicht versperrte ein Vorhang; als sie den zurückschob, leuchteten ihr Glutreste auf dem Herd entgegen. Daneben lag auf dem Boden der Einsiedler, eingerollt in eine Decke. Er atmete ruhig. Hatte er ihr wirklich sein Bett überlassen? Ein bewundernswerter Gastgeber.
In der ihr nächsten Ecke lehnte ein menschhoher Stock, den lieh Fayruza sich aus und humpelte weiter, auf den rechten von zwei Gängen zu. Ein frischer Lufthauch kam ihr entgegen, das musste der Ausgang sein. Weil sie sich mit ihrem ganzen Gewicht auf den Wanderstock stützte, knirschte dessen metallene Spitze auf dem Boden. Warum erwachte der Einsiedler davon nicht?
Nach zehn mühseligen Schritten stand sie auf dem Lagerplatz, den sie aus Angst vor einem Gefecht gemieden hatte. Ewig wollte sie sich in den Hintern beißen, dass sie nicht doch eine Kundschafterin geschickt hatte.
Vom Himmel strahlte der Halbmond, es war also die zweite Nacht seit dem Überfall. Fayruza hatte gute Sicht in die Wüste. Der Sand schimmerte silbrig verwunschen; die Luft war, so weit im Norden, noch einigermaßen warm um diese Nachtzeit. Weiter draußen hätte ihr Atem längst kleine Wölkchen gebildet.
Dank des Mondlichts fand sie Hinweise, dass der Einsiedler hier schon länger lebte. Der Pfad nach weiter oben war ausgetreten, an den schattigen Plätzen wuchsen Kräuter in Töpfen, die einen schwachen Duft verströmten. Minze, Salbei und Rosmarin. An der Wand stapelten sich Werkzeuge, nach Osten hin hatte der Helge einen kleinen Altar errichtet, und es gab einen Sitz über der einen Felsspalte. Wo sie früher einen großen Schritt hatte machen und sich über den Abgrund hocken müssen, hatte er sich die Angelegenheit mit einigen Ästen und Steinplatten bequemer gestaltet.
Eine dankbare Sache, vor allem mit einem kranken Bein.
Den halben Rückweg hatte Fayruza geschafft, als Rufe laut wurden. »Je naha’it!« Dann stürzte der Einsiedler aus dem Eingang und sah sich mit wildem Blick um. »Da bist du!« Es folgte ein Vortrag, dem sie nur »bitte« und »nicht« entnahm.
Fayruza legte den Kopf schräg. Sie konnte ein paar Brocken Helgisch – vor allem Zahlen und die Namen für die Waren – aber der Tirade hier folgte sie nur insoweit, als dass sein Ton zwischen erleichtert und vorwurfsvoll schwankte.
Um den Wortfluss ins Stocken zu bringen, legte Fayruza sich die rechte Hand auf die Brust und verneigte sich ein wenig. »Un Tarun ishatazesik«, versuchte sie. Sie nuschelte, aber wenigstens spannte ihre Backe nur und tat kaum mehr weh.
»Harr shatazesik«, sagte der Einsiedler.
»Ich bin Fayruza«, sagte sie. »Und du?«
»Naha Fayruza. Ich bin Gervas«, sagte er, »Harrs Diener.«
Als hätte sie sich das bei dieser Begrüßung nicht denken können. »Je nahit«, mein Herr, »tausend Dank für deine Gastfreundschaft.«
Gervas machte »pfft« und verscheuchte die Bemerkung wie eine lästige Fliege. »Es ist meine Pflicht als Harrs Diener. Komm wieder herein, es ist kalt.«
Also humpelte sie ihm hinterher in die Küche, wo er das Feuer schürte und sie auf eine ungepolsterte Eckbank aus zwei Steinen und einem Brett winkte. Fayruza ließ sich darauf sinken, lehnte den Kopf an die Felswand und schloss die Augen. Eigentlich wollte sie lieber zurück ins Bett, als mit dem Helgen zu plaudern. Gervas räumte irgendetwas herum, goss Wasser in ein Gefäß. Es roch nach Minze. Fast wie daheim, bevor sich ein ungewohnter Blütenduft darunter mischte.
Irgendwann schüttelte er Fayruza und hielt ihr eine Holzschale hin. Sie nahm sie und nippte an der Flüssigkeit darin. Ein Aufguss aus Kräutern, ohne Teekörner.
»Lavendel und Minze für aufgewühlte Gemüter«, sagte Gervas und setzte sich ebenfalls, eine Armlänge von Fayruza entfernt. »Morgen werde ich ein richtiges Frühstück kochen.«
Sie lächelte, obwohl die Nähte spannten. War jetzt der richtige Zeitpunkt für unangenehme Wahrheiten? Wo er ihr sozusagen schon vorab Lavendel verabreicht hatte. »Bitte, je nahit, sag mir, wo sind die anderen? Ich hatte vierzehn Leute dabei.«
Seufzend starrte Gervas in seine Teeschale. »Ich weiß. Den blauen Mann haben die Soldaten mitgenommen, und die Kamele auch.«
Das hieß, dass die anderen tot waren. Safr, Muñiya und alle. Und es war Fayruzas Schuld, denn sie hatte Eile vor Vernunft walten lassen.
Sie stellte die Schale ab und legte die Hände vor der Brust zusammen, schloss die Augen. Mehr als ihnen zu wünschen, dass sie in Muqihs Garten glücklich würden, konnte Fayruza nicht. Mochte der Blasse ihre Seelen mit allen Ehren empfangen. Mochten die Toten Fayruza vergeben und sie am Ende ihrer Tage freundlich aufnehmen.
Gervas räusperte sich. »Ich habe sie verbrannt, wie es sich gehört.«
Gehörte es sich so? Fayruza biss die Zähne zusammen. Ihr Volk wickelte seine Verstorbenen in Tücher, machte ein Grab und legte einen Stein mit dem Namen und einer Bitte an die Drei obenauf. Aber dieser Harr, dem war es nicht genug, wenn die Seele zu ihm stieg. Nein, er verlangte auch noch wertvolles Holz und Rauch und ließ dem Land nur Asche.
»Ich bin sicher, dass sie es gut haben«, sagte Gervas. »Harr nimmt alle tapferen Kämpfer in seine Halle auf.«
Sollte das ein Trost sein? Fayruza stemmte sich hoch und wollte ihm den Wanderstab über den Schädel zu ziehen. Stattdessen wischte sie die Teeschale zu Boden. Das Holz schepperte auf dem Stein. »Sie werden in Muqihs Garten sitzen und auf deinen Harr pissen«, zischte sie. Etwas zog in ihrer Backe, aber sie beachtete den Schmerz nicht und humpelte in ihre Kammer, bevor sie etwas zerstörte.
Nicht, dass es viel half. Sie lag auf dem Bett, starrte ins Dunkel, draußen klapperte Geschirr. Die Naht in ihrer Wange pochte und juckte. Fayruza rieb daran, was ihr aber auch keine Linderung verschaffte, sondern klebriges Blut zum Fließen brachte.
Irgendwann wurde es still, und die Erinnerungen nutzten diese Zeit ohne Ablenkungen, um hervorzukriechen. Wie lange hatte Fayruza auf Muñiya eingeredet, bis die sich breitschlagen ließ, eine letzte Karawane zu führen? Der Weg nach Norden war keiner für Menschen über fünfzig, hatte Muñiya gesagt und war dann doch mitgekommen. Wie oft hatte Fayruza ihrer Mutter versprochen, daheimzubleiben, nur um in der Nacht davonzuschleichen und auf dem Fettwanst den anderen hinterher zu galoppieren? Wieso hatte Fayruza nicht auf Khamer gehört?
Als sie doch einschlief, träumte sie, dass sie in einem dunklen Loch saß, an die Peitsche an einem Gürtel dachte und auf den Morgen wartete.
Derweil, ihr ahnt es, hatte sich Khamer tatsächlich in seiner Zelle an die Wand gekauert. Er lauschte auf die Wächter draußen, die an ihrem Tisch mit Würfeln um Geld spielten und sich einen Dreck darum scherten, ob ihre paar Gefangenen sich von ihren Flüchen gestört fühlten.
Ihr schaut so ungläubig – ja, es waren nur eine Handvoll Menschen in diesem Kerker. Einfache Diebe und derlei Verbrecher saßen in einem Gefängnis an der Südecke des Palastes ein. Mit denen gab sich Sintram nicht ab, aber ob es ihnen deswegen besser erging, in Zellen, die nur ein Loch in der Decke und keinen Abfluss hatten? Immerhin verfügten die politischen Gefangenen über Gittertüren, Tageslicht und einen Eimer.
Obwohl Khamer ahnte, was ihm blühte, wenn er nicht redete, obwohl er sich die Schmerzen, die die Peitsche verursachen würde, in allen Einzelheiten ausmalte, war ein Teil von ihm so müde, dass er hätte schlafen können. Aber wenn er nicht schlief, so rechnete er sich aus, wäre er morgen erschöpfter und würde von der Folter schneller ohnmächtig. Dann hätte er weniger Gelegenheit, irgendwem etwas zu erzählen.
Nicht, dass er mehr zu sagen hätte, als dass sie den Falschen erwischt hatten, denn allein fände er niemals den Weg nach Hause. Aber selbst das war ein