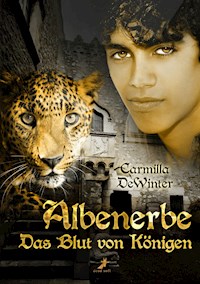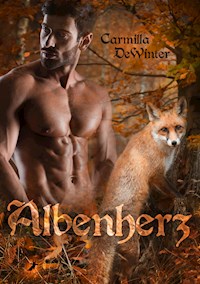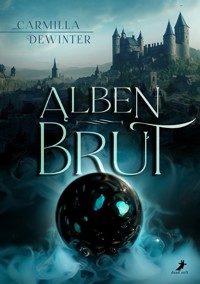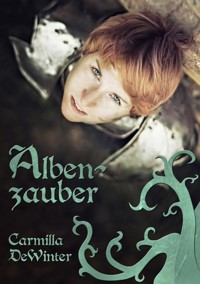Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie müssen keine Kriegerinnen sein, um zu kämpfen. Aber den Umgang mit Schwert, Dolch und Lanze zu kennen ist überaus nützlich, wenn man sich mit störrischen Nordmännern, vagabundierenden Rittern und schwangeren Drachen herumschlagen muss, die gerade Appetit auf Menschen haben. Allerdings ist das Arsenal der Frauenwaffen nicht auf Eisen und Stahl beschränkt. List, Tücke und diebische Finger gehören ebenso dazu wie Magie, sei sie lodernd heiß oder eisig kalt. Eine Portion Unberechenbarkeit kann auch nicht schaden. Und wenn das alles nicht reicht, kann eine Frau immer noch auf Wissen und Weisheit ihrer Ahninnen zurückgreifen. Falls sie es nicht mit der Universalwaffe aller Menschen zu allen Zeiten probiert: Liebe. Achtzehn Autorinnen und Autoren stellen ihnen in einundzwanzig Fantasy-Geschichten starke Frauen vor, die mit Mut, Magie und mancherlei Waffen um Leben, Freiheit, Stärke und nicht zuletzt um ihre Träume kämpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schwertgesang und Zauberschatten
Fantasy mit starken FrauenAnthologie
Haselünne, Oktober 2022Machandel Verlag Charlotte ErpenbeckCover-Bildquelle: grandfailure/depositphotos.com Innen-Illustrationen: balashovmihail38/Elymas/jeid5x/depositphotos.comISBN: 978-3-95959-355-7
Der Schatz des Konigs
Carmilla DeWinter
Es behagte Eusebia nicht, ihren Sohn aus den Augen lassen zu müssen, aber die Zeit wurde langsam knapp. Wenn sie dem Meister endgültig entkommen wollte, musste sie das Geld für eine Flucht auftreiben.
»Schon wieder eine Verabredung, hm?«, fragte die Zimmerwirtin, die keine Gelegenheit ausließ, Eusebias mangelnde Tugend zu kommentieren. Die Verachtung troff aus jedem Wort, während sie Eusebias Kleid aus durchscheinenden Lagen musterte.
»Wie angekündigt.« Eusebia küsste ihren Sohn auf den Scheitel und überreichte ihn der griesgrämigen Frau. Diese hob Jorgo mit einem geübten Griff auf ihre Hüfte und stupste ihn mit der freien Hand auf die Nase.
»Na, Spatz, wie geht es dir?«, gurrte sie.
Jorgo kicherte.
Die Wirtin lächelte zurück, dann wandte sie sich Eusebia zu. Jeder Anflug von Fröhlichkeit verschwand. »Wenn du ihn nach der Sperrstunde abholst, kostet es extra.«
Als ob Eusebia das nicht wüsste. Sie nickte. »Ich werde pünktlich sein.« Hoffentlich. Denn morgen wollte sie in aller Frühe aufbrechen – mit dem Gold.
Offenbar zweifelte die andere dieses Versprechen ebenfalls an, denn ihre Lippen pressten sich zu einem dünnen Strich. Der Nachteil, wenn man mit einem Geleitschreiben »zum Zwecke der Heiratsvermittlung« reiste. Jeder wusste, dass diese Art Schreiben billig zu haben waren und vor allem von besonders teuren Huren genutzt wurden. Eine gute Tarnung, wenn eine Frau nicht gleichzeitig als halbwegs zuverlässige Mutter gelten wollte.
Die Götter wussten, dass Eusebia das nicht einmal vor sich selbst schaffte.
So wie jetzt. Der Kleine begann zu weinen, als die Zimmerwirtin sich von der Tür abwandte.
Eusebia krallte die Finger in ihr Kleid. Wenn sie ihn jetzt anfasste, würde sie nie loskommen. »Ich bin bald zurück, Carissimo«, gelobte sie und eilte aus dem Haus.
War das, was sie tat, richtig? Sollten gute Mütter nicht die ganze Zeit ihr Kind umsorgen, statt es Fremden zu überlassen? Eusebia wusste es nicht. Dazu hatte sie zu wenige Erinnerungen an ihre eigenen Eltern, die sie aus Not an den Meister verkauft hatten, kaum dass sie laufen konnte.
Die Lemures sollten sie holen, wenn sie ihren Sohn einem solchen Schicksal aussetzte. Und dieser Auftrag der Gräfin – mit dem Geld würde sie im Norden untertauchen können, bis Jorgos Vater nicht mehr nach ihnen suchen ließ. Und bis der Meister hoffentlich vergaß, dass sie ihm noch etwas schuldete.
Vor dem Meister hatte sie mehr Angst.
Draußen lastete die Spätsommerhitze auf der Stadt, als wollte sie Eusebia an seine erdrückende magische Aura erinnern.
Drei Straßen weiter stand, wie abgesprochen, eine geschlossene Kutsche vor dem Hospital. Unter dessen Portikus sprach die junge Gräfin mit einer Greisin in einer Heilerinnenrobe, sodass Eusebia unbemerkt die Wagentür öffnen und ins Innere schlüpfen konnte.
Gleich darauf stieg die Gräfin ein, der Kutscher warf die Tür hinter ihr zu, und der Wagen rumpelte vorwärts. Dann schnippte die Gräfin mit den Fingern. Ein Fächelzauber bewegte die stickige, parfümgeschwängerte Luft, ohne für viel Erfrischung zu sorgen.
»Die Armbänder werden zu gut überwacht«, sagte die Gräfin. »Ferdinand ist gerissen und misstrauisch. Am liebsten wüsste er wohl von jedem Menschen der Welt, wo er sich gerade aufhält.«
Eusebia unterdrückte ein Seufzen und nickte ergeben. So ein Armband hätte ihr vieles erleichtert. Nun würde sie mit Sicherheit zu spät kommen, um Jorgo vor der Sperrstunde von der Wirtin zu erlösen. Er war zwar entwöhnt, aber das arme Kind würde völlig verstört sein, wenn er nachts aufwachte und Eusebia nicht an seiner Seite fand.
»Wir haben aber für ein wenig Ablenkung sorgen können«, ergänzte die Gräfin.
Was sollte das heißen? Doch auf Eusebias fragenden Blick reagierte die andere nicht.
»Vielen Dank, meine Dame.«
Diese nickte viel zu huldvoll für die ungenauen Nachrichten, die sie überbracht hatte, und steckte Eusebia ein Papier zu. Darauf befand sich die Zeichnung eines handtellergroßen Silberspiegels, den König Ferdinand oft bei sich trug.
Exakt auf diesen Spiegel hatte es eine Koalition von ehrgeizigen Adligen abgesehen. Er diente je nach Gerücht als Sitz eines bösen Geistes, für Blicke in die Zukunft oder als Sprachrohr zu einem geheimen Berater. Man hoffte wohl, den König damit erpressen zu können. Worum genau Landesherrschaft und Adel sich stritten, hatte Eusebia nicht gefragt.
Sie prägte sich die Einzelheiten ein und gab die Zeichnung wieder zurück.
Als Nächstes wühlte die Gräfin einen Beutel zwischen den Kissen hervor, aus dem sie eine flache, dunkelgraue Schatulle zog. »Blei und Gold«, sagte sie. »Fass den Spiegel nicht mit den Fingern an, schieb ihn gleich in diese Dose und versiegle sie.« Sie demonstrierte den Verschluss.
»Selbstverständlich, meine Dame.« Eusebia nahm das Ding entgegen: Es war schwer, der Zauber daran kaum zu bemerken. Um die Gräfin zu beruhigen, zeigte sie, dass sie den Mechanismus verstanden hatte.
Zuletzt überreichte ihr die Gräfin einen Beutel, damit sie die Dose am Gürtel befestigen konnte.
Die Kutsche hielt an. »Meine Schwester ist für ihre ausschweifenden Feste bekannt, Werteste. Ich werde wissen, wenn du wieder hier eintriffst, und dann bei Gelegenheit herauskommen«, sagte die Gräfin. »Wir sehen uns später.«
Bei Gelegenheit. Doch die Gräfin tat nur so kaltblütig, ihr Atem ging zu flach.
»Selbstverständlich, meine Dame«, wiederholte Eusebia.
Sie wartete, bis der Kutscher der Gräfin aus dem Verschlag geholfen hatte. Draußen flötete diese etwas zur Begrüßung irgendeines Herrn, der lachte. Die Tür blieb offen.
Nun tat Eusebia das, was der Meister sie gelehrt hatte: Verschwinden. Ihr mittelstarkes Zaubertalent zerfaserte, bis es nur für sehr aufmerksame und sehr begabte Magier zu finden war, dann verschmolz sie für fremde Augen mit dem Hintergrund.
Solche Dinge konnten nur Leute, die genau wussten, wer sie waren, oder solche, die sich selbst vollkommen aufgegeben hatten. Das hatte Meister Xerxes zu einem Adepten gesagt. Eusebia hatte lange zu der zweiten Gruppe gehört.
Sie wagte sich aus der Einfahrt der Villa und wanderte bergan, bis die Adelswohnsitze dem Garten vor dem Stadtschloss wichen. Hier residierte Ferdinand, der junge König von Divitania, mit Frau und Kindern.
Um diese Tageszeit unter der Woche speiste die Familie der Gräfin zufolge gemeinsam. Am Wochenende suchte der König oft anderweitig Zerstreuung – niemand wusste genau, wo –, aber dann wäre auch der Spiegel verschwunden.
Wie erwartet, passierte Eusebia die Wachhabenden, die aufmerksam die Umgebung beobachteten, unbehelligt und betrat den inneren der beiden Höfe. Nach imperialer Tradition plätscherte ein Springbrunnen in dessen begrünter Mitte. Im Säulengang folgte sie zwei plauschenden Bediensteten, die saubere Wäsche auf einem Wagen umherrollten. Ein Glücksgriff, denn alle Hintertüren waren durch Zauber gesichert. Die Frau streifte ein solches Armband, wie es die Gräfin Eusebia eigentlich versprochen hatte, über die Klinke und hielt einen Türflügel geöffnet, während der picklige Jüngling den Wagen hineinrollte. Passenderweise würde Eusebia damit in den Teil des Schlosses gelangen, in dem sich laut der Gräfin das Schreibzimmer des Königs befand.
Eusebia folgte den schwatzenden Bediensteten dichtauf, trotzdem blieb ein Zipfel ihres Gewandes eingeklemmt in der Tür zurück.
Bei allen von Hexen ausgeraubten Gräbern, das hatte ihr gerade noch gefehlt. Nur dank jahrelanger Übung unterdrückte Eusebia jeglichen Laut und machte sich daran, die Seide aus dem Spalt zu lösen.
Sie konnte es sich nicht leisten, eine Spur in Form eines Fetzens zu hinterlassen. Genauso wenig konnte sie es sich leisten, dass irgendwer über sie stolperte, und bei dem derzeitigen Betrieb auf dem Gang wäre das mehr als wahrscheinlich. Die beiden mit dem Wagen hatten sich zu einem halben Dutzend anderer Bediensteter gesellt, die den Anweisungen einer resoluten Matrone in Bezug auf einen Überraschungsgast lauschten.
Obwohl Eusebia schon brenzligere Situationen erlebt hatte, brach ihr der Schweiß aus. Ihre Finger zitterten. Damals hatte sie nur dem Meister gedient, und ihr eigenes Leben war ihr wertlos erschienen. Heute hatte sie ein Kind, das auf sie wartete. Es dauerte eine endlos lange Zeit, den Stoff zu befreien.
Sie sollte sich praktischere Kleidung besorgen. Das, was sie im Haus von Jorgos Vater eingepackt hatte, war hübsch, der Ehefrau des Hausherrn angemessen. Fließende Gewänder aus teuren Stoffen. Nichts, das sich für einen Einbruch eignete.
Doch bevor sie weitergehen konnte, schnaufte ihr die Matrone entgegen. Die Haushofmeisterin. Eusebia hatte ihr mit halbem Ohr zugehört: Offenbar war sie von der königlichen Tafel verscheucht worden, um das Zimmer für einen Cousin des Königs vorzubereiten. Die Haushofmeisterin hatte nicht mit Schimpfworten für den verzogenen jungen Mann gegeizt, der nicht einmal die Höflichkeit besaß, pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Jetzt wollte sie hinaufsteigen und ihrem Herrn Bescheid geben, dass bis zum Eintreffen des verzogenen Adelssprosses alles vorbereitet sein würde.
Eusebia wollte wetten, dass der Cousin die angekündigte Überraschung war. Futterneid innerhalb der eigenen Familie?
Um den Hals der Haushofmeisterin hing ein goldener Schlüssel an einer ebensolchen Kette. Die Magie an dem Objekt versah die lohend lindgrüne Aura der Frau mit einem gelben Rand, war also sehr stark.
Eusebia folgte der Frau und zückte dabei das Blasrohr mit dem selbst angemischten Gift.
Die feine Nadel zwickte die Haushofmeisterin ins Genick, kurz bevor sie die Treppe erreichte.
Die Frau schlug nach dem winzigen Pfeil und schimpfte über die elenden Mücken. Auf der ersten Stufe sank sie bewusstlos zusammen. Das Gift würde eine Person dieses Umfangs für eine knappe halbe Stunde außer Gefecht setzen, das reichte.
Eusebia schleppte sie in das Dunkel unter der Treppe, schnappte sich die Kette mit dem Schlüssel und hastete die breiten Steinstufen ins zweite Stockwerk hinauf.
Der Gräfin zufolge lag das Schreibzimmer des Königs am Eck und besaß einen prächtigen Blick auf den Fluss und die Innenstadt.
Im Licht der Abendsonne fand Eusebia die betreffende Tür schnell. Das Schloss war mit einem Zauber gesichert, der vor ihrem inneren Auge im gleichen Gelbton leuchtete wie der Schlüssel. Ansonsten spürte sie keine weiteren Sicherungen.
Oder?
Sie strich über das edle rotbraune Holz der Türzarge. Da war nichts. Wie auch? An Holz hingen niemals Zauber, sie zerfielen zu schnell. Mit ihren Sinnen tastete Eusebia sich auf die andere Seite, aber auch da gab es nichts.
Eusebia steckte den Schlüssel ins Schloss. Die metallene Klinke glomm auf, innen klickte etwas, und die Tür sprang auf. Ein schneller Blick bestätigte, dass das Zimmer leer war, also trat Eusebia ein. Dabei streifte etwas ihre Stirn wie der Faden eines Spinnennetzes, sie wischte danach. Wie seltsam.
Als sie die Tür hinter sich schloss, hielt sie Ausschau nach einem Netz oder einem Haar, das jemand an den Rahmen geklebt hatte. Nichts dergleichen. Offenbar spielten ihre aufgewühlten Nerven Eusebia Streiche, oder es hatte einen Luftzug gegeben.
Das Arbeitszimmer besaß wirklich eine atemberaubende Aussicht. Im Abendlicht funkelten die vergoldeten Kuppeln der drei wichtigsten Tempel. Aber nichts war so schön wie Jorgos Lachen. Eusebia wandte sich dem Schreibtisch zu, der aus dem gleichen rotbraunen Holz wie die Türzarge bestand.
Da lag der Spiegel neben einem Stapel Urkunden, die auf Siegel und Unterschriften warteten.
Eusebia hielt ihre Hand darüber – der Zauber am Metall war noch mächtiger als der Schließzauber der Tür, viel komplexer und gleichzeitig subtiler. Bei einer flüchtigen Überprüfung würde niemand vermuten, dass es sich um mehr als einen Handspiegel handelte.
Das Werk einer Künstlerin, das musste Eusebia anerkennen.
Sie band den Beutel von ihrem Gürtel los, holte die Bleischatulle heraus und öffnete sie.
Jetzt –
Die Tür knarrte. Ein Mann um die dreißig mit vollem dunklem Haar und einem modischen Bärtchen starrte in den Raum und runzelte die Stirn.
Der König.
Die Lemures sollten die Gräfin holen. Was war aus dem Ablenkungsmanöver geworden?
Wenigstens konnte er Eusebia nicht sehen. Auf keinen Fall. Die Zauber auf der Schatulle waren gut verborgen, und der gestohlene Schlüssel würde nicht auffallen, solange er um Eusebias Hals hing. Derlei hatte sie geübt, bis selbst der Meister seine Schwierigkeiten gehabt hatte, sie zu finden. Eusebia wich vom Schreibtisch zurück und stellte sich neben die Büste eines Philosophen, den sie nicht erkannte. Sie musste nur in dieser Ecke bleiben und ruhig abwarten.
Ihr Herz schien eine andere Vorstellung zu haben und rumpelte in ihrem Brustkorb wie ein ungebremstes Fuhrwerk.
Der König betrat den Raum, die Hände angriffsbereit erhoben. Um seine Finger knisterten Blitze.
Erst nach langen Augenblicken verschwanden sie wieder. Mit zusammengekniffenen Augen spähte er im Raum umher, aber Eusebia würde er so nicht entdecken. Seine Lippen pressten sich zu einem dünnen Strich.
Zweimal atmete er tief durch. Dann klatschte er in einem bestimmten Abstand in die Hände, wie Eusebia es bei Betrügerinnen gesehen hatte, die dem einfachen Volk mit vermeintlichen Ahnenbeschwörungen das Geld aus der Tasche zogen.
»Zeig dich!«, rief er, die Hände weiterhin erhoben, den Kopf zum Lauschen geneigt.
Eusebia zwang sich, nicht die Luft anzuhalten.
Seine Finger zuckten. Der König sammelte Macht, aber wozu?
Dann riss er die Hände auseinander, Staubfontänen ergossen sich aus Aktenbergen, Büchern, Regalen in den Raum. Es kitzelte in Eusebias Nase, in ihrem Rachen, ihre Augen tränten.
Jetzt hielt sie den Atem an. Nur nicht niesen.
Die Bewegung aus seinem Handgelenk bemerkte sie zu spät.
Sie hechtete vor dem Fangnetz zur Seite, doch dabei geriet die Büste ins Wanken. Einem zweiten Fangzauber konnte sie nicht ausweichen, er wickelte sich um ihre Füße und brachte sie zu Fall, sodass ihre Ellenbogen am Bodenmosaik aufschürften. Eusebia zwang ihren Atem in ein ruhigeres Tempo, damit der König sie nicht hörte. Was jetzt? Sie hatte Jorgo versprochen, dass sie ihn holen würde. Sehnsucht stach in ihr Herz. König Ferdinand würde sie nicht gehen lassen. Oder?
Aber er war ein König. Einen von seinem Stand und dieser Zaubermacht würde der Meister kaum herausfordern wollen. Nicht für die Geschäftsgeheimnisse von Jorgos Vater. Trotz all seiner Macht war der Meister ein Kleingeist geblieben, der zwar den Reichtum genoss, aber Verantwortung scheute.
»Wirst du dich jetzt zeigen?«, fragte König Ferdinand und schaute dabei suchend an Eusebias Kopf vorbei. »Oder muss ich dich rösten wie ein Schwein?«
Eusebia sammelte sich und hob ihre Tarnung auf.
Seine Brauen schossen in die Höhe. Blinzelnd fing er sich. »Das ist ein seltenes und gefährliches Kunststück«, stellte er fest. »Außerhalb von altertümlichen Versen und dramatischen Liebesgeschichten rechnet man nicht mit so etwas.«
Er beobachtete ihre Hände. Befürchtete er, sie würde ihn mit mehr Zauberkünsten aus dem Märchen überraschen? Ihn vielleicht mit einem Albenzauber umgarnen?
Niemand zuvor hatte sie angesehen, als wäre sie eine Bedrohung. Weder dem glänzenden Haar, noch dem wogenden Busen oder den wohlgeformten Hüften widmete der König Aufmerksamkeit. Es war eine Wertschätzung ihrer echten Talente, eine Musterung, die Eusebia trotz der Situation mit Stolz erfüllte.
»Ich weiß, dass es gefährlich ist, Majestät«, sagte sie. Dann holte sie tief Luft. »Es könnte zu Eurer Verfügung stehen.«
Er rieb sich den Bart. Brummte. »Tatsächlich?« In seinen Blick schlich sich eine Berechnung, die Eusebia an den Meister erinnerte.
Trotzdem sprach sie weiter. Ihr Sohn brauchte sie, und sie war kein Kind mehr. »Ich könnte Euch meine Auftraggebenden ans Messer liefern und ab jetzt für Euch arbeiten.«
»So. Und was sagt mir, dass Ihr nicht mit dem ersten Schiff verschwindet, Madame Unbekannt?«
Ja, was? Bei dem berechnenden Glimmen in den Augen ihres Gegners würde sie sich hüten, ihren Sohn zu erwähnen. Wie dem König die Treue versichern, ohne sich zu sehr abhängig zu machen?
Denn wenn sie es schaffte, den König gleichzeitig auf Abstand zu halten und sich als nützlich zu erweisen, wäre das hier besser als jedes Leben im Norden, das sie sich aufbauen konnte. Spionieren hatte sie gelernt. Im Gegensatz dazu, wie man ein Geschäft führte.
»Ein Blutschwur, dass ich zurückkehren und über die Einzelheiten schweigen werde?«, bot sie an. »Vor jedem Auftrag.«
Wieder wanderten seine Brauen nach oben. »Blutzauber sind in noch mehr Staaten geächtet als Sklaverei.«
Eusebia zuckte die Achseln. Sie würde mit einem gesetzeswidrigen Schwur leben können, solange der König nicht um die Wortwahl handelte und absoluten Gehorsam einforderte. Denn den würde er ausnutzen, das spürte sie. »Wann hat das jemals irgendwen abgehalten, der machthungrig genug war?«
Mit einer Handbewegung gab er ihrem Einwand statt. Die Fessel löste er so weit, dass er Eusebia auf einen der Hocker an der Wand bitten konnte. »Verratet Ihr mir, was Ihr stehlen solltet?«
»Den Spiegel.«
»Den?« Der König starrte das Ding auf dem Schreibtisch an. Auf seinem Gesicht breitete sich ein bösartiges, siegessicheres Grinsen aus. »Sieh an. Meine Frau wird sich wohl damit abfinden müssen, ihn bei Tisch zu sehen. Oder vielleicht finde ich einen Ersatz. Wenn Ihr mich entschuldigen wollt?«
Er griff nach dem Spiegel und trat nach draußen auf den Gang. Die Tür schloss sich mit einem Klicken, gleichzeitig leuchtete etwas auf – ein Zauber auf dem Holz! Wie das? Der König musste den begabtesten Magier der Welt auf seiner Seite haben.
Eusebia presste ein Ohr an die Tür, hörte aber nur das Gemurmel einer Stimme. Eine Art Sprachrohr? Zu einer Geliebten vielleicht? Die gleichzeitig für die Zauber verantwortlich zeichnen musste. Kein Wunder, dass die Königin – magisch völlig unbegabt, nur als Zuchtstute geheiratet – nicht wünschte, dass der König diesen Spiegel in ihrer Gegenwart benutzte.
Weil das Lauschen keine Ergebnisse lieferte, trat Eusebia von der Tür zurück. Es dauerte auch nicht lange, bis der König wieder eintrat.
»Habt Ihr ein Messer für den Schwur?«
Es war eine halbe Stunde bis zur Sperrstunde, als Eusebia ins Innere der gräflichen Kutsche schlüpfte.
Ihre Auftraggeberin ließ nicht lange auf sich warten. Hinter ihr schloss der Kutscher die Tür, auf ein Fingerschnippen hin spendete eine kleine Leuchtkugel kühles Licht.
»Was hast du denn so lange gebraucht?«, zischte die Gräfin.
»Verzeiht, meine Dame«, sagte Eusebia. »Die Ablenkung traf etwas verspätet ein.«
»Und?«
»Hier.« Eusebia löste den Beutel mit der Bleischatulle von ihrem Gürtel. Die Gräfin machte eine fast kindliche »Gib mir«-Geste wie Jorgo, wenn er Hunger hatte, und ein ebenso gieriges Gesicht dazu.
»Erst will ich die Belohnung sehen«, bestimmte Eusebia.
Die Gräfin zuckte mit der Nase, aber sie reichte unter sich, schob ein gut verborgenes Türchen in den Intarsien auf und holte einen Lederbeutel hervor. Darin klimperte es verlockend.
Die Gräfin öffnete die Börse und ließ Eusebia einen Blick auf den Glanz der Goldmünzen darin werfen. Dann hängte sie einen Zauber an den Inhalt, der mit ihrem Armreif verbunden war. »Ich löse ihn, sobald ich sehe, dass der Spiegel in der Schatulle ist.«
Eusebia überreichte also den Beutel. Dabei verbarg sie den zweiten Giftpfeil in der Hand. Nur für den Fall, dass die Gräfin gewiefter war als angenommen. Diese wog ihre Beute zufrieden in der Hand, holte das Bleigefäß heraus und ließ es aufschnappen.
Jetzt breitete sich ein zufriedenes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. »Wie schön.« Der Zauber, der das Gold festhielt, verschimmerte. »Du kannst gehen. Und du weißt, was wir vereinbart haben?«
»Ja, meine Dame.« Eusebia hatte versprochen, das Geld zu nehmen und zu verschwinden. »Ihr werdet mich nie wiedersehen.« Welcher Zauber auch immer auf diesem Spiegel lag – Ferdinand schien sich sicher, dass er ihn überall auf der Welt finden konnte. Er musste nur abwarten, bis die Gräfin ihre Gefolgsleute um sich gesammelt hatte, um die Verschwörung zu zerschlagen.
»Gut«, sagte die Gräfin. Sie klopfte an die Wand hinter sich, die Kutsche hielt, und Eusebia schlüpfte mit ihrem Gold hinaus in die Nacht.
Mit dem letzten Läuten des Tages vom nächstgelegenen Tempel stürmte Eusebia in die Herberge. Die Zimmerwirtin kam ihr gerade mit einer Lampe und dem Schlüssel entgegen.
Wie üblich kniff sie bei Eusebias Anblick die Lippen zusammen. Diesmal hatte sie sich wohl eine zusätzliche Bezahlung ausgemalt, auf die sie wegen Eusebias Pünktlichkeit nun verzichten musste.
Mit einem freundlichen Lächeln, das die Zimmerwirtin nicht verdient hatte, bedankte sich Eusebia für die Mühe, händigte den vereinbarten Lohn aus und hob den schlafenden Jorgo von der Eckbank in der Wohnung der griesgrämigen Frau. Sie küsste ihren Sohn auf den Scheitel und sog den lieblichen Kleinkindgeruch seiner Haare ein. Er schmatzte und krallte die kleinen Finger in ihren Ausschnitt.
Die Zimmerwirtin begutachtete derweil Eusebias Kleid und die Frisur. »Wo hast du dich denn rumgetrieben? So viel Staub.« Sie schnalzte mit der Zunge.
»Jemand hatte seine Bücherregale lange nicht gereinigt.« Ein Grinsen zerrte an Eusebias Lippen, denn das Weib würde wohl der Schlag treffen, sollte sie je erfahren, wo Eusebia sich herumgetrieben hatte.
Der Jemand mit den schlecht geputzten Regalen wünschte, sie übermorgen in aller Frühe zu sehen, um sich ein besseres Bild von ihren Fähigkeiten zu machen. Aber auch das verriet sie der Zimmerwirtin nicht, denn bis dahin gedachte Eusebia, sich eine Wohnung und für Jorgo eine Amme zu suchen, die über bessere Laune und weniger Vorurteile verfügte.
Das Bildnis der Leuchtenden
Angelika Diem
»Da vorne ist es!«, hörte Deyra ihren Führer rufen.
Sie blieb stehen, rückte das Bündel auf ihrem Rücken zurecht und atmete tief ein. Vor ihr erstreckte sich die Hochebene von Tarson, wogendes Land überzogen mit borstigem Gras, orangenen Flechten und silbrig glänzenden Moospolstern. Weiter im Norden verhüllten Wolken die Gipfel der Schlafenden Wächter. Insgeheim war Deyra froh darüber, dass ihr der Anblick der schneebedeckten Spitzen erspart blieb. Der Weg nach Tarson hatte sie alle Kraft gekostet. Bei dem Gedanken, dass ihr Ziel vielleicht weit hinter den Häuptern der Wächter liegen mochte, ließ sie die Schultern müde hängen.
Re-Andar, den sie auf dem Markt von Kadnihra als Führer angeworben hatte, nickte ihr zu. »Bald sind wir im Lager. Dort könnt Ihr Euch ausruhen.«
Deyra bedankte sich mit schwacher Stimme. »Wird der Lha-Innit mich empfangen?«, fragte sie, während sie mit gesenktem Kopf über den federnden Boden schritten. Deyra hatte Mühe, in Re-Andars Schatten zu bleiben. Ihm schien weder die sengende Hitze noch die dünne Luft etwas auszumachen, ebenso wenig wie die beißende Kälte der Nacht. Aber er war es schließlich auch gewöhnt, wie alle Tarsii.
»Ich werde dem Lha-Innit sagen, dass ihr die Gefährtin des Farbmagiers seid.«
»Mein Mann ist Maler«, erwiderte Deyra geduldig, »kein Magier.«
»Maler, pah!« Re-Andar lachte. »Mein Bruder ist Maler, er zeichnet Muscheln und Blüten auf die Arme seiner Frauen, aber nur ein Magier vermag ganze Berge und Menschen mit einem Stück Kohle und ein paar Klecksen einzufangen. Euer Mann hat dem Lha-Innit ein Bild des Höchsten Wächters geschenkt, als Dank für ein paar Nächte an seinem Feuer und ein paar Streifen getrocknetes Fleisch.«
»Wird der Lha-Innit mir helfen, die Leuchtenden zu finden?«, fragte Deyra drängend.
Re-Andar vermied es, ihr ins Gesicht zu blicken. »Die Leuchtenden sind eine Sage der Flachländer, Gefährtin des Farbmagiers.«
»Mein Mann hat an sie geglaubt, deshalb ist er zu Eurem Volk gekommen. Ist er noch hier?«
»Ich habe Euch doch erzählt, dass Euer Gefährte uns schon vor mehr als einem Mondwechsel verlassen hat.«
»Aber Ihr weigert Euch, mir zu sagen, wohin er sich wandte.«
»Er hat es mir nicht gesagt und ich war nicht sein Hüter.«
Deyra seufzte und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Das hatten wir schon hundert Mal. Ihr schweigt Euch aus, dennoch, ich werde die Wahrheit erfahren.« Die Entschlossenheit verlieh ihrer Stimme einen stählernen Unterton, den auch Re-Andar nicht überhören konnte. Er blickte sie mit einer sonderbaren Mischung aus Respekt, Verzweiflung und Mitleid an, zuckte die Schultern und marschierte weiter.
Je weiter sie auf die Hochebene hinauswanderten, desto welliger wurde das Land. Ein scharfer Wind kam auf, vermochte jedoch der Sonne nichts von ihrer Hitze zu nehmen. Deyra war dankbar für die Schmiere aus Bärenfett und Kräuterölen, mit der sie sich auf Re-Andars Drängen hin alle paar Stunden eingerieben hatte, seit sie vor drei Tagen den letzten Nadelwald hinter sich gelassen hatten. Ohne die übelriechende Mischung wäre ihr Gesicht längst ein einziger rotverbrannter Fleck, trotz des Schleierhutes, den der Wind vergeblich von ihrem Haar zu zerren versuchte.
Als sie die nächste Erhebung überquerten, tauchte in der Senke dahinter eine Herde kurzbeiniger Rinder auf. Graues Zottelfell schützte die gedrungenen Körper, und die seltsam gedrehten Hörner glänzten in sattem Rot.
»Shelas«, erklärte Re-Andar auf ihren fragenden Blick hin. »Sie versorgen meine Leute mit Wolle, Leder, Fleisch und Milch. Ohne sie und die Alten Riesen könnten wir hier nicht überleben.«
»Wer sind diese Alten Riesen?«
Re-Andar drehte sich um und grinste. »Wir stehen auf einem.«
»Der Hügel?«
»Das, was in ihm begraben liegt.« Er sah sich kurz um, machte ein paar Schritte und kniete nieder. Seine Hände gruben sich zwischen zwei Moospolstern in das sandige Erdreich. Deyra stellte sich neben ihn und beobachtete erstaunt, wie er etwas freischaufelte, das wie ein schmaler weißer Stein aussah.
Schließlich trat er zurück und forderte sie auf, es anzufassen. Nur zögernd glitten Deyras Fingerspitzen über die seidig glatte Oberfläche, die sich ganz und gar nicht wie richtiger Stein anfühlte, sondern wie ... »Knochen!« Sie sprang erschrocken auf. »Das ist ein Grab!«
»Ganz Tarson ist ein Friedhof«, sagte Re-Andar gelassen, »der Friedhof der Alten Riesen. Ehe die Götter Tarson über alle anderen Länder erhoben, muss es unter Meereswogen verborgen gewesen sein. Meine Vorfahren haben einst einen Alten Riesen vollständig ans Sonnenlicht geholt. Er hatte die Knochen eines Fisches mit einem Maul, das zehn Männer auf einen Bissen verschlingen konnte. Wir haben auch kleinere Fische gefunden, Muschelschalen und versteinertes Krebsgetier. Aber die Reste der Alten Riesen sind durch einen Zauber, den nur die Götter verstehen, noch immer so glatt und biegsam, als wäre das Fleisch erst gestern von ihren Knochen gefallen.«
Schweigend gingen sie weiter. Deyra versuchte, an die Alten Riesen zu denken, an das Meer, in dem sie geschwommen waren, aber ihre Gedanken kehrten immer wieder zu Alwyn zurück. Heute war es vier Monate her, seit er ihr Haus verlassen hatte, in der Hoffnung, das Unmögliche zu erreichen.
Sie dachte auch an Baron Kargis, und brennender Zorn erfüllte sie. Sie sah ihn wieder vor sich, wie er neben der Kutsche stand und sein Blick über Yarana, ihre vierzehnjährige Tochter, glitt. »Sie mag auf meine Burg kommen«, hatte er sie wissen lassen. »Es wird sich dort eine Stelle für sie finden, als ... Dienstmädchen.«
Bleich und zitternd hatte sich Yarana an ihre Mutter gedrückt. Jeder wusste, was der Baron mit den jungen Dienstmädchen trieb.
Doch dem Gesetz nach stand ihm zu, von säumigen Pächtern einen Jahresdienst oder eine gleichwertige Leistung zu fordern. »Bedauerlich«, hatte der Baron noch zu Alwyn gesagt, »dass Er das Geld des Herzogs anderweitig verprasst hat.« Dabei wussten sie alle, dass der Baron zehn Goldstücke für Alwyns bislang bestes Werk »Die Tanzenden Wasser« von Herzog Parrayn erhalten und acht davon in seine Tasche gesteckt hatte.
All die Zeit, die Alwyn für das Bild der »Tanzenden Wasser von Ghan« auf Reisen gewesen war, das Geld für die Leinwand, die Kohle und die Farben, alles vergebens. Ohne Alwyns Unterstützung hatte Deyra die Feldarbeit trotz der Mithilfe Yaranas und ihres zwölfjährigen Bruders Faron kaum geschafft, und als dann noch ein Sommerhagel auf das erst zur Hälfte abgeerntete Getreide niederprasselte, hätten sie das Geld des Herzogs dringender denn je gebraucht.
In jenem schrecklichen Augenblick, als Deyra sich voller Verzweiflung gefragt hatte, wie sie Yarana den Jahresdienst ersparen konnten, war Alwyn vor den Baron getreten. »Und wenn ich Euch ein Bild male, wie es noch nie gemalt worden ist?«, hatte er den Baron gefragt, »könnt Ihr dann auf Yaranas Dienst verzichten?«
»Ein Bild, das jenes der ›Tanzenden Wasser‹ übertrifft?« Der Baron hatte nicht lange überlegen müssen. »Der Herzog soll sich gelb ärgern. Ich will ein Bildnis der Leuchtenden.«
»Aber die gibt es doch gar nicht!«, hatte Deyra entsetzt ausgerufen.
»Deshalb ist auch noch nie ein Bild von ihnen gemalt worden«, hatte der Baron erwidert. »Bringe Er mir das Bild, dann darf Seine Tochter bei der Mutter bleiben. Ich gebe Ihm dafür ein halbes Jahr. Ist das Bild dann nicht in meiner Hand, wird sich Seine Tochter auf der Burg einfinden.«
Mit diesen Worten hatte er sie stehen lassen.
Noch am selben Tag hatte Alwyn sein Bündel gepackt. »In allen Geschichten wird von einer Verbindung zwischen den Tarsii und den Leuchtenden berichtet. Es muss sie einfach geben, und ich werde sie finden, für Yarana«, hatte Alwyn ihr zum Abschied gesagt.
An diese Worte hatte sich Deyra geklammert, während sie weiter und weiter nach Norden vordrangen.
Endlich, ihre Füße vermochten sie kaum noch zu tragen, tauchte eine besonders große und tiefe Senke vor ihnen auf. An der tiefsten Stelle säumten gut dreißig kuppelförmige Zelte einen kleinen Bach. Sie hatten das Lager der Tarsii gefunden. Männer, Frauen und Kinder mit goldkupferner Haut und rauchgrauen Augen scharten sich um die Neuankömmlinge. Sie wirkten alle gesund und fröhlich. Die wenigen Alten bewegten sich genauso flink und kraftvoll wie die jungen Tarsii. Schwäche und Krankheit schienen ihnen fremd zu sein. Was für ein glückliches Volk, dachte Deyra neidisch.
Re-Andars drei Frauen begrüßten ihn stürmisch. Er lachte, plauderte in seiner für Deyra unverständlichen Stammessprache, verteilte kleine Geschenke, und als Deyra schon glaubte, er hätte sie vergessen, wechselte er in die Sprache des Flachlandes und stellte sie dem Stamm vor.
Als sie hörten, dass der Farbmagier ihr Gefährte war, ging ein Raunen durch die Versammlung. Deyra begegnete Blicken, die sowohl mitleidsvoll wie misstrauisch waren. Ehe sie sich einen Reim darauf machen konnte, wichen die Tarsii auf einer Seite zurück und ließen einen Weg für den Lha-Innit frei. Deyra hatte einen alten, weißhaarigen Mann erwartet, doch der Lha-Innit schien nur wenig älter als Re-Andar zu sein. Der weite Umhang aus buntgefärbtem Wollstoff umhüllte seine sehnige Gestalt. Die grauen Augen musterten Deyra von Kopf bis Fuß. Sie versuchte, seinem Blick standzuhalten, aber das brennende Licht hinter dem Grau ließ sie schaudern.
»Kommt mit mir.« Der Lha-Innit winkte sie zum größten der Kuppelzelte und schlug eine der Lederhäute zur Seite. Im Inneren brannte ein kleines Feuer, der Geruch nach Kräutern und gebratenem Fleisch hieß Deyra willkommen. Erstaunt bemerkte sie, dass die gelblichen, gebogenen Stangen, die das Gerüst des Kuppelzeltes bildeten, wie große Rippen wirkten. Die Rippen der Alten Riesen! Wie sonst hätten die Tarsii auf dieser baumlosen Ebene jemals stabile Zelte bauen können?
Das Oberhaupt der Tarsii wartete, bis es sich Deyra auf einem Bündel Häute bequem gemacht hatte. Dann ließ er sich ihr gegenüber nieder und bot ihr einen Becher mit dampfendem Kräutertee an. Deyra wollte ihren Gastgeber nicht beleidigen, also lächelte sie, nahm den Becher in Empfang und nippte an dem bitteren Gebräu.
»Ihr wandelt also auf den Spuren Eures Gefährten«, sagte der Lha-Innit.
»Bis zu Eurem Lager waren sie leicht zu lesen, Erhabener«, erwiderte Deyra, »doch weiter hat der Wind sie zugeweht. Könnt Ihr mir helfen?« Sie blickte ihn über den Rand des Bechers abwartend an. Würde er ihren Fragen ausweichen wie Re-Andar? Oder sie anlügen?
Der Lha-Innit nahm einen tiefen Schluck. »Euer Gefährte wollte längst wieder an meinem Feuer sitzen.«
»Er sagte, dass er wiederkommt? Wann?«
»Sobald ihm der große Zauber gelungen ist.«
Deyra verstand. »Das Bildnis der Leuchtenden! Wo finde ich sie?«
»Ich habe Eurem Gefährten gesagt, dass niemand den Pfad zweimal betritt. Geht nach Hause und betet für ihn zu Euren Göttern.«
Alwyn war tot? Deyra setzte den Becher ab und starrte in die Flammen. Irgendwo im hintersten Winkel ihrer Seele hatte sie es geahnt. Die Trauer blieb aus, desgleichen der Schmerz. Sie fühlte nur eine dumpfe Leere. »Wo liegt er begraben?«
Der Lha-Innit sah sie verständnislos an.
»Zeigt mir den Weg zu Eurem Friedhof. Oder überlasst ihr eure Toten den wilden Tieren?«
»Euer Gefährte liegt nicht bei jenen, die uns vor ihrer Zeit verlassen haben.«
Vor ihrer Zeit? Die Götter allein bestimmten, wann die Zeit eines jeden gekommen war, egal, was die Sterblichen davon hielten. Was machten die Tarsii mit den Leichen derjenigen, die »zu ihrer Zeit« aus dem Leben geschieden waren?
Doch es gab andere Fragen, die Deyra weit mehr auf der Seele brannten.
»Wo ist er, wenn nicht hier?«
»Bei den Leuchtenden.«
»Haben sie ihn getötet – ermordet?«
»Die Leuchtenden mögen keine Eindringlinge.«
»Er wollte ihnen doch nichts tun, nur sie malen.«
»Niemand nähert sich den Leuchtenden, bevor seine Zeit gekommen ist. Der Farbenmagier wollte nicht hören, er ging seinen letzten Weg.«
»Aber seine Leiche habt Ihr nicht gesehen?«, fragte Deyra vorsichtig. Hoffnung glomm in ihr auf, aber sie wagte nicht, den Funken zu nähren. »Kein Tarsii kann bezeugen, dass er tot ist?«
Der Lha-Innit sah ihr wohl an, was sie dachte. Er seufzte und kippte den Rest seines Tees ins Feuer. Es zischte. »Habt Ihr mir nicht zugehört? Von den Leuchtenden kehrt niemand wieder.«
»Sagt mir, wo ich sie finde, bitte!«
Der Lha-Innit schüttelte den Kopf.
»Ich muss ihm nach, vielleicht hat er sein Bild noch beendet, ehe er starb. Vielleicht lebt er sogar noch. Meine Kinder, sie warten auf eine Nachricht von ihrem Vater.«
»Sie warten aber auch auf ihre Mutter.«
»Es hat mir weh getan, sie zurückzulassen. Soll alles vergeblich gewesen sein? Ohne das Bildnis kann ich meine Tochter nicht vor dem Baron und seinen Schergen beschützen. Wir können nicht woanders hinziehen, denn wer würde schon Pächter dulden, die sich um den Jahresdienst drücken? Wie kann ich Yarana vor die Augen treten, ohne das Letzte versucht zu haben?«
Der Lha-Innit schwieg.
»Muss ich mich Euch zu Füßen werfen? Wo finde ich die Leuchtenden?«
Der Blick des Tarsii glitt über ihr Gesicht, von dort in eine Ecke des Zeltes, wo ein kleines Bild lehnte.
Trotz des Halbdunkels erkannte Deyra die Umrisse eines hohen Berges, dessen weiß schimmernder Gipfel sich über die Wolken erhob. Das musste das Bild sein, von dem Re-Andar gesprochen hatte, das Bild vom Höchsten Wächter, das Alwyn für den Lha-Innit gemalt hatte.
»Wenn Ihr mir nicht helfen wollt«, hörte sie sich sagen, »werde ich die Leuchtenden alleine suchen. Nach Norden werde ich gehen und herausfinden, was jenseits des Höchsten Wächters verborgen liegt.«
Der Lha-Innit zuckte zusammen und Deyra atmete auf. Sie hatte richtig geraten. »Die Tarsii haben diese Berge nicht umsonst ›Wächter‹ getauft. Bewachen sie Euer Volk vor den Leuchtenden?«
Als der Lha-Innit nur stumm den Kopf schüttelte, lächelte sie. »Wollt Ihr mir nicht wenigstens erklären, wie ich die Wächter am besten überwinde?«
Nur zögernd und mit sichtlichem Widerwillen gab der Lha-Innit nach.
»Es führt nur ein Pfad um die Flanke des Höchsten Wächters in das verborgene Tal der Leuchtenden. Sucht nach der Stelle, wo Sternblüten besonders dicht stehen und folgt dem Band aus rotem Lehm.«
»Habt Dank!« Deyra schlang die Finger beider Hände vor der Brust ineinander und neigte den Kopf, bis ihre Stirn die Daumen berührte. »Ich werde zurückkommen, schon meiner Kinder wegen.«
Der Lha-Innit sah sie nachdenklich an. »Euer Geist brennt hell. Vielleicht ...« Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern rief nach Re-Andar.
»Sie wird bei uns bleiben, bis sie stark genug ist, um den roten Weg zu gehen«, sagte das Oberhaupt der Tarsii. Re-Andars Augen weiteten sich und er verbeugte sich schweigend.
»Wir geben ihr mit, was immer nötig ist, damit sie den Spuren des Farbenmagiers folgen kann.«
Deyra empfand tiefe Dankbarkeit, als sie die Geschenke der Tarsii entgegennahm.
Die neuen Fellstiefel passten, das getrocknete Fleisch und die Moosbeerfladen würden sie fünf Tage lang satt machen. Nur einen Führer wollte der Lha-Innit ihr nicht mitgeben.
»Keiner von uns käme zurück«, erklärte er bestimmt. »Du wirst den Weg allein finden.«
Trotz der Gastfreundschaft, dem weichen Felllager und dem köstlichen Shelas-Eintopf hielt es Deyra nur zwei Tage im Tarsii-Lager. Kaum dass sie glaubte, wieder voll bei Kräften zu sein, packte sie ihr Bündel und verabschiedete sich vom Lha-Innit und von Re-Andar.
Zu ihrem Glück hielt das gute Wetter an, bis sie die Berge erreichte. Sie folgte der Beschreibung des Lha-Innit und stieß auf den gut versteckten Beginn eines Pfades, der sich um die Flanke des Höchsten Wächters wand. Der Pfad selbst war gut ausgetreten, was Deyra wunderte, war doch jeder, der ihn benutzte, dem Tode geweiht. Und wie ein Volk von Selbstmördern hatten die Tarsii nicht gewirkt. Ohne große Steigungen und Gefälle ging es einige Stunden gemütlich dahin. Kurz vor Sonnenuntergang endete der Pfad plötzlich vor einem Felsvorsprung. Darunter tat sich ein Tal auf, schmal und gewunden, dass es fast schon eine Schlucht zu nennen war. Ein Bach gurgelte zwischen verkrüppelten Kiefern und moosüberzogenen Felsen dahin.
»Das Tal der Leuchtenden«, sagte Deyra halblaut, »ich habe es tatsächlich geschafft.« Sie formte mit den Händen einen Trichter und rief mit aller Kraft den Namen ihres Mannes. Die steilen Felswände des Tals warfen den Ruf zurück. Doch eine Antwort kam nicht.
»Wo kann er nur sein?« Deyra kniete sich am äußersten Rand des Vorsprungs nieder und suchte den Talgrund nach Zeichen ab. Bis auf das Rauschen des Wassers war es seltsam still hier. Kein Wild, kein Vogel war zu sehen. Während sie vorsichtig den steilen Hang zum Bach hinunterkletterte, entdeckte sie auf der anderen Seite etwa auf halber Höhe eine dunkle Öffnung im Fels. Feiner Nebel stieg aus dem Bach auf, sie fröstelte. In der Höhle würde sie Schutz finden. Das letzte Tageslicht ausnutzend sprang sie über den Bach, um auf der anderen Talseite wieder emporzuklettern.
Die ersten Sterne blinkten, als sie erschöpft vor dem Höhleneingang zusammenbrach. Eine Weile lag sie einfach nur da, während der Mond aufging und der Nebel das Tal mit einer Decke wie schimmernde Spinnenseide überzog. Endlich raffte sie sich auf und stolperte in die Höhle. Der Nebel reichte nicht bis hier herauf und das Mondlicht genügte, um eine Feuerstelle zu finden. Ihre Hände ertasteten trockenes Holz, etwas Laub und feine Späne. Sie zog Messer und Feuerstein heraus, und wenig später konnte sie die Hände an einem kleinen Feuer wärmen.
Sie fütterte die Flammen, und ihr Licht vertrieb die Schatten aus dem hintersten Teil der Höhle. Deyras Atem stockte, als sie das Bild sah, das da am Felsen lehnte. Sie trug die Leinwand ans Feuer und betrachtete sie. Man erkannte das Tal wieder, da war auch der Nebel und darin schwebten gespensterhafte Gestalten aus goldenem Licht. Es war ein wunderschönes Bild, aber tief in ihrem Inneren war Deyra enttäuscht. Sie konnte nicht sagen, woran es lag, aber dem Bild schien jener Funke zu fehlen, der das Werk eines Farbmagiers von der Pinselübung eines Malers unterschied. Das Bild der »Tanzenden Wasser« hatte etwas von dieser Magie ausgestrahlt, der Baron würde nicht zufrieden sein.
Deyra stellte das Bild zurück und durchforschte die Höhle weiter. Sie fand das Reisebündel, die Farbpalette und den Becher mit den Pinseln, aber von Alwyn selbst war nichts zu sehen.
Schweren Herzens rollte sie ihren Schlafsack aus. War er noch am Leben? Sie vermochte kaum noch daran zu glauben. Noch einmal trat sie an den Höhleneingang, um nach ihm zu rufen, da erblickte sie den ersten der Leuchtenden.
Die entfernt menschenähnliche Gestalt glitt unterhalb der Höhle durch den Nebel. Gebannt folgte Deyras Blick dem goldenen Leuchten, das Alwyns Bild nur ärmlich widerzuspiegeln vermochte. Eine seltsame Sehnsucht erfasste Deyra bei seinem Anblick, sie wünschte sich, unten am Bach zu sein, um den Leuchtenden aus der Nähe zu sehen. Er war nicht lange allein, mehr und mehr goldene Geistwesen tauchten im Nebel auf, stiegen hoch über das Tal empor und sanken wieder in einem Tanz hinab, dessen Musik aus uralter Zeit zu stammen schien.
Noch nie hatte Deyra etwas derart Schönes gesehen. Das Herz tat ihr weh, und ohne zu denken, trat sie noch weiter vor. Ein Stein löste sich unter ihrem Fuß und rollte den Abhang hinab.
Der vorderste der Leuchtenden hielt in seinem Tanz inne und wandte sich der Höhle zu. Erschrocken wich Deyra zurück, aber es war zu spät. Der Leuchtende kam ihr näher und näher.
Hin- und hergerissen zwischen dem Entzücken über seine Schönheit und der Wut darüber, dass er und die seinen Alwyn getötet hatten, drückte sich Deyra an die Höhlenwand.
Sie hielt den Atem an, schloss die Lider und zählte langsam bis fünfzig. Als sie die Augen wieder öffnete, schwebte der Leuchtende nur einen Schritt vor ihr. Ihr Herz hämmerte. Sie befeuchtete ihre Lippen und flüsterte: »Mach schon, töte mich, wie du Alwyn getötet hast.«
Der Leuchtende beugte sich zu ihr nieder, bis das goldene Leuchten ihr ganzes Gesichtsfeld ausfüllte. Plötzlich spürte sie einen sanften Druck auf ihrer Stirn, ein Glücksgefühl überflutete ihr ganzes Sein. Sie spürte, wie ihr Körper sich aufzulösen begann, ihre Umrisse verschwammen und sie selbst zu einer Leuchtenden wurde.
In diesem Augenblick erkannte sie Alwyn in dem Leuchtenden vor sich, sie begriff, warum sie im Lager der Tarsii keine kränklichen und altersschwachen Greise angetroffen hatte. Wer seine Zeit kommen spürte, ging freiwillig den letzten Weg, den Weg zu den Leuchtenden. Die Geistwesen der Tarsii umringten Alwyn und Deyra, teilten ihre Freude und führten sie in ihren Tanz ein.
Geborgen in einem Strom aus Zufriedenheit und Glück schwebte Deyra dahin. Zwischen ihr und Alwyn bedurfte es keiner Worte mehr, um ihre Liebe zu bezeugen. Deyra hatte nur noch einen Wunsch: in aller Ewigkeit mit den Leuchtenden zu tanzen.
Zeit hatte keine Bedeutung mehr. Deyra konnte nicht sagen, ob seit ihrer Wandlung Minuten oder Stunden vergangen waren, als sich der Rhythmus der Leuchtenden plötzlich änderte.
Sie schwebten aufeinander zu und bildeten einen engen Kreis um einen der Ältesten. Sein Licht hatte zu flackern begonnen, er hing bewegungslos im Nebel.
»Sie haben mich vergessen«, teilte er den anderen wortlos mit. »Lebt wohl.«
Eine Welle aus Mitgefühl und Trauer hüllte ihn ein. Sein Licht leuchtete noch einmal kräftig auf, dann schwebte er hoch hinauf. Weit über dem Nebel sandte er ihnen einen letzten, strahlenden Gruß und verblasste.
»Warum?«
Alwyn spürte Deyras stumme Frage, und während sie wieder zu ihrem Tanz zurückfanden, erklärte er ihr, dass ein Leuchtender nur so lange existierte, wie sich Familie und Freunde seiner erinnerten.
»Yarana und Faron werden ihren Kindern von uns erzählen«, dachte Deyra, »und Alwyns Bilder machen seinen Namen unvergesslich.« Dennoch wollte das ungetrübte Glücksgefühl nicht wiederkehren. Der Gedanke an ihre Kinder hatte sie daran erinnert, weshalb sie in das Tal gekommen war und an das Versprechen, das sie dem Lha-Innit gegeben hatte.
Alwyn spürte offenbar ihre Sorge und ihr schlechtes Gewissen, und auch die anderen unterbrachen ihren Tanz.
»Ich darf nicht bleiben«, ließ sie die Leuchtenden wissen.
»Gebt mich frei!«
»Dann musst du ohne mich gehen«, war Alwyns Antwort. »Ich habe meinen Frieden gefunden.«
Im Kreis der Gemeinschaft der Leuchtenden kehrte Deyra in die Höhle zurück. »Noch nie verspürte einer von uns den Wunsch, wieder Fleisch zu werden«, vernahm sie die Gedankenstimme des ältesten von ihnen. »Wenn dein Wille stark genug ist, den Schmerz zu ertragen, so sei es – aber ein Teil von dir wird stets eine Leuchtende sein und bleiben.«
Deyra nahm Abschied, klammerte sich an ihre Liebe zu Faron und Yarana, und langsam nahm sie wieder feste Gestalt an. Der Schmerz zerriss sie fast, aber sie ließ nicht los, bis die Wandlung abgeschlossen war. Keuchend brach sie in die Knie, bleierne Müdigkeit in allen Gliedern. Sie sank zur Seite und zog die Knie an die Brust. Ein tiefer, traumloser Schlaf bemächtigte sich ihrer.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie erwachte. Der Nebel hatte sich aufgelöst, die Leuchtenden waren verschwunden. Mühsam erhob sie sich und tapste zur Feuerstelle. Obwohl ihr Magen knurrte und ihr Mund sich anfühlte wie Sandpapier, musste sie sich zum Essen und Trinken zwingen. Schließlich nahm sie Alwyns Bild und trug es zum Höhleneingang, um es im Sonnenlicht noch einmal zu betrachten.
Ohne recht zu wissen warum, holte sie Alwyns Farbpalette und die Pinsel. Mit den Fingern strich sie über die Spitze des feinsten Pinsels, bis goldene Funken auf die bleichen Haare übersprangen.
Sie konnte das goldene Licht nicht sehen, das ihre Augen ausfüllte, als sie mit einem entrückten Lächeln den Pinsel in die Farben tauchte.
Zwei Tage vor Ablauf der Halbjahresfrist stand Deyra vor dem Tor der Burg. Ein Diener öffnete ihr, sah die verhüllte Leinwand und fragte nach ihrem Mann.
»Alwyn hat sein Leben für das ›Bildnis der Leuchtenden‹ geopfert.« Sie reichte dem Diener das Bild. »Ich nehme an, der Baron schläft noch.«
Der Diener nickte.
»Er wäre sicher erfreut, wenn sein erster Blick auf das Bild fallen könnte. Hängt es am besten so auf, dass er es gleich nach dem Aufwachen sieht. Am Tuch ist eine Schnur befestigt, mit der er das Bild enthüllen kann, ohne sein Bett verlassen zu müssen. Aber«, sie blickte dem Diener fest in die Augen, »niemand sonst soll es ansehen, versprecht es mir.«
Der Unterton in ihrer Stimme zwang den Diener, ein Versprechen zu murmeln.
»Ich verlasse mich auf Euch und Euren gesunden Menschenverstand.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging.
Bereits tags darauf erfuhr sie von einer Nachbarin, dass der Baron den Verstand verloren hatte. »Er liegt nur im Bett und starrt auf das Bild. Keinen Menschen duldet er im Zimmer. Weder gegessen noch getrunken hat er, und will ihn jemand sprechen, bekommt er einen Tobsuchtsanfall. Wenn das so weitergeht mit ihm, können ihn seine Erben bald begraben.«
Deyra dankte ihr für die Nachricht und spazierte summend zurück auf das Feld, wo ihre Kinder eifrig Unkraut zupften. In einer Woche würde der magische Glanz des Bildnisses erloschen sein, und die Erben würden seine lebendige Schönheit bewundern und sich erstaunt fragen, was daran den Baron in den Wahnsinn getrieben hatte. Yarana war in Sicherheit.
»Noch ein paar Jahre, Alwyn«, flüsterte Deyra, »bis Faron eine Braut gefunden hat und ich Yarana in guten Händen weiß. Bis dahin werde ich dafür sorgen, dass wir lange, sehr lange nicht vergessen werden.«
Sie unterdrückte das sehnsuchtsvolle, goldene Leuchten in ihren Augen und gesellte sich lächelnd zu ihren Kindern.
Der Hut aus Rabenfedern
Christian Metzger
Kari war weit gekommen, ohne dass die Knechte sie eingeholt hatten, aber sie wusste, sie wurde noch immer verfolgt. Ihr lahmes Bein schmerzte, sie hatte keine Ahnung, wie lange es sie noch tragen würde. Sie verbarg sich in der Uferböschung des Baches, lauschte und versuchte, ihr schnell schlagendes Herz zu beruhigen. Mit beiden Händen schöpfte sie von dem Wasser und trank. Die frische Kühle tat ihr gut, und sie trank noch mehr.
Plötzlich hörte Kari die Stimmen ihrer Verfolger wieder. Vor ihrem inneren Auge flammte das Bild auf, wie die drei Knechte durch den Wald schritten, mit ihren Stecken hier und da ins Gebüsch stachen oder Steine ins Unterholz warfen, um sie aufzuscheuchen. Verzweifelt sah sie sich nach einem Fluchtweg um. Die einzige Hoffnung war der Waldrand, die Straße. Sie holte noch einmal tief Luft, sprang auf und lief los.
»Da ist sie!«, hörte sie jemanden schreien, Gero vielleicht. Äste knackten hinter ihr im Wald. »Bleib stehen!«
Doch Kari hielt nicht an, sie humpelte und sprang nur noch schneller. Zweige peitschten ihr ins Gesicht, ihre nackten Füße schrammten über Steine, Dornen und herabgefallene Äste, doch sie wollte um keinen Preis anhalten. Dann war der Wald plötzlich zu Ende. Sie blinzelte gegen die Sonne, die sich schon deutlich zum Horizont neigte.
Vor ihr erstreckten sich die Straße, weite Wiesen und Waldflecken, die wie Inseln aus dem Gras herausragten. Kari rannte, so schnell sie konnte. Nicht weit entfernt am Wegesrand konnte sie einige Feuer und Wagen ausmachen, die in einem schützenden Halbkreis aufgestellt waren.
»Da unten ist sie! Hinterher!«
Diesmal erkannte Kari Geros Stimme ganz sicher. Für einen Moment kam sie ins Straucheln, rutschte den Hang hinab, doch sie fing sich. Jetzt sah sie auch die Gestalten in fremdartig bunter Kleidung, die vor den Wagen an einer langen, niedrigen Tafel beisammensaßen. Die Fahrenden waren beim Abendessen, und es schien eine fröhliche Runde zu sein. Ohne weiter nachzudenken, lief Kari zu ihnen, rollte sich unter den Tisch in den Dreck und blieb liegen, am Ende ihrer Kräfte. Einen Moment gestattete sie sich, die Augen zu schließen und die Welt um sich herum zu vergessen.
Als Kari sie wieder aufschlug, standen vor dem Tisch drei Stiefelpaare, sehr abgetragen und mehrfach geflickt.
»Was soll das?«, fragte eine Stimme, die Kari nicht kannte. »Was wollt ihr von uns?«
»Uns ist ein Mädchen weggelaufen.« Gero.
»Was kümmert uns das?«, mischte sich eine weitere Stimme ein. »Sucht sie woanders.«
Es gab eine kurze Pause.
»Wer hat bei euch das Sagen?«
»Ich bin Bardo.« Eine Stimme, kalt wie Eis. Ein weiteres Paar Stiefel erschien, schwarze, gut gepflegte Stiefel, die glänzten, wie Kari es noch nie zuvor gesehen hatte.
»Unter eurem Tisch hat sich ein Mädchen versteckt«, sagte Gero. »Sie gehört uns, das Recht ist auf unserer Seite. Lasst sie uns holen, dann werden wir alle gut miteinander auskommen.«
»Unter unserem Tisch?«, fragte Bardo.
»Ja doch!« Gero schien langsam die Geduld zu verlieren. »Ich warne dich, mach keinen Ärger!«
Kari zitterte. Gleich würden sie zupacken, sie hervorzerren und mit zurücknehmen. Die Strafe würde entsetzlich sein. Als sie das erste Mal versucht hatte, davonzulaufen, hatte der Schulze angeordnet, ihr das Bein zu brechen. Doch Kari wusste, es gab viel Schlimmeres als das.
Bardos Stimme blieb kalt, als würde Geros Zorn ihn nicht im Geringsten beeindrucken. »Wenn ihr mir das Mädchen zeigen könnt, soll sie euch gehören.«
Gero ließ sich auf die Knie nieder. Kari schluchzte und spürte, wie ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie wagte nicht einmal, ihm ins Gesicht zu schauen.
»Da ist niemand«, sagte Gero erstaunt.
»Unsinn!«, rief einer der anderen Knechte.
»Dann schau doch selbst, Rupert!«
Kari rollte sich zusammen wie ein Neugeborenes und erwartete, jeden Augenblick gepackt zu werden.
»Sie ist verschwunden!«
Die drei Knechte suchten noch eine Weile, sie sahen auch unter die Wagen. Einige der Fahrenden feuerten sie mit Pfiffen an und klatschten. Es gab einige Ratschläge, wo die Männer noch suchen könnten.
»Seht noch einmal unter dem ersten Wagen nach, da habt ihr erst dreimal nachgeschaut.«
»Da sieht man, was Suff am helllichten Tag anrichten kann.«
»Nein, sie steht direkt hinter euch und streckt euch die Zunge heraus!«
Die drei gaben endlich auf, fluchend und mit roten Gesichtern, und traten den Rückzug an. Kari rührte sich nicht, auch nicht, als sie die Knechte längst nicht mehr hören konnte.
»Wen haben wir denn da?« Eine muntere Männerstimme. Kari sah vorsichtig auf. »Du kannst jetzt herauskommen. Los doch, bevor das Abendessen kalt wird.«
Kari wagte es. Im Schein des Feuers und im Zwielicht der Dämmerung wirkten die Reisenden noch fremdartiger, kaum wie echte Menschen aus Fleisch und Blut. Aber aus dem Kessel über dem Feuer roch es höchst verlockend, und Kari bemerkte, wie ihr Magen knurrte.
»Wie heißt du, Mädchen?«, fragte ein anderer Mann. Kari erkannte seine Stimme. Bardo. Es war unmöglich, zu sagen, wie alt er war. Er hatte keine Haare, nicht einmal einen Bart oder Augenbrauen, und seine dunklen Augen lagen tief in den Höhlen. Auf seinem Kopf trug er einen merkwürdigen Hut aus schwarzen Rabenfedern. Kari nannte ihren Namen.
»Setz dich zu uns«, lud Bardo sie ein und machte eine ausholende Geste. »Das da sind Helko, Reginhar, Marwin, Lioba, Gisa, Conrad, Thilo, Rosalind, Odo, Amalia und Benno.«
»Von wo kommt ihr?«, wagte Kari zu fragen.
»Von überall und nirgends«, sagte Reginhar, der sie unter der Tischplatte hervorgelockt hatte. Lange Strähnen sandfarbenen Haares hingen ihm wirr ins Gesicht, und dichte blonde Bartstoppeln bedeckten sein Kinn. »Wir sind reisende Schausteller und ziehen von Ort zu Ort. Nicht weit von hier ist bald Jahrmarkt, da wollen wir hin. Aber nun setz dich und iss, du siehst hungrig aus.«
Kari setzte sich neben ihn. Benno, ein Junge, kaum älter als sie selbst, brachte ihr eine Schale mit dampfender Fleischsuppe, und Marwin wischte einen Löffel sauber und legte ihn ihr hin. Es wurde der schönste Abend, an den sich Kari erinnern konnte.
Odo, Conrad und Rosalind holten noch während des Essens eine Laute, eine Flöte und eine kleine Trommel hervor, und die ganze Truppe begann fröhlich zu singen und zu musizieren. Nur Amalia, eine zierliche, schwarzhaarige Frau mit dunklen Augen, nahm an der Fröhlichkeit nicht teil. Sie strahlte eine zerbrechliche Traurigkeit aus.
»Fang!«, rief Lioba plötzlich, und ehe sie nachdenken konnte, fing Kari einen Apfel aus der Luft.
»Gut reagiert«, lobte Reginhar. »Was meint ihr, ob Kari uns weiterhelfen könnte?«
»Warum nicht?«, meinte Helko, ein rotbärtiger Hüne mit kantigem Gesicht und wilder, lockiger Haarmähne.
»Uns fehlt ein Jongleur, musst du wissen«, sagte Bardo, lehnte sich zurück und umfasste die Armlehnen seines Stuhls. »Dreizehn müssen wir sein, um auf dem großen Jahrmarkt auftreten zu können. Wir sind nur zwölf.«
Kari bemerkte, wie alle sie ansahen. Die Musikinstrumente waren verstummt.
»Was sagst du dazu?«, fragte Bardo. »Du scheinst keinen Ort zu haben, an den du gehen möchtest. Wir bieten dir den Schutz und die Kameradschaft unserer fahrenden Gemeinschaft. Du wirst einen Platz zum Schlafen haben und teilen, was wir essen und trinken.«
»Aber ... ich kann doch gar nichts ... und ich habe ein lahmes Bein ...« Die Hoffnung war honigsüß, unmöglich, sich ihr einfach hinzugeben.
»Überlasse das uns.« Bardos Augen waren tiefe, dunkle Brunnen. »Wir werden sehen, wozu du dich eignest. Aber wenn du der Truppe beitrittst, sind damit auch Pflichten verbunden. Du tust, was ich befehle, ohne Fragen zu stellen. Ich verlange absoluten Gehorsam. Das ist alles.«
Er hielt ihr die linke Hand hin, und sie schlug ein. »Willkommen, Kari. Amalia wird deine Lehrmeisterin sein. Und nun kümmern wir uns um dein Bein. Hab keine Angst, es wird nicht weh tun.« Er kniete sich nieder und umfasste Karis Knie mit beiden Händen.
»Schließ die Augen«, sagte Bardo. »Und öffne sie erst wieder, wenn ich es dir sage.«
Ein wohliges Gefühl breitete sich plötzlich in Karis Knie aus, angenehm wie ein warmer Umschlag. Und als Bardo ihr befahl, die Augen wieder zu öffnen, war ihr Bein geheilt. Kari starrte den Anführer der Gaukler sprachlos an.
Bardo wandte sich an die anderen und trat zurück.
»Heißt Kari in der Truppe willkommen!«
Helko war zuerst bei ihr, drückte sie in einer rippensprengenden Umarmung an sich und gab sie dann an Reginhar weiter.
»Willkommen, Schwester!« Sie reichten sie herum und drückten sie, klopften ihr auf die Schulter. Lioba gab ihr einen schwesterlichen Kuss auf die Wange. Nur Amalia stand abseits und nahm an der Begeisterung nicht teil. Formte sie mit den Lippen ein wortloses »du verdammte Närrin«?
Kari konnte es sich nicht vorstellen. Sicherheit, genug zu essen und eine Zukunft. Es war weit mehr, als sie sich vor wenigen Stunden auch nur erträumt hätte.
Die Fahrenden brachen am nächsten Morgen auf, und Kari zog mit ihnen. Sie schlief in Amalias Wagen, den die Jongleurin zuvor allein bewohnt haben musste. Kari wunderte sich kurz darüber, wagte aber nicht zu fragen. Ihre Lehrmeisterin nutzte die erste Rast, um sie in die Kunst des Jonglierens einzuweihen.
»Jonglieren ist nicht einfach nur ein billiger Jahrmarkttrick«, sagte Amalia bei der Mittagsrast. »Es ist eine hohe Kunst. Du brauchst Gleichgewicht, Disziplin und ein feines Gespür für die Bewegung der Bälle. Das Spiel folgt seinem ganz eigenen Rhythmus, einer Melodie, wenn du so willst.«
Amalia half ihr, sich richtig hinzustellen, die Beine auseinander, die Arme entspannt herabhängend.
»Du musst die Unterarme anwinkeln«, sagte Amalia. »Stell dir vor, du würdest ein Tablett tragen, mit einer randvollen Schale Suppe darauf. Wenn du das Tablett schräg hältst, wird die Suppe verschüttet, verstehst du?« Amalia gab ihr einen Ball in die rechte Hand und zeigte ihr, wie sie den in einem Bogen vor ihrem Gesicht werfen sollte.
»Gut«, sagte Amalia nach einer Weile. »Aber du bewegst dich noch zu viel, greifst den Ball aus der Luft. Das Publikum muss glauben, dass sich allein der Ball bewegt, nicht deine Hände. Und das üben wir jetzt.«
Amalia hielt Wort und verbesserte selbst Kleinigkeiten. Doch es lohnte sich. Schon am Abend beherrschte Kari den einfachen Austausch mit zwei Bällen, und am Tag darauf durfte sie mit drei Bällen üben. Kari war erstaunt, wie rasch sie lernte. Das Jonglieren war eine einfache, immer gleiche Abfolge aus Werfen und Fangen. Es gelang ihr, sich so tief in das Spiel der Bälle zu versenken, dass sie alles andere um sich herum vergaß.
Amalia lobte sie gelegentlich für ihre Fortschritte, und Kari hatte das Gefühl, ihre Sache gut zu machen. Sie lernte schon bald, drei, vier und fünf Bälle in der Luft zu halten. Dann kamen Keulen und Messer, und nachdem sie sich an das Gewicht und den anderen Schwerpunkt gewöhnt hatte, war es nicht schwer, auch diesen Schritt zu bewältigen.
Am liebsten mochte Kari es, mit Amalia die Bälle auszutauschen, oder wenn sie übten, Seite an Seite zu jonglieren. Amalia war die beste Jongleurin der Truppe. Kari erlebte nie, dass Amalia einen Ball, ein Messer oder eine Keule fallen ließ, wie viele es auch waren. Unmöglich, jemals so gut zu werden wie ihre Lehrerin.
Beinahe jeden Abend gab die Truppe eine Vorstellung in den kleinen Dörfern und Weilern, die an der Straße lagen wie Perlen auf einer Schnur. Bardo ließ niemals alle seine Gaukler an einem Abend auftreten, nicht ein einziges Mal. Kari dachte zuerst, es sei deshalb, weil sich Auftritte in den kleinen Orten nicht lohnten. Aber für die Bauern waren sie trotzdem ein großes Ereignis, und wenn die bunt geschmückten Wagen den Weg entlangkamen, sprach es sich herum wie ein Lauffeuer. Die Zuschauer kamen von allen Gehöften, die nahe genug lagen, sichtlich froh über die Unterhaltung.
Mit der Zeit lernte Kari die Gaukler immer besser kennen. Amalia natürlich vor allem. Sie sprach nur wenig und lachte nie, aber Kari verehrte sie und übte so viel wie möglich, damit Amalia mit ihr zufrieden war. Bardo war ihr ein wenig unheimlich, und sie merkte bald, auch die anderen gingen ihm nach Möglichkeit aus dem Weg. Mit Reginhar, Lioba, Helko und den anderen konnte sie jeden Abend trinken, feiern und sich unterhalten. Es war aufregend und neu, stets an einem anderen Ort zu sein und morgens nicht zu wissen, wo man am Abend sein würde.
Nur Benno tat sich schwer damit. Lioba vertraute Kari eines Abends an, dass Benno nicht mit dem Herzen dabei war.
»Er ist von seiner Familie weggelaufen, der arme Junge. Aber jetzt vermisst er sie und weint sich abends vor Heimweh in den Schlaf.«
Kari fühlte einen leichten Anflug von Neid. »Kann er nicht einfach zu seiner Familie zurückkehren, wenn er das unbedingt möchte?«
»Nein«, sagte Lioba nach kurzem Zögern, und sie klang mit einem Mal sehr ernst.
»Dann wollen sie ihn nicht zurückhaben? Oder leben sie zu weit entfernt?«
»Ja«, sagte Lioba und wandte sich ab. »Sehr weit entfernt. Und nun lass mich mit deinen Fragen in Ruhe.«
Die Truppe folgte der Straße, bis sie den großen Jahrmarkt erreichte. Er lag unterhalb einer richtigen Stadt, die von einer Steinmauer umgeben war, mit einem großen, von zwei Türmen eingerahmten Stadttor.
Nur einen Katzensprung entfernt wuchs der Jahrmarkt auf einer Wiese in die Höhe wie eine zweite, kleinere Stadt. Kari merkte, wie ihr der Mund offenstand. Es mochten an die hundert bunte, mit Wimpeln geschmückte Wagen sein, die sich dort zusammengefunden hatten. Schon von fern konnte sie Musik hören und das Hämmern beim Aufbauen der Bühnen.
Bunte Pavillons und kleine Zelte wuchsen überall aus dem Boden, und die Artisten und Musikanten schoben ihre Wagen in Halbkreisen dahinter zusammen. Hier und da brannten Kochfeuer, und es roch nach Eintopf und gebratenem Fleisch.
Bardo hielt den vordersten Wagen an und drehte sich zu seiner Truppe um.
»Bereitet den Lagerplatz. Heute Abend treten wir auf. Ich verlasse mich darauf, dass alle ihr Bestes geben. Ich möchte heute alle auf der Bühne sehen. Kari, du wirst mit Amalia auftreten und uns zeigen, was du gelernt hast. Wartet hier. Ich bringe in Erfahrung, wo wir die Bühne aufbauen können.«
Die Aussicht auf den Jahrmarkt schien die Stimmung der Truppe nicht aufzumuntern, im Gegenteil. Diesmal klopfte Kari niemand auf die Schulter wie damals, als sie zu den Fahrenden gestoßen war.
»Komm«, sagte Amalia und bedeutete Kari, ihr in den Wagen zu folgen. Kari war aufgeregt und verwirrt zugleich.
»Ich darf mit euch auftreten!«, rief sie freudig und wollte ihre Lehrmeisterin umarmen.
Amalia versetzte ihr eine schallende Ohrfeige, die sie zurücktaumeln ließ und ihre Freude abkühlte wie der Sprung in einen kalten Wintersee.
»Hör mir gut zu, Kari«, sagte Amalia und packte sie mit überraschender Kraft. »Du musst von hier verschwinden. Bardo wird noch eine Weile verhandeln. Bis dahin musst du weg sein.«
»Was redest du da?« Kari stieß Amalia zurück und hielt sich die pochende Wange.
»Ich meine es ernst.« Amalias schwarze Augen hielten sie gefangen. »Lauf in die Stadt. Versteck dich in der Kirche oder auf dem Friedhof, bis wir mit den Wagen weit fortgezogen sind.«
»Das werde ich nicht!«, widersprach Kari heftig. »Wie kannst du nur so etwas von mir verlangen? Du bist meine Lehrerin, du solltest stolz darauf sein, dass ich mit euch auftreten darf.«
»Ich bin stolz auf dich«, sagte Amalia leise. »Aber gerade deshalb flehe ich dich an, verschwinde. Du begreifst nicht, in welcher Gefahr du schwebst. Solange du noch nicht mit uns auf der Bühne gestanden hast, ist es noch möglich.«