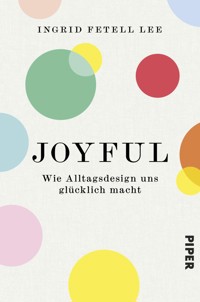
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Warum liebt jeder Mensch das rote Glühen eines Sonnenuntergangs? Weshalb zaubern uns blühende Bäume, blauer Himmel oder das Gefühl von feinem Sand unter den Füßen ein Lächeln ins Gesicht? Ist das alles bloß Zufall? Keineswegs, sagt die Designerin Ingrid Fetell Lee, denn die Materialien, Farben und Formen, die uns jeden Tag umgeben, beeinflussen tatsächlich unsere Gefühlswelt. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie diese Erkenntnis für sich nutzen, Ihre Wahrnehmung schärfen und die Dinge um sich herum gestalten können. Mit diesen Tricks leben Sie ein gesünderes und glücklicheres Leben! »Joyful ist ein unerschöpflicher und spannender Leitfaden dafür, was das Leben schön macht.«Arianna Huffington
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deAus dem Amerikanischen von Viola Krauß
Für Albert
© Ingrid Fetell Lee 2018Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Joyful. The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness«, Little, Brown Spark, Hachette Book Group, New York 2018deutschsprachigen Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2020Illustrationen: Ingrid Fetell LeeCovergestaltung: FAVORITBUERO, München nach einem Entwurf von Two AssociatesCovermotiv: Two AssociatesSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
1. Energie
Die Macht der Farbe
Mut zur Farbe
Die Wonnen des Lichts
Lichtmalerei
2. Fülle
Architektur als Medizin
Sinn und Verstand
Sinneshunger
Konfetti und Regenbogen
Maximalistische Maxime
3. Freiheit
Die perfekte Landschaft
Biophilie
Großstadtdschungel
Ruf der Wildnis
Wilder als wild
4. Harmonie
Wie unser Gehirn für Ordnung sorgt
Paradiesische Symmetrie
Den Rhythmus spüren
Im Fluss
Perfekt unperfekt
5. Spiel
Die Spiel-Form
Zuckersüß
Eine runde Sache
Das Leben in einer Blase
6. Überraschung
Kontrastreichtum
Kuckuck!
Ein Überraschungsdomizil
Wunderbar schräg
7. Erhabenheit
Baumhäuser und Hochhäuser
Leichter als Luft
Der Blick nach oben
Erleuchtungen
Sternbeobachtungen
8. Magie
Auf der Suche nach Elfen
Unsichtbare Energien
Illusions of Grandeur
Wunder-Werke
Wunder gibt es immer wieder
9. Festlichkeit
Zusammenkommen
Musik und Tanz
Vor Freude platzen
Blitzen und Funkeln
Das LuftballonMädchen
10. Erneuerung
Blüten-Blizzard
Flower Power
Offensichtliche Kurven
Ein Wiederbeleben der Freude
Joyful Toolkit
Schritt 1: Ihre ganz persönlichen Freuden
Schritt 2: Kreieren Sie Freude
Palette von Freuden
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
Motto
Ohne Gefühl gibt es keine Schönheit.
Diana Vreeland
Einleitung
Ich stand vor einem Gremium aus Professoren und war wahnsinnig nervös. Die Männer setzten eine ernste Miene auf, während sie die kleine Ansammlung von Objekten begutachteten, die hinter mir ausgestellt waren – eine seesternförmige Lampe, ein Teetassen-Set mit rundem Boden, ein Trio von Hockern, die aus geschichtetem, gefärbtem Schaumstoff gefertigt waren –, und ich fragte mich, ob es nicht ein Fehler gewesen war, meine vielversprechende Laufbahn in der Markenentwicklung für ein Aufbaustudium in Design aufzugeben. Nach langem Schweigen brach einer der Professoren schließlich das Eis. »Ihre Arbeit löst ein Gefühl der Freude in mir aus«, sagte er. Die anderen nickten.
Plötzlich lächelten sie alle. Eine Woge der Erleichterung durchströmte mich. Ich hatte die erste Prüfung meines Industriedesign-Studiengangs am Pratt Institute bestanden. Allerdings wich meine Erleichterung bald der Verwirrung. Freude war ein Gefühl und somit flüchtig und schwer definierbar. Nichts, was wir sehen oder anfassen können. Wie können solch einfache Gegenstände – Tasse, Lampe und Hocker – also Freude in uns hervorrufen? Ich versuchte, den Professoren eine Erklärung zu entlocken, doch sie gestikulierten und drucksten nur herum. »Das tun sie eben einfach«, hieß es. Ich dankte ihnen, aber während ich meine Sachen für die Sommerferien zusammenpackte, ging mir diese Frage nicht mehr aus dem Kopf.
Wie können materielle Gegenstände ein immaterielles Gefühl von Freude in uns hervorrufen?
Die Antwort schien zunächst eindeutig: Können sie gar nicht. Klar bereiten sie uns manchmal ein gewisses Vergnügen, doch ich hatte stets den Eindruck, dass es sich dabei um einen oberflächlichen, bedeutungslosen Quell der Freude handelt. Keines der Bücher über Glück und Zufriedenheit, die ich im Lauf der Jahre zurate gezogen hatte, legte jemals nahe, dass sich die Freude in meinen Kleider- oder Küchenschränken versteckt hielt. Vielmehr waren sich unzählige Experten darüber einig, dass die wirklich wichtige Art von Freude nicht im Außen, sondern in unserem Innern zu finden ist. Dieser Blickwinkel hat seine Wurzeln in uralten philosophischen Traditionen. So legt die Lehre des Buddha nahe, dass sich Zufriedenheit dann einstellt, wenn wir uns nicht länger an die irdischen Dinge klammern. Die Stoiker des antiken Griechenlands hatten ganz ähnliche Ratschläge parat, sie empfahlen Verzicht und die strenge Beherrschung der Gedanken. Und auch die heutige Psychologie begrüßt diese Besinnung auf sich selbst. Ihr zufolge lässt sich ein glückliches Leben dann erreichen, wenn wir den Blick auf die Welt und unseren Platz darin verändern. Überall wird davon ausgegangen, dass der Geist über die Materie triumphiert, nicht umgekehrt – angefangen bei Mantras und Meditation bis hin zu Therapie und der Veränderung unserer Gewohnheiten.
In den Wochen und Monaten nach meiner Prüfung stieß ich allerdings sehr wohl auf Momente, in denen die Menschen echte Freude im Materiellen fanden. Ob es sich dabei um die Betrachtung eines Lieblingsgemäldes im Museum oder das Bauen einer Sandburg am Strand handelte – die Leute lächelten und lachten und waren ganz im Augenblick versunken. Auch im Angesicht des pfirsichfarbenen Lichts der untergehenden Sonne und des zotteligen Hunds mit den gelben Galoschen lächelten sie. Und Freude schienen sie nicht nur in der sie umgebenden Welt zu entdecken. Viele gaben sich sogar große Mühe, ihre nähere Umgebung erfreulicher zu machen. Sie hegten Rosengärten, steckten Kerzen in Geburtstagskuchen und hängten an den Feiertagen Lichterketten auf. Warum sollten die Menschen das alles tun, wenn es sich rein gar nicht auf ihr Glücksempfinden auswirkt?
Allmählich tauchen Forschungsarbeiten auf, die einen klaren Zusammenhang zwischen unserer Umgebung und unserer seelischen Gesundheit sehen. Solche Studien haben zum Beispiel ergeben, dass die Menschen, die in sonnigen Räumlichkeiten arbeiten,[1] besser schlafen und mehr lachen als ihre Kollegen in schwach beleuchteten Büros und dass Blumen nicht nur für eine bessere Stimmung, sondern auch für eine bessere Gedächtnisleistung sorgen.[2] Als ich mich immer tiefer in diese Forschungsergebnisse grub, wurde die Freude allmählich weniger amorph und abstrakt und dafür greifbarer und realer. Ich hatte nicht mehr länger den Eindruck, sie sei schwer erreichbar, die Frucht jahrelanger Selbstbeobachtung oder eiserner Disziplin. Stattdessen begann ich, die Welt als Reservoir an Positivität zu begreifen, derer ich mich jederzeit bedienen kann. Ich stellte fest, dass manche Orte von einer Art Frohmut umgeben sind – ein helles Eckcafé, ein Fachgeschäft für Garne, ein Straßenzug mit Sandsteinhäusern, aus deren Blumenkästen Blüten hervorquellen –, und ich änderte schrittweise meine Gewohnheiten, um sie häufiger aufzusuchen. An schlechten Tagen fühlte ich mich nun nicht mehr länger überfordert und hilflos, sondern sah zu, dass ich kleine Dinge aufspürte, die mich garantiert aufheitern würden. Ich begann, das Gelernte in mein Zuhause zu integrieren, und verspürte zunehmend ein freudiges Kribbeln, wenn ich abends die Wohnungstür aufschloss. Mit der Zeit wurde mir klar, dass die vorherrschende Meinung beim Thema Freude falsch war.
Freude aufzuspüren ist überhaupt nicht schwer. Wir sind von ihr umgeben.
Diese befreiende Erkenntnis veränderte mein Leben. Als ich immer mehr Menschen daran teilhaben ließ, stellte ich fest, dass viele den Drang verspürten, sich in ihrer Umgebung um Freude zu bemühen, dass man ihnen aber das Gefühl vermittelte, das sei vollkommener Unsinn. Eine Frau erzählte mir, dass ein Strauß frischer Blumen bei ihr tagelang für gute Stimmung sorgte. Jedoch hielt sie das für unnötigen Luxus und gönnte sich deshalb nur zu besonderen Gelegenheiten einen. Es war ihr niemals in den Sinn gekommen, dass sie sich für die Kosten einer einzigen ihrer wöchentlichen Therapiestunden ein Jahr lang alle zwei Wochen einen Blumenstrauß würde leisten können. Eine andere schilderte, wie sie nach dem Neuanstrich ihr Wohnzimmer betrat und »aaaah« dachte – sich derart befreit und leicht fühlte, dass sie sich wunderte, wieso sie das nicht schon viel früher angegangen hatte. Ich erkannte, dass wir alle dazu neigen, in unserer Umgebung nach Freude zu streben, uns jedoch beigebracht worden ist, diesen Instinkt zu ignorieren. Was würde wohl passieren, wenn wir ihn wiedererweckten?
Ich musste genauer wissen, wie die physische Welt unsere Gefühle beeinflusst und weshalb manche Dinge ein Gefühl der Freude in uns auslösen. Ich begann, sämtliche Bekannte sowie ziemlich viele Fremde auf der Straße zu fragen, welche Gegenstände oder Orte sie mit Freude in Verbindung brachten. Einiges war sehr speziell und ganz persönlich: »die Küche meiner Großmutter«, »ein signiertes Grateful-Dead-Poster«, »das Kanu von unserem früheren Ferienhaus am Lake Michigan«. Manches war geprägt von einer bestimmten Kultur oder Erziehung, wie Lieblingsspeisen oder Sportvereine. Anderes hingegen hatte weder kulturellen noch persönlichen Ursprung. So erzählte mir eine Freundin von einem Nachmittag im Sommer, als sie auf dem Nachhauseweg von einem Regenguss überrascht wurde. Sie und ein paar andere, die ohne Schirm unterwegs gewesen waren, suchten Schutz unter einer Markise und stellten Vermutungen auf, wie lange das Gewitter wohl dauern würde. Nach einigen Minuten hörte es auf, und die Leute wagten sich wieder auf den Gehweg hinaus, als ein Mann plötzlich rief: »Da, schaut mal!« Am Himmel wölbte sich ein prächtiger Regenbogen, direkt über dem Empire State Building. Die Leute machten Halt und blickten nach oben, ihre nasse Kleidung klebte ihnen am Körper, und sie hatten alle ein dickes Grinsen im Gesicht.
Von dieser Geschichte hörte ich endlose Versionen. Es war kalt oder dunstig, es waren Freunde oder Fremde, und der Regenbogen wölbte sich über einem Konzert oder einem Berggipfel oder einem Segelboot. Regenbogen brachten den Menschen anscheinend immer und überall Freude. Ich fing an, mir solche Dinge aufzuschreiben, die ich wieder und wieder zu hören bekam. Beachpartys und Feuerwerke, Schwimmbecken und Baumhäuser, Heißluftballons und Wackelaugen und Eisbecher mit bunten Streuseln. Diese Freuden kennen weder Alter noch Geschlecht noch ethnische Herkunft. Sie lösen dieses gute Gefühl nicht nur in ein paar wenigen, sondern in nahezu allen Menschen aus. Ich sammelte Bilder von ihnen und pinnte sie an die Wand meines Ateliers. Jeden Tag nahm ich mir ein paar Minuten Zeit, neue Bilder hinzuzufügen, Kategorien zu bilden und nach Mustern zu suchen.
Eines Tages, als ich wieder einmal die Bilder studierte, machte es klick. Ich sah Lollis, Pompons und Tupfen, und dann dämmerte es mir: Sie besaßen alle eine runde Form. Leuchtende Quilts gesellten sich zu Gemälden von Matisse und regenbogenfarbigen Bonbons: Sie alle hatten richtig satte Farben. Das Bild der Fensterrose einer Kathedrale stellte mich zunächst vor ein Rätsel, doch als ich es neben eine Schneeflocke und eine Sonnenblume legte, leuchtete es mir ein: Sie alle besaßen eine symmetrische Sternenform. Als ich das in seiner Gesamtheit vor mir auf dem Tisch liegen sah, wurde mir klar, dass das Gefühl der Freude flüchtig und geheimnisvoll sein mag, dass wir jedoch mittels greifbarer, physischer Merkmale Zugang zu ihm haben. Genauer gesagt handelte es sich dabei um das, was Designer die Ästhetik nennen – die Eigenschaften, die Optik und Haptik eines Gegenstands ausmachen –, was ein Gefühl der Freude in uns hervorruft.
Bis zum damaligen Zeitpunkt war Ästhetik für mich etwas rein Dekoratives gewesen, fast schon albern und belanglos. Für das Aufbaustudium Design hatte ich mich entschieden, weil ich Dinge gestalten wollte, die das Leben der Menschen verbesserten. Ich war besessen davon, ergonomische, funktionale und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. Und obgleich mir die Kurse zu Farbigkeit und Textur, Form und Bewegung Spaß machten, behandelte ich diese Komponenten als Extras und nicht als das Wesentliche. In unserer Kultur ist diese Einstellung weitverbreitet. Wir legen zwar einigermaßen viel Wert auf Ästhetik, dürfen aber nicht zu viel Wert darauf legen oder uns um unser Erscheinungsbild bemühen. Ansonsten laufen wir Gefahr, zu oberflächlich oder substanzlos zu erscheinen. Wie oft haben Sie einer stilsicheren Freundin ein Kompliment gemacht, nur um sie entgegnen zu hören: »Ach, das alte Zeug? Ich hab einfach irgendwas zusammengewürfelt.« Doch wenn ich die Ästhetik meiner Atelierwand begutachtete, wurde mir klar, dass sie viel mehr als einen dekorativen Zweck erfüllte. Sie berührte mich tief in meiner Seele.
Zusammengefasst konnte ich zehn Gesichtspunkte einer Ästhetik der Freude feststellen. Jeder Einzelne von ihnen lässt eine eigenständige Verbindung zwischen dem Gefühl von Freude und den greifbaren Eigenschaften der äußeren Welt erkennen:
Energie: kräftige Farben und strahlendes LichtFülle: Üppigkeit, Vielfalt, BuntheitFreiheit: Natur, Wildheit, WeiteHarmonie: Ausgewogenheit, Symmetrie, freies FließenSpiel: Kreise, Kugeln, BlasenformenÜberraschung: Kontraste und MackenErhabenheit: Erhöhung, Leichtigkeit, TranszendenzMagie: unsichtbare Kräfte und TrugbilderFestlichkeit: Synchronität, Glitzern, explodierende FormenErneuerung: Blüten, Ausdehnung, Kurven
Wie hängen diese ästhetischen Gesichtspunkte und unsere Gefühlswelt zusammen? Und warum erzeugen ausgerechnet diese Merkmale ein Gefühl der Freude?
Diese Fragen brachten mich auf eine Reise, die mich an einige der fröhlichsten Orte der Welt führte. Auf den folgenden Seiten werden wir eine Baumhauspension besuchen sowie eine von Farbe verwandelte Stadt, eine Wohnung, die den Alterungsprozess verhindern soll, und eine ausschließlich aus Kreisen geformte Villa. Wir werden Naturwunder wie das Öffnen der Kirschbaumknospen in Japan bestaunen und menschengemachte Wunder wie das Steigenlassen Hunderter Heißluftballons in der Wüste von Albuquerque. Unterwegs werden Sie von den neuesten Erkenntnissen der Psychologie und der Neurowissenschaft erfahren, die erklären helfen, warum jene Orte und Erfahrungen die Macht besitzen, Freude in uns auszulösen.
Letzten Endes geht es bei Joyful jedoch nicht darum, Freude in den abgelegensten Winkeln dieser Erde zu suchen. Nein, genau da, wo Sie gerade sind, sollen Sie mehr Freude finden. Auf den folgenden Seiten werden Sie gefeierte Künstler und Designer kennenlernen – Architekten, Raumgestalter, Farbexperten, Gärtner, Quilt-Näherinnen, Heimwerker, Floristen und sogar einen Künstler, der mit Ballons arbeitet – und hinter ihr Geheimnis kommen, wie sie Freude in fast allen Bereichen der physischen Welt aufspüren und erschaffen. Auch Menschen, die Freude in ihrem Zuhause und ihrem Viertel hervorbringen – in Landhäuschen und Wohnmobilen, Wohnzimmern und Büronischen, Gehwegen und Erholungsgebieten –, werden Sie begegnen, damit Sie sehen, wie kleine Veränderungen gewöhnlichen Gegenständen und Orten ungemeine Freude einflößen können.
Eine ganze Welt der Freude liegt zu Ihren Füßen. Sie brauchen keine Technik zu erlernen, sich keine Selbstdisziplin aufzuerlegen. Die einzige Voraussetzung besitzen Sie bereits: die Offenheit dafür, die Freude, von der Sie umgeben sind, ausfindig zu machen.
* * *
In den Jahren, als ich als Designdirektorin bei dem renommierten Innovationsunternehmen IDEO und im Privatbereich tätig war und außerdem den Design-Blog The Aesthetics of Joy kuratierte, konnte ich miterleben, wie Ästhetik die Einstellung und das Verhalten der Menschen umgekrempelt hat. Sie verrät uns, warum in manchen Restaurants und Geschäften rege Betriebsamkeit, in anderen hingegen gähnende Leere herrscht. Mit ihrer Hilfe können wir dahinterkommen, warum eine Umgebung in den Menschen Angst und Rivalität auslöst, während es in einer anderen gesellig und tolerant zugeht. Überlegen Sie mal, wie die Leute sich in der sterilen Kabine eines Flugzeugs verhalten, wie wegen des Neigungsgrads einer Rückenlehne Streit ausbricht und mit den Ellbogen um den Platz auf der Armlehne gerangelt wird. Und vergleichen Sie das dann damit, wie sich die Leute in der lockeren Atmosphäre eines Musikfestivals verhalten. Umgeben von pulsierender Musik und schillernder Deko teilt man sich Essen und Trinken, macht auf der überfüllten Wiese Platz für die Neuankömmlinge und tanzt mit wildfremden Menschen. Die Ästhetik der Freude besitzt eine solche Kraft, dass sie unser Unbewusstes direkt anspricht und das Beste in uns zum Vorschein bringt, ohne dass wir es überhaupt bemerken.
Woher wissen Sie, ob Ihr Umfeld fröhlich ist oder nicht? Einen genauen Maßstab dafür gibt es nicht, aber denken Sie doch einmal über die folgenden Fragen nach:
Wie oft lachen Sie?Wann haben Sie das letzte Mal tiefe, grenzenlose Freude verspürt?Welche Gefühle kommen in Ihnen hoch, wenn Sie abends Ihr Zuhause betreten? Und wenn Sie jedes Ihrer Zimmer betreten?Wie sehr weiß Ihre Lebensgefährtin/Ihr Lebensgefährte oder Ihre Familie Freude zu schätzen?Wer sind die fröhlichsten Menschen in Ihrem Leben? Wie oft sehen Sie diese?Wie oft bereitet Ihnen die Arbeit Freude?Engagiert sich das Unternehmen, für das Sie tätig sind, für ein fröhliches Umfeld, ist ihm das gleichgültig, oder arbeitet es sogar dagegen an? Wie kommt es dort an, wenn man in lautes Gelächter ausbricht?Welche Beschäftigungen machen Ihnen die größte Freude? Wie oft gehen Sie ihnen nach? Können Sie ihnen zu Hause oder in der Nähe Ihres Zuhauses nachgehen?Wie viel Freude lässt sich in Ihrer Stadt oder Gemeinde entdecken? Und in Ihrer direkten Nachbarschaft?Was sind Ihre »Wohlfühlorte«? Liegen manche davon innerhalb eines Radius von zehn Kilometern?
Jedem Menschen ist die Fähigkeit, sich zu freuen, angeboren. Und wie die Zündflamme eines alten Gasherds brennt sie in Ihrem Innern selbst dann noch, wenn Sie die Kochplatten längere Zeit nicht verwendet haben. Was Sie hier in Händen halten, ist der Schlüssel dazu, wie Sie diese Flammen der Freude neu entfachen. Er verheißt radikale Veränderungen Ihrer Sichtweise der Sie umgebenden Welt. Diesem Buch liegt der Gedanke zugrunde, dass wir die Freude nicht nur irgendwo entdecken. Wir können sie genauso gut selbst kreieren, für uns selbst und für unser Umfeld.
Betrachten Sie dieses Buch als eine Art »Glückshelfer«, mit dem Sie in Ihrem Nahbereich mehr Freude ausfindig machen und auskosten lernen und verstehen, weshalb gewisse Dinge und Orte Sie innerlich zum Leuchten bringen. Auch als Maßnahmenpalette kann es Ihnen dienen, mit deren Hilfe Sie in Ihrem Leben Freude kreieren und gestalten können. Die Kapitel bauen aufeinander auf, daher ist es wohl am sinnvollsten, wenn Sie sie in der richtigen Reihenfolge lesen. Lassen Sie sich aber bitte nicht davon abhalten, zu einer Ästhetik zu springen, von der Sie sich magisch angezogen fühlen. Blättern Sie danach nur gerne wieder zurück, um zu schauen, was Ihnen entgangen ist.
Wahrscheinlich werden Sie feststellen, dass manche ästhetischen Prinzipien Sie mehr ansprechen als andere. Wenn Sie zum Beispiel die Natur lieben, werden Sie sich vom Prinzip der Freiheit vermutlich am meisten angezogen fühlen. Falls Sie Höhenangst haben, liegen Ihnen einige Aspekte der Erhabenheit wahrscheinlich nicht. Zudem werden Sie womöglich feststellen, dass die Ästhetik, mit der Sie sich am wohlsten fühlen, je nach Aufenthaltsort und Lebensphase variiert. Ein trostloses Büro verträgt Energie, wohingegen ein hektisches Familiendomizil von Harmonie profitiert. Wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, ist es möglich, dass jenes Familiendomizil nun einer spielerischen Ästhetik bedarf, damit es sich wieder lebendig anfühlt.
Die verschiedenen Ästhetik-Prinzipien dürfen Sie ruhig beliebig kombinieren und nebeneinander verwenden, damit Sie etwas erschaffen, das Ihnen ganz persönlich Freude macht. Dabei sind keine bestimmten Regeln zu beachten. Als Orientierungshilfe werde ich Sie aber wissen lassen, welche Prinzipien sich besonders gut ergänzen und welche sich eher nicht so gut miteinander vertragen. In manchen Kapiteln nehme ich zwar Bezug auf bestimmte Produkte, die den ästhetischen Prinzipien Leben einhauchen können, aber Sie müssen sich rein gar nichts Teures kaufen, um einen Raum in einen freudvollen Ort zu verwandeln. Das letzte Kapitel beinhaltet schließlich ein Toolkit, also einen Werkzeugkasten voller Anleitungen und Arbeitsblätter, die Ihnen dabei helfen, die Gedanken dieses Buchs auf Ihre eigenen Räumlichkeiten und Ihr eigenes Leben zu übertragen.
Nur allzu oft bewegen wir uns durch die physische Welt, als handelte es sich dabei um ein Bühnenbild, eine stumme Kulisse für unseren Alltag. Dabei wimmelt es in dieser Welt in Wahrheit nur von Inspirationsquellen, Anlässen zum Staunen und Sichfreuen. Ich hoffe, dieses Buch wird Sie dazu befähigen, mehr dieser Gelegenheiten in Ihrer Umgebung zu entdecken und zu ergreifen. Freude vermag in kleinen Augenblicken große Veränderungen zu entfachen. Ein verrücktes Outfit kann jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, was diesen Menschen wiederum dazu veranlasst, einer Fremden etwas Gutes zu tun, der es gerade nicht so gut geht. Mögen die freudvollen Gesten auch noch so winzig sein, mit der Zeit summieren sie sich, und ehe wir uns versehen, sind nicht nur ein paar Menschen glücklicher geworden, sondern die ganze Welt.
1. Energie
Im Spätherbst des Jahres 2000 wurde in der albanischen Hauptstadt Tirana ein historisches Gebäude von einer Malerkolonne mit einem kräftigen Orange überzogen. Ein Farbton zwischen Mandarine und Orangensaft-Instantpulver verschluckte die alte Fassade, verteilte sich rücksichtslos auf Stein und Beton und sparte dabei nur die Fenster aus. Mit dem Anstrich hatte man morgens begonnen, und um die Mittagszeit hatte sich auf der Straße eine Menschenmenge angesammelt, die dastand und gaffte. Der Verkehr kam zum Erliegen. Völlig verunsichert fingen die einen Zuschauer an zu schreien, während die anderen in Gelächter ausbrachen, weil sie die gewagte Farbe in all dem Grau derart erschütterte.
Bei diesem ganzen Aufruhr hätte man meinen können, der Anstrich sei das Werk eines besonders dreisten Tunichtguts gewesen. Dabei handelte es sich jedoch keineswegs um irgendwelches Geschmiere, und der Auftraggeber war auch kein gewöhnlicher Vandale. Es war der Bürgermeister.
Edi Rama gewann 2004 die Wahl zum besten Bürgermeister der Welt, weil er die albanische Hauptstadt nach nur vier Jahren Amtszeit so umwerfend schön restauriert hatte. Wenn Sie heute Tirana besichtigen, deutet kaum noch etwas auf den ehemals dreckigen, gefährlichen Zustand hin, in dem Rama die Stadt einst übernommen hatte. Die jahrzehntelange Diktatur hatte das Land ruiniert, und nach dem Sturz des Regimes fiel das Land ins Chaos und musste weitere zehn Jahre darben. Ende der Neunziger war Tirana zum Paradies für Korruption und organisiertes Verbrechen geworden. Taschendiebe und Prostituierte drückten sich an den Straßenecken herum. Berge von Abfall säumten die Straßen. Rama selbst formulierte es folgendermaßen: »Die Stadt war tot. Sie sah aus wie ein Durchfahrtsort, an dem man sich nur aufhielt, weil man auf irgendetwas wartete.«[1]
Das Bemalen der Gebäude war der Akt der Verzweiflung eines Bürgermeisters, der sich mit einer leeren Stadtkasse und einer demoralisierten Einwohnerschaft konfrontiert sah. Als ausgebildeter Maler der Akademie der Künste fertigte er die ersten Gestaltungsentwürfe selbst an. Er wählte kräftige Farbtöne und knallbunte Muster, die der Trostlosigkeit der Stadtlandschaft ein Ende bereiten sollten. Zum orangefarbenen gesellten sich weitere farbenfrohe Gebäude, private wie öffentliche, und sie breiteten sich rasch überall in der Stadt aus.
Anfangs waren die Reaktionen sehr gemischt: Manche Einwohner waren entsetzt, andere neugierig, einige von ihnen begeistert. Bald schon gingen jedoch seltsame Dinge vor sich. Die Leute hörten auf, die Straßen zuzumüllen. Sie fingen an, Steuern zu zahlen. Die Ladenbesitzer entfernten die Metallgitter vor ihren Fenstern. Sie behaupteten, sie fühlten sich sicherer in der Stadt, obwohl nicht mehr Polizisten als vorher in den Straßen patrouillierten. Die Menschen trafen sich auf einmal wieder in Cafés und sprachen davon, ihre Kinder in einer verwandelten Stadt aufwachsen zu sehen.
Nichts hatte sich verändert außer der Oberfläche. Ein paar Flecken Rot und Gelb, Türkis und Violett. Und doch hatte sich einfach alles verändert. Die Stadt war voller Leben, voller Überschwang. Voller Freude.
* * *
Als ich zum ersten Mal von der Verwandlung Tiranas hörte, kam es mir vor wie ein Wunder. Es hatte keine kräftigen Finanzspritzen gegeben, keine groß angelegten öffentlichen Bauprojekte. Es schien, dass die Stadt durch die bloße Kraft der Freude wiederbelebt worden sei. Wie konnte das sein?
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fing ich damals an, mich näher mit dem Thema Freude zu beschäftigen, wobei an allererster Stelle die Frage stand: Was genau ist Freude eigentlich? Das ließ sich anfangs nur schwer beantworten, denn jeder hat andere Vorstellungen davon, und selbst die Wissenschaft ist sich bei der Definition uneins. Psychologen würden »Freude« wohl ungefähr folgendermaßen beschreiben: eine intensive, kurzzeitige positive Emotion, die sich durch bestimmte Anzeichen bemerkbar macht – Lächeln, Lachen und das Gefühl, herumhüpfen zu wollen.[2] Zufrieden machen wir es uns auf dem Sofa gemütlich. Glückselig sind wir in friedvoller Meditation versunken. Vor Freude aber hüpfen wir, kichern wir, wirbeln wir herum und lassen die Hüfte kreisen. Freude ist ein überschwängliches Gefühl, die energiegeladene Version von Glück.
Von daher ist es kaum überraschend, dass ein Energiegefühl für uns mit Lebendigkeit, Vitalität und Freude zu tun hat. Energie haucht der Materie Leben ein. Sie ist die Währung des Lebens, wandelt tote Materie zu atmenden, pulsierenden Organismen. Allein das Lebendigsein bedeutet, durch eine gewisse dynamische Kraft am Schwingen zu sein. Je mehr Energie wir haben, desto mehr können wir spielen, etwas erschaffen, lieben, führen, erforschen, uns freuen und in Verbindung mit der uns umgebenden Welt treten. Vielleicht hatte ebendiese Energie etwas damit zu tun, dass Tirana durch Freude zu neuem Leben erweckt wurde. Doch woher stammt diese freudvolle Energie? Und wie bekommen wir mehr davon?
Wir begreifen Energie meist als Resultat von etwas, das wir zu uns nehmen, als den auf einen Cappuccino oder zuckrigen Kuchen folgenden Kick zum Beispiel. Doch als ich so darüber nachdachte, wurde mir klar, dass wir von Energie umgeben sind, die ganze Zeit über. An den meisten Tagen schwebt sie unbemerkt durch unser Zuhause, obwohl wir überflutet werden von ihren Feldern und Wellen: von den funkelnden Staubpartikeln, die von unseren Glühbirnen ausgehen, den Schallwellen aus unserer Musikanlage, der Brise, die von draußen hereinweht, und von der thermischen Energie unserer Heizung. Sie ist derart unauffällig, dass wir sie völlig vergessen – bis wir eines trockenen Wintertags einen metallischen Türgriff anfassen und von einem kleinen Prickeln überrascht werden.
Natürlich können wir, im Gegensatz zu den Pflanzen, die Energie nicht einfach von unserer Umwelt absaugen. Und doch hat die uns umgebende Energie manchmal sehr wohl einen Einfluss auf die Energie in unserem Innern. Ist es Ihnen nicht auch schon so gegangen, dass Sie sich nach einer harten Arbeitswoche müde auf eine Party geschleppt haben und die Musik Sie wieder munter gemacht hat? Oder ist Ihnen jemals aufgefallen, dass Sie an sonnigen Tagen viel leichter aus dem Bett kommen als an grauen? Ich begann mich zu fragen, warum manche Umgebungen diese stimulierende Wirkung haben und wie wir mehr fröhliche Energie in unser Leben bringen können.
Die Macht der Farbe
Als ich mit meinen Recherchen zum Thema Freude begann, war sofort klar, dass den lebendigsten Orten und Gegenständen eines gemeinsam war: strahlend bunte Farben. Ob es sich dabei um eine Reihe Hausfassaden mit gewagten bonbonfarbenen Streifen oder eine Auslage bunter Stifte in einem Schreibwarengeschäft handelte – kräftige Farben rufen durchweg Entzücken in uns hervor. Leuchtende Farben zieren Feierlichkeiten auf der ganzen Welt, und es scheint fast, dass die Freude umso intensiver ist, je intensiver die Farben sind. In China leiten tanzende, leuchtend bunte Drachen das neue Jahr ein, während der brasilianische Karneval mit schillernden Federkostümen aufwartet. Beim indischen Frühlingsfest »Holi« verzichten die Menschen auf solchen Schmuck und werfen stattdessen händeweise mit Pulverfarbe, was für ein überwältigendes Schauspiel buntscheckigen Staubs sorgt, der die grinsenden Zuschauer von oben bis unten in Farbe taucht.
Farbe und Gefühl lassen sich beinahe unmöglich getrennt voneinander betrachten, auch wenn uns diese Verbindung oftmals gar nicht bewusst ist, wenngleich unsere Sprache sie widerspiegelt: Unsere Stimmung hellt sich auf oder verdunkelt sich. Manchmal sehen wir alles grau in grau. Oder wir ärgern uns schwarz. Wenn wir verliebt sind, sehen wir hingegen alles durch eine rosarote Brille. Die symbolische Bedeutung der Farben[3] ist zwar von Kultur zu Kultur unterschiedlich, doch Helligkeit und Leuchtkraft gelten anscheinend allgemein als fröhlich. Kinder spüren das intuitiv. Eine Untersuchung der Gemälde von Vorschulkindern[4] hat ergeben, dass helle Farben mit Fröhlichkeit und Aufgeregtheit assoziiert werden, während dunkle Farben wie Braun oder Schwarz oft verwendet wurden, um negative Gefühle auszudrücken. Die Erwachsenen tun es den Kindern gleich. Der Grafikdesigner Orlagh O’Brien hat in Großbritannien und Irland die Menschen im Rahmen einer Studie gebeten, ihren Gefühlen Farben zuzuordnen. Der Streifen, der die für Freude ausgewählten Farben[5] zeigt, besteht aus hellen, lebendigen Nuancen und setzt sich beinahe zur Hälfte aus sonnigen Gelb- und Orangetönen zusammen.
Da uns helle Farben Auftrieb geben, ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen jede Menge Energie bei der Suche nach den hellsten Nuancen aufwenden. Die Dieri,[6] ein Aborigine-Stamm, waren bekannt dafür, jedes Jahr beinahe tausend Kilometer zu Fuß nach Bookartoo zu pilgern, um dort in einer Mine ein ockergelbes Farbpigment zu bergen. Es befanden sich haufenweise Ockerminen in ihrer Nähe, doch die Dieri wollten nur den hellsten, leuchtendsten Ocker für ihre rituellen Körperbemalungen. Die Römer waren besessen von einem Farbstoff, der mithilfe eines übel riechenden Verfahrens aus den Analdrüsen der Purpurschnecke gewonnen wurde.[7] In der Kolonialzeit waren die hellsten Pigmente oftmals ein derart wohlgehütetes Staatsgeheimnis, dass nicht nur ein französischer Botaniker sein Leben riskierte bei dem Versuch, eine Schachtel Cochenilleschildläuse aus Mexiko herauszuschmuggeln, aus denen Karmin gewonnen werden kann. Auch heute noch vermag Farbe den Menschen zu großen Reisen zu inspirieren. So werden Wallfahrten zu rotfelsigen Canyons und pinken Sandstränden unternommen, und so füllen sich jeden Herbst die Frühstückspensionen in Neuengland und Kanada mit »Leaf-Peepern«, die auf der Suche nach den schönsten Herbstfarben sind.
Über seine Erfahrungen mit der Droge Meskalin schrieb Aldous Huxley einst, dass die Farbwahrnehmung beim Menschen überflüssig sei: »Der hoch entwickelte Farbensinn des Menschen ist ein biologischer Luxus – unschätzbar wertvoll für ihn als intellektuelles und spirituelles Wesen, aber unnötig für sein biologisches Überleben.«[8] Dennoch sind unsere Augen wahre Experten darin, zwischen minimal unterschiedlichen Farben zu unterscheiden, und die Wissenschaft geht davon aus, dass wir bis zu sieben Millionen verschiedene Nuancen sehen können.[9] Unser Regenbogen ist zwar nicht ganz so weit gefasst wie der, den viele Vögel mit ihrer Wahrnehmung bis weit ins Ultraviolettspektrum in der Lage sind zu sehen, aber trotzdem ist das eine erstaunlich große Bandbreite. Ist es dann nicht ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Fülle an Farben allein dazu dient, uns in eine rosige Laune zu versetzen?
In Wahrheit ist unser Farbsehen alles andere als verschwenderischer Luxus.[10] Für unser Überleben hat diese Sinneswahrnehmung nämlich eine wesentliche Rolle gespielt – insbesondere beim Auftreiben von Energiequellen. Unsere einstigen Vorfahren waren nachtaktiv und hatten daher, wie die meisten Säugetiere, kaum Verwendung für das Farbsehen. Zarthäutig und warmblütig wie sie waren, suchten sie im Schutz der Dunkelheit nach Futter und verließen sich dabei viel stärker auf ihren Geruchssinn als auf ihre Sehkraft. Vor fünfundzwanzig Millionen Jahren aber wagte sich eine dreiste Bande von Nachtaffen ans Tageslicht und übernahm damit unsere bis heute geltende tagaktive Lebensweise. In dieser ökologischen Nische wurde die Fähigkeit, Farben sehen zu können, auf einmal zum praktischen Vorteil. Während die Augen ihrer nachtaktiven Vettern lediglich zwei Zapfentypen für die Farbwahrnehmung aufwiesen, bildete sich bei unseren Vorfahren ein dritter Zapfentyp heraus, der die Unterscheidbarkeit von Gelb-, Rot- und Grüntönen verbesserte und die Anzahl Farben, die sie wahrnehmen konnten, vervielfachte. Irgendwann sollte sich dieser Zapfen für die Deutung einer Verkehrsampel nützlich erweisen, doch für die Primaten war der unmittelbare Nutzen weit größer. Die Wissenschaft geht nämlich davon aus, dass sie dadurch in der Lage waren, zuckerreiche reife Früchte und nahrhafte junge Blätter in dem dichten Laubwerk der Baumwipfel auszumachen, in dem sie lebten.[11] (Junge Blätter weisen oftmals eine rote Färbung auf, da sie Anthozyan-Pigmente enthalten, die noch nicht vom Chlorophyll überlagert wurden.) Der Forschung zufolge hat die Farbwahrnehmung einen solch großen Vorteil bedeutet, dass das Gehirn unserer Vorfahren den Geruchssinn zurückgefahren hat, damit die visuellen Informationen besser verarbeitet werden konnten. Entgegen Aldous Huxleys Meinung also war das Farbsehen für unser Überleben derart essenziell, dass wir dafür sogar andere Sinneswahrnehmungen geopfert haben.
Die größte Sorge eines jeden Organismus – ob einzelliges Pantoffeltierchen oder zweihundert Tonnen schwerer Blauwal – ist die, genügend Energie zur Verfügung zu haben: für das Sammeln von Nahrung, das Suchen eines Unterschlupfs, das Abwehren von Feinden, die Fortpflanzung, die Kindererziehung, das Tennisspielen, das Rumbatanzen. Das gilt insbesondere für große Warmblüter wie uns. Unter dem Mikroskop betrachtet, stellt das Leben an sich schon ein fieberhaftes Unterfangen dar. Unsere Zellen schwirren den ganzen Tag umher. Ihre Kernhülle löst sich auf, um die Chromosomen zu verteilen, und bildet sich neu, sie erzeugen RNA-Stränge, die als Boten fungieren, lagern Aminosäuren zu Proteinen zusammen, reparieren und duplizieren sich. Um diesen Ofen namens Stoffwechsel am Laufen zu halten, verfügen wir über zwei ausgeklügelte Mechanismen, welche die beinahe immerwährende Suche nach Nahrung vorantreiben: Hunger, der diese Suche in Gang setzt; und Freude, die das Finden von Nahrung belohnt. Im Lauf von Millionen von Generationen kündeten leuchtende Farben derart zuverlässig von Essen, dass wir sie eng mit Freude gekoppelt haben.[12]
Farbe ist sichtbar gemachte Energie. Sie aktiviert einen uralten Schaltkreis, der bei dem Gedanken an etwas essbares Süßes vor Freude aufleuchtet. In einer Welt, die eine breite Palette künstlicher Farben aufweist, verspüren wir diese Freude auch dann noch, wenn das farbige Objekt keine körperliche Nahrung darstellt. Allgemeiner formuliert, ist Farbe ein Indikator für die Reichhaltigkeit unserer Umgebung. Sie signalisiert unserem Unterbewusstsein nicht nur, dass für unser leibliches Wohl gesorgt ist, sondern auch, dass uns diese Umwelt über einen längeren Zeitraum versorgen wird. Um es mit den Worten des deutschen Malers Johannes Itten zu sagen: »Farbe ist Leben, denn eine Welt ohne Farben erscheint uns wie tot.«[13] Das Wesentliche der Energie-Ästhetik ist eine Lebendigkeit, die uns wissen lässt, dass unsere Umgebung uns beim Wachsen und Gedeihen unterstützen wird.
Dieses Wissen ließ die magische Verwandlung Tiranas in einem anderen Licht erscheinen. Edi Ramas Farben hauchten einer tot aussehenden Stadt Leben ein und signalisierten den Einwohnern, dass ihre Heimat kein »Abfallhaufen«[14] mehr ist, wie einer von ihnen es ausgedrückt hat, sondern ein lebendiger Ort mit seiner ganz eigenen, sprudelnden Vitalität. Sobald ich begriffen hatte, dass sich unsere Beziehung zu Farbe nicht als beiläufiges Vergnügen, sondern als ganz wesentlicher Vorbote des Lebens entwickelt hatte, wurde mir klar, dass die Farben eine unbewusste Veränderung in der Beziehung der Einheimischen zu ihrer Umgebung zur Folge hatten: von Kampf oder Flucht zu Dableiben und Wachsen. Die Anzahl von Unternehmen hat sich in Tirana innerhalb von fünf Jahren verdreifacht, und die Steuereinnahmen haben sich sogar versechsfacht.[15] Diese Mehreinnahmen wiederum konnten Entwicklungsvorhaben wie das Abreißen von fünftausend illegal errichteten Gebäuden sowie das Pflanzen von viertausend Bäumen finanzieren. Journalisten, die etwa ein Jahr nach den ersten Anstrichen in die Stadt kamen, stellten fest, wie in ehemals desolaten, kriminellen Straßenzügen inzwischen geschäftiges Treiben herrschte, wie die Leute in Cafés saßen und in den Parks spazieren gingen. Der albanische Künstler Anri Sala erzählte, wie sich der Wandel verselbstständigt hat. »Am Anfang stellten die Farben selbst den Wandel dar, doch mittlerweile können wir beobachten, wie sich die Stadt um die Farben herum wandelt.«[16] Die Wandgemälde waren wie ein Feuer, das im Herzen der Stadt entzündet worden war. Sie wirkten wie ein Katalysator, der eine Transformation entfacht hat, die letztlich den ursprünglichen Effekt in den Schatten stellte. Wie einer der Einwohner schrieb: »Selbst ein Blinder kann den tiefen Wandel Tiranas bezeugen.«[17]
Kaum zu glauben, dass Farben eine derartige Macht besitzen. Selbst Rana, der diese Metamorphose am eigenen Leib erlebt hat, wirkt mitunter verblüfft in Anbetracht des ganzen Ausmaßes, und viele ähnliche Wandmalereien anderswo sind schon als bloße »Verschönerungsmaßnahmen« und vergeudetes Geld abgetan worden. Ich denke, wir unterschätzen die Macht der Farben, weil wir in ihnen nur eine Zierde und keinen Nutzwert sehen. In unserer von Menschenhand geschaffenen Welt bewegen sich die Farben bloß an der Oberfläche – als dünne Hülle, als letzter Schliff. In der Natur jedoch zieht sich die Farbe durch die Gesamtheit eines Gebildes. Die Kakifrucht ist innen wie außen orange; der braune Elch ist innen rot. In der Natur bedeutet Farbe etwas: ein bestimmtes Entwicklungsstadium, eine bestimmte Mineralienkonzentration. Wir begreifen Farbe als etwas, das das Darunterliegende versteckt. Dabei erfahren wir sie als Offenbarung. Edi Rama ist der gleichen Auffassung.[18] Ihm zufolge werden Farben in einer »normalen Stadt« wie ein Kleid oder ein Lippenstift getragen, in einer Stadt wie Tirana allerdings, wo die elementarsten Bestandteile des Gemeindelebens so furchtbar vernachlässigt worden waren, haben Farben eher die Funktion lebenswichtiger »Organe«. So kosmetisch sie aussehen mögen, sie gehen mitten ins Herz.
* * *
Kurz nachdem ich von Tiranas Verwandlung erfahren hatte, lernte ich jemanden aus meiner eigenen Heimat kennen, der ebenfalls daran glaubte, dass Farben trostlose Orte und die Menschen darin beleben können. Als Ruth Lande Shuman sich in den 1990ern diverse Mittelschulen in East Harlem anschaute, wurde ihr irgendwann klar, dass diese einer anderen Art Institution ähnelten. »Jede einzelne dieser Schulen sah aus wie ein Gefängnis und fühlte sich auch so an«, sagte sie, als es darum ging, was sie zur Gründung des gemeinnützigen Unternehmens Publicolor inspiriert hat. Publicolor sorgt bei benachteiligten öffentlichen Schulen in New York City für eine Transformation, indem es ihnen einen schillernd bunten Anstrich verpasst. Vor meinem inneren Auge stiegen die mir bekannten Schulen auf: Betonfassaden, fensterlose Flure, die von maulwurfsgrauen Schließfächern gesäumt waren, die sandfarbenen Linoleumböden. »Die machen einen derart feindlichen Eindruck«, meinte Shuman und schüttelte den Kopf. »Kein Wunder, dass die Schüler scharenweise abbrechen. Kein Wunder, dass die Lehrer Burnout kriegen. Und kein Wunder, dass die Eltern den Gebäuden fernbleiben.« (Etwa 24 Prozent der Schüler bleiben nicht die vollen vier Jahre auf der amerikanischen Highschool; als Shuman ihre Arbeit aufnahm, waren es allerdings sogar über 50 Prozent. Bei den schwarzen und hispanoamerikanischen Schülern macht der Anteil der Schulabbrecher ein Drittel aus.)
Zuvor hatte Shuman für den gemeinnützigen Zirkus Big Apple Circus gearbeitet und am eigenen Leib erfahren, welche Freude das Betreten eines farbenfrohen Ortes macht. Zudem hatte sie Farbenlehre studiert, und genau wie Edi Rama glaubte auch sie, dass sich Farben tief greifend auf das Verhalten der Menschen auswirken können. Den ersten Anstrich bekam eine Schule in East New York, einer Gegend in Brooklyn, in der die Hälfte der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze lebt. Anfangs stieß sie bei den Schulleitern auf Ablehnung und musste sich wegen der leuchtenden Farben einigen Spott anhören. Zwanzig Jahre später hat Publicolor über vierhundert Schulen und Gemeindezentren gestrichen, ist vom Weißen Haus und der Stadt ausgezeichnet worden und hat unter den Schulrektoren viele Fans.
Schulen sind komplexe Systeme, weshalb sich die Auswirkungen von Farbe auf die schulischen Leistungen nur schwer einzeln betrachten lassen. Dennoch gibt es viele Anhaltspunkte dafür, dass Publicolors Eingreifen signifikante Veränderungen zur Folge hatte. Es werden kaum mehr Graffitis an die Wände gemalt, und laut Rektoren sind sowohl Schüler als auch Lehrer häufiger anwesend. Manchen Rektoren zufolge haben sich sogar die Prüfungsergebnisse verbessert. Das vielleicht überraschendste Ergebnis war, dass Schüler und Lehrer durchweg sagen, sie fühlten sich danach sicherer in ihrer Schule. Genau wie die Ladenbesitzer in Tirana, die ihre Metallgitter von den Fenstern entfernten, merkten die Schüler und Studenten, dass sie durch die bunt bemalten Wände weniger Angst an diesem Ort verspürten. Womöglich setzt dieses Sicherheitsgefühl mehr Gehirnkapazitäten für Lehrtätigkeiten und Lernen frei, was sich wiederum mit konzentrierteren Schülern und leistungsstärkeren Schulen bemerkbar macht.
Ich vermute, dass hier noch etwas anderes im Spiel ist. Lebhafte Farben wirken wie ein Aufputschmittel, sie rütteln uns wach, reißen uns aus unserer Bequemlichkeit heraus. Der Künstler Fernand Léger erzählte, welcher Wandel in einer frisch renovierten Fabrik in Rotterdam eintrat: »Die alte Fabrik war traurig und düster, die neue ist hell und bunt: durchsichtig. Und dann geschah etwas. Ohne dass es irgendwelche Anweisungen gegeben hatte, trugen die Arbeiter auf einmal saubere und ordentliche Kleidung. ... Sie hatten das Gefühl, etwas Wichtiges sei gerade passiert, um sie herum und in ihnen selbst.«[19] Umfassende Untersuchungen zum Thema Farben am Arbeitsplatz legen nahe, dass sich dieses Phänomen in großem Umfang abspielt.[20] Im Rahmen einer Studie mit tausend Teilnehmern in Schweden, Argentinien, Saudi-Arabien und Großbritannien hat sich gezeigt, dass die Angestellten in hellen, farbenfrohen Büros wacher und aufmerksamer waren als ihre Kollegen in tristeren Büros sowie fröhlicher, interessierter, freundlicher und zuversichtlicher. Die Farblosigkeit der meisten Schulgebäude und Büros ist alles andere als inspirierend und führt zu Rastlosigkeit und Konzentrationsschwäche.[21] Lebendige Farben hingegen helfen uns dabei, die Energie aufzubringen, um zu lernen, zu wachsen und produktiv zu sein.
Publicolor lässt Schüler und Verwaltungsangestellte bei der Farbauswahl mitentscheiden, doch im Laufe der Jahre hat sich eine unverkennbare Farbpalette herausgebildet, zu der gelbe, grüne und orange Zitrustöne, gepaart mit türkis- und lachsfarbigen Akzenten, gehören. Das sind fröhliche, helle und satte Farben, aber ich fragte mich, wie sie wohl auf richtig großen Flächen wirkten. Würden uns solch knallbunte Farben auf einem großen Gebäude nicht erschlagen?
Diese Neugier brachte mich dazu, dass ich mich eines Nachmittags im Juli mit einer Malerrolle in der Hand in einem Obdachlosenheim in Brownsville, Brooklyn, wiederfand und eine Tür arubablau anstrich. Im Sommer organisiert Publicolor nämlich in den Morgenstunden Schülerunterricht in Lesen, Schreiben und Mathematik, und am Nachmittag streichen die Schulkids öffentliche Einrichtungen in benachteiligten Gegenden. Wir trafen am frühen Nachmittag ein und sahen eine mit Farbklecksen übersäte Shuman, die herumschwirrte und Farben und Malerzubehör überprüfte und sich bei den Schülern erkundigte, wie sie ihren Sommer und das Projekt fanden. Sie kannte jeden beim Namen. Als alle da waren, gingen wir nach draußen in den Hof zwischen die fünf Heimgebäude, und sie machte mich mit dem Mädchen bekannt, das mich heute anleiten würde: die sechzehnjährige Kiyana aus Sunset Park in Brooklyn. Wir knöpften uns eine der Türen vor, die auf den Hof hinausgingen. Kiyana war eine Publicolor-Veteranin, die schon fünf Projekte auf dem Konto hatte, deshalb überließ ich ihr die kniffligen Stellen um den Rahmen herum und konzentrierte mich darauf, die Farbe gleichmäßig zu verteilen, ohne dass sie zu dick oder schmierig aussah. Ich fragte Kiyana, welches ihr bisheriges Lieblingsprojekt sei, woraufhin sie nachdenklich lächelte. »Auf jeden Fall meine eigene Schule. Die fühlte sich danach tatsächlich viel besser an«, meinte sie, und die Art, wie sie »tatsächlich« sagte, verriet ihre Verwunderung darüber. »Durch die Farben fühle ich mich dort viel, viel wohler.«
Mich in Kiyanas Haut zu versetzen war ein Kinderspiel, denn genau zu diesem Zeitpunkt war das Heim perfekt zweigeteilt in Vorher und Nachher. Die westlichen Gebäude waren mit den Gelb- und Orangetönen eines Sonnenuntergangs gestrichen worden, wobei das Erdgeschoss mit seinem sanften Goldton am hellsten war und das Obergeschoss mit der Farbe einer reifen Aprikose am dunkelsten. Das Aquamarin der von uns gestrichenen Türen verlieh dem Ganzen einen tropischen Touch. Die östlichen Gebäude, die erst in der darauffolgenden Woche an die Reihe kommen würden, waren von oben bis unten graubraun. Wie ich dort so in der Mitte stand, haute mich der Unterschied um. Rechterhand lag eine Ödnis, ein düsterer letzter Ausweg. Linkerhand ein Wohnviertel in Miami, dessen warme Farben Sonne und ein Stück Optimismus ausstrahlten.
Mut zur Farbe
Nur wenige würden als Lieblingsfarbe Grau oder Beige angeben, und trotzdem hüllen viele von uns ihr Zuhause in fade neutrale Farben. Wieso klafft da eine Lücke zwischen den Farben, die uns aufmuntern, und den Farben, mit denen wir uns umgeben, fragte ich mich.
»Chromophobie«, lautete die unmittelbare Antwort, als ich mich bei Peter Stamberg und Paul Aferiat danach erkundigte. Die beiden sind die Architekten des farbenprächtigen Hotels Saguaro in Palm Springs und führen die Tatsache, dass ihr Hotel das weltweit am dritthäufigsten vertretene Objekt auf Instagram im Jahr 2016 ist, auf jene spannungsgeladenen Nuancen zurück. »Die Menschen fürchten sich vor Farbe«, meinte Stamberg zu mir. Damit meinte er definitiv nicht sich selbst und Aferiat, denn die beiden wohnen in einem wahrhaften Tempel leuchtender Farbigkeit: ein offenes Loft, das nicht von Wänden, sondern Farben unterteilt wird, von gelben, grünen, blauen und orangefarbenen Paneelen. Die beiden saßen mir gegenüber auf einem lila Sofa, unter ihnen ein pinkfarbener Teppich, neben ihnen zwei zinnoberrote Stühle. Eine große Glasgeschirrsammlung, die in einem Farbverlauf warmer Töne arrangiert war, zierte einen Tisch am Fenster und warf bernsteinfarbene Lichtsplitter auf den Boden.
»Sie fürchten sich davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und dann damit leben zu müssen«, sagte Aferiat. Das konnte ich gut nachvollziehen. Damals kannte ich den Ausdruck noch nicht, aber ich war eine Chromophobikerin, wie sie im Buche steht. Ich fürchtete mich so sehr vor Farben, dass sich das gesamte Spektrum meiner Wohnung zwischen Weiß und Cremeweiß bewegte. Mein Sofa war elfenbeinfarben, meine Bücherregale weißgrau. Meine Bettwäsche, Handtücher und Vorhänge waren reinweiß. Meine große Pinnwand war mit einem rauen Leinenstoff bezogen, und in der Ecke meines Schlafzimmers türmten sich meine Klamotten auf einem Regiestuhl, den ich mit einem – dreimal dürfen Sie raten – weißen Segeltuch behängt hatte. Jedes Mal, wenn ich ein neues Möbelstück brauchte, studierte ich bunte Kataloge, liebäugelte mit senffarbenen Samtsofas und pink gestreiften Sesseln. Doch am Ende landete ich stets wieder beim verlässlichen alten Weiß.
Dann zog ich eines Tages in meine Traumwohnung um: ein im obersten Stockwerk eines der historischen Brownstone-Stadthäuser gelegenes »Railroad Apartment« (ein linearer Grundriss mit ausschließlich Durchgangszimmern) mit makellosen Holzdielen, einem Blick ins Grüne und sogar einem kleinen Oberlicht im Badezimmer. Der einzige Haken war der, dass die Wände buttergelb angestrichen waren.
Chromophobie
Gleich als ich die Wohnung zum ersten Mal sah, nahm ich mir vor, dass ich sie neu streichen würde. Doch nach meinem Einzug passierte etwas Seltsames. Jedes Mal, wenn ich die Wohnung betrat, hatte ich das Gefühl, die Sonne ging auf, sogar im tiefsten Winter. Wenn ich von einer Reise heimkehrte, war ich außer mir vor Freude – jedes Mal. Sechs Jahre lang blieb ich dort wohnen, und schon nach der ersten Woche kam mir nie mehr in den Sinn, sie neu zu streichen.
Gerne würde ich behaupten, dies war das Ende meiner Chromophobie, doch in Wahrheit war es mein Designstudium, das meine Einstellung zu Farben veränderte. Währenddessen verbrachte ich nämlich viele Stunden damit, Muster farbigen Papiers auszuschneiden und zu gruppieren, Malerfarben zu mischen und das Zusammenspiel verschiedener Nuancen zu erforschen. Ich erkannte, dass die Welt voller Farben steckt, die ich nicht gelernt hatte zu sehen. Bisher hatte ich geglaubt, Schatten seien grau, und auf einmal sah ich, dass sie purpurrote Färbungen aufwiesen. Ein Apfel war für mich schlicht rot gewesen, ohne dass mir klar war, wie grundlegend anders dieses Rot aussieht, wenn der Apfel auf der Fensterbank statt auf der Ladentheke liegt. Für mich bedeutete diese neue Art der Wahrnehmung eine unbeschreiblich große Freude.
Heute beschäftigen sich, so scheint es, nur Künstler eingehend mit Farbe. Dem Historiker John Stilgoe zufolge war dies bis zur letzten Jahrhundertwende anders: Gebildete Leute neigten sich der Farbenlehre zu, dem Zusammenspiel von Licht und Farbe an einem bestimmten Ort.[22] Die Menschen erlernten das Sehen genauso wie das Lesen und Schreiben. Kein Wunder also, dass wir uns ohne diese Bildung beim Thema Farbe ein wenig verloren fühlen.
Der Unterschied zwischen energiegeladenen, fröhlichen Farben besteht darin, wie rein und hell die Pigmente sind. Designer sprechen hierbei von »Sättigung« und »Helligkeit«. Als ich diese Begriffe lernte, erschloss sich mir auf einmal die Welt der Farben: Eine gesättigte Farbe ist die Farbe in Reinform, wie man sie beispielsweise auf Bausteinen für Kinder findet. Sie sind kräftig und intensiv. Möchte man eine Farbe entsättigen, so fügt man Grau bei und lässt sie dadurch dumpfer wirken. Frühlingsgrün wird zu Olivgrün; Himmelblau wird zu Blaugrau. Beige ist entsättigtes Gelb – ein Gelb, dem sämtliche Freude ausgetrieben wurde! Grau ist der Inbegriff einer entsättigten Farbe, es setzt sich nur aus Weiß und Schwarz zusammen. Als Teil eines Farbkonzepts können entsättigte Farben durchaus nützlich sein, doch wenn wir uns umschauen und ausnahmslos Grau- und Kaki- und Beigetöne sehen, ist unsere Umgebung ganz schön trostlos. Die Helligkeit einer Farbe hängt davon ab, wie viel Weiß oder Schwarz hineingemischt wurde. Weiß reflektiert das Licht, Schwarz absorbiert es. Wenn man Weiß hinzufügt, wird die Farbe also heller und reflektierender, wenn man hingegen Schwarz hinzufügt, wird sie dunkler und gedeckter. Hellrosa und Himmelblau wirken energetisierender als Bordeaux und Marineblau, da sie mehr Licht reflektieren und einen Raum dadurch mit Leben füllen. Dunkle, entsättigte Farben absorbieren das Licht und reduzieren dadurch die Energie.
Der souveräne Umgang mit Farben erfordert ein wenig Übung. Doch zum Glück gibt es Schnellverfahren dafür, fröhliche Farbkombinationen zu finden und unsere Augen darin zu schulen, Farbe in ihrer ganzen bezaubernden Tiefe sehen und einsetzen zu können. Als Stamberg und Aferiat bei der Farbauswahl für eines der von ihnen gestalteten Häuser einmal nicht weiterwussten, wandten sie sich an einen guten Freund, den Maler David Hockney, der ihnen riet: »Tut das, was ich immer tue, wenn ich ein Farbproblem habe. Schaut euch Matisse an.« Die kräftigen Farben der Gemälde von Henri Matisse haben die beiden dann nicht nur zum richtigen Blauton geführt, sondern waren ihnen von da an auch beim Umgang mit ihren Kunden behilflich. Die friedliche Koexistenz dieser kühnen Farben auf einer Leinwand schenkt ihnen für gewöhnlich das Vertrauen, dass solche Farben auch bei ihnen zu Hause gut aussehen werden. Die helle, leuchtende Farbpalette von Matisse ist eine ideale Inspirationsquelle, doch ich schaue mir auch gerne Helen Frankenthaler, Sonia Delaunay, Pierre Bonnard und natürlich David Hockney an, wenn ich mich in puncto Farben inspirieren lassen möchte.
Und wenn Sie immer noch nicht ganz überzeugt sind, nehmen Sie sich die Worte des legendären Innendesigners David Hicks zu Herzen, der die Vorstellung, dass sich Farben gegenseitig beißen können, für eine Erfindung »feiner Damen« der 1930er-Jahre hielt. »Farben beißen sich nicht«, sagte er. »Sie befinden sich in Schwingung.«
* * *
Auch Ellen Bennett, die dreißigjährige Gründerin der Schürzenmanufaktur Hedley & Bennett aus Los Angeles, leidet definitiv nicht an Chromophobie. »Ich liebe Farben«, meinte sie zu mir, als ich mich mit ihr an einem verregneten Septembernachmittag traf. Das »ie« von »liebe« zog sie dabei in die Länge, um der Stärke ihrer Zuneigung noch mehr Ausdruck zu verleihen. Ihr Zuhause sei ganz in Regenbogenfarben gehalten, und als Highlights nannte sie: farbcodierte Bücherregale, ein blaues Schlafzimmer, eine Haustür in leuchtendem Gelbgrün sowie ein hellgelber Küchenherd, den sie ihrem Freund schon nach drei Monaten schenkte. Die quirlige Bennett drückte mich beim Kennenlernen gleich ganz fest und gab mir einen Kuss auf die Wange. Für sie ist klar, dass Farben ein Gefühl von Wärme erzeugen können. »In den Räumen, die ich gestalte, sollen sich die Leute willkommen fühlen«, hat sie einmal gesagt, »so als ob sie von den Räumen umarmt würden.«[23]
Ihre Liebe zu lebendigen Farben führt Bennett auf ihre Herkunft zurück. Als Halbmexikanerin pendelte sie in ihrer Kindheit zwischen Mexiko und Kalifornien hin und her. »Das Leben in Mexiko war die reinste Farbenpracht. Das Haus meiner Großmutter ist helltürkis. Einfach alles ist bunt dort, vom Mais am Straßenrand bis zu den Mangos im Lebensmittelladen. In den USA war dagegen alles sehr viel brauner. Brauner Sand, braune Schulen ... einfach nur Braun. Wenn ich wieder zurück nach Mexiko ging, gab es wieder Gelb und Grün und Rot, und jedes einzelne Haus hatte eine andere Farbe. Alles fühlte sich einfach lebendig an. Aus der Perspektive eines kleinen Kindes spürte ich diese Energie in mir drinnen, und ich dachte, diese Energie will ich haben. Das gefällt mir.«
Als ich Bennetts Erinnerungen an diese beiden Welten lauschte, nagte etwas an mir, das sich nur als Farbneid beschreiben lässt. Auch ich war in Ländern gewesen, die eine ganz natürliche und mühelose Leuchtkraft besaßen. Südostasien, Lateinamerika, die karibischen Inseln. Diese farbenprächtigen Orte strahlen eine Wärme und Vitalität aus, die den meisten US-amerikanischen Städten fehlt. Farben lassen sich dort am ehesten auf Hinweisschildern und Reklame finden. »Das Leben in Mexiko findet einfach auf einem höheren Energielevel statt«, meinte Bennett. Farbe treibt die Freude an die Oberfläche. Wieso bleibt Farbe in manchen Kulturen den Feierlichkeiten vorbehalten, während andere sie in den Alltag integrieren?
Es wäre zu kurz gefasst, wenn wir diese Frage mit unterschiedlichen Vorlieben beantworteten: Manchen Kulturen verlangt es nach Farbe, andere bevorzugen ein Leben in Graustufen. Meiner Meinung nach liegt der Hund in tief verwurzelten kulturellen Vorurteilen des Westens begraben, die eine Kultiviertheit anstreben und von allem Freudvollen wegstreben. Diese Vorurteile finden ihren Ausdruck in Johann Wolfgang von Goethes Farbenlehre von 1810. Darin schrieb er, dass »wilde Nationen, ungebildete Menschen, Kinder eine große Vorliebe für lebhafte Farben empfinden« und dass »gebildete Menschen in Kleidung und sonstiger Umgebung die lebhaften Farben vermeiden und sie durchgängig von sich zu entfernen suchen«.[24] Diese Weltanschauung herrscht tatsächlich noch in weiten Teilen Europas und Nordamerikas vor, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist. Freude und Farben tun wir als kindisch und belanglos ab und lobpreisen neutrale Töne als Zeichen von Coolness und Geschmack. Das Farbenspektrum eines modernen Heims wird von einem moralischen Kompass bestimmt, wo Selbstbeherrschung als Richtschnur und Überschwang als Schwäche gilt. Die klare Botschaft lautet: Gesellschaftlichen Beifall gibt es nur, wenn wir unserem natürlichen Hang zur Freude entwachsen oder lernen, sie zu kontrollieren.
Diese Voreingenommenheit hat uns so weit gebracht, dass es vielen von uns beinahe peinlich wäre, Farbe in unser Leben zu integrieren. Neulich traf ich eine Frau, die mir erzählte, dass sie Farben liebe, sie aber nur im Kinderzimmer einzusetzen wage, nicht im Rest des Hauses. Frauen bringt man bei, im Alter gedeckte Farben zu tragen, damit es nicht heißt, sie wollten krampfhaft jünger aussehen. Das ist eine weit heimtückischere Form von Chromophobie, die nicht von mangelndem Selbstbewusstsein, sondern der Tyrannei der öffentlichen Meinung getrieben wird. Wäre unsere Welt nicht vielleicht sehr viel bunter, wenn die Leute keine Angst davor hätten, lachhaft auszusehen?
Menschen wie Ellen Bennett, die einen Weg gefunden haben, fröhliche Farben mit einem seriösen Geschäftsmodell zusammenzubringen, finde ich sehr inspirierend. Als sie achtzehn wurde, zog Bennett nach Mexiko-Stadt und finanzierte ihre Ausbildung zur Köchin mit Gelegenheitsjobs, unter anderem auch als Lottofee im mexikanischen Fernsehen. Einige Jahre später zog sie dann wieder zurück, mit dem festen Vorsatz, die leuchtenden Farben Mexikos mit in die USA zu bringen. Sie fand eine Anstellung als Postenköchin in einem Restaurant. Die Arbeit dort machte großen Spaß, doch etwas gefiel ihr überhaupt nicht: die Arbeitskleidung. Als sie sich über die Schürze beschwerte, stellte sie fest, dass es ihren Kollegen ganz genauso ging. »Darin sahen wir beschissen aus und fühlten uns auch beschissen«, sagte sie. Eines Tages wollte ihr Chef neue Schürzen für das gesamte Team bestellen, und Bennett flehte ihn an, die Bestellung bei ihr aufzugeben. Sie hatte keine Schnittmuster, keinen Stoff und noch nicht mal eine Nähmaschine, doch in diesem Augenblick war ihre Schürzenmanufaktur Hedley & Bennett geboren.
Die allererste Schürze war aus gelbem Leinen gefertigt, und bald darauf folgten weitere Farben. Bennett wusste, dass die Schürzen auch etwas taugen und nicht nur gut aussehen müssten, also kannte sie bei ihrer Qualität keine Gnade. »Das ist ein verdammt ernst zu nehmendes Kleidungsstück, das echt fröhlich und verspielt aussieht«, sagte sie, »und einem gleichzeitig ein Gefühl von Sicherheit, von Stolz und von Würde verleiht. Es ist bunt und auch funktional, es ist einfach sehr gut verarbeitet.« Dank dieser Funktionalität können sich die Leute ein Stück Arbeitskleidung aussuchen, das heiter und spaßig aussieht. Und diese Kombi hat offensichtlich Erfolg, denn Hedley & Bennett stattet mittlerweile über viertausend Restaurants aus.
Letzten Endes gehen Bennetts Ambitionen aber weit über Schürzen hinaus. In Wirklichkeit macht ihr Unternehmen aus einem billigen, hässlichen Kleidungsstück, das die Arbeiter gezwungenermaßen tragen, eine Klamotte, die Stolz und, ja, Freude in die Arbeit bringt. Von Schürzen sprach sie, wie ich es noch nie gehört hatte: »Das ist dein kleiner Umhang«, sagte sie und spielte damit auf Superhelden an. Zuerst schaute ich skeptisch drein, doch je länger ich über diese Metapher nachdachte, desto plausibler erschien sie mir. Wenn Clark Kent in seinen hautengen blau-roten Superman-Anzug schlüpft, verwandelt er sich, ihm werden Energien und Kräfte verliehen, die in seiner tristen Tweedjacke undenkbar wären. Und in der Tat »rüstet« auch Bennett April Bloomfield, David Chang und unzählige Postenköche aus, bereitet sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional auf ihre bevorstehende Arbeit vor.
Meine Unterhaltung mit Bennett ließ mich auch über andere Kleidung nachdenken. Es heißt, wir sollen uns gemäß unserem Traumberuf kleiden. Lässt sich das nicht auch auf unsere Traumstimmung übertragen, auf die Stimmung, die wir uns wünschen? Als ich mich der Ästhetik der Freude zu widmen begann, probierte ich aus, in Situationen, die mir auf die Laune drückten, knallbunte Farben zu tragen. Ich legte mir grellgelbe Gummistiefel zu. Wenn dann ein Platzregen vorhergesagt wurde, zog ich sie vergnügt an, packte meinen (ebenfalls gelben) Regenschirm und stürzte aus der Tür, um auf dem Weg zur Arbeit darin herumzuplanschen. Als ich solo war und mich durch endlose Blind Dates quälte, begann ich, Kleider mit hellen Mustern zu kaufen, die mich mit der Energie für den bevorstehenden Small Talk versorgen sollten. Und neulich bekam ich ein limettengrünes Sportshirt geschenkt. Wenn mich diese Neonfarbe gleich nach dem Aufwachen anlacht, möchte ich sofort aufstehen und Yoga machen. Von nun an werde ich meine verschlissenen Sportklamotten durch kräftige Farben ersetzen, wenn es so weit ist.
Kleiden Sie sich entsprechend der Stimmung, die Sie sich wünschen.
Meine Freundin Beth, der größte Paradiesvogel, den ich kenne, hat nicht nur die Auswirkungen von Farbe auf sich selbst im Blick, sondern auch ihre Auswirkungen auf andere Menschen. Mit 1,78 Metern ist sie ziemlich groß gewachsen, außerdem ist sie unglaublich clever und nimmt kein Blatt vor den Mund. »Mein ganzes Leben lang«, sagt sie, »habe ich mir anhören müssen, dass ich einschüchternd oder sogar angsteinflößend wirke.« So begann sie, knallige Farben zu tragen, um weniger unnahbar zu wirken, um weniger schnell abgekanzelt zu werden. Beth besitzt keine dunklen Mäntel, nur welche in lebhaften Farben wie Gelb oder Grün. An trüben Wintertagen sieht sie Menschen an sich vorbeigehen und lächeln. Fast so, als ob ein buntes Kleidungsstück ein winzig kleines Geschenk, ein funkelndes Fleckchen Freude in einer trostlosen Landschaft wäre.
Als Beth und ich zusammenarbeiteten, organisierte einer unserer Kollegen einen »Dress Like Beth Day«. Die Leute kamen in rosa gepunkteten Hosen, gelben Pullovern und türkisen Kleidern zur Arbeit und ließen derart die Sonne aufgehen, dass wir beinahe Sonnenbrillen brauchten. Das war einer der schönsten Tage überhaupt. Alle kamen richtig in Schwung.
Die Wonnen des Lichts
Kann es Freude ohne Farbe geben? Ich war mir dessen nicht ganz sicher, bis ich auf eine von Dr. Oliver Sacks’ Geschichten stieß. Sie handelt von seiner Reise auf die Insel Pingelap im Jahr 1994, wo viele Bewohner an genetisch bedingter absoluter Farbenblindheit leiden. Mit von der Partie ist der norwegische Wissenschaftler Knut Nordby, der ebenfalls von Achromatopsie betroffen ist. Irgendwann landet die Reisegesellschaft in einem heftigen Gewitter, dem ein prächtiger Regenbogen folgt. Sacks beschreibt Nordbys Wahrnehmung des Regenbogens als »leuchtenden Bogen am Himmel«[25] und lässt uns daraufhin an weiteren freudigen Schilderungen von Nordby teilhaben: Doppelte Regenbogen hat er bereits gesehen und sogar einen vollständigen Regenbogenkreis. Letztlich kommt Sacks zu dem Ergebnis, dass die visuelle Welt der Farbenblinden »in mancherlei Hinsicht ärmer sein mag, ansonsten aber genauso reichhaltig wie die unsere ist«.
Ohne Farben mögen wir wohl Freude finden, ohne Licht hingegen wäre das sehr schwierig. Jeden Anblick, der uns mit Freude erfüllt, angefangen bei einem Sonnenaufgang bis hin zu einem Babygesicht, haben wir Licht zu verdanken, das von der Außenwelt reflektiert wird und auf unsere Augen trifft. Licht versorgt Farben mit Energie. Und mehr noch: Es ist Energie in Reinform und ruft an sich schon Freude in uns hervor. Wir lassen uns in unserem Tagesrhythmus vom Sonnenlicht leiten, dieser vierundzwanzigstündigen Uhr, die unseren Energiepegel lenkt.[26] Außerdem werden über das Sonnenlicht auf unserer Haut die Vitamin-D-Produktion des Körpers angekurbelt, unser Immunsystem gesteuert und der Serotoninspiegel beeinflusst, der sich wiederum auf unseren Gefühlshaushalt auswirkt. Viele Menschen in den höheren Breitengraden leiden an einem Mangel an Tageslicht und sind von saisonal abhängigen Depressionen betroffen (passenderweise mit »SAD« abgekürzt, was im Englischen ja »traurig« bedeutet). Licht und Laune befinden sich oftmals auf einer gemeinsamen Umlaufbahn: je dunkler das Licht, desto dunkler unsere Stimmung.
Ende der Leseprobe





























