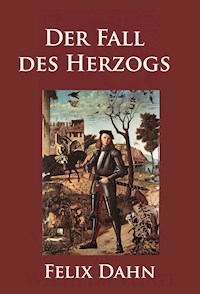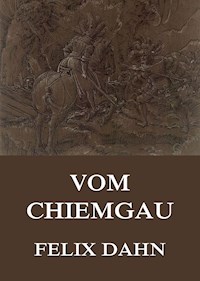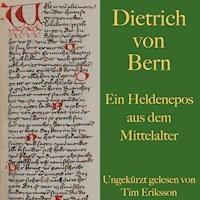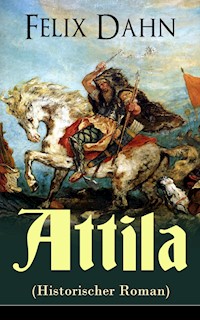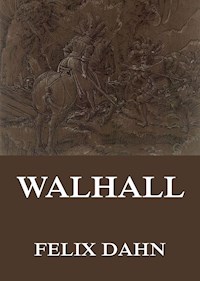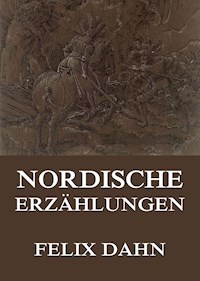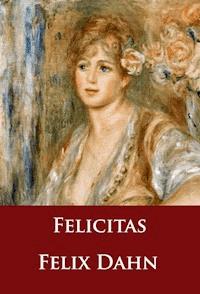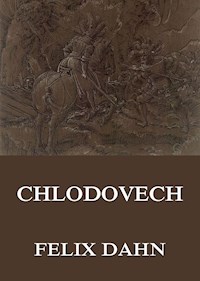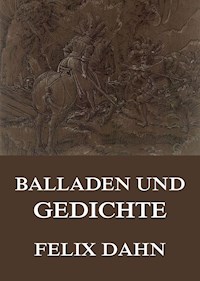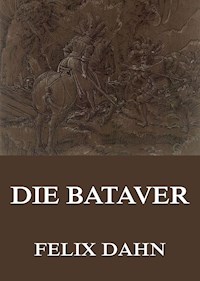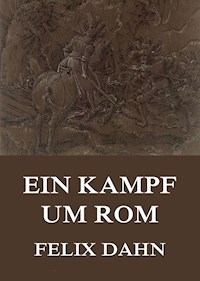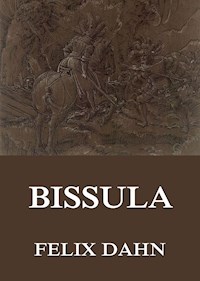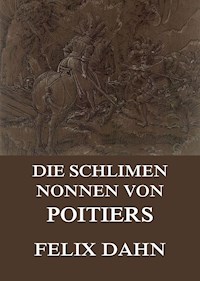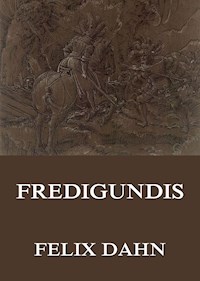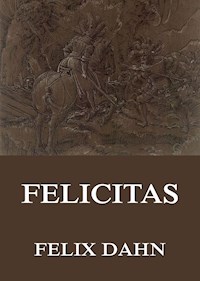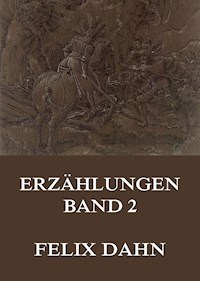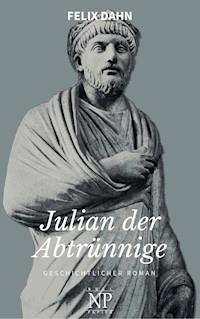
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung mit kommentierten Latein-Passagen Felix Dahns fesselnder, dreibändiger geschichtlicher Roman über den umstrittenen römischen Kaiser Julian, erstmalig vollständig, kommentiert und in Neuer Deutscher Rechtschreibung. Flavius Claudius Iulianus war von 360 bis 363 römischer Kaiser. In christlich geprägten Quellen wird er häufig als Julian der Abtrünnige bezeichnet, da er den christlichen Glauben aufgegeben hatte. Selten bezeichnet man ihn als Julian II. Sein Vetter ernannte Julian 355 zum Caesar und beauftragte ihn, Gallien gegen die Germanen zu verteidigen. Diese Aufgabe erfüllte er sehr erfolgreich. Julians kurze Regierungszeit als Alleinherrscher war innenpolitisch durch seinen vergeblichen Versuch geprägt, das durch Konstantin den Großen im Reich privilegierte Christentum zurückzudrängen. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 916
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Felix Dahn
Julian der Abtrünnige
Die Jugend – Der Cäsar – Der Imperator
Felix Dahn
Julian der Abtrünnige
Die Jugend – Der Cäsar – Der Imperator
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-47-4
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch – Die Jugend
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Zweites Buch – Der Cäsar
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Drittes Buch – Der Imperator
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Buch – Die Jugend
»Wenn es, wie die Gelehrten sagen, vier Tugenden gibt: Mäßigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, so hat Julianus sie alle geübt.« Ammianus Marcellinus (Augenzeuge), XXV. 4.
Erstes Kapitel
In den Vorgemächern des Kaiserpalastes zu Nikomedia in der Provinz Pontus in Kleinasien drängte sich in später Stunde einer Frühlingsnacht – es war der zweiundzwanzigste Mai des Jahres dreihundertsiebenunddreißig nach Christi Geburt – bei dem trüben Licht duftender Öllampen eine gespannte, teils bange, teils hoffnungsgierige Schar: Bischöfe, Feldherren, Staatsmänner, Höflinge.
Manchmal traten Ärzte, Freigelassene, Sklaven aus dem durch mehrfache Vorhänge abgetrennten Innenraum, hastigen Fragen selten Beachtung, seltener Antwort gebend, aus dem Palast eilend mit allerlei Aufträgen, unerhörte Arzneimittel zu holen, zu bereiten.
»Es geht rasch zu Ende«, flüsterte, nach der Ausgangstüre laufend, einer der Heilkünstler. »Nahm er die Taufe?« forschte ein Bischof. Aber jener war schon vor der Türe.
Gleich darauf aus dem Krankenzimmer schrilles Geschrei: aber nicht der Trauer, nicht Totenklage. »Tot ist der Imperator, der große Constantinus. Heil, Heil und Sieg dem neuen Imperator, Constantius, dem Herrn der Erde.« Bei dem Rufe warfen sich alle in dem Vorzimmer Versammelten nieder auf das Antlitz.
Alsbald erschien der Vorsteher des heiligen Schlafgemaches, der Präpositus sacri Cubiculi, und winkte mit erhobener Hand: »Hinweg!« Sie verschwanden in Eile.
Nach einiger Zeit trat aus dem Sterbegemach ein junger Mann in Purpurgewändern, aschfahl von Antlitz, von rastlos unstetem Blick der tief liegenden schwarzen Augen; er zitterte vor Aufregung; sein Schritt wankte, er stützte sich schwer auf einen langen goldenen Stab: es war der Stab der Weltbeherrschung; er hatte ihn eben aufgenommen. Das Haupt hing auf die Brust, die schmalen vorgebeugten Schultern schienen die Wucht der neuen Würde nicht tragen zu können; er sah starr vor sich nieder auf den Marmorestrich.
Ein Kriegstribun, in vollen Waffen gerüstet, war der erste, der ihm aus dem Innengemach folgte: er hielt eine Papyrusrolle in der Hand. Gleich hinter ihm wandelte der Bischof der Stadt bedachtsamen Schrittes in das Vorzimmer. »Bleibt es dabei, o Imperator?« fragte mit leisem Grauen der Gepanzerte.
Constantius sah nicht auf. »Hab ich’s zurückgenommen?« fragte er entgegen; scheinbar ruhig, aber seine Lippe zuckte. Er sah zweifelnd zu dem Präpositus hinüber, aber dieser hob warnend, fast drohend den Finger.
»Herr, die Liste ist lang!« sprach der Kriegsmann. »Deine drei Oheime? Also alle Brüder deines eben verewigten Vaters, darunter auch der Patricius Julius, dein eigner Schwiegervater, der Vater deiner verstorbenen Gemahlin? Und deine Vettern, alle sieben? Sind zehn! Alle deine Verwandten? Sonder Ausnahme? Sie sind …« – »Feinde des Imperators«, unterbrach dieser. »Und der heiligen Kirche«, fiel der Bischof vortretend ein. »Heimlich heidnisch oder, was noch schlimmer, ketzerisch gesonnen im Herzen. Hilf doch, Eusebius!« Da schritt der Präpositus in seinem goldstrotzenden Gewande dicht an den Tribun heran und herrschte ihm mit heiserer Stimme zu: »Kann ein Krieger nicht mehr gehorchen?« – »Auch die Frauen, die Mädchen?« – »Alle, die noch heiraten können«, nickte der Imperator. »Sie sind so gefährlich wie die Männer.« – »Oft rachsüchtiger und schlauer!« ergänzte Eusebius. Er war der oberste Eunuch des Palastes.
»Hier stehen aber auch drei Kinder! Auch die? Deine beiden jungen Neffen? Deine kleine Nichte?« – »Was fragst du?« knirschte der Augustus, mit dem Fuß aufstampfend. »Alle, die mir jetzt oder künftig schaden können. Soll ich die Rächer heranwachsen lassen?«
Gleich darauf krachten die Haustüren gar mancher Paläste zu Nikomedia von außen nach innen: Waffenklirren – roter Schein von Pechfackeln – Lärm – Widerspruch, hier und da Widerstand der Haussklaven – gleich darauf Wehgeschrei von Sterbenden.
In das Haus des Patricius Julius, des einen Bruders des eben Verstorbenen, drang ein Centurio mit einer Schar von blonden barbarischen Söldnern. Der Hausherr selbst trat ihnen im Atrium rasch mit teilnahmsvoller Sorge entgegen.
»Wie steht’s mit unserem Herrscher, meinem Bruder?« – »Das frag ihn selbst im Hades! Oder vielleicht im Himmel der Christen!« schrie der Centurio. »Mich sendet der neue Herr: dein Neffe Constantius, der schickt dir – durch mich – dies!« Er stieß ihn nieder; das kurze Römerschwert durchdrang die linken Rippen und fuhr im Rücken heraus. »Wo ist die Frau?« schrie der Wilde. »Wo das Mädchen?«
»Hier, Mörder!« rief eine ausnehmend schöne Frau von etwa vierzig Jahren, die ein kleines Mädchen an der Hand führte. »Lass uns mit ihm sterben!«
Der Legionär zückte das breite Schwert gegen sie; dabei sah er ihr in das Antlitz: so wunderbar schön waren diese Augen – er senkte erschüttert für eine kurze Weile die Waffe, die vom Blute des Mannes troff.
Der wand sich sterbend und stöhnte noch einmal. Da vergingen der Gattin die Sinne; bewusstlos sank sie auf ihr Antlitz über der Leiche zusammen. Laut weinte und schrie das geängstigte Kind.
Mit dem Fuß schob der Centurio die Ohnmächtige zur Seite und holte noch einmal aus, sie vom Rücken zu durchbohren.
Da stürzten aus einem der Schlafräume zur Rechten zwei seiner Söldner hastig zurück: »Mach, dass du fortkommst«, schrie der erste verstört, fasste ihn am Arm und drängte ihn gegen die Ausgangstür. »Seid ihr fertig?« fragte er. »Was ist euch? Wo sind die Köpfe? Zwei Knaben: Gallus heißt der eine, der andere …« – »Gallus liegt im Sterben«, antwortete der Söldner. »So sagte uns der Arzt, ein kleiner buckeliger …« – »An den schwarzen Blattern, bestätigte uns ein Mönch, der dabeistand«, ergänzte der zweite. »Den Blattern?« rief der Centurio. »Weh! Beim Styx! Die stecken an! Also der ältere – gefährlichere – stirbt. Und was ist’s mit dem jüngeren, he, Bero, Alemannenbär?« – »Der jüngere? Das ist ein Kind von kaum sechs Jahren. Ich morde keine Kinder«, zürnte der Riese und schüttelte die roten wirr-zottigen Locken. »Willst du, so tu’s selbst. Ich nicht! Geh hinein! Er liegt schluchzend über den sterbenden Bruder hingestreckt. Geh, schlachte du ihn ab!« – »Ich danke! Ich scheue jene schwarzen Beulen. Fort aus dem verpesteten Hause!« – »Alles, was schaden kann, sagte der Ober-Eunuch.« – »Kinder können doch nicht schaden. Auch nicht diese Kleine da! Weiter! Die Liste ist gar lang und kurz die Maiennacht. Und die Sonne darf keinen mehr am Leben finden, so hieß es. Fort! Hinaus!«
Zweites Kapitel
In Kilikien nahe bei Tarsus ragte in einer abgelegenen öden Vorstadt aus düsteren Zypressen ein düsteres Gebäude; wie eine Feste umschlossen es hohe Steinmauern.
Und es war auch eine Feste: eine Wehrburg der Kirche, eine Klosterschule, in welcher Knaben und Jünglinge, streng abgesperrt von dem Lärm und von den Verführungen des Lebens, für den Priesterberuf vorgebildet wurden. Nicht alle hatten freiwillig diese Laufbahn gewählt: es waren viele Waisen darunter, meist Söhne von »Hochverrätern«; oder doch von – Hingerichteten.
An das schweigende Haus mit seinen schmalen, lichtarmen Gängen und den schmucklosen, einfenstrigen Zellen der Zöglinge stieß ein nicht minder freudlos anmutender Garten: entlang den altersgrauen Mauern starrten die dunkelgrünen, finsteren Zypressen, und in jedem Eck der rechtwinkeligen Umwallung schüttelte eine einsame Pinie, verträumt und traurig, das schwermütige Haupt.
Der Rasen des Gartens war von der heißen Sonne braun gebrannt. In der Mitte lag der verwitterte Steinbrunnen fast ausgetrocknet: er sollte einen Springquell vorstellen; aber nur ein kläglich dünner Wasserstrahl hob sich mit schwacher Regung ein paar Fuß aus dem schwarzen Marmorgrund, um alsbald wie todesmatt und lebensmüde, wie verzweifelnd geräuschlos wieder herabzugleiten.
Es war Hochsommerzeit. Mitleidlos brannte die grelle Mittagssonne senkrecht nieder auf die blendend weißen Sandwege, die den viereckigen Raum, ein Kreuz bildend, schnitten. Kein Busch, keine Blume ward hier geduldet; sie hätte auch verschmachten müssen; daher flog hier auch nie ein Falter, kein Vogel sang; die Schwalbe hielt im Zwitschern ein, flog sie über den öden Raum dahin; rings alles still bis auf das einförmige Gezirp der Zikaden auf den in der Glut badenden waagrechten Ästen der Pinien.
Zwölf Jahre nach jener Mordnacht waren vergangen; da wandelten unermüdet, ununterbrochen, trotz der drückenden Hitze auf den schattenlosen Wegen, langsam, in immer gleichmäßigem Schritte dahin, ein Mann in reifen Jahren und ein halbwüchsiger Jüngling: beide barhäuptig, bararmig und barfuß, beide in lange weißgraue Kutten als einziges Gewand gekleidet; die waren von Ziegenfell, das Haar nach innen gekehrt; ein dreifach geknoteter derber Strick hielt das raue Kleid über den Hüften zusammen.
Der Jüngling bemerkte, wie der zu seiner Rechten Schreitende schwer unter der sengenden Hitze litt: Er atmete mit Anstrengung, er wischte wiederholt den Schweiß von der hohen, tief gefurchten Stirne. »Wie kann ich dir danken?« sprach der Jüngere, das dunkle seelenvolle Auge mit den lang schattenden schwarzen Wimpern zu jenem aufschlagend. »In Christo Geliebter, du mein Lehrer, mein einziger Freund auf Erden, du mein ein und alles! Mir legt der Abt die Buße auf, und du – du teilst sie freiwillig mit mir! Nur um sie …« – »Dir zu erleichtern, mein in Gott geliebter Sohn! Eintausend Vaterunser sind dir auferlegt, hintereinander in der Sonnenglut zu beten, dann mir zu beichten und die von mir über dich zu verhängende weitere Buße zu leisten. Ich begleite dich, bis du tausend Gebete zu Ende gesprochen: ich weiß, du wandelst leichter, schreite ich neben dir.« Dankbar drückte ihm der Jüngling die Hand. »Darf ich jetzt – nachdem ich die Strafe erlitten – fragen, weshalb ich bestraft ward? Vorher ist es ja verboten.« Der andere nickte, ließ das durchdringende, fast unheimlich scharf blickende Auge auf ihm ruhen und strich ihm über das glänzend schwarze, ganz kurz geschorene Haar. »Jetzt darfst du fragen. Du wurdest gestraft wegen geistlicher Hoffart, o mein Julianus.«
»Ich?« rief der Jüngling und blieb erschrocken stehen. »Oh, die Heiligen wissen, wie demütig ich bin im tiefsten Herzen, wie zerknirscht im Bewusstsein meines Unwertes, meiner Sündhaftigkeit. Was habe ich verbrochen?«
»Du hast, als du dich unbeachtet glaubtest in deiner Zelle, einen Stachelgürtel um die Lenden geschnürt.« Jähes Blut schoss in die wachsfahlen, eingesunkenen Wangen des jungen Büßers: die schmächtige, noch beinahe knabenhafte Gestalt bebte. »Wer hat …? Wie ist es möglich …? Ich war ganz allein.« – »So wähntest du. Aber Gott nicht nur – auch der Abt sieht dich, wo dich niemand sieht.« Da wechselte der Ausdruck auf dem schmalen, hageren Antlitz des Jünglings; zornig loderte nun sein dunkles Auge, die blauen Adern in den Schläfen schwollen an: »Lysias, das ist elende Auflauerei.«
Erschrocken sah sich Lysias um. Er legte warnend den Zeigefinger der Linken auf den Mund.
Da lag der Jüngling schon, wie vom Blitze niedergestreckt, vor ihm im Staub, umfasste seine Knie und flehte: »O vergib den Frevel: die Todsünde des Zornes.«
»Und die schlimmere des Zweifels, würde Abt Konon sagen«, sprach Lysias, ihn erhebend. »Kann Gott dem heiligen Abt nicht enthüllen, was du im Verborgenen treibst? Es ist aber Überhebung, ist geistlicher Hochmut, durch heimliche Kasteiung mehr Ruhm als die Brüder vor Gott gewinnen zu wollen. Nun zu deiner Beichte. Aber bevor wir damit beginnen«, hier verschärfte sich wieder wie drohend der spähende Blick, »ich muss bis in die tiefsten Wurzeln deiner Gedanken, bis in die feinsten Keime deiner Neigungen dringen und deine ganze Vergangenheit überschauen, um dich, den Gewordenen, zu begreifen: Erzähle mir also von Anfang, von deiner frühesten Kindheit an die Geschichte deines jungen Lebens. Nur stückhaft, getrübt durch der Menschen Hass oder Vorliebe, kam mir manche Kunde davon zu in – in der Einsamkeit dieses Klosters«, fügte er zögernd bei. »Gern, mein Vater. Aber du weilst noch nicht lang – nicht häufig im Kloster. Wo …?« Ein leichtes Gewölk zog über die tief gefurchte Stirn des Mannes. »Lass das! Einstweilen nur soviel: Ich reise oft nach Ägypten, meiner Heimat, zurück.«
»Wohl in das Mutterkloster unseres Klosters; wie fast aller andern, welches Pachomius der Fromme auf jener Insel des Nilstroms, Tabennae …?« – »Nicht doch! Frage nicht! Dann – zu rechter Zeit – wirst du viel mehr aus meinem Munde vernehmen, als du je ahnen könntest. Beginne. »Ich weiß also: Du bist der Sohn des Patricius Julius, der Neffe des großen Imperators Constantin, der Vetter unseres jetzigen Herrn, Constantius …« – »Dem Gott langes Leben und Sieg verleihe«, unterbrach der Jüngling, die mageren, schmalen Hände fromm zum Gebete faltend. Scharf prüfte dabei der Ältere den Ausdruck seiner Mienen: er fand – mit Überraschung –, die Worte der vorgeschriebenen Formel wurden nicht formelhaft oder erzwungen, vielmehr mit tiefer Empfindung, aufrichtig gesprochen. »Noch in der Stunde des Todes des großen Herrschers«, fuhr Lysias fort, »wurden alle seine Verwandten getötet, auf Befehl des neuen Herrn, Constantius.«
»Dem Gott langes Leben und Sieg verleihe!« wiederholte Julian; aber diesmal furchte sich ihm wider Willen die weiße Stirn.
»Ausgenommen nur seine beiden Brüder, Constans und Constantinus, mit denen er sich, nach des Vaters Gebot, in das Reich teilen musste. Zu ihrem Glücke weilten sie nicht in Nikomedia. Damals ward auch … hingerichtet dein Vater, obwohl er dem Constantius nicht nur Vatersbruder, auch noch sonst verbunden war. Nicht?« fragte er lauernd.
»Gewiss! Er war meines Vaters Eidam, er ist nicht nur mein Vetter, auch mein Schwager: er war mit meiner kurz vorher verstorbenen Schwester vermählt, unser Imperator Constantius, dem Gott …«, er brach kurz ab.
Lysias warf einen befriedigten Blick auf den innerlich Ergrimmten und fuhr fort: »Als nun das Ärgste geschehen war …«
»Als das Ärgste geschehen war«, unterbrach Julian mit einem wohlgefälligen Lächeln, »da geschah erst das Ärgste! Ist es eine Sünde, o Vater«, er errötete sehr anmutig, »dass ich mich stark erfreue an solchem dialektischen Spiel?« – »Am Wortwitz? Eine Eitelkeit ist es, eine Schwäche, nicht gerade eine Sünde. Du bist überhaupt recht witzig, aber noch viel mehr eitel als witzig, o Julianus.« – »O mein Lehrer!« – »Jawohl! Trotz aller Demut, zu der du dich – oft schwer! – zwingen musst. Du gehst vernachlässigt einher – aber wie Sokrates zu Antisthenes sprach: Durch die Löcher deines Mantels strahlt deine Eitelkeit hindurch.« – »Du hast recht«, flüsterte Julian und schlug die langen Wimpern nieder. »Ich will es abtun.« Er bückte sich, ihm die Hand zu küssen. Lysias entzog sie. »Du wirst das nicht können, mein lieber Sohn. Es ist deine eigenste Eigenart. Aber hüte dich: Man beherrscht die Menschen durch ihre Lieblingsschwäche; dich wird man durch deine Eitelkeit beherrschen.« – »Mich, den armen Mönch? Wer sollte das der Mühe wert finden?« Ein scharfer Blick schoss hier aus den leidenschaftlichen Augen des andern. »Wer? Nun, vielleicht ich, Julianus.« – »Du scherzest! Übrigens: Von dir will ich mich beherrschen lassen – immerdar!« – »Willst du?« fragte Lysias mit einem stechenden Blick. »Ich werde dich dieses Wortes dereinst gemahnen, Julian. Aber fahre fort. Was war noch ärger als dieses Ärgste? Als diese … Morde?«
»Der Gebrauch, der Missbrauch, den der Mörder von dem Erfolg machte, gegenüber den Seelen von uns drei Kindern, die er – noch! – verschonte, der Herzverhasste!« Feuer loderte aus den Blicken des Jünglings. »O vergib, mein Vater, aber ich kann ihn noch immer nicht recht lieben, den Augustus! Ich weiß ja: Liebet eure Feinde – vergebet euren Schuldigern. Und so weiter! Ach, was er mir getan – ich verzeih es ihm. Aber was er Gallus, was der heiß geliebten Mutter, der Schwester – ich kann es nicht verzeihen! Strafe mich, versage mir den Sündenerlass – denn das ist meine schlimmste Beichte! Aber ich kann nicht. Noch nicht!«
Und in überwältigender Qual des Gewissens warf er sich abermals seinem Beichtiger zu Füßen; in heißer Angst, flehentlich sah er zu ihm empor.
Da zuckte der die Achseln, sah sich vorsichtig um und sprach dann ganz ruhig: »Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Ich tät’s auch nicht, ’s ist wider die Natur. Steh auf.«
In äußerster Überraschung, ja Bestürzung sprang der Jüngling auf die Füße und starrte ihn an. »Was – was ist das? Das war kein christlich Wort.« – »Aber ein wahres. Still! Kein Aufsehen! Die Späher! Sie lauern da oben hinter den Fenstervorhängen auf uns herab. Erzähle weiter.« Doch Julian konnte sich noch immer nicht erholen von seinem Staunen. »Wahrheit außer der Kirche? Gegen die Kirche? Das gibt es nicht!« flüsterte er entsetzt vor sich hin. »Und du, du – bist ein Priester des Herrn?« – »Ein Priester bin ich. Ein Priester großer Herren – und meines Herrn. Gedulde dich noch! Sprich weiter. Ich befehle es.« Mit Anstrengung fasste, sammelte sich Julian: Er konnte das suchende Auge nicht lösen von dem Antlitz des widerspruchsvollen, rätselhaften Mannes.
»Wir waren, sobald die Krieger hinweggestürmt, von unserem Arzt und einem Mönch, einem Freund unseres Hauses, der in der Mordnacht den todkranken Bruder pflegen half, aus den blutbespritzten Gemächern in das Asyl einer Kirche geflüchtet. Von dort aus ließ der Imperator nach mehreren Tagen uns drei Geschwister in den Palast holen. Mit Gewalt riss uns der Kriegstribun der Prätorianer aus den Armen unserer Beschützer. Zum Tode, meinten die beiden, würden auch wir nun geschleppt. Mir war’s gleichgültig, ich weiß nicht, warum. Obwohl ein Kind, war ich wie lebensmüde: Ich beruhigte die Schwester Juliana, die sich ängstlich an mich klammerte, küsste sie auf die Augen – wir haben uns immer so lieb gehabt! – und sprach: ›Weine nicht, liebes Schwesterlein, wir sind Waisen; wir haben auf Erden keinen Freund. Denn auch die Mutter ist wohl ermordet.‹ Der gute Mönch sagte, sie ist aus dem Hause des Arztes, der die Bewusstlose gerettet hatte, von Kriegern mit Gewalt fortgeführt worden. Waisen aber sind am besten geborgen – im Grabe der Eltern. Denn dann sind sie nicht Waisen mehr.«
»Ein sechsjähriger Knabe«, staunte Lysias. »Widernatürlich frühreif.«
»Aber Gallus, mein Bruder, sieben Jahre älter als ich, inzwischen genesen, tobte gegen den Tribun. Er schlug nach ihm, er wollte ihm das Schwert aus der Scheide reißen; mit Gewalt musste der Mann den Zappelnden auf den gepanzerten Arm nehmen. In dem Vorhof der Basilika wurden wir in zwei Sänften gehoben – ich mit Juliana –, den schreienden Gallus nahm der Tribun in die andere. Die Läden der Sänften wurden sorgfältig geschlossen; das Volk auf den Straßen sollte nicht erfahren, wer da in das Palatium – zum Tode? – gebracht werde, auf dass es nicht versuche, uns zu befreien! Sechzig Prätorianer waren aufgeboten, drei Kinder vom Entspringen abzuhalten: Waffenklirrend umdrängten sie die Sänften, die Neugierigen, die herzuliefen, den Aufzug zu sehen, mit gefällten Speeren abwehrend.
In dem Palast angelangt, wurden wir vor den Imperator geführt. In dem von Gold und Elfenbein leuchtenden Saale saß er, umgeben von den Großen und von den Eunuchen des Hofes, auf dem hohen Thron: blutrot der Thron, blutrot sein Mantel. Ich sah sein Antlitz zum ersten Mal: das leichenfahle, hagere – stets von heftigem Zucken bewegt – den unsteten Blick …«
»Genug! Ich kenne ihn.«
»Mir schauderte: all das Blutrot mahnte mich des Blutes der Meinen – die ja auch die Seinen gewesen! –, das er in Strömen vergossen. ›Schuldlos Blut färbt wohl besonders stark?‹ Das musste ich immer denken. Auf einen Wink des Obereunuchen sollten wir vor dem Augustus auf die Knie niederfallen. Juliana gehorchte, auch ich, da ich mich nicht berühren lassen wollte, wie Gallus geschah, den sie an den Schultern niederdrückten. Nun ward uns verlesen – uns drei Kindern, o mein Vater! – unser Todesurteil. Mit Berufung auf Gottes Ausspruch, dass er die Schuld der Eltern rächt bis ins vierte Glied. Unsere Eltern seien wegen erheblichen Verdachtes des Hochverrats hingerichtet, wir hätten vermöge der vorbeugenden Gerechtigkeit das gleiche verdient, des Vaters und der Mutter Vermögen sei dem Fiskus verfallen und bereits eingezogen. Wir wurden nun gefragt, ob wir alles verständen? Die Schwester und ich, wir nickten stumm. Gallus aber ballte die Faust wider den Imperator und schrie zum Thron hinauf: ›Ja, ich versteh’s! Blutiger Herodes! Kindermörder!‹
Der Augustus ward noch bleicher als er war – bleicher als bleich. – Klingt das nicht zierlich?«
»Schon wieder ein Wortspiel, o Julianus, du, eitler als eitel!«
»Aber Eusebius, der Präpositus und Obereunuch, fuhr fort; Constantius hatte kein Wort gesprochen, nur scheuen Auges von mir auf Gallus, von Gallus auf mich geblickt. ›Dem Tode seid ihr verfallen. Über euerm Nacken schwebt das Schwert des gefällten Urteils.‹ (Ein schiefes Bild, nicht? Ich musste das damals schon denken.) ›Allein die Gnade des Imperators lässt es – noch! – unvollstreckt. Lebt, lebt weiter unter dem hangenden Schwert. Aber seid stets dessen gedenk: jeden Augenblick – ein Zucken der imperatorischen Wimper, und es fällt auf euere Nacken.‹
Gallus wollte erwidern; er machte drohend einen Schritt gegen den Thron hin; da winkte der erschrockene Imperator hastig mit dem Zipfel seines Purpurmantels. ›Hinaus! Hinaus!‹ stieß er hervor mit hohler Stimme – es war sein erstes Wort –, und hurtig schoben und drängten die Prätorianer uns an den Schultern aus dem Saal.
Draußen wurden wir sofort getrennt – umsonst barg ich die laut weinende Schwester an meiner Brust: sie rissen sie aus meinen Armen! Ich sah sie, sah Gallus niemals wieder. Ich ward in geschlossener Sänfte aus der Stadt geführt, ans Meer, eingeschifft und zuerst nach Ionien, alsbald aber hierher nach Kilikien gebracht. Dort, an der Schwelle der Mauerpforte, empfing mich der heilige Abt und verkündete mir, der Imperator habe mir das Leben geschenkt nur unter der Bedingung, dass ich mich nie vermähle und dass ich ein Priester des Herrn werde. Mir war alles gleich, auch Tod oder Leben. Diese hohen, finstern Mauern schienen mir Grabesmauern. Sind wir doch hier auch so gut wie begraben! Keine Kunde von der Außenwelt dringt in diese Stelle. Weiß ich doch nicht einmal, ob meine Mutter, meine Geschwister noch am Leben sind. Der heilige Abt verbot zu fragen.
Nur durch deine Güte erfuhr ich ja auch von dem Wichtigsten, was in diesem Reiche der Römer geschehen ist in all diesen zwölf Jahren. In unserem Haus, dem der Constantier, lebt, scheint es, die Wolfsart von Romulus und Remus fort. Die drei Brüder, die Söhne und Erben des großen Constantin, Constantius, Constans und Constantin, die sich in das Reich geteilt, gerieten in Streit um die Beute, das heißt um das Erbe der in jener Mainacht Gemordeten: Constantin fiel, sinnlos vor Gier, nach Räuberart in das Gebiet des Constans ein und ward erschlagen wie ein Wolf im Walde. Zehn Jahre darauf trieb Constans durch seine Ungerechtigkeit einen tapferen Feldherrn, Magnentius, zur Verzweiflung, zur Empörung und fiel auf der Flucht. Schwer, furchtbar, blutig hatten des letzten übrigen der drei Brüder, hatten des Constantius Heerführer zu ringen, bis sie Magnentius niedergekämpft hatten. So herrscht jetzt Constantius allein über den Weltkreis: von den fernsten Atropaten östlich vom Tigris im fabelhaften Morgenland bis zu den Britannen, die in den Nebeln des Weltmeers verschwinden, und vom Mittellauf des Nils bis zu dem grausigen Rheinstrom, der manchmal, sagt man, zu festem Eis gefrieren soll: Weh, wer das schauen müsste. Aber welche Fülle der Macht! Fast zu gewaltig für einen Sterblichen. Kann Constantius …?«
Er schwieg, in Sinnen versunken.
Lysias blieb stehen: »Hättest du Lust, ihm einen Teil dieser Bürde abzunehmen?« Scharf, durchdringend prüfte er bei der Frage die Mienen des jungen Mönches. Dieser aber lächelte schwermütig: »Ich? Wie du spottest! Doch freilich: Wäre ich nicht zum Dienste des Herrn bestimmt, weißt du, was ich am liebsten werden möchte? Ein großer Feldherr. Im Dienste des Römerreichs Perser und Germanen und alle Barbaren hinwegscheuchen von den Grenzen in sieghafter Schlacht …« – »Nun sprüht dein dunkles, sonst so träumerisches Auge Blitze! So gefällst du mir, o Julianus. Aber erzähle weiter. Wie erging es dir nun hier? Trotztest du nicht dem schimpflichen Zwange?« – »O nein! Willenlos ließ ich alles mit mir geschehen. Doch geschah mir nichts Schlimmes – nichts Schlimmeres als den anderen Knaben: lernen, beten, büßen, büßen, beten, lernen – so verstrichen mir die Jahre hier. So werden sie wohl verstreichen, bis ich sterbe – hoffentlich bald. Lernen, büßen, beten!« Erschöpft hielt der kleine Schmalbrüstige inne.
»Ja«, murmelte der andere vor sich hin. »Und was beten? Was büßen? Was lernen?« – »Wie meinst du, heiliger Vater?« – »Nenne mich nicht heilig. Nicht Menschen sind heilig, nur die …« – »Du sagtest: ›Was lernen!‹ Ja freilich! Es genügt mir wenig! Auf die Zweifel, die Fragen, die mich zu eifrigst umtreiben, Tag und Nacht, erhalte ich Antwort weder von den Büchern, die wir auswendig lernen, inwendig wäre besser, nicht?« lächelte er, erfreut über die Wortwendung, »noch mündlich von den Vätern. Eingebungen der Dämonen nennen sie meine quälendsten Fragen und verordnen mir dafür Bußen. Ich frage gar nicht mehr! Und ich möchte doch so gern! Brennend verlangt mich zum Beispiel zu wissen – mehr zu wissen als die heiligen Bücher sagen! – vom Werden und Wesen der Welt, des Lichtes, der Sonne da oben und der Sterne! Oh, wer mir davon Kunde gäbe! Wo finde ich sie?« – »Hier«, sagte Lysias, und nach einem vorsichtigen Blick nach den Fenstern des Klosters, griff er in seine Kutte und zog zwei starke Papyrusrollen hervor. »Und hier. Rasch! Unter dein Gewand damit.«
Aber Julian zögerte. Erstaunt blickte er auf die Überschriften. »Platons Timäos! Und Plotin! Sie sind streng verboten. Bei Geißelung!« – »Fürchtest du dich, Julian? So gib sie zurück.« – »Nur mit meinem Leben! O Dank! Dank!« Und er wollte sich wieder in den Staub vor ihn werfen. Lysias hielt ihn ab. »Nicht doch! Man kniet nur vor jenen, die dem All das Licht gesandt haben und dir – mich.« – »Und meine Beichte? Und die Vergebung meiner Sünden?« – »Du trachtest nach dem Licht: der Gott des Lichts, der oberste von allen, vergibt dir – durch mich – alle Sünde. Denn nur eins ist Sünde: nicht nach dem Lichte, nicht nach den … guten Gewalten trachten. Du bist nun reif, soviel zu hören. Bald mehr! Genug für heute! Es grüßt dich, Julianus – durch mich – der göttlichste Gott.« Er strich ihm mit der Rechten über Stirn und Augen.
Und raschen Schrittes eilte er hinweg; verzückt schaute ihm der Jüngling nach.
Drittes Kapitel
Tag für Tag wandelte nun der junge Mönch stundenlang allein mit Lysias, dem er von dem Abt besonders zur Ausbildung überwiesen war, in dem stillen Klostergarten, stundenlang vertieft in ernste Gespräche.
Julian ermüdete niemals zu fragen. Sein leuchtendes, schwärmerisches Auge hing ganz an den Lippen des Lehrers, und dieser ermüdete nicht, zu antworten. Freilich, seine Antworten genügten oft wenig dem scharfen, an Dialektik sich freuenden Geiste des Schülers. Es schien, als ob der so weit überlegene, reife Mann gar oft den Frager nur in den Vorhof der Weisheit dringen lasse, die letzten Aufschlüsse noch zurückhalte. Dadurch geriet der Jüngling in einen Zustand rastlosen, nagenden, bohrenden Zweifels. Immer leidenschaftlicher ward sein Drang nach Erkenntnis entfacht; hätte Lysias es auf solche Steigerung angelegt, und zugleich darauf, den Grübler immer fester an den kargen Belehrer zu knüpfen, er hätte es nicht schlauer angehen können.
Als Julian nach einigen Tagen ihm verstohlen die Schriften Platons und Plotins zurückgab, glühten die bleichen Wangen, seine magere Hand zitterte. »Dank! Heißen Dank! Aber mehr. Mehr! Alles!« flüsterte er. – »Du fieberst, mein Sohn!« sprach Lysias, die Rollen sorgfältig unter seinem Gewande verbergend. »Dein Auge glänzt, deine Schläfen brennen, doch deine Finger sind eiskalt. Wie hast du geschlafen?«
»Gar nicht. All diese Nächte nicht! Immer, immer las ich’s noch mal. Ich weiß nun gar viel davon auswendig. Wie viel leichter, gieriger erfasst mein Geist diese Wunder, diese Offenbarungen als die Offenbarung des heiligen Apostels Johannes. Wie wüst ist diese, wie …! Aber sprich endlich, Meister! Gar vieles in diesen Lehren – und oft gerade, was mich am glühendsten begeistert – widerstreitet der Lehre der Kirche. Ach ich flehe dich an – ich ringe so hart! Was – was ist Wahrheit?« – »So fragten auch andere schon.« – »Ja, Pontius Pilatus, der Mörder des Herrn!« rief Julian mit Grauen. »Aber doch …! Weiche mir nicht länger aus. Ich verzweifle in diesem Hin- und Herschwanken zwischen den Lehren der Kirche und den Gedanken im Timäos oder den Geheimnissen Plotins. Aber ach! Ich weiß ja gar nicht, wohin! Ich wage mich nicht weiter hinaus auf das offene Meer der Gedanken! Ich kann, ich will nicht den Anker lichten, den ich ein Jahrzehnt lang so tief in den Felsgrund der heiligen Kirche versenkt. Nur die Kirche hat die Wahrheit und das Heil. Ich kann nicht, ich werde niemals von ihr lassen.« Er seufzte. Er stöhnte. Er sah schwärmerisch gen Himmel.
Lysias ließ lange den bohrenden Blick auf ihm ruhen.
»So? Nun, es begreift sich. Die Zucht war lang, scharf und unausgesetzt. Die werdende Seele des Kindes schon ward planmäßig umsponnen. Es ist vielleicht besser so! Vielleicht irrte ich, denn die Sterne irren nicht! Ich war zu rasch! O mein Sohn, die Weltanschauung des Menschen ist gar nicht bloß das Ergebnis seiner Gedanken, noch mehr der Erleuchtung durch die Himmlischen und durch die eignen Erlebnisse. Und du – du hast noch nichts erlebt.« – »Ich dächte doch!« erwiderte erschaudernd der Jüngling. »Allerdings, deines Hauses Ausmordung, das Todesurteil über drei Kinder, verhängt durch den frommen Imperator. Es ist ziemlich viel. Aber doch, scheint es, noch nicht genug! Wie lehrt die Kirche? ›An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.‹ Constantius ist nun zwar schon eine Giftfrucht sondergleichen …« – »Aber er ist nur Laie«, warf Julianus ein.
»Wohl! Du sollst die Früchte an den Priestern kennenlernen. Erleben sollst du nun die Erkenntnis, dann erst wieder weiter forschen, denken, Schlüsse ziehen.« – »Aber, du selbst«, rief Julian gequält, »du bist ja auch ein Priester der Kirche …?« – »Ein Priester bin ich, ich sagte es schon. Jedoch es gibt der Götter viele – wenigstens«, verbesserte er rasch, »nach dem Glauben der Menschen! Und es gibt Grade der Erkenntnis viele – wie der Weihen.«
»O Lysias! Glaubst du, dass es irgendeine Weisheit gibt, welche …? Ich rede nicht von der Erkenntnis der Welt; diese genügt mir nicht, wie sie die Väter lehren! Ich kann nicht an den verhängnisreichen Apfelbiss im Paradiese glauben. Äpfel sind, so scheint’s, ein Obst des Unheils (ist das nicht ein hübscher Witz?). Denk an die Troer und Achäer, an Eris und Paris. Aber gibt es irgendeine Lehre, die mehr die Tugend ihrer Bekenner fördert als die Selbstverleugnungslehre unserer heiligen Kirche? Sie entzückt mich, diese begeisternde Pflichtenlehre, diese Abtötung des Fleisches, wie sie Abt Konon übt, und diese Demut, dieser Verzicht auf alle Macht und Herrschaft selbst der höchsten Bischöfe. Nie will ich anders von den Pflichten denken als die Kirche lehrt: die Flucht aus der Welt, die Verachtung der Welt, die demütige Selbstverleugnung.«
»Das also sind sie, die beiden ›Früchte‹, die dir den größten Wert zu haben scheinen? Die Hauptbeweise für die Göttlichkeit der Kirchenlehre: die Fleischabtötung und die herrschaftsverachtende Demut?«
»Gewiss, mein Meister! Die Selbstverleugnung! Die Vernichtung der fleischlichen Begier und die Vernichtung der Herrschgier. O wie hat jüngst der Abt Konon den jungen Theodoretos, den schönen kraftstrotzenden Griechen, geißeln lassen, weil der den Kopf umwandte, um dem üppigen vollbrüstigen Fischermädchen nachzugucken, wie es am Fasttag die Fische aus der Stadt dem Kloster gebracht hatte! Er selbst, der hohe Abt, schwang die Geißel, dass das Blut des nackten Knaben in Strömen auf den Estrich schoss. Welch heiliger Eifer! Als war es ihm Wollust, so glühte er. Und wie kasteiet er sich selbst! Nie einen Tropfen Wein bringt er über die heiligen Lippen. Und dann: welche Demut sogar der höchsten Priester! Hast du vergessen, was neulich aus dem Briefe des Papstes Liberius verlesen ward? Wie der, dem schon nahezu alle Bischöfe eine Art von Ehrenvorrang einräumen, als dem Nachfolger Sankt Peters selbst, wie sich der Papst vor dem Imperator Constantius auf das Antlitz warf, am Eingang der Peterskirche, wie er sich ›den Knecht der Knechte Gottes‹ nannte, ›des Imperators niedrigsten Sklaven‹, wie dem Imperator allein alles Erdreich und auch die Kirche zu gehorchen habe? Und doch weiß ja der heilige Vater, dass er von Sankt Petrus den Schlüssel des Himmelreichs überkommen hat, zu binden und zu lösen für die Erde und für den Himmel. Wahrlich, eine Lehre, die solche Tugenden erzieht, ist göttlich! Was wollen dagegen Platon und Plotin! Haben sie die Heiden vor der Sünde bewahrt?«
»Gut, mein Sohn, an ihren Früchten, das heißt an ihren Priestern sollst du die Kirche erkennen. Und zwar nicht nur vom Hörensagen und nicht aus Briefen. Es wird allmählich Zeit, dass du den Blick aus diesen Klostermauern hinaus in die Welt schweifen lässt; in die Welt, wie sie ist, nicht wie sie dir geschildert wird. Noch die Pfingsttage sollst du hier erleben. Dann werde ich den hochehrwürdigen Abt bitten, dass er dich mir als Begleiter mitgibt auf eine Amtsreise. Freue dich, Julian! Du sollst die Welt sehen. Du sollst Gut und Bös unterscheiden lernen.«
Julian erschrak heftig. »O Meister! So sprach die Schlange.«
»Gewiss! Hat sie gelogen? Nur wer das Böse kennengelernt hat, kennt auch das Gute.«
Viertes Kapitel
Das Pfingstfest war gekommen. Schon den Tag vorher hatte die Einleitung der frommen Feier begonnen: strengeres Fasten, häufigerer Gottesdienst, zahlreichere gemeinschaftliche Gebete und Gesänge. Geistliche und Mönche waren, oft aus weiter Ferne, herzugewandert, das hohe Fest in dem seiner Heiligkeit, seiner strengen Zucht wegen berühmten Kloster zu begehen. Es hieß »Hagion«, »Heiligtum«.
Julian traf in diesen Tagen die Reihenpflicht als Pförtner. Unermüdlich und ohne Klage saß er, wie die schlummerlose Nacht hindurch, so unter dem heißen Sonnenbrand des Mittags vor der Klosterpforte und waltete seines Amtes.
Da wankte auf der staubigen Straße vom Norden, vom Taurusgebirge her, in welchem die nackten Wände steil in die Luft ragten, an seinem Stab abermals ein Pilger in brauner Mönchskutte heran. Obzwar noch rüstig an Jahren, war er gebeugt in der Haltung: die Glut des Tages, die Mühe der Wanderung schienen schwer auf ihm zu lasten; gleichwohl ging er zu Fuß neben seinem Maultier her; er bückte sich oft, von dem Rand des Grabens die kargen Halme zu pflücken und sie dem Tiere darzureichen, das dann dankbar zu ihm aufblickte. Als er in Sehnähe kam, hielt der junge Pförtner die Hand vor die Augen, die blendenden Sonnenstrahlen auszuschließen. Nun erkannte er offenbar den Wanderer. Hurtig lief er ihm entgegen. Sobald er ihn erreicht hatte, wollte er sich ihm zu Füßen werfen, aber der Ankömmling hielt ihn ab und zog ihn an die Brust.
»O Johannes, mein Vater, mein frommer Lehrer!« rief der Jüngling innig und bedeckte die hageren sonnengebräunten Hände des Pilgers mit Küssen. »Wie wohl tut es mir in der Seele, dich wiederzusehen! Allzu lang bist du mir fern gewesen.«
Der Pilger ließ die sanften blauen Augen lang auf den bleichen erregten Zügen des Mönches ruhen: »Ja, mein Julianus, ich glaube, es ist gut, dass wir wieder einmal Blicke und Worte tauschen. Ich hatte starke Sehnsucht nach dir. Und schwere Träume ängstigten mich um dich. Ich sah dich Arglosen umringelt von einer giftigen Schlange, die ihre Kreise näher und näher um dich zog. Die Sorge um deine Seele trieb mich her. Ich finde dich verändert, sehr. Gar wenig jugendlich siehst du aus! Eingefallen die Wangen, bleich, nur in der Mitte ein roter brennender Fleck, schwarze Schatten um die Augen: allzu hell glänzen die aus tiefen Höhlen heraus. Und warum – ich sah es wohl! – saßest du mitten im Sonnenbrand statt in dem Schatten des vorspringenden Eckturms?«
Der Pförtner schlug die Augen nieder. Gluten schossen plötzlich in die wachsfahlen Wangen. Der schmächtige Körper, der das Mittelmaß nicht erreichte, zitterte. Er wankte. Der andere hielt ihn aufrecht an den Schultern.
»Ich ahne! Du wolltest dich wieder einmal über das Gebot der Klosterzucht hinaus kasteien! Maßlose Abtötung, nein: Peinigung des Fleisches! Selbst auferlegte Buße!« Julian barg das Angesicht an seinem Halse und weinte, weinte bitterlich. »Mein armer Sohn! Mein Liebling! Fasse dich! Was quält dich so?« – »O lass mich weinen! Weinen an deiner treuen Brust. Ah, das tut wohl wie Gewitterregen nach verzehrendem Sonnenbrand. Oh, lass mich dir beichten.« – »Nicht mir, mein Julian! Wer ist dein vom Abte verordneter Beichtiger?« – »Lysias.«
Da erschrak der Alte und fuhr zusammen.
»Aber er erlässt mir alle Sünden, die ich beichte, ohne jede Buße. Er lächelt über das, was ich Sünde nenne. Auch über …« Er verstummte.
Der Pilger strich ihm über die Stirne: »Auch wohl über den Zweifel«, ergänzte er, »der dir immer wieder auftaucht? Mein armes Kind! Du musst nicht zweifeln, darfst nicht grübeln. Glauben musst du, oder elend sein.« – »Woher weißt du …?« – »Ich liebe dich, darum kenn ich dich. Auch ich war einmal jung, war voll Fleischeslust, aber auch voll Lernbegier, war voll Hoffart weltlichen Wissens gegenüber den Lehren des Herrn, die freilich wider die Vernunft gehen, weil über die Vernunft. Darum eben müssen wir glauben. Verzage nicht, verzweifle nicht, weil du noch zweifelst, mein Sohn. Du wirst überwinden. Glaube mir, nicht durch die Bücher, nicht durch die Lehre, durch das Leben allein wirst du unlösbar mit Christus verknüpft. Man kann seinen Erlöser nicht ergrübeln, erleben muss man ihn und seine Wahrheit! Vor jenem aber, dessen Namen du vorher genannt hast, vor jenem lass dich warnen. Er ist –«
Da traf von hinten her ein heftiger Faustschlag den Kopf des Pilgers, dass dessen Reisehut zur Erde flog. Lysias stand zornglühend zwischen den beiden. Sowie Julian ihn erkannte, senkte er den Arm, den er rasch zum vergeltenden Streich erhoben hatte. »Er ist dein geistlicher Oberer, du schweifender Mönch, wie dieses Knaben, des pflichtvergessenen Pförtners, der, dem kindischen Herzen folgend, dir entgegenlief, seinen Posten verlassend. Dort stehen, von den andern Straßen her angelangt, viele Waller vor der heiligen Stätte – und der Pförtner …?«
Schon war Julian zurückgeeilt und bat die dort Harrenden um Verzeihung.
Einstweilen hob Lysias drohend den Zeigefinger gegen den Ankömmling, und grimmig, bösartig, blitzte sein Auge wider ihn, als er rief: »Wag es, mit mir um diese Seele zu ringen! Wag es, nur noch einmal mit ihm allein zu flüstern, und er soll dich kennenlernen, du Mörder.«
»Wo ist Johannes?« fragte Julian, sobald er die angelangten Gäste über den Hof an die innere Türe geleitet und nun die Außenpforte wieder erreicht hatte.
»Umgekehrt.« – »Ach! Warum?« klagte der Jüngling. – »Weil ich es befahl. Er ist Subdiakon. Ich bin Presbyter.« – »Und warum schlugst du ihn? Und wann werd ich ihn wiedersehen?« – »Niemals. So hoff ich.« – »Aber warum?« – »Du wagst zu fragen? Weil ich’s nicht will. Das genüge dir, Knabe. Aber da ich so töricht bin, dich zu lieben, dich unaussprechlich zu lieben, – will ich deine kecke Frage beantworten: weil er Gift ist für deine Seele. Und weil er dich befleckt mit Blick und Wort. Die Schuld Kains belastet seine Seele. Und er – Er! – will dich vor mir warnen. Der Einfältige! Hat Er Antwort auf die brennenden Fragen, Erfüllung für den Wissensdrang deines Geistes? Was riet er dir?« – »Glauben.« – »Dumpfes Hinnehmen! Der Narr! Der Schwärmer, dem das nagende Gewissen die Klarheit des Gedankens zerrüttet hat. Du zweifelst? Ich sage dir: Er ist ein Mörder. Ihm könntest du folgen? Zurück in die Nacht des blöden blinden Glaubens, in die Knechtung des Verstandes, statt mir, in die Freiheit des Gedankens und in das Licht? Nein, du kannst nicht anders! Mir musst du folgen. Warte nur noch bis dies Fest zu Ende. Die Ausgießung des Geistes, des heiligen! Jawohl! Auch auf dich soll er ausgegossen werden, der Geist meines Gottes – des Lichtgottes! – und erkennen wirst du bald an seinen Wirkungen den Geist jenes Gottes, dem Johannes dient.«
Fünftes Kapitel
Endlich war der Abend auch des zweiten Pfingstfeiertages vorüber.
Mit Bewunderung hatte Julian zu dem Abte Konon emporgeblickt, der, ohne einen Bissen, ohne einen Tropfen Wein zu genießen, in allen diesen Tagen unermüdet der schweren Pflichten seines Amtes gewaltet hatte in Messe lesen, Predigten halten, Beichte hören, Psallieren, Umzüge führen, Pilger empfangen, ihre Wünsche und Fragen anhören, erledigen und beantworten. Und wann nun die andern Geistlichen, ermüdet, das Lager suchten, dann brannte noch die einsame Ampel hoch in dem turmähnlichen Söller des obersten Stockwerks, wo der Abt dem Gebet, der Buße, der Forschung oblag. Und wann, lange nach Mitternacht, Julian wieder erwachte, noch immer glühte da oben die Ampel, eine stille Bezeugerin des Fleißes, der Frömmigkeit, der Kasteiung.
Bald nach Mitternacht des Pfingstmontages ward Julian geweckt durch einen Luftzug, der über sein Strohlager auf dem Mosaikestrich hinstrich. Die schmale Tür seiner schmalen Zelle war halb geöffnet. In dem bleichen Licht des Mondes, das durch die ein Fenster ersetzende Luke – hoch oben in der Mauer – hereinfiel, sah er eine dunkle Gestalt regungslos auf der Schwelle stehen. Der junge Mönch erschrak bis ins tiefste Herz hinein. Unter nagenden Zweifeln, unter bohrenden Gewissensqualen war er endlich gegen Mitternacht eingeschlafen.
»Hebe dich von hinnen«, flüsterte er jetzt, und kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, »im Namen des dreieinigen Gottes – weiche, Versucher, wie immer du heißest: Satanas oder Lucifer oder …«
»Lysias«, tönte es da ebenso leise von der Tür her. »Steh auf und folge mir. Aber still!« Schon stand Julian hinter ihm auf der Schwelle. Nun schritt er barfuß über die kalten Marmorplatten des langen Klosterganges. Den Jüngling fror.
Geräuschlos schloss Lysias die schwere Eisentüre des Ganges auf. Sie waren im Garten. Der Führer eilte auf dessen Gittertor zu. »Das Kloster verlassen? Zur Nacht?« stammelte Julian. »Wohin?« – »Zum Abt!« und Lysias schob den Riegel zurück.
»Der Abt? Da – hinter uns – hoch oben leuchtet seine Lampe, einem schönen Sterne gleich. Seine Zelle ist …« – »Leer. Folge!« Nun ging es rasch hinein in das Olivenwäldchen, das sich vom Kloster gegen die Vorhügel des Gebirges hinzog. Alles still und einsam. Der Mond ward hin und wieder von ziehenden Wolken verdeckt.
Plötzlich schreckte der Jüngling zusammen, ein verhaltener Schrei entfuhr ihm. Er griff mit beiden Händen nach dem Kopf. »Was war das? Was huschte über mein Haar? Ein Dämon!« – »Nein. Eine Eule. Der Vogel Athenas … will sagen«, verbesserte er rasch, »der Weisheit. Ein gutes Wahrzeichen! Du bist auf dem Wege zur Erkenntnis. Vorwärts!«
Noch eine gute Strecke führte Lysias in den nun dichteren Wald hinein; er hatte alsbald den breiten Weg der alten Legionenstraße nach Tarsus verlassen und einen kaum wahrnehmbaren Steig seitab durch dichtes Gestrüpp eingeschlagen. Nur mit Mühe konnte Julian folgen. Die scharfen Zweige der manneshohen Dornbüsche schlugen ihm ins Gesicht, dass seine Wangen bluteten, und rissen Löcher in seine Kutte. Nun standen sie vor einem hoch in die Nachtluft ragenden Bau stolzer Halbbogen. Es war die Wasserleitung, die in besseren Tagen Roms ein Imperator – Hadrian – erbaut hatte; aber lange schon war sie verfallen. Große Steinplatten lagen auf der Erde, von Moos, von Steinbrech überwachsen. Lysias bückte sich und tastete suchend unter den Trümmern umher. Endlich griff er in die eiserne Handhabe einer gewaltigen Marmorplatte, die einem Brunnendeckel glich. Er wandte sich. Julian bog atemlos das Antlitz vor: »Jetzt schweige, was du auch sehen magst, keinen Laut! Oder wir sind beide des Todes!« Er schob nun mit Anstrengung die Platte zur Seite. Eine Schlange huschte, aufgeschreckt, mit Zischen davon. Ein paar Stufen wurden sichtbar. Lysias schritt einige dieser Staffeln hinab. Er winkte dem Jüngling, zu folgen. Sie standen jetzt auf der aus Ziegelsteinen gemauerten Wölbung eines unterirdischen, kellerähnlichen Raumes, aus welchem verworrenes Geräusch bis zu ihnen empordrang. Lysias kniete nieder, beugte das Antlitz und lugte durch einen schmalen Spalt in der Steinwölbung in die Tiefe, die offenbar früher das Wasserbecken für die Leitung gebildet hatte; aber jetzt musste die ehemalige Brunnenstube trocken sein, denn durch den Spalt glänzte aus der Tiefe ein matter Lichtschimmer herauf.
Lysias nickte befriedigt, erhob sich, Platz zu schaffen, und wies Julian mit dem Zeigefinger die Ritze in dem Gestein. Der drückte nun das Gesicht darauf. Sofort wollte er zurückschnellen. Aber mit eiserner Faust zwang ihm der Priester den Nacken nieder.
Und Julian sah, musste sehen! Er schloss das Auge. Allein nun vernahm er auch Worte! Und jetzt – unwillkürlich – spähte er auch wieder hinab. Da saßen und lagen in dem kreisrunden Becken bei dem Scheine von Ampeln und Fackeln auf weichen Polstern und Teppichen Konon der Abt mit etwa sechs seiner Mönche und ebenso vielen der Pilger und Einsiedler, die Julian der Pförtner als Pfingstgäste eingelassen hatte. Zwischen ihnen aber, die Häupter an ihre Knie geschmiegt, ruhten etwa ebenso viele Mädchen und Weiber aus der nahen Stadt in schamloser Tracht. Der Abt wiegte auf seinem Schoß die üppige Fischerdirne. Vor ihm, auf dem Teppich, wälzte sich, sinnlos betrunken, nackt bis auf den Lendengürtel, Theodoret der junge Mönch. Lallend hielt er die leere Schale zu der Vollbusigen empor, die ihm laut lachend aus goldnem Krug einschenkte.
»Siehst du, Leaena«, begann der Abt mit schwerer Zunge, »was der Junge, der Theodoret, für weiße Glieder hat? Er ist schöner als du. Er wird dich ablösen in meiner Gunst, wie Ganymed bei Vater Zeus Frau Hera verdrängt hat. Ich merkte es schon, als ich ihn geißelte. Ich dachte nicht damals, als ich ihn so hart züchtigte …« – »Aus eitel Eifersucht!« höhnte Leaena. – »Dass er so bald unseres Vertrauens sich würde wert erweisen. Ja, ja, Knabenschöne geht über Mädchenschöne.« – »Nicht immer«, lachte die Schwarzlockige. »Nicht vielen weich ich. Nicht viele Jünglinge sind so schön. Zum Beispiel, sieht nicht der hagere Imperatorsvetter aus wie ein kranker Ziegenbock?« Schallendes Gelächter antwortete ihr, untermischt mit den Rufen: »Der Grübler!« – »Der Dummkopf!« – »Der fromme Narr!« – »Ich trug ihm auf«, fuhr der Abt fort, »heute bis Mitternacht für mein Seelenheil zu beten. Er ist grenzenlos einfältig. Reiche den schweren Wein hervor, dort aus dem Erdloch! Schenkt ein! Wir können nicht mehr warten.« »Auf wen?« fragte einer der Klostergäste. »Nun, auf den einzigen, der heute fehlt, auf Lysias! – Horch! Was war das? Da oben? Was fiel da?« »Nichts! Ein Stein bröckelte aus der Decke!« antwortete Leaena. Aber es war Julian gewesen, der, mit halbersticktem Schrei, ohnmächtig mit dem Antlitz auf das Gewölbe niedergestürzt war.
Sechstes Kapitel
In schwerem Fieber lag der junge Mönch auf seinem Stroh; an seiner Seite saß Lysias, mit einem in Essig getränkten Schwamm ihm die heißen Schläfen kühlend.
Schon sechs Tage waren vergangen, seit er den Taumelnden, halb stützend, halb tragend, mit äußerster Anstrengung aus jener Tiefe zurückgebracht hatte in das Kloster. Hier war Julian sofort von heftiger Gehirnkrankheit ergriffen und dem Tode so nahe gebracht worden, dass der Klosterarzt ihn verloren gab. Nicht aber Lysias. Der war Tag und Nacht nicht von seinem Lager gewichen, unermüdlich in seiner Pflege; eifersüchtig hatte er jeden andern ferngehalten von den Fieberreden des Kranken.
»Der Arzt gibt ihn auf«, hatte er zu dem Abte gesagt, »so überlass ihn meiner Heilkunst. Du weißt, ich kenne die geheimen Kräfte der Natur.« – »Jawohl. Zwar schwerlich kommt dir solche Wissenschaft vom Heiligen Geist. In Ägypten, in Corduene, in Persien und wo sonst du dich so lang umgetrieben, da walten noch die Dämonen. Aber mir kann’s gleich sein, ob der verrückte Junge lebt oder stirbt. Und der Augustus wird sich auch trösten über des lieben Vetters Tod.« So hatte Lysias freie Hand gehabt und die Horcher fernhalten können.
»Stirbt er, so stirbt mir – ach, den Göttern! – eine große, vielleicht die letzte Hoffnung. Diesen Grübler und Schwärmer, diesen für alles, was er für edel hält, begeisterten und dabei doch so eitlen Träumer kann man vorausberechnen in jeder Regung seines Geistes. Und auf ihn verweisen alle sichersten Zeichen der Gestirne – auf ihn und … mein Haus! – Unberechenbar aber freilich ist der Zufall. So auch der Zufall, dass er mich aus dem Munde des Abtes als – angeblichen – Genossen jener Lüste kennenlernte. Das hätte ihn fast getötet. Und das zwingt mich nun, ihm früher, als ich wollte… Er schlägt die Augen auf! Der Puls – das Fieber, ist stark gefallen. Er wird leben! Für mich – und für … sie! – soll er leben! Und mehr noch: für die Olympier alle als ihr Retter und Rächer!«
Zwei Monate später wandelten Lysias und Julian miteinander durch die Straßen Roms. Der Genesene zeigte noch vielfach Spuren der Schwäche. Oft griff er nach dem Arme seines Begleiters und stützte sich auf ihn zu kurzer Rast. Bewundernd ließ sich der Jüngling, der zum ersten Mal die Ewige Stadt betrat, von seinem erfahrenen Führer die wichtigsten Bauwerke, Denkmäler, Erinnerungsstätten weisen und erklären.
Prüfend ruhten dabei jene scharfen Augen auf ihm.
»Es ist seltsam mit dir«, meinte Lysias, als er den jungen Mönch von dem Grabe Sankt Peters, wo der brünstig gebetet hatte, hinweggeleitete, zurück über den Tiber. »Woran denkst du? Schwerlich an die Ketten des Apostels, die du soeben geküsst hast. Wohin? Das ist nicht der Weg in das Haus unseres Gastfreundes auf dem Mons Pincius! Hier geht es ja …« – »Ei, auf das Forum! Nach dem Kapitol!« rief Julian begeistert, und sein Auge leuchtete. »O lass mich heute noch einmal dorthin; lass mich die Sonne sinken sehen vom Tarpejischen Felsen aus. Es drängt meinen Geist, drängt all mein Wesen aufs Kapitol.« – »Von Sankt Petrus zum Jupiter des Kapitols? Ein weiter Weg! Weiter noch für den Gedanken als für den Fuß! Wie du doch hin- und herschwankst – nicht mit den Beinen nur! So! Lehne dich nur an mich und raste!«
Julian drückte das Haupt an die Schulter des viel höher Gewachsenen. »Ist es ein Wunder, dass ich wanke und schwanke, hin- und hergezogen? Was hab ich nicht erlebt seit zwei Monaten!« – »Nicht eben viel. Du hast die Heuchelei erkannt, die schlimmer als tierischen Begierden und Laster unter der Larve der Selbstabtötung, der Kasteiung des Fleisches. Du hast die Eine Frucht jener Lehren erkannt. Das Verbot des Natürlichen erzeugt das Widernatürliche. Das ist noch nicht viel. Und doch hättest du schier den Verstand darüber verloren – wie den Glauben.« – »Zum Glück aber noch beide nicht! Allein das Ärgste war, dass ich auch dich als einen Genossen jenes Treibens erkennen musste. Oh, was ich litt in jenen Tagen …« – »Bis ich dir erklären konnte … lange Zeit warst du unfähig zu denken! Nur Gebete plappertest du und sahst überall Dämonen und halb nackte Weiber! – dass ich, um jenen Abt und sein einflussreiches Kloster und gar viele diesem Verbündete zu Rom und am Hofe des Imperators zu beherrschen, zum Schein ihre Laster teilte und so auch ihre andern Geheimnisse und zumal ihren Einfluss bei dem Augustus.« – »Ein gewaltig Opfer! Tugenden heucheln ist arg, aber Laster heucheln muss noch schwerer sein.«
»Der Zweck verlangt es. Dafür tat ich noch ganz andres!« Unheimlich funkelten die heiß blickenden grauen Augen. »Der Zweck! Ja, welcher Zweck? Wann endlich wirst du dich mir ganz enthüllen …?« – »Wann du ganz reif sein wirst, mich ganz zu begreifen. Es fehlt noch viel. Solange du mit Inbrunst die Lippen an jene Stücke alten Eisens pressest, die man dir für die Ketten des Fischers vom Galiläischen Meer ausgibt, der vielleicht den Tiber nie gesehen … so lange gewiss nicht. Sieh, mein Sohn, ich wiederhole: Mit leichter Mühe könnte ich dir im Wege der Logik, der Philosophie die Unmöglichkeit der ganzen Kirchenlehre dartun.« Julian schüttelte ernsthaft die dunklen Locken, die ihm in diesen Monaten der Freiheit gewachsen waren. »Du bezweifelst das? Gut, eben deshalb würde mein Sieg in dem Streit mit Gründen nichts helfen. Du würdest mir sagen: ›Ich kann dich nicht widerlegen, aber ich glaube doch.‹« – »Wahrscheinlich! Gewiss! Ja!« – »Darum sollst du die Unwahrheit der Kirchenlehre nicht erlernen, nein, erleben.« – »Oder ihre Wahrheit, lehrte Johannes!« dachte Julian bei sich, aber er sagte es nicht. – »Dann erst bist du reif für meine Offenbarungen und für meine Pläne. Ein gut Stück Kirchenlehre hat dir jene Nacht doch schon aus der Seele gerissen.« – »Ja leider, leider!« klagte Julian, die Augen schmerzlich schließend. »Allein, das ist ein Kloster, fern in Kilikien. Hier an der Stätte, die nach Jerusalem die heiligste auf Erden, hier, nahe den Gräbern der Apostelfürsten, hier, wo der Nachfolger Sankt Peters wirkt und waltet, hier wird sich diese Lehre rein und reinigend bewähren. Seit ich hier wandle, fühle ich meinen Glauben wieder erstarkt. Das heißt …«, er stockte.
»Das heißt«, fuhr Lysias an seiner Statt fort und schlug mit der Hand auf den Schild eines ehernen Julius Cäsar, zu dessen Füßen sie eben auf dem weiten, statuengeschmückten Platz vor dem Theater des Marcellus standen, »das heißt: der da stört dich in deinem Glauben und jener da drüben« – er wies auf einen marmornen Trajan – »und dieser dort, der Germanenbesieger und Philosoph Marc Aurel – ja, auch der Jupiter und der Mars des Kapitols und Hera und Pallas Athene und dort – der Herrlichste von allen: Phöbos Apollo, der ewige Jüngling, der unbesiegte Sonnengott!« Und aus des Mannes harten Augen leuchtete eine Begeisterung, wie sie der Jüngling nie an ihm gesehen. »Woher weißt du …? staunte er.
»Oh, ich weiß noch mehr! Mir gaben die Götter, in den Seelen der Menschen zu lesen. Wohl zieht es dich zum Grabe Sankt Peters und zum Hause seines Nachfolgers. Aber stärker doch bewegen dir, seit du hier weilst, die jugendliche Seele, die alten Helden und die alten Götter Roms. Ich wusste das voraus! Und sieh, das ist der zweite Grund, aus dem ich dich bei dem ersten Schritt in die Welt aus jenem Kloster gerade hierher geführt. Du sagst dir hier in schlummerlosen Nächten: »Was ward aus Rom, da es den alten, großen, schönen, erhabenen Göttern diente, durch die Scipionen, Cäsar, Trajan, Hadrian? Die Herrin der Welt! Was ward aus Rom seit Constantin …? – Sein Name sei gepriesen! – Und Constantius, der Liebling Christi«, sprach er plötzlich ganz laut. »Gott verleih ihm Sieg und langes Leben.«
»Was hast du auf einmal?« – »Jener Priester, er folgt uns schon lang, ist ein bezahlter Angeber, ein Späher des Obereunuchen Eusebius. Ich kenne ihn. Aber er weiß nicht, dass ich ihn kenne und dass ich auch zu den Günstlingen des frommen Imperators zähle.« – »Du?« – »Was also«, fuhr Lysias wild leidenschaftlich fort, »was ward aus Rom, seit Constantin, abgefallen von den Göttern unserer Väter, den Legionen die alten Siegesadler nahm und sie ersetzte durch …« – »Das Labarum!« unterbrach Julian ehrfürchtig. »Das heilige Zeichen des Kreuzes und den Anfang des Namens Christi.« – »Ein Zeichen, das nichts von Romas alten Siegen weiß! Unter dem die Legionen geschlagen werden von Parthern und Persern am Tigris, von Jazygen am Ister, von Franken und Alemannen …«
»Franken? Alemannen? Was sind denn das für Leute?« forschte der Jüngling, hoch aufhorchend.
»Unter neuen Namen alte Feinde: Germanen des Rheins. Gesteh es nur, deine Träume sind, seit du hier weilst im Schatten des Kapitols, mehr von Waffen als von heiligen Ketten, mehr von Cäsar als von Christus erfüllt. Deshalb gerade erbat ich mir vom Abt – du weißt jetzt, warum er gewähren muss, was ich ernstlich fordere! – dich, den kaum Genesenen, zum Begleiter, als er mich hierher an den römischen Bischof sandte. Dankst du mir nicht, dass ich dir das ewige Rom gezeigt?«
»Ach wie heiß! Eine ganze Welt ist mir hier neu aufgegangen. Mir schwindelt manchmal! Nicht all die Fülle von Gestalten kann ich bewältigen, die hier aus Tempeln und Palästen und Bildsäulen auf mich eindringt. Ich verstehe noch nicht alles.«
»Wie solltest du! Haben sie dir doch im Kloster von der Geschichte der Hellenen und der Römer nur beigebracht, was dich mit Abscheu vor ihren Lastern erfüllen sollte. Was erfuhrst du von der Herrlichkeit ihrer Götter, ihrer Waffen, ihres Heldentums, ihrer Staatskunst, ihrer Welteroberung? Nichts. Aber Geduld! Bald sollst du Roms Geschichte von Männern lernen, nicht von Priestern.« – »Dort? Im Kloster?« – »Nie sieht dich das Kloster wieder!« – »O Dank! Mir graut davor.« – Da traf ihn ein lodernder Blick. »So heb es auf. Und alle seinesgleichen.« – »Lysias! Du redest irr. Ich!« – »Willst du es?« – »Ich wollt es, wenn …« – »Willst du es?« – »Ja, ich will!« – »So wirst du’s tun. Denn wisse: du – Liebling der Götter – wirst einst alles können, was du wollen wirst.« – »Ich verstehe dich nicht, Meister.« – »Solange der Papst dein Meister ist, bin ich es nicht.«
Julian schwieg eine Weile nachdenklich. »Wohin führst du mich?« fragte er dann erstaunt. »Du bogst längst ab von dem Wege nach dem Kapitol. Wir müssen weit darüber hinaus sein, im Osten der Stadt! Wohin gehen wir?« – »Zum Heiligen Vater.« – »Zu Liberius selbst?« rief der Jüngling, in Ehrfurcht erschauernd. Er blieb stehen. »Er soll so weise sein, so klug sein …« – »Wie die Schlangen. Aber nicht ganz so harmlos wie die Tauben. Übrigens hat sich der Galiläer geirrt; wie bei jenem Feigenbaum, an dem er – der Allwissende! – Feigen zu finden glaubte und nicht fand; denn weder sind die Schlangen klug noch die Tauben sanft. Komm hier hinab, diese Stufen.« – »Und so demütig ist er, so fern von jedem weltlichen Gedanken, des Imperators treuester Untertan.« – »Halt! Stolpere nicht. Hier wird es dunkel. Da, halte dich an meine Hand.« – »Wo sind wir?« – »Auf dem Esquilin, dem Speisemarkt der Livia, in der Krypta der neu vom Papst errichteten Basilika, der Liberiana, wie sie schon im Volke heißt. Hierher hat er mich beschieden. Er hat mir Wichtiges zu vertrauen, einen Auftrag. Und einen im Urkundenwesen, in Rechtsschriften gewandten Geistlichen sollte ich mitbringen. Du hast, unterwiesen von dem Abt, dem ehemaligen Juristen, die Verträge des Klosters verfasst, viele Jahre lang. So durfte ich dich wählen. Aber dass du der Vetter des Imperators bist, dem Gott … nun, sagst du die Formel nicht mehr auf?« – »Nein! Ich mag nicht. Sie ist Lüge.« – »Das verschweige sorgfältig.« – »Die Vetterschaft ist weder Ruhm noch Glück! Aber weshalb nicht im Sankt Peter? Weshalb dies Geheimnis?« – »Man soll nicht erfahren von unserm Verkehr. Halt, wir sind am Ziel. Es hieß: ›Zwölf Stufen, dann zwölf Schritte nach rechts. Dann an dem Holzverschlag der Mauer eine vorspringende Scheibe…‹ Hier ist sie! ›Diese einwärts drücken‹, sie gibt nach! – eine schmale Pforte tut sich auf; sieh: Licht schimmert uns entgegen; folge mir, tritt ein.«
Siebentes Kapitel
Sie standen in einem halbkreisförmigen Raum; er entsprach der Apsis oben in der Basilika. Die Mosaiken an den Wänden waren bereits verdunkelt durch den Qualm einer Öllampe, welche hier nie erlöschen durfte. Die christlichen Symbole: der Fisch, das Lamm, der Gute Hirte, kehrten in eintöniger Reihenfolge immer wieder.