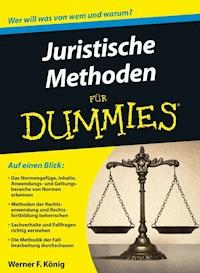
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Stehen Sie gerade am Anfang eines Jura-Studiums? Oder müssen Sie sich als Nicht-Jurist im Nebenfach mit Jura beschäftigen? Ist Ihnen die juristische Methodik noch fremd und fühlt sie sich für Sie gewöhnungsbedürftig an? Das muss nicht so bleiben! Dieses Buch führt Sie in die Logik der Juristerei ein und erklärt Ihnen in gewohnt verständlicher und anschaulicher Dummies-Manier die Welt der Normengefüge, Sachverhalte und Fallfragen, Auslegung und Fallbearbeitung. Und ganz nebenbei erfahren Sie auch, welche juristischen Todsünden Sie auf keinen Fall begehen sollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2016
© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © alphaspirit – fotolia.comKorrektur: Frauke Wilkens, MünchenSatz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-71122-2ePub ISBN: 978-3-527-80125-1mobi ISBN: 978-3-527-80124-4
Über den Autor
Werner F. König ist seit etwa 20 Jahren Rechtsprofessor an einer deutschen Hochschule. Vorher hat er als praktischer Jurist gearbeitet. Er kennt also nicht nur die Theorie, sondern weiß auch, wie die Praxis aussieht. Seit vielen Jahren prüft er an der Universität und im Ersten Juristischen Examen. Daher weiß er sehr gut, wo die vermeidbaren Fehler gemacht werden – und wie man sie vermeidet.
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I – Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht
Teil II – Von der Werkbank: Das Normengefüge
Teil III – Vom Holz: Sachverhalt und Fragestellung
Teil IV – Vom Werkzeug: Auslegung und Rechtsfortbildung
Teil V – Vom Sägen, Bohren und Hobeln: Technik der Fallbearbeitung
Teil VI – Noch ein Blick in die Werkstatt: Der Top-Ten-Teil
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht
1 Methodisch Fälle lösen
Regeln sorgen für Ordnung
Wie diese Regeln aussehen
Wie man diese Regeln anwendet
Die Regeln und ihre Ordnung
Woher die Regeln kommen
Welche Regel Sie nehmen dürfen
Was für Regeln es gibt
Wie die Regeln ineinandergreifen
Sachverhalt und Fragestellung
Was ist passiert?
Wer will was von wem und wieso?
Die Methoden der Rechtsanwendung
Was heißt das eigentlich? Auslegung von Gesetzen
Was nicht im Gesetz steht? Fortbildung des Rechts
Ausfüllen statt auslegen: Der unbestimmte Rechtsbegriff
Die Antwort und Ihre Begründung
Immer schön logisch …
Immer schön der Reihe nach …
2 Was sind Rechtsnormen und wozu sind sie da?
Regeln zum Verhalten
Regeln zur Zuweisung von Rechtspositionen
Wenn, dann … – der Aufbau der Norm
3 Übersicht über die Fallbearbeitung
Anwendung von Normen: Der Rechtssyllogismus
Der Syllogismus als klassisches logisches Verfahren
Der Rechtssyllogismus als Normanwendung
Passt alles? Die Subsumtion
Schritt für Schritt: Die Tatbestandsmerkmale
Worauf es ankommt: Das Problembewusstsein
Und was heißt das nun genau? Die Rechtsfolgenkonkretisierung
Rechtsanwendung als komplexe Aufgabe
Lösungen zu der kleinen Übung zum Problembewusstsein
Teil II Von der Werkbank: Das Normengefüge
4 Woher nehmen? Rechtsquellen
Schwarz auf weiß: Positives Recht
Nationales Recht
Internationales Recht
Das war schon immer so: Gewohnheitsrecht
Keine Rechtsquelle: Richterrecht
Urteile als Einzelfallrecht
Urteile als Rechtserkenntnisquelle
Vom Richterrecht zur Norm
5 Welche Norm nehmen? Geltung und Anwendbarkeit
Passt das hier überhaupt? Geltung und Anwendbarkeit
Geltung
Anwendbarkeit
Ass sticht König: Geltungsvorrang
Normenpyramide
Bundesrecht bricht Landesrecht
Was passt besser? Konkurrenz von Normen
Anwendungsvorrang
Rechtsfolgenharmonisierung
Echte Konkurrenz
Das kann weg! Abdingbarkeit
6 Was steht drin? Norminhalte
Vollständige und unvollständige Normen
Was ist was? Legaldefinitionen
Definition als Zwischenschritt der Subsumtion
Definitionen im Gesetz
Keine Regel ohne Ausnahme: Gegennormen
Einwendungen
Einreden
Ausnahmen: Keine Regel ohne …
Guck doch woanders! Verweisungen
Rechtsgrundverweisung und Rechtsfolgenverweisung
Verweisungen für Profis: Die entsprechende Anwendung
Verweisungsketten: Von Norm zu Norm zu Norm
Und übrigens …: Ausfüllungsnormen
7 Wie passt das zusammen? Das Normengefüge als System
Fallfrage, Antwortnormen und Hilfsnormen
Fragestellung und Antwortnorm
Hilfsnormen: Normen, die Sie auch noch brauchen
Ein Beispiel und eine kleine Übungsaufgabe
Was Sie über das System wissen müssen und was nicht
Grundstrukturen des Rechtssystems
Aufbauprinzipien und Hilfen beim Suchen
Womit Sie Ihr Hirn nicht belasten sollten
Lösungen der Aufgaben
Teil III Vom Holz: Sachverhalt und Fragestellung
8 Was ist passiert? Die prozessuale Wahrheit
Wie viel Holz brauchen Sie überhaupt? Selektive Sachverhaltsermittlung
Was Sie nicht wissen müssen
Was Sie gar nicht fragen dürfen
Wo Sie Ihr Holz suchen: Die Wahrheit im Prozess
Was Sie nicht untersuchen müssen
Was Sie glauben dürfen
Wenn Sie kein Holz finden: Die Feststellungslast
9 Wer will was von wem warum? Die Fallfrage
Von der Bedeutung der Unzufriedenheit
Von der Bedeutung laienhafter Antworten
Lösung zur Aufgabe am Schluss von Kapitel 8
10 Der mitgeteilte Sachverhalt im Studium
Von der Todsünde der Sachverhaltsveränderung
Wie Sie in die Falle tappen
Wie Sie die Falle vermeiden
Von der Auslegung des Sachverhalts
Was beiläufig erwähnt wird, ist normal abgelaufen
Was nicht geschildert wird, ist nicht passiert
Der Aufgabensteller kennt das Recht, die Beteiligten nicht
Der Aufgabensteller sagt die Wahrheit, bei den Beteiligten weiß man das nicht
Von der Lücke im Sachverhalt
Behandlung als unstreitig
Alternativlösung
Entscheidung nach der Feststellungslast
Teil IV Vom Werkzeug: Auslegung und Rechtsfortbildung
11 Was im Gesetz steht: Methoden der Auslegung
Auslegung und ihre Elemente: Ein Überblick
Wann auslegen und wann nicht?
Elemente der Auslegung
Ausgangspunkt und Grenze der Auslegung: Wortlautargumente
Die zwei Funktionen der grammatikalischen Auslegung
Der Normadressat als Bezugspunkt der grammatikalischen Auslegung
Auslegung anhand des Kontexts: Systematische Argumente
Der unmittelbare Kontext
Der fernere Kontext
Höhere Prinzipien als Kontext
Auslegung anhand des Gesetzeszwecks: Teleologische Argumente
Wie Sie es richtig machen
Wie Sie es falsch machen
Auslegung anhand der Textgeschichte: Historische Argumente
Was haben die sich denn gedacht? Genetische Argumente
Was war denn das Problem? Rechtshistorische Argumente
Ergebnis der Auslegung: Abwägung der Argumente
12 Was nicht im Gesetz steht: Methoden der Rechtsfortbildung
Wenn das Gesetz Löcher hat: Methoden der Gesetzesergänzung
Wann ist ein Loch ein Loch?
Anwendung einer ähnlichen Regelung: Gesetzesanalogie
Anwendung eines allgemeinen Prinzips: Rechtsanalogie
Entscheidung nach Gerechtigkeit: Freie Rechtsfortbildung
Wenn das Gesetz Fehler hat: Methoden der Gesetzeskorrektur
Reine Formulierungsfehler: Kleine berichtigende Auslegung
Inhaltliche Irrtümer: Große berichtigende Auslegung
Übers Ziel hinausgeschossen: Teleologische Reduktion
Wenn das Gesetz unrecht ist: Die Entscheidung gegen das Gesetz
Rechtsfortbildung und Gewohnheitsrecht
13 Zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung: Der unbestimmte Rechtsbegriff
Was ist das und wozu taugt es? Von Türchen und Scheunentoren
Was macht man damit? Vom Ausfüllen unbestimmter Rechtsbegriffe
Ausfüllen als Interessenabwägung
Kleine Helferchen des Gesetzgebers
Ausfüllen für Profis: Fallgruppenbildung
Wie kommen hier die Grundrechte ins Spiel? Vom Grundgesetz als Werteordnung
Schutzlücken und Generalklauseln
Grundrecht gegen Grundrecht: Praktische Konkordanz
Generalklauseln als untaugliche Eingriffsnormen
Teil V Vom Sägen, Bohren und Hobeln: Technik der Fallbearbeitung
14 Immer schön logisch: Die Denkgesetze
Nur was logisch ist, überzeugt
Definieren bis zur Evidenz
Vollständiges Definieren ist nicht immer nötig
Von echter und falscher Evidenz
Die Begriffsvertauschung als Todsünde der Falllösung
Die Widersprüchlichkeit als Todsünde der Falllösung
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten
Ohne Umkehrschlüsse geht es nicht
Vorsicht mit Umkehrschlüssen!
Die unzureichende Begründung
Die fehlende Begründung
Die leere Begründung
Der Zirkelschluss
Der logische Bruch
15 Immer schön der Reihe nach: Der richtige Aufbau
Zwei Aufbauarten: Urteil und Gutachten
Urteil und Gutachten im Vergleich
Das Gutachten
Urteilssätze im Gutachten
Zwei Aufbauprinzipien: Logik und Praktikabilität
Aufbaulogik: Von der Fallfrage zum Ergebnis
Der praktische Aufbau
Zwei Möglichkeiten, weniger zu schreiben: Weglassen und Offenlassen
Problematische und unproblematische Ergebnisse
Weglassen: Zur Argumentation nicht Nötiges
Offenlassen: Unproblematisches und Nachrangiges
Zwei Möglichkeiten, mehr zu schreiben: Hilfsbegründung und Hilfsgutachten
Eine kleine Übersicht zum Weglassen, Offenlassen und zu Hilfserwägungen
16 Ihr Fahrplan zur Klausurlösung
Erster Schritt: Lesen Sie die Fallfrage!
Zweiter Schritt: Lesen Sie den Sachverhalt!
Dritter Schritt: Suchen Sie Normen!
Vierter Schritt: Wenden Sie die Normen an!
Fünfter Schritt: Prüfen Sie Ihr bisheriges Ergebnis auf Plausibilität!
Sechster Schritt: Entwerfen Sie den Aufbau Ihrer Lösung!
Siebter Schritt: Schreiben Sie die Lösung nieder!
Achter Schritt: Fertig!
Lösung zur Aufgabe am Schluss von Kapitel 15
Teil VI Der Top-Ten-Teil
17 Acht wichtige Tipps fürs Fällelösen
18 Die sieben Todsünden der Falllösungstechnik
19 Dreiunddreißig juristische Begriffe, die Ihnen spanisch vorkommen
Stichwortverzeichnis
Einführung
Es ist schön, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben! Es wird Ihnen dabei helfen, das knifflige, aber auch sehr schöne Handwerk des juristischen Fällelösens zu erlernen. Von außen sieht das manchmal ziemlich geheimnisvoll aus. So besonders geheimnisvoll ist es aber gar nicht. Sie werden sehen, es ist vor allem eins: schön logisch!
Über dieses Buch
Dieses Buch erklärt Ihnen, wie Sie wie ein Jurist denken. Sie müssen es nicht von vorn bis hinten ganz durcharbeiten. Sie können immer gerade da nachschauen, wo Sie sich beim Lösen Ihrer eigenen Fälle unsicher sind. Natürlich schadet es auch nichts, es einmal ganz zu lesen.
Vielleicht sind Sie ein wenig überrascht, gerade zur juristischen Methodenlehre ein … für Dummies-Buch gefunden zu haben. Vielleicht dachten Sie, juristische Methoden seien etwas Trockenes und Langweiliges. Dann sollten Sie das Buch ganz dringend lesen, denn das ist genau der Grund, aus dem es geschrieben wurde: Juristische Methoden sind spannend und interessant! Es lohnt sich, sie kennenzulernen.
Konventionen in diesem Buch
Es ist schön, wenn Sie das Buch ganz lesen. Sie müssen nicht. Sie können vorn anfangen und hinten aufhören, aber Sie müssen nicht. Lesen Sie ruhig das, was Sie gerade interessiert, und den Rest später, und was Sie sowieso schon wissen, lesen Sie gar nicht. Damit Ihnen das leichter fällt,
werden Sie zu Beginn jedes der sechs Teile des Buches darüber informiert, wovon seine einzelnen Kapitel handeln;
erfahren Sie zu Beginn eines jeden Kapitels, was Sie darin finden.
Juristische Methoden sind etwas sehr Abstraktes. Abstraktes prägt sich besser ein, wenn es anhand von konkreten Beispielen erklärt wird. Darum ist das Buch voll davon. Sie sind meist entsprechend gekennzeichnet, damit Sie gleich erkennen, dass es jetzt etwas konkreter wird. Wenn Sie schon verstanden haben, worum es gerade geht, und kein Beispiel mehr dazu brauchen, lesen Sie die Passagen einfach nicht. Das geht auch. Es entgeht Ihnen freilich etwas, denn manchmal sind Beispiele aus der Praxis auch die Würze, die dafür sorgt, dass Ihnen das ganze Essen besser schmeckt.
Für den Fall, dass Sie beim Lesen einen Fachausdruck aus einem anderen Kapitel noch nicht kennen, finden Sie in Kapitel 19 eine kleine Liste mit den Erklärungen der wichtigsten Begriffe.
Törichte Annahmen über den Leser
Sie möchten wissen, mit welchem Handwerkszeug Sie aus einem Lebenssachverhalt die richtigen rechtlichen Schlussfolgerungen ziehen. Vielleicht studieren Sie ja Rechtswissenschaften und das ist etwas, das man in jeder Prüfung von Ihnen erwartet. Vielleicht sind Sie aber auch Sozialarbeiter oder Kauffrau und möchten endlich einmal verstehen, wie der Justitiar im Hause immer zu seinen Ergebnissen kommt.
Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie juristische Fragen nur mit dem Gesetz vor sich beantworten können. Darum wissen Sie vermutlich auch schon, wie Sie an den Gesetzestext herankommen. Aber falls nicht: Es gibt nicht nur schöne gedruckte Sammlungen, die man kaufen kann. Sie können ein Gesetz, das Sie nicht haben, auch jederzeit im Internet nachschlagen. Kostenlose Seiten mit allen wichtigen Gesetzen sind:
www.gesetze-im-internet.de
dejure.org
Und wenn Sie einmal ältere Fassungen recherchieren möchten:
lexetius.com
Für das Smartphone gibt es außerdem die verschiedensten Gesetze-Apps zum Herunterladen, manche davon auch kostenlos, für die Android-Systeme zum Beispiel bei:
gesetze-im-android.de
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Juristische Methoden für Dummies hat sechs Teile mit insgesamt 19 Kapiteln. Alle Teile zusammen geben Ihnen eine vollständige Anleitung dazu, wie Sie sich eine juristische Falllösung zusammenbauen können. Stellen Sie sich einfach vor, die Falllösung wäre ein Möbelstück und Sie wollten es zimmern. Jeder Teil beschreibt etwas anderes, das Sie dazu wissen müssen.
Teil I – Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht
Im ersten Kapitel bekommen Sie einen Überblick darüber, was ein Jurist tut, wenn er einen Fall löst. In Kapitel 2 erfahren Sie etwas über den Hauptakteur – die Rechtsnorm – und in Kapitel 3 darüber, wie Sie mit den Methoden der Subsumtion und Rechtsfolgenkonkretisierung Gesetzestext und Lebenssachverhalt zusammenbringen.
Teil II – Von der Werkbank: Das Normengefüge
Das Normengefüge, das die Rechtsordnung ausmacht, ist die Unterlage, auf der Sie arbeiten, wenn Sie Fälle lösen. In Kapitel 4 bis 7 erfahren Sie, aus welchen einzelnen Teilchen es besteht und wie diese miteinander zusammenhängen.
Teil III – Vom Holz: Sachverhalt und Fragestellung
In den Kapiteln 8 bis 10 geht es um den Werkstoff, mit dem Sie arbeiten. Das ist der Sachverhalt, den Sie einer juristischen Prüfung unterziehen wollen beziehungsweise sollen (oder sogar müssen). Sie erfahren hier auch, wie wichtig es ist, die richtigen Fragen zu stellen und auch nur die Fragen zu beantworten, die sich gerade stellen. Kapitel 10 befasst sich mit dem, was Sie vor allem interessieren wird, wenn Sie Jura studieren: mit dem mitgeteilten Sachverhalt in Prüfungsaufgaben.
Teil IV – Vom Werkzeug: Auslegung und Rechtsfortbildung
Die Kapitel 11 bis 13 behandeln die juristischen Methoden im engeren Sinne. Das ist das Werkzeug, mit dem Sie Ihre Falllösung bauen. Sie erfahren hier etwas über
die Techniken, mit denen Sie aus dem Gesetzestext durch Auslegung seine Bedeutung ermitteln können;
die Situationen, in denen es richtig ist, Rechtsfragen durch Rechtsfortbildung zu entscheiden, und die Techniken, die Sie dazu brauchen;
die Techniken, mit denen Sie bewusst offene Begriffe im Gesetz – »unbestimmte Rechtsbegriffe« – durch Ausfüllung für Ihren Fall handhabbar machen.
Teil V – Vom Sägen, Bohren und Hobeln: Technik der Fallbearbeitung
In Kapitel 14 bis 16 wird Ihnen noch näher vorgestellt, wie Sie mit diesem Werkzeug an Ihrem Werkstoff und auf Ihrer Werkbank tatsächlich arbeiten. Sie erfahren etwas über die formale Logik, der die juristische Argumentation gehorchen muss, und über die Regeln, nach denen sie aufgebaut sein sollte. Kapitel 16 enthält einen kleinen Taschenbauplan für Ihre Klausurlösung.
Teil VI – Noch ein Blick in die Werkstatt: Der Top-Ten-Teil
Hier finden Sie noch ein paar nützliche Listen, die Sie in Ihrer Fällelösungswerkstatt (im Geiste) aufhängen können, wenn Sie mögen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Was da steht, sollten Sie sich unbedingt merken. Sie werden es noch einmal brauchen.
Hier steht ein kurzes Beispiel für das, was eben erklärt wurde. Sie müssen das nicht lesen. Manchmal versteht es sich mit einem konkreten Beispiel halt etwas besser.
Hier finden Sie einen Tipp für Ihre Arbeit. Wenn Sie den beherzigen, wird alles leichter.
Hier wird ein wichtiger Begriff näher erklärt. Das sollten Sie sich anschauen, denn der Begriff kommt Ihnen vermutlich nicht nur in diesem Buch unter.
Dieses Symbol weist auf einen Abschnitt hin, den Sie auch überspringen können. Es wird darin etwas Interessantes erklärt, das Sie nicht unbedingt wissen müssen, wenn Sie die Details nicht interessieren.
Dieses Symbol weist Sie auf einen Fehler hin, den Sie auf keinen Fall machen sollten.
Wie es weitergeht
Nun können Sie loslegen. Alles, was Sie jetzt noch brauchen, ist ein Fall zum Lösen. Da finden Sie sicher einen – und wenn nicht, schlagen Sie die Zeitung auf! Wie Sie dort einen Fall zum Lösen finden, können Sie in Kapitel 9 nachlesen.
Teil I
Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht
In diesem Teil . . .
In diesem Teil bekommen Sie zunächst im ersten Kapitel einen groben Überblick über die gesamte juristische Methodenlehre. In Kapitel 2 erfahren Sie, wozu juristische Regelungen überhaupt da sind und wie sie aussehen. In Kapitel 3 erfahren Sie, wie eine juristische Falllösung zusammengesetzt ist. Das alles dient der Einführung. Bevor man einen Tisch zimmern kann, muss man halt erst einmal wissen, dass er eine Platte und vier Beine hat. Die fieseligeren Details – wo die Beine hinkommen, wie man sie anleimt und so weiter – stehen weiter hinten in diesem Buch.
1
Methodisch Fälle lösen
In diesem Kapitel
Ordnung schaffen durch Regeln
Ordnung in den Regeln
Ordnung in Sachverhalt und Fragestellung
Ordnung bei der Anwendung der Regeln
Ordnung in den Argumenten
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt: Was tun Juristen eigentlich den ganzen Tag? (Wenn Sie Jura studieren, haben Sie sich das hoffentlich schon vor dem Studium gefragt!) Die Antwort klingt simpel: Sie lösen juristische Fälle. Das heißt: Sie beantworten Rechtsfragen, die sich vor dem Hintergrund eines bestimmten Sachverhalts stellen. Die Antwort soll natürlich nach Möglichkeit richtig sein oder – juristisch ausgedrückt – der Rechtslage entsprechen. Von der Art und Weise, wie Sie vorgehen müssen, um eine solche Antwort zu finden, handelt dieses Buch. Dieses Kapitel gibt Ihnen darüber einen ganz groben ersten Überblick.
Regeln sorgen für Ordnung
Wenn irgendwo Ordnung herrschen soll, braucht es dazu Regeln. Wenn Sie Ihre Kaffeelöffel nicht jedes Mal suchen wollen, wann immer Sie einen brauchen, stellen Sie dazu eine Regel auf. »Kaffeelöffel gehören in die obere linke Schublade rechts neben dem Herd!« Wenn viele Menschen miteinander zusammenleben wollen, muss eine bestimmte Ordnung herrschen. Dazu gibt es Regeln. Die bilden die Rechtsordnung. Rechtsordnungen gibt es schon sehr, sehr lange, vermutlich seit Menschen in größeren Gruppen zusammenleben. Sogar aufgeschrieben haben Menschen diese Regeln schon sehr lange. Wenn Sie einmal nach Paris kommen, können Sie sich im Louvre eine schwarze Stele anse-hen, die den Codex Hammurapi enthält, ein geschriebenes Gesetzbuch aus dem 18. vorchristlichen Jahrhundert.
Wie diese Regeln aussehen
Regeln, die als Recht daherkommen, heißen Rechtsnormen. Sie sagen uns zweierlei:
was wir tun oder lassen sollen;
was es für Folgen haben soll, wenn wir uns nicht daran halten.
Die Zehn Gebote sind darum keine Rechtsnormen. Sie sagen uns nämlich nur, was wir tun oder lassen sollen. Was geschieht, wenn wir uns nicht daran halten, müssen sie uns nicht sagen, denn es sind religiöse Gebote. Wenn Sie sie brechen, geht das nur Gott und Sie etwas an. Es sind kategorische Imperative. Das fünfte Gebot sagt nur: »Lass das Töten sein!«
Rechtsnormen dagegen nennen uns die Folgen, die es hat, wenn wir gegen sie verstoßen. § 212 Abs. 1 StGB sagt uns daher: »Lass das Töten sein, sonst kommst du ins Gefängnis!« Rechtsnormen sind also hypothetische Imperative. § 212 Abs. 1 StGB befiehlt: »Wenn einer einen anderen tötet, dann sollt ihr ihn zu einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren verurteilen!«
Alle vollständigen Rechtsnormen sind daher Konditionalsätze. Sie sagen, was es für eine Folge haben soll, wenn etwas geschehen ist. Dieses Etwas heißt Tatbestand. Die Folge, die das Geschehene haben soll, heißt abstrakte Rechtsfolge. Mehr darüber finden Sie in Kapitel 2.
Wie man diese Regeln anwendet
Wer einem Juristen eine Rechtsfrage stellt, will über Rechtsfolgen informiert werden. Er sagt Ihnen, was passiert ist, und Sie sollen ihm sagen, was das für Konsequenzen hat. Römische Juristen haben darum gesagt: »Da mihi facta, dabo tibi ius!« (Gib mir die Fakten, dann gebe ich dir das Recht!) Das funktioniert so:
Chantal sagt: »Ich habe gestern den Kevin erschlagen, als er mir blöd kam! Was kann mir da passieren?«
Sie überlegen nun: »Erfüllt das den Tatbestand einer Norm?« Da denken Sie natürlich an § 212 Abs. 1 StGB. Dann prüfen Sie, ob der Sachverhalt, der Ihnen bekannt ist, zum Tatbestand der Norm passt. Diese Prüfung heißt Subsumtion. Dass Kevin ein anderer Mensch ist und dass das Erschlagen eine Form des Tötens ist, ist klar. Wenn Sie nun noch feststellen, dass Chantal kein Mörder (oder – gegendert – keine Mörderin) ist, ist die Subsumtion gelungen. (Den Teil überspringen wir jetzt, sonst ist das kein einfaches Beispiel mehr.)
Dann folgt Schritt 2: Sie stellen fest, dass die von § 212 Abs. 1 StGB angeordnete abstrakte Rechtsfolge eingreift. Chantal soll mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft werden.
Das ist aber nur die abstrakte Rechtsfolge, die das Gesetz anordnet. Daraus müssen Sie nun noch die konkrete Folge ableiten, die das für Chantal hat (und die Ihre Frage beantwortet). Das nennt sich dann Rechtsfolgenkonkretisierung. Das ist hier ziemlich einfach. Sie können dann gleich die Antwort geben:
»Wenn das herauskommt, stecken sie dich für mindestens fünf Jahre in den Knast!«
Damit haben Sie dann Chantals Rechtsfrage beantwortet und den Fall gelöst. In Kapitel 3 können Sie das noch wesentlich genauer nachlesen.
Die Regeln und ihre Ordnung
Wenn Sie Ihre Kaffeelöffel finden wollen, brauchen Sie in der Küche Ordnung. Wenn Sie die Rechtsnorm finden wollen, die Ihren Fall löst, brauchen Sie unter den Rechtsnormen Ordnung. Diese Ordnung nennt sich Rechtsordnung.
Woher die Regeln kommen
Wasser fließt aus der Quelle. Rechtsnormen fließen aus einer Rechtsquelle. Was da nicht herkommt, ist auch keine Rechtsnorm. Rechtsquellen gibt es nur zwei. Dementsprechend gibt es auch nur zwei Sorten von Recht:
Geschriebenes Recht: Das ist das Recht, das von einem dafür zuständigen Staatsorgan erlassen wird. Dazu muss es schriftlich niedergelegt sein. Deshalb nennen wir es auch das positiveRecht (vom lateinischen ponere = setzen, stellen, legen). Das Wort »Gesetz« ist auch hiervon abgeleitet.
Ungeschriebenes Recht: Das ist das Recht, das einfach durch langjährige Übung entsteht. Damit daraus Recht wird, muss die Übung allgemeiner Konsens sein und es muss ihr die Überzeugung zugrunde liegen, dass es sich nicht bloß um eine freiwillige Übung handelt, sondern dass sie rechtlich geboten ist. Weil das nicht von heute auf morgen geht, sondern voraussetzt, dass es den Leuten zur Gewohnheit geworden ist, sich solche Regeln als Recht zu denken, nennen wir das auch Gewohnheitsrecht.
Die Fähigkeit, Rechtsnormen zu erlassen, gehört zur staatlichen Souveränität. Alles Recht ist daher erst einmal staatliches Recht. Staaten können sich aber auch durch Verträge verpflichten, bestimmte Regeln anzuerkennen. Das ist dann zwischenstaatliches Recht. Schließlich können Staaten sich auch noch darauf verständigen, Teile ihrer Gesetzgebungskompetenz an überstaatliche Institutionen abzugeben. So entsteht überstaatliches Recht, wie zum Beispiel die Verordnungen der Europäischen Union.
Mehr zur Rechtsquellenlehre finden Sie in Kapitel 4.
Welche Regel Sie nehmen dürfen
Bevor Sie eine Norm anwenden, müssen Sie prüfen, ob sie überhaupt für Ihren Fall gedacht ist. Dazu müssen Sie Ihren Geltungs- und ihren Anwendungsbereich prüfen. Der kann in drei Ebenen eingeschränkt sein:
Räumlich: Gilt die Norm für diesen Staat / dieses Bundesland?
Zeitlich: Wann ist sie in, wann außer Kraft getreten? Gibt es eine Übergangsvorschrift, die ihre Anwendbarkeit nach dem Außerkrafttreten regelt?
Sachlich: Ist die Norm für Fälle dieser Art gedacht?
Eine Norm, die gegen höherrangiges Recht verstößt, gilt überhaupt nicht, denn dieses hat Geltungsvorrang. Aber auch wenn mehrere Normen gleichrangig sind, kann eine von ihnen Anwendungsvorrang vor der anderen genießen. Dann gelten zwar beide, aber nur eine ist auf Ihren Fall anwendbar.
Geltungsvorrang hat:
Verfassungsrecht vor Gesetzesrecht
Gesetze vor Rechtsverordnungen
staatliches Recht vor dem von Selbstverwaltungskörperschaften (Satzungen)
Bundesrecht vor Landesrecht
Europäische Verträge vor Europäischen Verordnungen und Richtlinien
Anwendungsvorrang haben speziellere vor allgemeineren Regelungen.
Einzelheiten zum Geltungs- und Anwendungsbereich lesen Sie in Kapitel 5.
Was für Regeln es gibt
Wie jede vollständige Rechtsnorm aussieht, steht schon weiter vorn in diesem Kapitel. Sie sagt: »Wenn [Tatbestand], dann [Rechtsfolge].« Das Gesetz ist aber außerdem voll von unvollständigen Rechtsnormen. Keine von ihnen gibt selbst irgendeine Antwort auf Ihre Rechtsfrage. Sie sind aber Hilfsmittel auf dem Weg zur Antwort. An solchen Hilfsnormen gibt es:
Definitionsnormen: Sie legen fest, wie Begriffe, die in einer Rechtsnorm vorkommen, verstanden werden sollen.
Gegennormen: Sie legen fest, wann eine anderswo angeordnete Rechtsfolge ausnahmsweise nicht eintreten soll.
Verweisungsnormen: Sie verweisen Sie ganz oder teilweise auf eine andere Norm und ersparen sich dadurch eigene Anordnungen. Es gibt sie in mehreren Varianten, denn es kann auf den Tatbestand einer anderen Norm, auf die dort angeordnete abstrakte Rechtsfolge oder auch auf die ganze Norm verwiesen werden. Dabei kann deren Anwendung angeordnet werden, obwohl ihr Anwendungsbereich eigentlich nicht eröffnet ist, oder auch deren »entsprechende« Anwendung, wozu Sie sie erst noch umformulieren müssen.
Ausfüllungsnormen: Sie konkretisieren eine anderswo schon angeordnete Rechtsfolge oder ergänzen sie um eine weitere.
Näheres über all diese Arten von Hilfsnormen finden Sie in Kapitel 6.
Wie die Regeln ineinandergreifen
Wenn Sie eine Rechtsfrage beantworten wollen, müssen Sie also eine Norm finden, die die Antwort bereithält. Da die Rechtsfrage sich – meistens – auf konkrete Rechtsfolgen bezieht, brauchen Sie eine Norm, die genau diese Rechtsfolgen anordnet. Jede Norm, die das tut, ist eine taugliche Antwortnorm.
Die Frage beantworten Sie nun, indem Sie den Sachverhalt unter die Antwortnorm subsumieren. Dabei müssen Sie Schritt für Schritt jedes einzelne Tatbestandsmerkmal der Antwortnorm darauf untersuchen, ob es durch den Sachverhalt ausgefüllt wird. Hierbei werden Sie öfter auf einen Begriff stoßen, unter den Sie nichts direkt subsumieren können, weil er das Ergebnis einer rechtlichen Wertung ist. Das nennt sich ein normatives Tatbestandsmerkmal. Ist diese rechtliche Wertung das Ergebnis der Anwendung einer anderen Norm, so ist das ein bestimmter Rechtsbegriff. Er wirft eine Vorfrage auf, die Sie nunmehr zuerst beantworten müssen. Dazu brauchen Sie eine Vor-Antwortnorm.
Paula ist ein Brief ins Haus geflattert, in dem es heißt: »Gratuliere, Sie haben einen Mercedes gewonnen!« Paula hat allerdings bei gar keinem Preisausschreiben mitgemacht. Sie will nun wissen, ob sie von dem Absender, eine Firma Shortlife Ltd., tatsächlich den Mercedes verlangen kann.
Als Antwortnorm kommt hier § 661a BGB infrage: Zu den Tatbestandsmerkmalen gehört, dass die Firma Shortlife Ltd. Unternehmerin und Paula Verbraucherin sein muss. Beides sind bestimmte Rechtsbegriffe. Bevor Sie Paulas Rechtsfrage beantworten können, müssen Sie daher zwei Vorfragen beantworten, nämlich:
1. Ist Paula Verbraucherin? Die Vor-Antwortnorm, die Sie dafür prüfen, ist § 13 BGB.
2. Ist Shortlife Ltd. Unternehmerin? Die Vor-Antwortnorm, die Sie dafür prüfen, ist § 14 BGB.
Nachdem Sie die Vorfrage beantwortet haben, kehren Sie zur Prüfung Ihrer Antwortnorm zurück. Freilich kann auch die Vor-Antwortnorm wieder einen bestimmten Rechtsbegriff enthalten, der Sie zwingt, nun erst noch eine Vor-Vorfrage zu beantworten, für die Sie erst eine Vor-Vor-Antwortnorm suchen müssen, und so weiter.
Bei jedem Ergebnis müssen Sie außerdem Ausschau nach eventuellen Gegennormen halten, die Ihnen das Ergebnis wieder aus der Hand schlagen. Das gilt nicht nur für das aus der Antwortnorm folgende Ergebnis, sondern auch für jedes Ergebnis, das die Beantwortung einer Vorfrage ergeben hat.
Und dann vergessen Sie nicht, dass auch Gegennormen nur Normen sind, die wiederum bestimmte Rechtsbegriffe enthalten können, sodass auch ihre Prüfung Vorfragen aufwerfen kann. Schließlich gibt es gelegentlich auch noch Gegen-Gegennormen, die Ihnen das Ergebnis noch einmal umdrehen!
Das alles verlangt strikt logisches Denken und einen guten Überblick darüber, was für eine Norm Sie gerade warum prüfen! Wenn Sie diesen Überblick behalten, ist das die halbe Miete auf dem Weg zur perfekten juristischen Falllösung. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 7.
Sachverhalt und Fragestellung
Eine Rechtsfrage können Sie erst beantworten, wenn Sie wissen, wie sie lautet, und wenn Sie wissen, welchen Sachverhalt Sie unter die Normen subsumieren sollen, die Sie brauchen, um die Rechtsfrage zu beantworten.
Was ist passiert?
Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber: Das ist größtenteils unwichtig. Warum? Na, weil Sie ja nicht dabei waren und daher sowieso nie sicher wissen können, was passiert ist. Sie müssen nur wissen, wovon Sie annehmen sollen, dass es passiert sei. Der Sachverhalt, den Sie unter Ihre Normen subsumieren, setzt sich wie folgt zusammen:
Es gibt Tatsachen, von denen Sie aus Rechtsgründen ausgehen müssen, weil das Gesetz das in Rechtsnormen so anordnet. Solche Normen heißen Fiktionen und unwiderlegbare Vermutungen.
Wenn vor Gericht der Beibringungsgrundsatz gilt, müssen Sie außerdem alle Tatsachen als richtig annehmen, die zwischen den Parteien unstreitig sind. Das ist vor allem im Zivilprozess so. Dort wird nach der prozessualen Wahrheit gesucht. Gilt dagegen der Untersuchungsgrundsatz, heißt das, dass Sie alles hinterfragen müssen. Nur weil es keiner bestreitet, ist es noch lange nicht wahr. Das ist vor allem im Strafprozess so. Dort wird nach der materiellen Wahrheit gesucht.
Sie müssen als richtig annehmen, was bewiesen ist. Allerdings ist der juristische Beweis kein naturwissenschaftlicher Beweis. Er ist erbracht, wenn die Lebenserfahrung Ihnen sagt, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, an der Richtigkeit einer Tatsache zu zweifeln.
Sie müssen all das als richtig annehmen, wofür eine Vermutung spricht. Vermutungen sind allerdings widerlegbar. Sie dürfen auf sie nur zurückgreifen, wenn nicht das Gegenteil feststeht (nämlich weil es seinerseits bewiesen oder – falls der Beibringungsgrundsatz gilt – unstreitig ist).
Nun kann es aber immer noch sein, dass Ihnen Tatsachen fehlen! Dann haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Alternative Prüfung:Sie nehmen erst das eine, dann das andere als richtig an und zeigen, dass es für das Endergebnis darauf nicht ankommt. Dann haben Sie gezeigt, dass die offene Tatsache zwar nicht für die Begründung, wohl aber für die endgültige Antwort auf die Fallfrage irrelevant ist.
2. Feststellungslast: Geht auch das nicht, müssen Sie klären, wer das Risiko dafür trägt, dass eine Tatsache nicht festgestellt werden kann.
Es gibt eine Regel zur Feststellungs- oder auch Beweislast, die jeder kennt. Das ist die im Strafrecht geltende Regel »In dubio pro reo« (Im Zweifel für den Angeklagten). Das Risiko, dass sich etwas nicht aufklären lässt, soll niemals der Angeklagte tragen. Schließlich soll er ja nicht bestraft werden, wenn nicht bewiesen ist, dass das auch tatsächlich gerechtfertigt ist.
Mehr zu all dem finden Sie in Kapitel 8 und Kapitel 10.
Wer will was von wem und wieso?
Die richtige Antwort können Sie nicht geben, ohne die richtige Frage zu kennen. Wenn Sie »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams gelesen haben, wissen Sie ja, dass die Antwort auf die Frage aller Fragen »42!« ist. Sie wissen auch, dass niemand damit etwas anfangen kann, weil die Frage gar nicht bekannt ist.
Wenn Sie eines Tages Rechtsanwalt sind, werden Sie schnell feststellen, dass die Leute durchaus nicht dazu neigen, Ihnen klare Fragen zu stellen. Das ist der Grund dafür, dass das auch Prüfer im Staatsexamen manchmal nicht tun.
Sie können aber aus einer Sachverhaltsschilderung die Rechtsfragen, die sich stellen können, mit einem simplen Trick auch selbst herausfinden. Sie fragen sich nämlich:
1. Wer ist mit der Situation unzufrieden?
2. Was wird der mit der Situation Unzufriedene haben (oder sonst erreichen) wollen?
3. Von wem wird er es haben wollen?
4. Warum wird er es haben wollen?
Dann nähern Sie sich der Rechtsfrage, die der Fall aufwirft, auch wenn niemand sie explizit gestellt hat. Sie glauben das nicht? Doch, das können Sie auch:
Johannes fährt mit seinem Fahrrad gemütlich pfeifend die Straße entlang. Leider sieht er die kleine Emily zu spät, die gerade dabei ist, die Straße zu überqueren, und fährt sie an. Emily hat eine Platzwunde am Knie. Johannes’ Fahrrad hat einen Achter im Vorderrad.
Nun versuchen Sie es:
1. Wer ist mit der Situation unzufrieden? Johannes, weil sein Fahrrad kaputt ist. Emily, weil sie verletzt ist. (Natürlich kommt es hier eigentlich mehr darauf an, ob Emilys Eltern unzufrieden sind, denn sie kann ja noch nichts selbst entscheiden.)
2. Was wird der mit der Situation Unzufriedene haben wollen? Johannes ein repariertes Fahrrad. Emily ein Schmerzensgeld.
3. Von wem wird er es haben wollen? Johannes von Emilys Eltern. Emily von Johannes.
4. Warum wird er es haben wollen? Johannes, weil Emilys Eltern nicht aufgepasst haben. Emily, weil Johannes nicht aufgepasst hat.
Und schon ist recht klar, wie die Fallfragen lauten und welche Antwortnormen Sie in Erwägung ziehen werden, nämlich:
1. Kann Johannes von Emilys Eltern Ersatz für die Reparatur seines Fahrrads verlangen?
2. Kann Emily von Johannes ein Schmerzensgeld verlangen?
Die Antwortnormen suchen Sie unter den in §§ 823 ff. BGB geregelten unerlaubten Handlungen. Wenn Sie das noch etwas genauer wissen wollen, lesen Sie Kapitel 9.
Die Methoden der Rechtsanwendung
Die eigentliche Methodenlehre kennt zwei Gruppen von Methoden:
Methoden der Gesetzesanwendung: solche, mit denen die bestehenden Rechtsnormen angewendet werden
Methoden der Rechtsfortbildung: solche, mit denen die bestehenden Rechtsnormen um zusätzliche Rechtssätze erweitert werden
Was heißt das eigentlich? Auslegung von Gesetzen
Gesetze enthalten Begriffe. Da der Gesetzgeber mit ihnen keinen ganz bestimmten Fall lösen will, sondern ein Instrument zur Lösung einer Vielzahl von ihm noch gar nicht bekannten Fällen bieten möchte, wird er für das Gesetz immer eine mehr oder weniger abstrakte Formulierung wählen. Die Formulierung im Gesetz lässt daher meistens einen Spielraum für die Auslegung der gewählten Begriffe.
Dass Gesetzestexte auslegungsbedürftig sein können, ist keine sehr neue Erkenntnis. Das war Juristen schon immer klar. Früher hat man Gesetze allerdings oft eingeteilt in »klare« Stellen, die man nicht auslegen darf, und »dunkle«, bei denen man nicht darum herumkommt. Erst der Hermeneutik des 19. Jahrhunderts verdanken wir die Erkenntnis, dass es so etwas wie »klare Texte« gar nicht gibt. Jeder Begriff in einer Rechtsnorm kann der Auslegung bedürfen. Das liegt daran, dass so gut wie jeder Begriff außer einem Begriffskern, der keinen Zweifel darüber zulässt, dass etwas von ihm erfasst wird, auch einen Begriffsrand hat, in dem es Interpretationssache ist, ob er etwas erfasst oder nicht. Was jenseits dieses Randes liegt, erfasst er dagegen wieder definitiv nicht.
Auslegen heißt: zeigen, dass ein im Gesetz enthaltener Begriff eine bestimmte Bedeutung hat, die den zu prüfenden Sachverhalt erfasst (oder eben nicht).
Um etwas zu zeigen, müssen Sie argumentieren. Die Argumente, die Sie zur Auslegung des Gesetzes verwenden dürfen, bezeichnet man als Auslegungsmethoden. Es gibt davon genau vier:
1. Grammatikalische Auslegung: anhand des Wortlauts
2. Systematische Auslegung: anhand des Kontexts, des Zusammenspiels mit anderen Normen
3. Teleologische Auslegung: anhand des Ziels, das der Gesetzgeber mit der Norm verfolgt
4. Historische Auslegung: anhand der Vorgeschichte und der Entstehungsgeschichte der Norm
Was das im Einzelnen heißt, lesen Sie in Kapitel 11.
Jede Auslegung hat aber eine Grenze, die vom Wortlaut der Norm gezogen wird. Dieser bestimmt den Auslegungsspielraum.
Nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB wird ein Dieb besonders streng bestraft, wenn er als Mitglied einer »Bande« handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat. Was das Gesetz nicht sagt ist: Wie viele Menschen müssen sich dazu verbunden haben, damit sie eine »Bande« bilden können?
Dabei ist die äußere und innere Grenze des Wortlauts: Ein Einzelner kann keine Bande sein. Drei Leute reichen jedenfalls dafür aus. Dazwischen liegt der Begriffsrand des Wortes »Bande«. Ob es tatsächlich drei sein müssen oder ob auch zwei schon ausreichen, ist eine Auslegungsfrage, die die Rechtsprechung tatsächlich im Lauf der Zeit verschieden beantwortet hat. Früher reichten ihr zwei (BGHSt 23, 239). Heute verlangt sie drei (BGHSt 46, 321).
Was nicht im Gesetz steht? Fortbildung des Rechts
Die Methoden der Rechtsfortbildung lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
Methoden der Gesetzesergänzung: Sie fügen den vorhandenen Rechtsnormen eine Regel hinzu, die das Gesetz enthalten müsste, aber nicht enthält. Sie stopfen also ein Loch in der Rechtsordnung.
Methoden der Gesetzeskorrektur: Sie ändern die vorhandenen Rechtsnormen, wenn sie so, wie sie im Gesetz stehen, nicht angewendet werden sollten. Sie beseitigen also einen Fehler in der Rechtsordnung.
Mit beidem ist große Zurückhaltung geboten, denn es ist ja der Gesetzgeber, der entscheidet, welche Regeln er aufstellen will, nicht die Rechtsanwender. Das zur Demokratie gehörende Prinzip der Gewaltenteilung verbietet es anderen Staatsgewalten, selbst Gesetzgeber zu spielen. Deshalb sind die Fälle, in denen Rechtsfortbildung ausnahmsweise erlaubt ist, auf einige wenige Situationen beschränkt.
Von Studenten wird selten verlangt, dass sie das Recht tatsächlich fortbilden, denn das ist schon ziemlich knifflig. Im Jurastudium reicht es, wenn Sie sich damit vertraut machen, welche Methoden der Rechtsfortbildung es gibt und wie sie grundsätzlich funktionieren. Sonst verstehen Sie ja nicht, wie die Gerichte und die Rechtswissenschaft zu manchen ihrer Ergebnisse kommt.
Wann und womit Sie das Gesetz ergänzen dürfen
Ergänzen dürfen Sie das Gesetz, wenn es eine planwidrige Lücke enthält. Die erkennen Sie daran, dass keine Rechtsnorm Ihren Fall erfasst und der Schluss, dass dann auch keine Rechtsfolge eintritt, zu einem Ergebnis führt, das
denklogisch nicht möglich ist,
in einen Wertungswiderspruch führt oder
dem mit dem Gesetz verfolgten Zweck zuwiderläuft.
Sie müssen außerdem feststellen können, dass der Gesetzgeber dies nicht etwa genau so haben wollte.
Es gibt drei Methoden, um eine solche planwidrige Lücke zu schließen. Sie sind in genau dieser Reihenfolge in Erwägung zu ziehen:
1. Gesetzesanalogie: Sie wenden eine Norm an, die einen ähnlichen Sachverhalt regelt, und formulieren sie so um, dass sie nun Ihre Rechtsfrage nach denselben Prinzipien löst.
2. Rechtsanalogie: Sie suchen nach einem allgemeinen Prinzip, das den Regelungsgrund für viele Rechtsnormen bildet und aus dem sich nach dem Muster dieser Normen eine Regel für die Lösung auch Ihrer Rechtsfrage formulieren lässt.
3. Freie Rechtsfortbildung: Sie wenden eine Regel an, die Sie für den konkreten Fall erst entwickeln.
Wann und wie Sie das Gesetz korrigieren dürfen
Auch der Gesetzgeber irrt sich gelegentlich einfach:
Wo er sich offensichtlich nur verschrieben hat, dürfen Sie das immer korrigieren und das Gesetz so lesen, wie der Gesetzgeber es eigentlich formulieren wollte. Das nennt sich kleine berichtigende Auslegung.
Wo er sich zwar nicht verschrieben, aber doch offensichtlich in dem vertan hat, was er damit erreichen wollte, dürfen Sie auch das korrigieren und das Gesetz so lesen, als hätte der Gesetzgeber geschrieben, was er hätte schreiben sollen. Das nennt sich große berichtigende Auslegung. Entscheidend ist, dass der Fehler tatsächlich offensichtlich ist, also jedem ohne großes Nachdenken sofort auffällt.
Schließlich dürfen Sie eine Norm, die der Gesetzgeber weiter formuliert hat als zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich ist, teleologisch reduzieren, nämlich wenn sie einen Fall erfasst, den sie nicht mehr erfassen muss, um all ihre Zwecke zu erreichen. Das setzt allerdings voraus, dass der Gesetzgeber nicht genau das wollte, nämlich – vorsichtshalber – auch ein paar Fälle erfassen, die er gar nicht erfassen muss, um seine Ziele zu erreichen.
Alles Weitere zu den Methoden der Rechtsfortbildung finden Sie in Kapitel 12.
Ausfüllen statt auslegen: Der unbestimmte Rechtsbegriff
Manche Gesetze enthalten einen Begriff, der bewusst so unbestimmt gehalten ist, dass man durch Auslegung allein nicht feststellen kann, ob er auf den Sachverhalt zutrifft. Dazu muss man vielmehr eine Wertung anhand der Umstände des Einzelfalls vornehmen. Ein solcher Begriff heißt unbestimmter Rechtsbegriff.
So regelt zum Beispiel § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB, dass man von einem Vertrag nicht wegen einer Pflichtverletzung des anderen Teils zurücktreten kann, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.
Was im Einzelfall unerheblich ist, lässt sich nicht bestimmen, ohne die konkreten Umstände des Einzelfalls gegeneinander abzuwägen: Was war insgesamt vertraglich geschuldet? Welche Folgen hat die Pflichtverletzung für den Gläubiger?
Bei unbestimmten Rechtsbegriffen genügt es daher nicht, sie erst auszulegen und dann den Sachverhalt unter sie zu subsumieren, sondern man muss sie ausfüllen, wozu der Sachverhalt bereits als Hilfsmittel benötigt wird.
Das Abwägen aller Umstände des Einzelfalls kann Ihnen aber auch erspart bleiben:
1. Beispiele und Regelbeispiele: Das Gesetz kann Normen enthalten, in denen wichtige Hinweise für das Ausfüllen enthalten sind. Das geschieht in Form von Beispielen dafür, wann er jedenfalls erfüllt ist oder wann er in der Regel erfüllt ist. Das stellt Weichen.
2. Fallgruppen: Wenn der unbestimmte Rechtsbegriff schon lange im Gesetz steht, hat sich oft eine allgemeine Übung herauskristallisiert, in welchen typischen Fallkonstellationen er für erfüllt gehalten wird. Solche anerkannten Fallgruppen dürfen Sie wie gesetzliche Beispiele anwenden – nur dass sie eben nicht im Gesetz stehen.
Wenn Sie mehr über das Ausfüllen unbestimmter Rechtsbegriffe wissen wollen, lesen Sie Kapitel 13.
Die Antwort und Ihre Begründung
Wenn Sie eine Antwort geben, soll sie natürlich richtig sein. Zumindest muss es Ihnen gelingen, den Fragesteller davon zu überzeugen, zumal wenn es Ihr Prüfer ist. Damit Ihre Antwort auf die Fallfrage überzeugend ist, müssen Sie Ihre Lösung auch überzeugend darstellen. Dafür gilt: Nur was logisch ist, überzeugt.
Immer schön logisch …
Logik bei der Subsumtionstechnik heißt: Stellen Sie die Verbindung zwischen dem abstrakten Begriff des Tatbestands der Norm und dem Sachverhalt über so viele Zwischenschritte her, bis das Ergebnis jeden Leser überzeugen wird. Jeder Zwischenschritt ist eine Definition. Auch eine Teildefinition reicht völlig, wenn Sie den Sachverhalt erfasst, den Sie subsumieren möchten.
Definieren, bis Evidenz erreicht ist
Die Definitionen, die Sie verwenden, müssen ihrerseits evident richtig sein. Das sind sie, wenn
Sie sie als Legaldefinitionen direkt dem Gesetz entnehmen können,
sie selbsterklärend sind,
Sie sie mit den anerkannten Auslegungsmethoden gewonnen haben oder
es sich um in Literatur und Rechtsprechung allgemein anerkannte Definitionen handelt.
Lisa wirft einen Eichenschrank mit voller Absicht um, als Laura vorbeigeht. Die liegt nun verletzt am Boden. Weswegen hat Lisa sich strafbar gemacht?
Natürlich ist das Körperverletzung im Sinne von § 223 Abs. 1 StGB. Das ist so eindeutig richtig, dass die Subsumtion unter die einzelnen Tatbestandsmerkmale (andere Person – körperlich misshandelt – Vorsatz) ohne jeden Zwischenschritt gelingt.
Dann aber überlegen Sie, ob Lisa vielleicht auch den Strafschärfungstatbestand des § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllt hat. Dazu müssen Sie entscheiden, ob der Schrank eine »Waffe« oder ein »anderes gefährliches Werkzeug« ist.
Waffe ist er natürlich keine. Das brauchen Sie nicht weiter zu vertiefen. Aber was ist ein »gefährliches Werkzeug«? Da können Sie – wie so oft im Strafrecht – auf eine allgemein anerkannte Definition zurückgreifen: ein fester Gegenstand, der, als Mittel zur Herbeiführung einer Körperverletzung eingesetzt, nach seiner Beschaffenheit und der Art seiner Benutzung geeignet ist, erhebliche Körperverletzungen herbeizuführen.
Nun geht es Schritt für Schritt weiter: Ist ein Eichenschrank ein fester Gegenstand? Fester geht’s kaum! Ist er so beschaffen, dass er erhebliche Körperverletzungen herbeiführen kann, wenn man ihn umwirft? Na klar, dazu reicht allemal sein Gewicht.
Nun haben Sie ein für jeden Leser evidentes Ergebnis gewonnen und können Lisa sagen, dass sie mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren rechnen muss.
Ihr Ergebnis muss nicht für Sie, sondern für den Leser evident sein. Sie erreichen das nicht, in dem Sie Wörter wie »offensichtlich« oder »zweifellos« einfügen! Lesen Sie dazu den Abschnitt »Von echter und falscher Evidenz« in Kapitel 14.
Was nicht logisch ist
Nicht mehr logisch ist Ihre Argumentationskette, wenn Ihnen dabei Denkfehler unterlaufen. Das ist der Fall, wenn Sie
Begriffe vertauschen: Das gleiche Wort ist nicht immer derselbe Begriff.
sich widersprechen: Wenn Sie etwas für wahr erklärt haben, können Sie es nicht später für falsch erklären.
die dritte Möglichkeit übersehen: Dass Paul nicht Nein gesagt hat, heißt noch nicht, dass er Ja gesagt hat. Er kann auch gar nichts gesagt haben.
etwas unzureichend begründen: Nämlich gar nicht, mit sich selbst, in einem Zirkelschluss oder unter Auslassung eines notwendigen Zwischenschritts.
Zu all diesen logischen Fehlern, die Sie nicht machen sollten, können Sie mehr in Kapitel 14 nachlesen.
Immer schön der Reihe nach …
Die Reihenfolge, in der Sie etwas abhandeln, soll dafür sorgen, dass Sie selbst nichts vergessen und dass Ihr Zuhörer oder Leser Ihnen folgen kann. Das geht am besten, wenn Sie dabei ein bestimmtes Strukturprinzip einhalten. Davon kennt die Rechtswissenschaft zwei:
Urteilsaufbau:





























