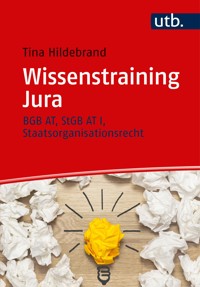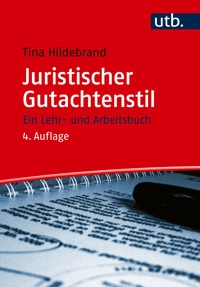
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neuauflage des erfolgreichen Leitfadens zur Erstellung juristischer Gutachten. Der Band hilft sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen, juristische Fallbearbeitungen in Seminaren und Klausuren sprachlich-stilistisch einwandfrei zu erstellen. Das Lehr- und Arbeitsbuch bietet neben theoretischen Ausführungen auch vielfältige Übungen sowie Checklisten für ein gutes Gutachten. "Bestenfalls läse jeder Erstsemesterstudent den Text." (Prof. Dr. Roland Schimmel in "Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft") Das Buch führt verständlich an alle Fragen heran, die sich im Zusammenhang mit juristischen Gutachten stellen und verbessert gezielt die Schreibkompetenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
utb 4206
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Dipl. jur. Tina Hildebrand, B. A., lehrte mehrere Jahre an der Universität Bielefeld und bot Schreibkurse und -beratung für Jura-Studierende an. Jetzt ist sie als Lehrkraft für Deutsch und Jura am Oberstufen-Kolleg Bielefeld tätig.
Tina Hildebrand
Juristischer Gutachtenstil
Ein Lehr- und Arbeitsbuch
4., aktualisierte und erweiterte Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563824
4., aktualisierte und erweiterte Auflage 2024
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2017
2. Auflage 2016
1. Auflage 2014
© 2024 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthältgegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 4206
ISBN 978-3-8252-6382-9 (Print)
ISBN 978-3-8385-6382-4 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6382-9 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1:Funktionen des Gutachtenstils
1.Warum schreibe ich Gutachten?
2.Welcher Stil ist angemessen?
3.Welche Funktionen hat ein Gutachten?
4.Warum verwende ich im Gutachten kein Passiv?
Aufgaben
Kapitel 2:Syllogistischer Schluss im gutachterlichen Viererschritt
1.Wofür ziehe ich einen syllogistischen Schluss?
2.Was kann beim syllogistischen Schluss schiefgehen?
3.Wie baue ich aus den einzelnen Schritten ein Gutachten?
4.Was bringen mir die vier Schritte?
5.Darf ich die Reihenfolge des Viererschritts unterbrechen?
Aufgaben
Kapitel 3:Obersatz
1.Welche Obersätze gibt es?
2.Welche Informationen gehören in den Obersatz?
3.Welche sprachlichen Möglichkeiten gibt es, einen Obersatz zu formulieren?
3.1Warum verwende ich Konjunktiv II?
3.2Welche „Möglichkeitswörter“ verwende ich?
3.3Kann ich Fragewort und Konjunktiv II im Obersatz verwenden?
Aufgaben
Kapitel 4:Definition
1.Warum definiere ich?
2.Was definiere ich?
3.Wer entwickelt die Definitionen?
4.Wie entwickle ich eine Definition?
5.Wo finde ich Definitionen?
6.Viele Definitionen – welche soll ich wählen?
7.Kann ich mehrere Definitionen hintereinander schreiben?
8.Zähle ich Alternativen auf, die nichts mit dem Fall zu tun haben?
9.Wie ausführlich muss eine Definition sein?
10.Schreibe ich dieselbe Definition mehrmals?
11.Ist der Unterschied zwischen Obersatz und Definition immer klar?
Aufgaben
Kapitel 5:Subsumtion
1.Was ist Subsumieren?
2.Wie formuliere ich eine Subsumtion?
3.Wie subsumiere ich „sauber“?
4.Wie lang ist eine Subsumtion?
5.Wie subsumiere ich eine Definition, die Alternativen enthält?
6.Welche Definition subsumiere ich zuerst?
7.Wie argumentiere ich in der Subsumtion?
Aufgaben
Kapitel 6:Ergebnis
1.Was ist die Funktion des Ergebnisses im Gutachten?
2.Wie formuliere ich das Ergebnis?
3.Wie formuliere ich den letzten Ergebnissatz?
Aufgaben
Kapitel 7:Typische Fehler im Gutachten
1.Wie verwechsle ich Urteil und Gutachten nicht?
2.Warum verzichte ich auf „weil“ und „da“?
3.Warum lasse ich den Begriff „Sachverhalt“ weg?
4.Schreibe ich Artikel vor die Personen?
5.Welche Wörter kürze ich ab?
Aufgaben
Kapitel 8:Schwerpunktsetzen im Gutachten
1.Was ist Schwerpunktsetzen im Gutachten?
2.Warum verkürze ich den Gutachtenstil?
3.Wann kürze ich ab?
4.Wie kürze ich ab?
5.Wie wähle ich die Abkürzungsmethode?
6.Warum brauche ich gerade beim Kürzen Überschriften?
Aufgaben
Kapitel 9:Eigenkorrektur mit Checkliste
1.Wie kann ich mein Gutachten überarbeiten?
2.Wie korrigiere ich mit der Checkliste?
Aufgabe
Kapitel 10:Meinungsstreit
1.Was ist ein Meinungsstreit?
1.1Streit über die Auslegung eines Tatbestandmerkmals
1.2Streit, ob ein Merkmal zum Tatbestand gehört
1.3Streit über das Verhältnis von Normen
2.Warum schreibe ich „Meinung“ nicht?
3.Wie nenne ich die „Meinungen“?
4.Wann erörtere ich einen Streit und wann nicht?
5.Wann ist ein Streit Schwerpunkt des Gutachtens?
6.Muss ich alle Ansichten erwähnen?
7.Wie baue ich einen Streit auf?
8.Welchen Konjunktiv brauche ich?
9.Leite ich den Streit ein?
10.Was mache ich in der Stellungnahme?
Aufgaben
Kapitel 11:Auslegung
1.Wofür brauche ich das Auslegen?
2.Wo lege ich aus?
3.Wie lege ich aus?
3.1Wie lege ich nach dem Wortlaut aus?
3.2Wie lege ich systematisch aus?
3.3Wie lege ich historisch aus?
3.4Wie lege ich nach dem Sinn und Zweck aus?
3.5Wie finde ich den Sinn und Zweck?
3.6Wie lege ich verfassungskonform aus?
3.7Wie lege ich richtlinienkonform aus?
3.8In welcher Reihenfolge lege ich aus?
3.9Lege ich in der Klausur nach allen Methoden aus?
4.Wie lege ich Willenserklärungen und Verträge aus?
Aufgaben
Kapitel 12:Juristisches Argumentieren
1.Wofür brauche ich juristische Argumentationstechniken?
2.Wann ziehe ich einen Analogieschluss?
2.1Darf ich im Strafrecht über den Wortlaut auslegen?
3.Was ist eine teleologische Reduktion?
4.Wann ziehe ich einen Umkehrschluss?
4.1Wie unterscheide ich eine abschließende von einer beispielhaften Aufzählung?
4.2Widersprechen sich Umkehrschluss und Analogieschluss?
5.Wann ziehe ich einen Erst-Recht-Schluss?
6.Wann ziehe ich einen Schluss zum Absurden?
Aufgaben
Kapitel 13:Stellungnahme
1.Schreibe ich eine „Stellungnahme“ oder einen „Streitentscheid“?
2.Welcher Stil ist in der Stellungnahme angemessen?
3.Was mache ich in der Stellungnahme?
4.Wie viele Argumente brauche ich?
4.1Wie finde ich Argumente?
4.2Wie baue ich die Argumentation auf?
4.3Wie bringe ich die Auslegung in einer Klausur ein?
5.Wie erarbeite ich selbst einen Streit?
6.Wie überarbeite ich meinen Streit?
Aufgaben
Kapitel 14:Umgang mit dem Sachverhalt
1.Was ist noch erlaubt und was ist schon „Quetschen“?
2.Wie finde ich die Schwerpunkte im Sachverhalt?
3.Muss ich stets das ganze Prüfungsschema auf den Fall anwenden?
Aufgabe
Kapitel 15:Strafrechtliche Gutachten
1.Wie formuliere ich den ersten Obersatz im Strafrecht?
1.1Wie formuliere ich die Handlung im ersten Obersatz?
1.2Wie binde ich die Handlung sprachlich ein?
1.3Wann führe ich den Erfolg im ersten Obersatz auf?
1.4Welche Zeit verwende ich im ersten Obersatz?
1.5Was beachte ich bei der Fallfrage?
1.6Was ist der Unterschied zwischen Strafbarkeit und Schuld?
1.7Was prüfe ich, wenn nicht nach der Strafbarkeit aller Beteiligten gefragt ist?
2.Wie übersehe ich keine Delikte?
3.Wann teile ich ein Gutachten in Handlungskomplexe?
4.Wie sortiere ich die Delikte innerhalb des Handlungskomplexes?
5.Wie schaffe ich das strafrechtliche Gutachten in einer Klausur?
Aufgaben
Kapitel 16:Zivilrechtliche Gutachten
1.Wie formuliere ich den ersten Obersatz im Zivilrecht?
1.1Ist ein Vertrag oder die Norm die Anspruchsgrundlage?
1.2Wie formuliere ich den Anspruchsinhalt?
2.Wie formuliere ich die anderen Obersätze?
3.Wie finde ich Anspruchsgrundlagen?
3.1Wie finde ich die richtige Anspruchsgrundlage?
3.2Wie lautet der Aufbau einer Anspruchsprüfung?
3.3Wie baue ich das gesamte zivilrechtliche Gutachten auf?
Aufgaben
Kapitel 17:Öffentlich-rechtliche Gutachten
1.Wie baue ich ein öffentlich-rechtliches Gutachten auf?
2.Wie formuliere ich den ersten Obersatz?
3.Schreibe ich „soweit“ oder „wenn“ im ersten Obersatz?
4.Warum schreibe ich nicht die Klage habe „Aussicht“ auf Erfolg?
5.Wann prüfe ich Zulässigkeit und Begründetheit?
6.Darf ich verfassungsmäßig und rechtmäßig austauschen?
7.Wie finde ich die richtige Verfahrensart?
8.Was mache ich in der Zulässigkeit?
9.Was mache ich in der Begründetheit?
10.Wie prüfe ich die Verhältnismäßigkeit?
11.Wie gehe ich in der Klausur vor?
11.1Die „halbklassische“ Variante
11.2Die „Umkehrvariante“
Aufgaben
Lösungen
Literatur
Vorwort
Dieses Buch richtet sich an alle, die ein juristisches Examen ablegen wollen. ExamenskandidatInnen müssen den Gutachtenstil beherrschen, gleichzeitig wird ihnen kaum Wissen über diesen Stil vermittelt oder die Möglichkeit gegeben, ihn zu trainieren. Es musste also ein Buch her – eines, das Wissen vermittelt und trainiert.
Wenn Sie, angeregt durch das Buch, über das Schreiben nachdenken, werden Sie langsamer, das ist normal. Langfristig ist das Ziel, schneller und besser zu werden. Vergleichen Sie Schreiben mit Autofahren: Erst müssen Sie fahren und überlegen, bis sich die Fähigkeiten automatisieren. Das Reflektieren über den Gutachtenstil lohnt sich also, Sie schreiben mit weniger Zeitdruck formell und inhaltlich bessere Gutachten.
Der Inhalt dieses Lehrbuches ist durch viele Fragen der Studierenden in den Schreibkursen und der juristischen Schreib-Beratung entstanden, was sich in der Frage-Antwort-Struktur widerspiegelt. Außerdem waren eigene Fehler, die Analyse von Gutachten und viele Gespräche mit Kolleg:innen hilfreich. Vielen Dank dafür an: den Mittagstisch (Kai Zaki, Torsten Breder und Tobias Diedrich), Julia Maier, Denise Freisem, Heike Brandl und das PunktUm-Team, Elke Langelahn, Denis Hedermann und alle anderen, die das Projekt unterstützt haben.
Wenn Ihnen beim Lesen neue Ideen zum Gutachtenstil einfallen, schicken Sie mir eine E-Mail an: [email protected].
Kapitel 1:Funktionen des Gutachtenstils
1.Warum schreibe ich Gutachten?
2.Welcher Stil ist angemessen?
3.Welche Funktionen hat ein Gutachten?
4.Warum verwende ich im Gutachten kein Passiv?
Aufgaben
1.Warum schreibe ich Gutachten?
In Ihrem späteren Beruf werden Sie ein Gutachten „denken“, um die Fallfrage Ihres Mandanten zu beantworten. Diese Denkmethode hinterfragt erst einmal jeden Punkt und legt sich dann auf ein Ergebnis fest. Damit ist das Gutachten das Mittel der Wahl, um sicherzustellen, dass Sie keinen relevanten Punkt übersehen und jeden „Coup“ der Gegenseite vorhersehen. Zu Beginn des Studiums zweifeln Sie daher in Ihrem Gutachten Dinge an, die Sie vorher nie angezweifelt hätten.
Beispiel: Ist ein Fahrrad eine Sache?
Das Gutachten ermöglicht diesen Weitblick durch seine neutrale Struktur, indem es das Ergebnis für jeden Punkt mit der Gutachtenmethode herleitet. Der Trick ist, sich selbst beim Denken zu „beobachten“. Ihr Blickwinkel bleibt offen und Sie betrachten die Frage neutral aus vielen juristischen Perspektiven. Die Fallfrage beantworten Sie erst mit dem letzten Satz des Gutachtens.
Merke: Gutachtenschreiben ist eine Art, juristisch zu denken. Mit einem sorgfältigen Gutachten zeigen Sie, dass Sie juristisch denken können.
2.Welcher Stil ist angemessen?
Wenn Sie einen Text schreiben, egal ob juristisch oder nicht, ist für den Stil entscheidend, welche Funktion dieser Text haben soll. Wollen Sie begeistern, wählen Sie enthusiastische Ausdrücke, wollen Sie überzeugen, legen Sie Wert auf Objektivität und eine klare Argumentation. Die Funktion eines Textes wirkt sich auf den Stil, den Aufbau und die Wortwahl aus.
Auch juristische Texte – Gesetze, Aufsätze, Kommentierungen usw. – haben bestimmte Funktionen, die sich sogar von Textsorte zu Textsorte unterscheiden können. Ein Lehrbuch ist anders aufgebaut und verwendet andere Formulierungen als ein Gutachten. Daher schließen Sie nicht vom Stil eines Lehrbuchs auf den eines Gutachtens. Erschrecken Sie also nicht vor den manchmal komplizierten Sätzen in einem Lehrbuch. Die Sätze in einem Gutachten sind einfacher strukturiert. Es ist kein schlechter Stil, mehrere Hauptsätze aneinanderzureihen oder Wörter zu wiederholen – im Gegenteil – das ist angenehm für den Korrektor, weil er, wie bei einer Liste, schnell abhaken kann, was Sie alles geprüft haben.
3.Welche Funktionen hat ein Gutachten?
Sie „denken“ als Anwältin oder Anwalt ein Gutachten, um dem Mandanten zu geben, was er sich wünscht: Die Beantwortung seiner Frage neutral und ohne unwichtige Exkurse. Daher erfüllt die Sprache im Gutachten vor allem die Funktionen Neutralität und Ökonomie.
Neutralität bedeutet, dass Sie keine wertenden Ausdrücke, wie „offensichtlich“ oder „zweifelsohne“, verwenden.1 Außerdem bleiben Sie anonym, indem Sie nicht in der Ich-Form schreiben.
Tipp: Verzichten Sie auf Abtönungswörter wie: halt, eben, ruhig, bloß. Diese Wörter enthalten eine Bewertung.
Ökonomie bedeutet, dass Sie so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig schreiben, um die Fallfrage zu beantworten. Den Maßstab für die Einschätzung, was nötig ist, liefert die Fallfrage. Alles, was nicht die Fallfrage beantwortet, streichen Sie. „Alles rein!“ gilt nicht für ein Gutachten. „Rein“ darf nur, was die Fallfrage beantwortet. Überlegen Sie daher genau, ob Sie jeder Satz der Falllösung näher bringt. Erliegen Sie nicht der Versuchung, Wissen abzuladen, das für die Lösung nicht relevant ist. Im Gutachten besteht die Gefahr bei der Definition. Nach manchem spitzfindigen Korrektor ist sogar jedes Wort falsch, das nicht der Lösung dient. Das mag übertrieben sein – oder eine Provokation – letztlich heißt es nur, dass Sie keinen Satz schreiben sollten, den Sie keinem Gutachtenschritt zuordnen können.
Merke: Alles, was die Fallfrage beantwortet, muss „rein“. Alles darüber hinaus darf nicht „rein“.
4.Warum verwende ich im Gutachten kein Passiv?
In anderen wissenschaftlichen Studienfächern wird häufig Passiv als Zeichen der Neutralität verwendet. Das Passiv hat nämlich den Vorteil, dass die handelnde Person nicht genannt wird und der Fokus auf der Sache liegt. Für Juristen ist aber gerade wichtig, wer handelt.
Beispiel Passiv: Es könnte ein Kaufvertrag geschlossen worden sein.
Beispiel Aktiv: V und K könnten einen Kaufvertrag geschlossen haben.
Merke: Vermeiden Sie Passivkonstruktionen.
Aufgaben
Aufgabe 1:
Vergleichen Sie die Gutachtenauszüge: Welcher Stil ist angemessen? Entscheiden Sie anhand der Fallfrage im Obersatz, was überflüssig oder unpassend ist und streichen Sie diese Formulierungen.
Auszug I: Fraglich ist, ob das Demonstrationsverbot für die Partei „Ganz Recht“ in die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 I GG eingreift. Ein Eingriff ist jede staatliche Maßnahme, die dem Einzelnen das vom Grundrecht geschützte Verhalten erschwert oder unmöglich macht. Durch das Verbot der Demonstration wird der „Ganz Recht“-Partei die geplante Versammlung unmöglich gemacht. Folglich greift das Demonstrationsverbot in die Versammlungsfreiheit ein.
Auszug II: Wahrscheinlich greift das Demonstrationsverbot für die Partei „Ganz Recht“ in die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 I GG ein. Ein Eingriff ist ja immerhin jede staatliche Maßnahme, die dem Einzelnen das vom Grundrecht geschützte Verhalten leider erschwert oder unmöglich macht. Dieses Grundrecht ist aufgrund des Demokratieprinzips, nachdem alle Macht vom Volk ausgeht, von höchster Bedeutung. Durch das Verbot der Demonstration wird der „Ganz Recht“-Partei auf jeden Fall die geplante Versammlung unmöglich gemacht. Folglich greift das Demonstrationsverbot natürlich sehr stark in die Versammlungsfreiheit ein.
Aufgabe 2:
Korrigieren Sie die Sätze nach Verstößen gegen die Funktionen Neutralität und Ökonomie.
a)A hat sich zweifelsfrei gem. § 212 I StGB wegen Totschlags strafbar gemacht.
b)Im vorliegenden Fall ist hier nun vordergründig zu untersuchen, ob das Zeitungsinserat ein Angebot ist.
c)Es ist eindeutig festzustellen, dass ein Anspruch des A gegen B besteht.
d)Sie hat sich nur wehren wollen.
e)Im Sachverhalt deutet nichts darauf hin, dass A nicht geschäftsfähig ist.
f)Die Vorschrift greift offensichtlich in die Meinungsfreiheit der A ein.
g)Er hat bloß den Arm gehoben, um zu winken, er wollte gar kein Angebot bei der Versteigerung abgeben.
Aufgabe 3:
Formulieren Sie von Passiv in Aktiv.
a)Eine körperliche Misshandlung wurde begangen. (Personen: Täter T und Opfer O)
b)Ein Angebot wurde abgegeben. (handelnde Person: K)
c)Eine Verfassungsbeschwerde wurde erhoben. (handelnde Person: M)
1Ebenso: Wieduwilt, JuS, 2010, 288 (289).
Kapitel 2:Syllogistischer Schluss im gutachterlichen Viererschritt
1.Wofür ziehe ich einen syllogistischen Schluss?
2.Was kann beim syllogistischen Schluss schiefgehen?
3.Wie baue ich aus den einzelnen Schritten ein Gutachten?
4.Was bringen mir die vier Schritte?
5.Darf ich die Reihenfolge des Viererschritts unterbrechen?
Aufgaben
1.Wofür ziehe ich einen syllogistischen Schluss?
Sie stehen vor der Schwierigkeit, konkrete Antworten anhand von abstrakten Gesetzen geben zu müssen. Diese Kluft überwinden Sie mit dem syllogistischen Schluss. Der Syllogismus schließt vom Allgemeinen auf das Besondere. Juristisch heißt dies: vom allgemeinen Gesetz zum besonderen Fall. Der Syllogismus besteht aus drei Schritten: Obersatz, Untersatz und dem logischen Schluss.
Beispiel für einen Syllogismus: Ist Dortmund eine Großstadt?
Obersatz: Eine Stadt ist eine Großstadt, wenn sie mindestens 100 000 Einwohner hat.
Untersatz: Dortmund hat über 500 000 Einwohner.
Logischer Schluss: Dortmund ist also eine Großstadt.
Im Gutachten ziehen Sie für jeden Prüfungspunkt einen syllogistischen Schluss und stellen ihn im gutachterlichen Viererschritt dar. Der Syllogismus ist dreischrittig, das Gutachten vierschrittig.
Tipp: Beachten Sie, dass der syllogistische „Obersatz“ nicht mit dem gutachterlichen Obersatz übereinstimmt. Dieser heißt im Gutachten „Definition“. Der „Untersatz“ ist die gutachterliche Subsumtion.
Syllogismus
Gutachten
—
Obersatz
Obersatz
Definition
Untersatz
Subsumtion
Logischer Schluss
Ergebnis
Im Gutachten stellen Sie eine konkrete Frage im Obersatz. Diese beantworten Sie in der Definition zunächst abstrakt, also ohne den konkreten Fall. Den konkreten Fall beziehen Sie erst in der Subsumtion mit ein und verbinden so den Fall mit der abstrakten Antwort aus der Definiton. Den Obersatz beantworten Sie mit einer Schlussfolgerung im Ergebnis.
Beispiel im gutachterlichen Viererschritt:
Obersatz: Fraglich ist, ob Dortmund eine Großstadt ist.
Definition: Eine Stadt ist eine Großstadt, wenn sie mindestens 100 000 Einwohner hat.
Subsumtion: Dortmund hat über 500 000 Einwohner.
Ergebnis: Dortmund ist eine Großstadt.
Juristisches Beispiel:
Obersatz: T könnte heimtückisch gehandelt haben.
Definition: Heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt.
Subsumtion: T hat sich hinter der Tür so versteckt, dass O ihn nicht wahrnehmen konnte. Somit hat T die Arg- und Wehrlosigkeit des O ausgenutzt.
Ergebnis: T handelte heimtückisch.
2.Was kann beim syllogistischen Schluss schiefgehen?
Der syllogistische Schluss hat zwei Knackpunkte: Definition und Subsumtion. Ist die Definition unvertretbar, ist auch der Schluss unvertretbar. Um die „Vertretbarkeit“ der Definitionen zu gewährleisten, gibt es Regeln: die juristischen Auslegungsmethoden (s. Kapitel 12).
Beispiel:
Fraglich ist, ob Micky eine Maus ist.
Eine Maus ist ein Lebewesen, das Käse mag.
Micky mag Käse.
Folglich ist Micky eine Maus.
Die Definition ist unvertretbar, denn nicht nur Mäuse mögen Käse. Daher eignet sich „mag Käse“ nicht als Definition. Nach dieser Definition wäre auch jeder Mensch, der Käse mag, eine Maus.
3.Wie baue ich aus den einzelnen Schritten ein Gutachten?
Wichtig ist, dass sich jeder Schritt aus dem vorherigen ergibt. Auf diese Weise machen Sie die Prüfung logisch nachvollziehbar und verdeutlichen dem Leser, warum Sie etwas prüfen. Dazu ein Beispiel aus dem Alltag: Wenn Sie nach Paris fahren, packen Sie erst Ihren Koffer und steigen dann in den Zug, andersherum geht es nicht. Genauso logisch aufgebaut sollte Ihr Gutachten sein, d. h. ein Schritt ergibt sich aus dem vorherigen.
Im Gutachten zeigt sich die logische Struktur dadurch, dass jeder Schritt etwas vom nächsten enthält. Zwischen Definition und Subsumtion einerseits und zwischen Obersatz und Ergebnis andererseits besteht eine größere inhaltliche Übereinstimmung.
Beispiel: Logische Struktur mit Sachverhalt
Obersatz: Fraglich ist, ob Tvorsätzlichgeschlagen hat.
Definition: Vorsätzlich handelt, wer willentlich und wissentlich den objektiven Tatbestand erfüllt.
Subsumtion: Twusste, dass er Oschlug und wollte dies auch.
Ergebnis: Somit hat Tvorsätzlichgeschlagen.
Beispiel: Logische Struktur ohne Sachverhalt
Tipp: Das zu prüfende Merkmal gehört nicht in die Subsumtion.
Diese Struktur eines einzelnen Prüfungspunktes finden Sie auch in der Gesamtstruktur des Gutachtens wieder. Ist im Obersatz nach einer Norm gefragt, können Sie in der Definition die Voraussetzungen der Norm nennen. Die Subsumtion ist die Prüfung aller Voraussetzungen. Der letzte Satz ist der Ergebnissatz für den ersten Obersatz.
Allerdings ist es unüblich, nach dem Norm-Obersatz alle Voraussetzungen zu nennen, zu leicht vergisst man eine. Stattdessen bietet sich ein Obersatz mit dem ersten Tatbestandsmerkmal an.
Beispiel: Gesamtstruktur eines Gutachtens
Obersatz der gesamten Prüfung
A könnte sich wegen Körperverletzung gemäß § 223 I StGB strafbar gemacht haben, indem er B mit der Faust ins Gesicht schlug.
Definition der gesamten Prüfung [Diesen Satz können Sie weglassen.]
Voraussetzung ist, dass A den Tatbestand des § 223 I StGB erfüllt hat sowie rechtswidrig und schuldhaft handelte.
Subsumtion aller Voraussetzungen
I. Tatbestand
1. A könnte B durch den Faustschlag körperlich misshandelt haben.
Eine körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt.
Der Faustschlag ist eine üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden des B nicht nur unerheblich beeinträchtigt.
Somit hat A den B körperlich misshandelt.
2. Durch den Schlag hat A ebenso die Gesundheit des B geschädigt.
3. A handelte vorsätzlich.
II. Rechtswidrigkeit
Der Schlag des A war rechtswidrig.
III. Schuld
A handelte zudem schuldhaft.
Ergebnis der gesamten Prüfung
Damit hat sich A wegen Körperverletzung gem. § 223 I StGB strafbar gemacht.
4.Was bringen mir die vier Schritte?
Der Vorteil des Viererschritts besteht darin, Ihnen eine Struktur zu geben. Es gibt Regeln dafür, was in jedem Satz stehen soll. Das ist ein sehr großer Unterschied zu anderen Textsorten, bei denen man häufig mit Schreibblockaden zu kämpfen hat. Außerdem ermöglicht Ihnen die feste Reihenfolge, unbekannte Fälle zu lösen.
5.Darf ich die Reihenfolge des Viererschritts unterbrechen?
Sie müssen den Viererschritt sogar unterbrechen. Regelmäßig werden Sie feststellen, dass Sie nach dem ersten Obersatz einen zweiten formulieren, nämlich für das erste Tatbestandsmerkmal. Zudem kann ein Begriff der Definition nicht klar sein. Dann können Sie wählen, ob Sie eine weitere Definition anschließen oder einen neuen Obersatz für den unklaren Begriff formulieren.