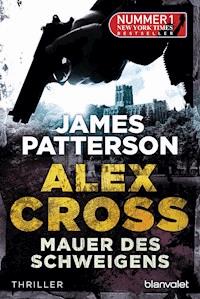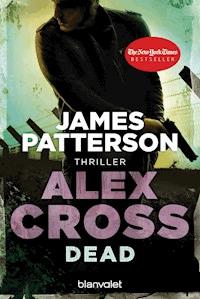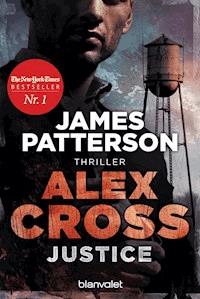
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Alex Cross ermittelt in seinem tödlichsten – und persönlichsten – Fall!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Detective Alex Cross kehrt zum ersten Mal seit über dreißig Jahren zurück in seinen Heimatort Starksville in North Carolina, denn sein Cousin Stefan wird eines schrecklichen Verbrechens beschuldigt. Auf der Suche nach Beweisen für Stefans Unschuld stößt Cross auf ein Familiengeheimnis, das alles infragestellt, woran er je geglaubt hat. Kurz darauf wird er außerdem in die lokalen Ermittlungen bezüglich einer grausamen Mordserie hineingezogen. Bald schon ist Alex Cross nicht nur einem brutalen Killer auf den Fersen, sondern auch der Wahrheit über seine eigene Vergangenheit – und die Antworten, die er findet, könnten sich als tödlich erweisen.
Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Zum ersten Mal seit über dreißig Jahren kehrt Alex Cross in seinen Heimatort Starksville in North Carolina zurück, und der Anlass ist alles andere als erfreulich: Sein Cousin wird eines schrecklichen Verbrechens beschuldigt. Cross muss alles daransetzen, seine Unschuld zu beweisen – und das in einer Stadt, in der jeder bestechlich zu sein scheint. Noch dazu fördert er im Laufe seiner Ermittlungen ein Familiengeheimnis zutage, das alles infrage stellt, woran er je geglaubt hat. Auf den Spuren eines Geists, den er für tot gehalten hatte, wird Cross hineingezogen in einen Fall, der die örtliche Polizei vor ein Rätsel stellt: eine grausige Mordserie in Promikreisen. Nicht nur muss Cross einen brutalen Killer unschädlich machen, sondern auch die Wahrheit über seine eigene Vergangenheit ans Licht bringen. Doch was, wenn die Antworten, die er findet, sich als tödlich erweisen?
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
JUSTICE
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Cross Justice« bei Little, Brown and Company, New York.
1. AuflageCopyright der Originalausgabe © 2015 by James Patterson Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Gerhard Seidl, text in formUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© David Dea, © conrado) AF · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-22498-1V002www.blanvalet.de
Prolog
I FEEL PRETTY …
1 Coco ließ den Leichnam in der gefüllten Badewanne liegen und betrat den riesigen begehbaren Kleiderschrank mit nichts am Leib außer einem schwarzen Seidenhöschen und schwarzen, bis zu den Ellbogen reichenden Handschuhen. Zuerst mal befand sich hier nur Freizeitkleidung, alles sehr gute Qualität, keine Frage, aber nicht das, wonach Coco im Moment der Sinn stand.
Handgeschneiderte Roben. Schicke Abendkleider. Die verführerische Dramatik einer eleganten Garderobe, das war es, was Coco magnetisch anzog. Professionelle Blicke und geübte, behandschuhte Finger glitten zunächst über ein mausgraues, schulterfreies Kleid von Christian Dior und anschließend eine weiße Gucci-Robe mit einem tiefen Rückenausschnitt.
Die Schnitte waren nach Cocos Ansicht großartig, aber die handwerkliche Arbeit war nicht ganz so exakt, die Ausführung nicht ganz so überzeugend, wie man es bei Kleidungsstücken, für die zehntausend Dollar und mehr verlangt wurden, eigentlich erwarten würde. Selbst auf dem Gipfel des Luxussegments war die Kunst des Kleiderschneiderns heutzutage nicht mehr das, was sie einmal gewesen war, gerieten die alten Fertigkeiten mehr und mehr in Vergessenheit. Ein Jammer. Eine Schande. Ein Frevel, wie Cocos längst verstorbene Mutter es ausgedrückt hätte.
Trotzdem wanderten die beiden Stücke in einen Kleidersack, zur späteren Verwendung.
Coco schob noch ein paar Kleider mehr zur Seite und suchte nach dem einen, das herausstach, das große Emotionen hervorrief, nach dem einen, das einen sagen ließ: »Ooooh ja. Das ist mein Traum. Meine Fantasie. Die ist es, die ich heute Abend sein möchte.«
Bei einem Cocktailkleid von Elie Saab war die Suche schließlich zu Ende. Größe 36. Perfekt. Tiefdunkle blaue Seide, ärmellos, mit einem tiefen Dekolleté und einem rautenförmigen Rückenausschnitt – auf spektakuläre Weise retro, späte Fünfziger, frühe Sechziger, wie aus dem Garderobenfundus der Fernsehserie Mad Men.
Mr. Draper zur Besprechung, bitte. Sabbern ausdrücklich gestattet.
Coco kicherte, aber an diesem Kleid war nichts Lächerliches. Es war ein durch und durch atemberaubendes Stück, ein Kleidungsstück, das sämtliche Gespräche in einem Drei-Sterne-Restaurant oder einem Ballsaal voll mit den Reichen, Mächtigen und Prominenten dieses Planeten zum Erliegen bringen konnte. Es war eines jener seltenen Kleider, das über ein eigenes Gravitationsfeld verfügte und die Lust aller Männer sowie den Neid aller Frauen in einem Umkreis von hundert Metern auf sich zog.
Coco ergriff es, trat vor den hohen Spiegel am hinteren Ende des begehbaren Kleiderschranks und blieb eine Weile davor stehen, um sich zu bewundern. Groß gewachsen und schlank, mit einem Gesicht wie gemalt für die Titelblätter der großen Zeitschriften und der Körperhaltung einer Tänzerin, dazu ovale haselnussbraune Augen und eine makellose Haut. Die kaum angedeuteten Brüste und die schlanken, jungenhaften Hüften vervollständigten das Bild, und wäre die Welt nicht so schrecklich grausam gewesen, dann hätte ein sinnliches Geschöpf wie dieses auf den Laufstegen von Paris bis Mailand endlose Triumphe gefeiert.
Zutiefst frustriert starrte Coco jetzt auf das einzige Ding, das einem Traumleben als glamouröses Supermodel immer noch im Weg stand. Denn trotz des Klebebands unter dem schwarzen Höschen konnte es wenig Zweifel geben, dass Coco ein Mann war.
2 Vorsichtig, um das Make-up nicht zu verschmieren, streifte Coco die Elie-Saab-Robe über seinen glatten kahlen Schädel und seine femininen Schultern, hoffte inständig, dass die fließenden Linien des Kleids jeden Hinweis auf seine Männlichkeit verbargen.
Seine Gebete wurden erhört. Als Coco sich den Stoff über den Hüften und den Oberschenkeln glatt strich, da war er fraglos und trotz der Glatze eine atemberaubend schöne Frau.
Dann entdeckte er hauchzarte schwarze, bis zu den Oberschenkeln reichende Seidenstrümpfe und schlüpfte sehr behutsam hinein, bevor er sich vor das Schuhregal neben den Spiegeln stellte. Er zählte, aber bei zweihundert Paaren hörte er auf.
Was war Lisa gewesen? Eine Reinkarnation von Imelda Marcos?
Er lachte und entschied sich für ein Paar schwarze Stilettos von Sergio Rossi. Sie drückten zwar vorn an den Zehen ein wenig, aber wenn es um Mode ging, dann musste eine Frau tun, was eine Frau eben tun musste.
Nachdem er die Riemen festgezogen und das Gleichgewicht gefunden hatte, verließ er den begehbaren Kleiderschrank und betrat die riesengroße Suite. Ohne der exklusiven Einrichtung Beachtung zu schenken, stellte er sich vor das Schminktischchen mit der großen Schmuckschatulle.
Nach etlichen eher uninteressanten Stücken entdeckte er ein Paar tahitianischer Perlenohrringe und die dazugehörige Halskette von Cartier, die das Kleid ergänzten, aber keinesfalls übertönten. Wie hatte seine Mutter immer gesagt? Zuerst das Herzstück, dann die Accessoires.
Er legte den Perlenschmuck an und griff nach der Fendi-Einkaufstasche, die er schon vorher neben dem Schminktischchen abgestellt hatte. Er kramte zwischen den Papiertüchern in der Tasche herum, ohne das zusammengefaltete Polohemd, die Jeans und die Bootsschuhe zu beachten, und zog schließlich eine ovale Schachtel hervor.
Coco nahm den Deckel ab und brachte eine Perücke zum Vorschein. Sie war über fünfzig Jahre alt, aber immer noch in einem makellosen Zustand. Sie bestand aus üppigem, vollem Naturhaar, dunkelblond, nicht gefärbt. Jede einzelne Strähne hatte ihren natürlichen Glanz, ihre Spannkraft und ihre Struktur perfekt behalten.
Er setzte sich an das Schminktischchen, steckte die Hand noch einmal in die Einkaufstasche und holte ein kleines Stück doppelseitiges Teppichklebeband heraus. Mit einer Schere aus der Schublade des Schminktischchens schnitt er das Klebeband in vier gleich große, je rund zweieinhalb Zentimeter lange Teile. Anschließend zog er mit den Zähnen einen der langen schwarzen Handschuhe von den Fingern.
Er löste die Schutzfolie von der Rückseite der Klebestreifen und ließ den Abfall in die Fendi-Tasche fallen. Dann befestigte er die vier Stücke auf seiner Kopfhaut – eines auf dem Scheitelpunkt, das zweite rund siebeneinhalb Zentimeter weiter vorn, und dann noch je eines über den Ohren.
Nachdem er den Handschuh wieder angezogen hatte, nahm Coco die Perücke aus der Schatulle, stülpte sie sich behutsam auf den Kopf, schaute dabei in den Spiegel und rückte sie ganz vorsichtig zurecht. Er seufzte vor Wohlgefühl.
In Cocos Augen sah die Perücke noch immer ganz genau so spektakulär aus wie damals, vor vielen Jahren, als er sie das erste Mal wahrgenommen hatte. Sie war von einem Meister in Paris hergestellt worden. Der hatte das Haar in der Mitte gescheitelt, die Haare im Nacken relativ kurz geschnitten und an den Schläfen gleichmäßig länger werden lassen. Das brachte die langen Schläfenlocken besonders gut zur Geltung, sodass die Haare jetzt einen tropfenförmigen Rahmen für Cocos Gesicht bildeten, der kurz unter dem Kinn und knapp über der Perlenkette seinen Abschluss fand.
Hochzufrieden mit seiner gesamten Erscheinung legte Coco eine frische Schicht Lippenstift auf und bedachte die Frau, die ihn aus dem Spiegel ansah, mit einem verführerischen Lächeln.
»Du bist wunderschön heute Abend, meine Liebe«, sagte er erfreut. »Ein wahres Kunstwerk.«
Dann zwinkerte er seinem Spiegelbild zu, stand auf und begann zu singen: »I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and …«
Während er sang, betrachtete er mit kundigem Blick die Schmuckschatulle und holte etliche vielversprechende Stücke mit großen Smaragden heraus. Er steckte sie ebenfalls in die Fendi-Tasche und ging dann noch einmal zurück in den Schrank. Dort rückte er ein Regal voller gestärkter Männerhemden beiseite und brachte einen Tresor mit einer Tastatur zum Vorschein.
Coco hatte den Code im Kopf, tippte ihn ein und holte hocherfreut zehn jeweils zehn Zentimeter dicke Päckchen mit Fünfzigdollarnoten heraus. Auch sie landeten in der Fendi-Tasche, dann machte er den Tresor wieder zu, steckte die Tasche samt Inhalt in den Kleidersack, zog den Reißverschluss zu und legte ihn sich über die Schulter.
Vor dem Verlassen des Schrankzimmers schnappte er sich noch einen Schlüsselbund. Dabei fiel sein Blick auf eine ungewöhnlich geformte, fünfeckige, schwarz-goldene Badgley-Mischka-Alba-Handtasche. Er holte sie aus dem Regal. Was für ein Glück!
Er ließ die Schlüssel hineinfallen.
In der Suite zögerte er noch einmal und ging kurz ins Badezimmer, das allein so groß war wie ein kleines Häuschen. Dabei rief er: »Lisa, Schätzchen, ich fürchte, ich muss jetzt los.«
Coco drehte den Kopf nach links und betrachtete die brünette Frau in der Badewanne mit einer Mischung aus Interesse und Traurigkeit. Lisas tote türkisfarbene Augen waren weit aus den Höhlen hervorgetreten und ihre Collagenlippen verzerrt, als ob durch den Kurzschluss, den das ins Wasser gefallene, eingesteckte Radio verursacht hatte, sämtliche Sicherungen in ihrem aufgerissenen Mund durchgebrannt waren. Verblüffend eigentlich, angesichts des technologischen Fortschritts und der Entwicklung von Schutzschaltern, dass ein bisschen Strom und eine Badewanne voller Wasser immer noch genügten, um ein schlagendes Herz ins Stocken zu bringen.
»Ich muss zugeben, meine Liebe, du hast sehr viel mehr Geschmack gehabt, als ich dir je zugetraut hätte«, sagte Coco zu der Toten. »Nach einer kurzen Inspektion deines Kleiderschranks ist mir Folgendes klar geworden: Du hattest das Geld, und du hast es sinnvoll verwendet. Und, ganz ehrlich? Selbst im Tod bist du noch wunderschön. Brava, meine Liebe. Brava.«
Er hauchte ihr ein Küsschen zu, drehte sich um und ging weg.
Mit entschlossenen Schritten durchquerte Coco die Villa und gelangte über die Wendeltreppe ins Foyer hinab. Es war später Nachmittag, und bald würde die Dämmerung einsetzen. Die untergehende Sonne Floridas schien zu den Fenstern herein und warf ihre goldenen Strahlen auf ein Ölgemälde an der hinteren Wand.
Coco fand, dass der Künstler Lisa in all ihrer Schönheit getroffen hatte, auf dem Höhepunkt ihrer weiblichen Ausstrahlung, Eleganz und Reife. Niemand konnte das je rückgängig machen. Von heute an würde Lisa nur noch die Frau auf diesem Bild sein und nicht die leblose Hülle im ersten Stock.
Er trat durch die Haustür und gelangte auf eine kreisförmige Einfahrt. Es war Ende Juni und im Landesinneren unerträglich heiß. Aber hier, so dicht am Meer, wehte eine sanfte, angenehme Brise.
Coco ging die Einfahrt entlang, vorbei an Lisas perfekt gepflegtem Garten mit seinen üppigen tropischen Farben und den blühenden Orchideen. Wilde Papageien hockten hoch oben in den Palmen und krächzten laut, als er auf eine Taste drückte und das Tor aufschwingen ließ.
Er ging einen Block weiter, vorbei an gepflegten Rasenflächen und hübschen Häusern, und genoss das Klicken seiner Absätze auf dem Bürgersteig und das Gefühl, wie das Seidenkleid seine seidenumhüllten Oberschenkel streichelte.
Etwas weiter vorn am Straßenrand parkte ein ungewöhnlicher, alter Sportwagen – ein dunkelgrüner Aston Martin DB5, in der Cabrio-Version. Der Aston hatte schon bessere Tage gesehen und benötigte dringend die eine oder andere Reparatur, aber Coco liebte den Wagen noch immer heiß und innig, wie ein unsicheres Kind sich an seine Lieblingsdecke klammerte, so lange bis sie irgendwann einfach zu Staub zerfiel.
Er stieg ein, legte den Kleidersack auf den Beifahrersitz und steckte den Zündschlüssel ins Schloss. Röhrend erwachte der Motor zum Leben. Nachdem er das Verdeck aufgeklappt hatte, legte er den ersten Gang ein und lenkte den Aston in den spärlichen Abendverkehr.
Heute Abend bin ich wunderschön, dachte Coco. Und es ist ein spektakulärer Abend hier in Palm Beach, in meinem Paradies. Romanzen ohne Zahl und Gelegenheiten in Hülle und Fülle warten auf mich. Ich spüre schon, wie sie auf mich zukommen.
Wie meine Mutter immer gesagt hat: Eine Frau braucht im Leben nichts weiter als Mode, Liebe und die eine oder andere Gelegenheit.
ERSTER TEIL
STARKSVILLE
1 Als ich die Hinweistafel mit der Aufschrift »Starksville, North Carolina, 10 Meilen« sah, wurde mein Atem flacher. Mein Puls beschleunigte sich, und ich wurde von einer irrationalen, düsteren Niedergeschlagenheit erfasst.
Meine Frau Bree saß neben mir auf dem Beifahrersitz unseres Ford Explorer. Sie musste es bemerkt haben. »Alles in Ordnung, Alex?«, erkundigte sie sich.
Ich versuchte, die seltsamen Gefühle, die mich so plötzlich angefallen hatten, abzuschütteln und sagte: »Ein großer Schriftsteller aus North Carolina, Thomas Wolfe, hat einmal geschrieben, dass man nie wieder nach Hause zurückkehren kann. Ich frage mich gerade, ob er vielleicht recht hat.«
»Wieso können wir nicht mehr nach Hause, Dad?«, wollte mein fast sieben Jahre alter Sohn Ali wissen, der auf der Rückbank saß.
»Das ist bloß eine Redewendung«, sagte ich. »Wenn man in einem kleinen Ort aufwächst und dann wegzieht, in eine große Stadt, dann kommt einem alles ganz anders vor, wenn man zurückkehrt. So ist das gemeint.«
»Ach so«, meinte Ali und starrte wieder auf sein iPad.
Meine fünfzehnjährige Tochter Jannie hatte seit unserer Abfahrt aus Washington, D. C., die meiste Zeit geschmollt. Jetzt sagte sie: »Du warst nie wieder hier, Dad? Nicht ein einziges Mal?«
»Nein«, antwortete ich und sah sie im Rückspiegel an. »Seit … wie lange ist das her, Nana?«
»Fünfunddreißig Jahre«, gab meine winzige, über neunzig Jahre alte Großmutter, Regina Cross, zur Antwort. Sie saß zwischen den beiden Kindern auf der Rückbank und musste sich große Mühe geben, um überhaupt aus dem Fenster sehen zu können. »Wir haben mit der Familie zwar immer Kontakt gehalten, aber mal hier runterzufahren hat sich einfach nie ergeben.«
»Bis jetzt«, ergänzte Bree, und ich spürte, dass sie mich ansah.
Meine Frau und ich arbeiten beide als Detectives bei der Metropolitan Police in Washington, D. C. Ich wusste also, dass ich unter professioneller Beobachtung stand.
Und da ich keinerlei Interesse verspürte, die »Diskussion« der vergangenen Tage wieder aufleben zu lassen, sagte ich bestimmt: »Mein Chef hat angeordnet, dass wir für ein paar Tage wegfahren sollen, und Blut ist nun mal dicker als Wasser.«
»Wir hätten auch einen Strandurlaub machen können …« Bree seufzte. »In Jamaika noch mal, zum Beispiel.«
»Ich mag Jamaika«, sagte Ali.
»Aber dafür fahren wir in die Berge«, sagte ich.
Jannie ächzte. »Und wie lange müssen wir da bleiben?«
»So lange der Prozess gegen meinen Cousin dauert«, erwiderte ich.
»Aber das kann sich ja, was weiß ich, einen ganzen Monat hinziehen!«, jammerte sie los.
»Wahrscheinlich nicht«, sagte ich. »Aber ausschließen kann man es nicht.«
»Oh Gott, Dad, wie soll ich denn für die Herbstsaison meine Form halten?«
Meine Tochter ist eine begnadete Läuferin, und seit sie am Anfang des Sommers ein bedeutendes Rennen gewonnen hatte, hatte sie nur noch das Training im Kopf.
»Du trainierst zweimal pro Woche mit einem Team aus Raleigh, das die AAU-Zulassung hat«, erwiderte ich. »Die kommen auf die Sportanlage der Highschool, weil sie in der Höhe trainieren wollen. Dein Trainer hat doch sogar gesagt, dass du auch vom Höhentraining profitieren kannst. Ich will kein Wort zum Thema Training mehr hören. Das ist alles organisiert.«
»Da gibt es Höhlen in Starksville? Was denn für Höhlen?«, krähte Ali dazwischen.
»Höhe«, verbesserte ihn Nana Mama, die ehemalige Englischlehrerin und stellvertretende Schuldirektorin. »Damit ist die Höhe über dem Meeresspiegel gemeint.«
»Starksville liegt mindestens siebenhundert Meter über dem Meer«, sagte ich und zeigte nach vorn. In der Ferne waren bereits schemenhaft die Silhouetten der Berge zu erkennen. »Da oben, noch über diesem Gebirgszug.«
Jannie schwieg für einen Moment, dann sagte sie: »Ist Stefan unschuldig?«
Ich überlegte. Stefan Tate war Sportlehrer und wurde beschuldigt, einen dreizehn Jahre alten Jungen namens Rashawn Turnbull gequält und ermordet zu haben. Außerdem war er der Sohn der Schwester meiner verstorbenen Mutter und …
»Dad?«, meldete sich Ali zu Wort. »Ist er unschuldig?«
»Scootchie ist überzeugt davon«, erwiderte ich.
»Ich mag Scootchie«, sagte Jannie.
»Ich auch«, gab ich mit einem Seitenblick auf Bree zurück. »Und wenn sie mich um etwas bittet, dann erfülle ich ihr diesen Wunsch.«
Naomi »Scootchie« Cross ist die Tochter meines verstorbenen Bruders Aaron. Vor Jahren, während ihres Jurastudiums an der Duke University, war sie von einem sadistischen Mörder, der sich Casanova nannte, entführt worden. Ich habe sie damals glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und ihr damit das Leben gerettet. Diese grauenhafte Erfahrung hatte uns sehr eng zusammengeschweißt.
Zu unserer Rechten huschte jetzt ein schmales, dicht bewachsenes Maisfeld vorbei, zu unserer Linken eine Kiefernplantage.
Genau diese Bilder waren in den Tiefen meiner Erinnerung abgespeichert, und ich bekam ein mulmiges Gefühl. Am hinteren Ende des Maisfelds, das wusste ich, stand ein Schild, das mich in einem Städtchen willkommen hieß, das mir das Herz herausgerissen hatte, einem Ort, den ich mein Leben lang zu vergessen versucht hatte.
2 In meiner Erinnerung war das Holzschild, das die Grenzen meiner schwierigen Kindheit markierte, ziemlich verblasst und von grünem Efeu überwuchert. Tatsächlich aber war es aus Metall, relativ neu und ohne jeden Bewuchs.
WILLKOMMEN IN STARKSVILLE, NC21.010 EINWOHNER
Nachdem wir das Schild passiert hatten, kamen wir an zwei längst stillgelegten Fabrikgebäuden vorbei. Die fensterlosen Backsteinmauern waren bereits stark verfallen. An dem Maschendrahtzaun, der die Ruinen umgab, hing deutlich sichtbar die amtliche Räumungsanordnung. In den Tiefen meines Gehirns regte sich etwas. Soweit ich mich erinnern konnte, waren in der ersten Fabrik Schuhe und in der zweiten Bettwäsche hergestellt worden. Das wusste ich, weil meine Mutter in der Bettwäschefabrik gearbeitet hatte, damals, als ich noch ein kleiner Junge war, und bevor sie an Zigaretten, Schnaps, Drogen und letztendlich dann an Lungenkrebs zugrunde gegangen war.
Ich blickte in den Rückspiegel, sah das verkniffene Gesicht meiner Großmutter und wusste, dass auch sie den Erinnerungen an meine Mutter nicht entkommen konnte. Wahrscheinlich dachte sie auch an ihren Sohn, meinen verstorbenen Vater. Wir fuhren an einem schäbigen Einkaufszentrum vorbei, an das ich mich nicht erinnern konnte, und dann an einem leer stehenden Piggly-Wiggly-Supermarkt, an den ich mich noch ganz genau erinnern konnte.
»Manchmal hat meine Mom mir fünf Cent gegeben, und dann habe ich mir dort Süßigkeiten oder eine Dose Mr. Pibb geholt«, sagte ich und deutete auf den Laden.
»Fünf Cent?«, meldete sich Ali zu Wort. »Du hast für fünf Cent Süßigkeiten gekriegt?«
»Zu meiner Zeit hat es sogar nur einen Cent gekostet, junger Mann«, sagte Nana Mama.
»Was ist ein Mr. Pibb?«, wollte Bree wissen. Sie war in Chicago aufgewachsen.
»Limonade«, antwortete ich. »Ich glaube, Pflaumensaft mit Kohlensäure.«
»Das klingt ja eklig«, meinte Jannie.
»Nein, das schmeckt gar nicht schlecht«, sagte ich. »So ähnlich wie Dr. Pepper. Meine Mom hat das immer gern getrunken, und mein Dad auch. Weißt du noch, Nana?«
Meine Großmutter seufzte. »Wie könnte ich das je vergessen …«
»Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr nie ihre richtigen Namen aussprecht?«, warf Bree dazwischen.
»Christina und Jason«, sagte Nana Mama leise.
Ich blickte erneut in den Rückspiegel. Mit einem Mal sah sie sehr traurig aus.
»Erzähl doch mal was von ihnen«, sagte Ali, ohne den Blick von seinem iPad zu nehmen.
Zum ersten Mal nach Jahrzehnten empfand ich wieder Trauer und Schmerz, weil ich meine Mom und meinen Dad verloren hatte. Ich sagte kein Wort.
Dafür sprach meine Großmutter: »Es waren zwei wundervolle Menschen, die große Probleme hatten, Ali.«
»Achtung, da vorn kommt ein Bahnübergang, Alex«, sagte Bree.
Ich löste den Blick vom Rückspiegel und registrierte die blinkende Ampel und die herabsinkenden Schranken. Wir blieben hinter zwei Pkws und einem Lastwagen stehen und sahen zu, wie ein Güterzug träge an uns vorbeirumpelte.
Bilder gingen mir durch den Kopf, wie ich als Acht-, Neunjähriger an diesen Bahngleisen, die durch ein Waldstück dicht bei unserem Haus führten, entlangrannte. Es war eine regnerische Nacht gewesen, und aus irgendeinem Grund hatte ich schreckliche Angst gehabt. Wieso?
»Schaut mal, da sind Leute auf dem Zug!« Ali riss mich aus meinen Gedanken.
Tatsächlich sah ich zwei Gestalten auf einem der Güterwaggons sitzen, einen Schwarzen und einen Weißen. Sie mussten etwa zwanzig Jahre alt sein und ließen sich gerade an der vorderen Kante des Waggons nieder, sodass die Beine über den Rand nach unten baumelten. Es schien, als würden sie sich auf eine längere Reise einstellen.
»Solche Männer haben wir früher Landstreicher genannt«, sagte Nana Mama.
»Aber die Klamotten sind eigentlich zu gut für Landstreicher«, sagte Bree.
Als der Waggon mit den beiden jungen Männern die Straße überquerte, wurde mir klar, was Bree meinte. Die beiden trugen Baseballmützen, Schild nach hinten gedreht, dazu Sonnenbrillen, Kopfhörer, viel zu weite Shorts, schwarze T-Shirts und glänzende, knöchelhohe Turnschuhe. Sie schienen jemanden in dem Auto direkt vor uns zu kennen, jedenfalls grüßten sie mit drei erhobenen Fingern. Der Fahrer des Wagens streckte daraufhin den linken Arm zum Seitenfenster heraus und grüßte mit derselben Geste zurück.
Und dann waren sie schon an uns vorbei, dicht gefolgt vom letzten Waggon mit der roten Laterne, unterwegs nach Norden. Die Schranke öffnete sich. Die Ampel hörte auf zu blinken. Wir überquerten die Gleise. Die beiden Pkws fuhren nach rechts weiter, aber ich musste hinter dem Lastwagen warten, weil er nach links abbiegen wollte. Ein Wegweiser verriet uns, dass es dort zur CAINEDÜNGEMITTELCOMPANY ging.
»Iii-gitt!«, sagte Ali. »Was stinkt denn da so grässlich?«
Ich roch es ebenfalls. »Harnstoff.«
»Du meinst, wie in Pipi?« Jannies Stimme klang angewidert.
»Tierpipi«, sagte ich. »Und wahrscheinlich auch Tierkacka.«
Sie stöhnte auf. »Oh Gott, was sollen wir hier bloß?«
»Wo übernachten wir eigentlich?«, wollte Ali wissen.
»Hat Naomi alles organisiert«, erwiderte Bree. »Ich kann bloß hoffen, dass es da eine Klimaanlage gibt. Draußen hat es mindestens dreiunddreißig Grad, und wenn der Wind dann noch diesen Gestank …«
»Es hat siebenundzwanzig Grad«, sagte ich nach einem Blick auf das Thermometer am Armaturenbrett. »Wir sind ja schon ziemlich hoch.«
Ich fuhr weiter, folgte meinem Instinkt, ohne einen einzigen Straßennamen zu kennen. Trotzdem schien ich den Weg in die Innenstadt von Starksville genau zu kennen, als sei mein letzter Besuch erst einen Tag her und keine dreieinhalb Jahrzehnte.
Die Stadt war Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden, und zwar rund um einen rechteckigen Platz, auf dem jetzt eine Statue von Colonel Francis Stark zu sehen war. Er hatte im Bürgerkrieg aufseiten der Konföderierten gekämpft und Heldenstatus erlangt. Außerdem war er der Sohn des Gründers und Namensgebers der Stadt. Starksville hätte durchaus ein malerisches Städtchen sein können. Viele Häuser waren schon älter, manche stammten sogar noch aus der Zeit vor dem Krieg, andere hatten Backsteinfassaden, so wie die Fabriken am Stadtrand.
Doch die Wirtschaftskrise hatte Starksville schwer getroffen. Auf jedes Geschäft, das an diesem Donnerstag geöffnet hatte – ein Bekleidungskaufhaus, eine Buchhandlung, ein Pfandleiher, ein Waffengeschäft und zwei Schnapsläden – kamen zwei leer stehende mit zugekleisterten Schaufenstern. Überall hingen Schilder: »Zu verkaufen«.
»Ich weiß noch, dass Starksville gar kein schlechter Ort zum Leben war. Und das trotz der Jim-Crow-Gesetze«, sagte Nana Mama schwermütig.
»Was sind denn Crow-Gesetze?«, wollte Ali mit gerümpfter Nase wissen.
»Das waren Gesetze gegen Menschen wie uns«, erwiderte sie und richtete ihren knochigen Zeigefinger auf eine geschlossene Apotheke. »Genau da hingen immer die Schilder mit der Aufschrift ›Zutritt für Farbige nicht gestattet‹.«
»Hat Dr. King die abgemacht?«, wollte mein Kleiner wissen.
»Letztendlich hat er den Anstoß dafür gegeben«, sagte ich. »Aber meines Wissens war er nie selber in …«
»Oh, da ist ja Scootchie!«, fiel Jannie mir ins Wort.
3 Meine Nichte stand auf dem Bürgersteig vor dem Bezirksgericht und diskutierte mit einem gesetzt wirkenden Afroamerikaner in einem gut geschnittenen grauen Anzug. Naomi trug einen marineblauen Rock mit dazu passendem Blazer und drückte eine braune DIN-A4-Dokumentenmappe an die Brust. Sie schüttelte nachdrücklich den Kopf.
Ich stellte den Wagen am Straßenrand ab und sagte: »Sieht aus, als hätte sie noch zu tun. Am besten bleibt ihr erst mal sitzen, und ich frage sie schnell, wo wir übernachten sollen.«
Ich stieg aus und trat mitten hinein in einen – nach Washingtoner Maßstäben – herrlichen Sommertag. Die Luftfeuchtigkeit war erstaunlich gering, und eine sanfte Brise wehte die Stimme meiner Nichte zu mir herüber.
»Sag mal, Matt, willst du eigentlich jedem meiner Anträge widersprechen?«, sagte sie gerade.
»Selbstverständlich«, erwiderte der Mann. »Das ist schließlich mein Job, oder war dir das nicht klar?«
»Dein Job ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen«, gab sie empört zurück.
»Ich glaube, dass wir die Wahrheit schon längst kennen«, erwiderte er. Dann sah er mich über ihre Schulter hinweg an.
»Naomi?«, rief ich.
Sie drehte sich um, sah mich und entspannte sich sofort. »Alex!«
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht kam sie auf mich zu, fiel mir um den Hals und sagte leise: »Gott sei Dank. Diese Stadt treibt mich noch in den Wahnsinn.«
»Ich bin gekommen, so schnell ich konnte«, sagte ich. »Wo ist Stefan?«
»Sitzt immer noch im Gefängnis. Der Richter weigert sich, eine Kaution festzusetzen.«
Inzwischen beobachtete Matt uns – besser gesagt: mich – mit durchdringenden Blicken.
»Ist das der Staatsanwalt?«, wollte ich leise wissen.
»Komm, ich stelle euch vor«, sagte sie. »Damit er ein bisschen nervös wird.«
»Nur zu«, sagte ich. »Ein bisschen Nervosität kann nichts schaden.«
Naomi brachte mich zu ihm und sagte: »Darf ich vorstellen, Matthew Brady, stellvertretender Bezirksstaatsanwalt. Das hier ist mein Onkel und Stefans Cousin. Dr. Alex Cross, ehemaliger Angehöriger der Verhaltensforschungsabteilung des FBI und aktuell Sonderermittler bei der Metropolitan Police in Washington, D. C.«
Falls Brady beeindruckt war, dann ließ er sich nichts anmerken. Er reichte mir wenig begeistert die Hand. »Und warum genau sind Sie hier?«
»Meine Familie und ich haben ein paar sehr anstrengende Monate hinter uns. Darum haben wir uns zu einem kleinen Urlaub entschlossen, zurück zu den Wurzeln sozusagen. Und außerdem möchte ich meinem Cousin ein bisschen moralischen Beistand leisten«, erwiderte ich.
»Tja, dann.« Er schniefte und sah Naomi an. »Wenn Sie Mr. Tate wirklich helfen wollen, dann sollten Sie meiner Meinung nach ernsthaft über ein Schuldeingeständnis nachdenken.«
Naomi lächelte. »Steck dir die Idee gefälligst dahin, wo die Sonne niemals scheint.«
Brady grinste freundlich und hob die geöffneten Hände. »Ist deine Entscheidung, Naomi, aber meine Einschätzung ist, dass er sich entweder vor Prozessbeginn schuldig bekennt und dann hinter Gittern weiterleben kann, oder aber es kommt zur Verhandlung. Und dann hat er nichts anderes als die Todesstrafe zu erwarten.«
»Auf Wiedersehen«, sagte sie liebenswürdig und hängte sich bei mir ein. »Wir müssen jetzt los.«
»Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben«, sagte ich.
»Ebenfalls, Dr. Cross«, erwiderte er und drehte sich um.
»Ganz schön steif, der Gute«, sagte ich, als er außer Hörweite war und wir zu meinem Auto gingen.
»Das ist seit dem Studium immer schlimmer geworden«, sagte Naomi.
»Dann kennt ihr euch schon länger?«
»Wir waren zusammen auf der Uni.« Und dann stieß sie einen spitzen Schrei aus, weil nämlich Jannie aus dem Explorer gestiegen war.
Wenige Augenblicke später standen alle auf dem Bürgersteig und umarmten Naomi, die einfach nicht darüber hinwegkam, wie groß und kräftig Jannie geworden war. Als meine Großmutter ihr einen Kuss gab, schossen ihr die Tränen in die Augen.
»Du hast dich ja überhaupt nicht verändert, Nana«, sagte Naomi. »Hängt vielleicht in irgendeiner Dachkammer ein Gemälde von dir, das an deiner Stelle älter wird?«
»Das Bildnis der Regina Cross …« Nana Mama kicherte.
»Wie gut es tut, euch alle zu sehen«, sagte Naomi, doch dann verfinsterte sich ihre Miene. »Ich wünschte nur, dass die Umstände nicht so traurig wären.«
Meine Frau meinte: »Wir finden schon raus, wie das alles wirklich war, und dann kommt Stefan frei, und wir genießen unseren Urlaub.«
Naomis Gesichtsausdruck wurde noch eine Spur düsterer. »Das ist leichter gesagt als getan, Bree. Aber ich weiß, dass die Tanten auf uns warten. Am besten fahrt ihr mir einfach hinterher.«
»Kann ich bei dir mitfahren, Scootchie?«, fragte Jannie.
»Na klar«, erwiderte Naomi und zeigte quer über die Straße. »Der kleine rote Chevy da, das ist meiner.«
Wir verließen die Innenstadt und fuhren durch eine Wohngegend mit auffallend schroffen Gegensätzen. Die Häuser waren entweder sehr heruntergekommen oder frisch renoviert. Die Autos waren entweder nagelneu oder praktisch schrottreif. Und die Menschen auf der Straße waren entweder schäbig gekleidet oder trugen hippes Großstadt-Outfit.
Anschließend überquerten wir die alte Bogenbrücke, die sich über den Stark River spannte. Fast zwanzig Meter unter uns schoss der Fluss durch eine tiefe Schlucht aus hohen Granitwänden, brauste tosend und schäumend über riesige Felsen hinweg ins Tal. Ali entdeckte ein paar Kajaks in den Schaumkronen.
»Kann ich das auch mal machen?«, schrie er.
»Nie im Leben«, entgegnete Nana Mama bestimmt.
»Wieso denn nicht?«
»Weil die Schlucht schon viele Todesopfer gefordert hat«, lautete ihre Antwort. »Es gibt da alle möglichen Unterströmungen und Kanten oder Baumstämme, wo man sich einklemmen kann und nicht wieder rauskommt. In meiner Jugend sind mindestens fünf Kinder da unten ums Leben gekommen, und einer davon war mein kleiner Bruder. Man hat die Leichen nie gefunden.«
»Echt?«, fragte Ali.
»Echt«, antwortete Nana Mama.
Naomi fuhr geradewegs über die Brücke, dann ging es noch einmal über einen Bahnübergang, und schließlich landeten wir in Birney, einer besonders schäbigen Gegend. Fast jeder der kleinen Bungalows am Straßenrand sehnte sich nach ein wenig liebevoller Zuwendung. Kinder spielten in den lehmigen Vorgärten. Hunde kläfften uns an. Hühner und Ziegen stoben von der Straße. Und die Erwachsenen auf den Eingangstreppen musterten uns misstrauisch, als würden sie jeden kennen, der in dieses Viertel gehörte, und wissen, dass wir Fremde waren.
Das bedrückende Gefühl, das mich beim Anblick des Ortsschilds überkommen hatte, kehrte wieder zurück. Und als Naomi in die Loupe Street einbog, wurde es beinahe unerträglich. Die rissige, mit Schlaglöchern übersäte Straße war eine Sackgasse, und die drei Häuser am hinteren Ende schienen die einzigen im ganzen Viertel zu sein, die gut erhalten waren. Es handelte sich um drei identische und offensichtlich frisch gestrichene Bungalows. Jeder wurde von einem niedrigen Gartenzaun und einem gut gewässerten Rasen umschlossen. Die Eingangsveranden besaßen ein Fliegengitter, und davor waren Blumenbeete angelegt worden.
Ich stellte meinen Wagen hinter Naomis ab und blieb erst einmal sitzen, während meine Frau und mein Sohn bereits ausgestiegen waren. Nana Mama hatte es auch nicht besonders eilig, und so konnte ich mir ihre verbissene Miene im Rückspiegel ausgiebig betrachten.
»Alex?« Bree steckte den Kopf zur offenen Beifahrertür herein.
»Ich komme«, sagte ich, stieg aus und half meiner Großmutter nach draußen.
Langsam gingen wir um das Auto herum, blieben stehen und musterten den am nächsten stehenden der drei Bungalows, als würden dort Geister hausen. Und genau so empfanden wir es auch.
»Warst du hier schon mal, Dad?«, wollte Ali wissen.
Ich stieß langsam den Atem aus, nickte und sagte: »Das ist das Haus, in dem dein Daddy aufgewachsen ist, mein Junge.«
4 »Du meine Güte, seid ihr etwa schon da, Tante Regina?«, ertönte eine Frauenstimme, noch bevor Ali oder jemand anderes aus meiner Familie etwas sagen konnte.
Ich nahm den Blick vom Haus meiner Kindheit und sah, wie eine altehrwürdige Dampfwalze von Frau in einem roten, hawaiianischen Gewand mit Blumenmuster und grellgrünen Strandlatschen von nebenan auf uns zugestürmt kam. Sie strahlte über das ganze Gesicht und fuchtelte mit den Händen, als sei sie gerade dem Auferstandenen begegnet.
»Connie Lou?«, rief Nana Mama. »Junge Dame, mir scheint, du hast abgenommen seit deinem Besuch vor zwei Jahren.«
Connie Lou Parks war die Witwe des Bruders meiner Mutter, also meine Tante. Und sie hatte tatsächlich abgenommen, seit wir sie das letzte Mal gesehen hatten. Trotzdem hatte sie immer noch eine Statur wie ein Footballprofi. Aber als sie die anerkennenden Worte meiner Großmutter hörte, da bebte sie am ganzen üppigen Körper, zog Nana Mama in ihre mächtigen Arme und gab ihr einen lauten Schmatz auf die Wange.
»Mein Gott, Connie«, sagte Nana Mama. »Du brauchst mich ja nicht gleich abzuschlecken.«
Meine Tante fand das überaus köstlich und küsste sie gleich noch einmal.
Dann stellte meine Großmutter ihr die Frage, die der Küsserei sofort ein Ende bereitete: »Wie hast du denn so abgenommen?«
»Ich hab eine Steinzeitdiät gemacht und angefangen, jeden Tag zu gehen«, verkündete Tante Connie stolz. Dann lachte sie wieder. »Über zwanzig Kilo hab ich so verloren, und meine Blutzuckerwerte sind auch besser geworden. Alex Cross, komm auf der Stelle zu mir! Ich will dich knuddeln!«
Sie legte die Arme um mich und drückte zu. Dann blickte sie mich mit feuchten Augen an. »Danke, dass du Stefan helfen willst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel uns das bedeutet.«
»Das ist doch selbstverständlich. Ich habe keine Sekunde gezögert«, erwiderte ich.
»Hast du wohl, und das ist auch nachvollziehbar«, stellte sie sachlich fest. Dann wandte sie sich Bree und den Kindern zu, umarmte sie und überschüttete sie mit einem Schwall herzlicher Worte. Nana Mama sagt immer, dass meine Tante Connie jeden Menschen, dem sie begegnet, wie einen guten, alten Freund behandelt. Und sie hatte recht. In meiner Erinnerung hatte ich jedenfalls nur Bilder von ihrem freundlichen Gesicht und ihrem ansteckenden Lachen abgespeichert.
Als die Begrüßungsrunde abgeschlossen war, sah Tante Connie mich an und wies dann mit einer Kopfbewegung auf den Bungalow. »Seid ihr einverstanden, wenn wir euch dort unterbringen? Das Haus ist komplett renoviert. Nichts sieht mehr so aus wie früher.«
Ich war mir nicht sicher. »Wohnt denn da niemand?«
»Meine Karen mit ihrer Familie, aber sie sind über den Sommer unten an der Golfküste. Sie müssen sich um Petes Mutter kümmern. Der geht es sehr schlecht. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie würden euch das Haus sehr gerne überlassen, wenn ihr euch dort wohlfühlt.«
Ich schaute zu Bree hinüber und sah ihr an, dass sie die Kosten eines wochenlangen Hotelaufenthalts gegen eine freie Unterkunft abwog. »Ich hätte nichts dagegen«, sagte ich.
Tante Connie lächelte und umarmte mich schon wieder. »Gut, dann richtet ihr euch nach dem Essen dort ein. Wer hat Hunger?«
»Ich«, sagte Ali.
»Hattie hat uns alle zu sich eingeladen«, fuhr Connie Lou fort. »Dann wollen wir mal sehen, dass ihr euch irgendwo frisch machen könnt, und dann müsst ihr uns unbedingt erzählen, was es Neues gibt.«
Meine Tante war eine solche Naturgewalt, dass Ali, Jannie und Naomi ihr ohne zu zögern folgten, als sie davonstürmte. Bree streckte Nana Mama die Hand entgegen und sah mich erwartungsvoll an.
»Ich komme gleich nach«, sagte ich. »Aber ich glaube, ich muss da zuerst mal alleine rein.«
Ich spürte, dass meine Frau das nicht wirklich nachvollziehen konnte. Ich hatte mit ihr noch kaum über meine Kindheit geredet, weil mein Leben im Grunde genommen erst wirklich begonnen hatte, nachdem Nana Mama mich und meine Brüder bei sich aufgenommen hatte.
»Tu, was du tun musst«, sagte Bree.
Meine Großmutter blickte mir direkt ins Gesicht. »Du hast überhaupt keine Schuld an dem, was geschehen ist. Hast du verstanden? Das alles lag nicht in deiner Macht, Alex Cross.«
Während der ersten Jahre hatte Nana Mama pausenlos solche Dinge zu mir gesagt. So hatte sie mir geholfen, selbstzerstörerischen Tendenzen zu widerstehen, hatte mir einen besseren Weg in die Zukunft gezeigt.
»Ich weiß, Nana«, sagte ich und stieß das Gartentor auf.
Aber als ich mich der Eingangsveranda mit dem Fliegengitter näherte, kam ich mir so seltsam und entwurzelt vor wie noch nie im Leben. Als wäre ich zwei völlig verschiedene Personen: zum einen ein tüchtiger Detective, liebender Ehemann und hingebungsvoller Vater auf dem Weg zu einem kleinen, friedlichen Häuschen im Süden, zum anderen ein unsicherer, verängstigter achtjähriger Junge, der seinem Zuhause entgegentrottete, in dem er vielleicht von Musik, Liebe und Freude, vielleicht aber auch von Gebrüll, Chaos und Wahnsinn empfangen wurde.
5 Tante Connie hatte recht gehabt. Ich erkannte das Haus tatsächlich nicht wieder.
Irgendwann im Lauf der letzten Jahrzehnte musste es komplett entkernt worden sein, jedenfalls hatte es einen völlig neuen Grundriss erhalten. Die Eingangsveranda war der einzige Teil, der mir noch bekannt vorkam. Aber den Windfang, in dem wir immer unsere Schuhe abgestellt hatten, gab es nicht mehr, genauso wenig wie die halbe Wand, die die Küche vom Wohnzimmer abgetrennt hatte, dort, wo ich mit meinen Brüdern Charlie, Blake und Aaron gespielt und ferngesehen hatte – zumindest dann, wenn wir auch einen funktionierenden Fernseher gehabt hatten.
Die neuen Möbel waren hübsch und der Flachbildfernseher groß. In der Küche gab es neue Schränke, einen neuen Herd, einen neuen Kühlschrank und eine Geschirrspülmaschine, außerdem auch ein paar neue Fenster. Aus dem düsteren Raum mit dem trostlosen Resopaltisch, an dem wir unsere Mahlzeiten eingenommen hatten, war ein lichtdurchflutetes freundliches Zimmer mit Essecke geworden.
Ich stand einfach nur da und konnte fast meine Mutter vor mir sehen, an einem ihrer besseren Tage. Sie trug ihren fadenscheinigen Morgenmantel, strahlte aber wie eine Schönheitskönigin, rauchte eine Kent mit Filter und kochte für uns Waffeln mit Spiegelei. Im Radio lief WAAA 980 AM aus Winston-Salem. Sie spielten einen Song von Sam Cooke, und meine Mutter sang leise mit.
… been a long time coming, but I know a change gonna come …
Das war ihr Lieblingslied, und sie hatte eine fantastische raue Stimme, die in der Baptistenkirche ihres Vaters ausgiebig geschult worden war. So stand ich also in der Küche, in der sie früher für uns gesungen hatte, und hatte ihre Stimme klar und deutlich im Ohr. Ich musste schlucken, und dann brach ich weinend zusammen.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Vermutlich habe ich meine Mutter schon so lange in irgendeiner Kiste in den Tiefen meiner Erinnerung aufbewahrt, dass ich dachte, ich sei über die Tragödie ihres Lebens endgültig hinweg. Aber offensichtlich war ich das nicht. Sie war klug, einfühlsam und sehr witzig gewesen. Begabt im Umgang mit Worten und Tönen. Sie konnte spontan anfangen zu rappen, und bei den wenigen Gelegenheiten, wo ich sie in der Kirche hatte singen hören, war es mir jedes Mal, als hätte ein Engel von ihr Besitz ergriffen.
Aber es hatte auch andere Zeiten gegeben, viel zu viele davon. Dann war sie wie von Dämonen besessen gewesen. Im Alter von zwölf Jahren hatte sie den Selbstmord ihres eigenen Vaters mit angesehen, und das hatte sie für ihr ganzes kurzes Leben zum seelischen Krüppel gemacht. Im Wodka und im Heroin fand sie Erleichterung, sodass ich sie in ihren letzten Lebensjahren fast nie mehr nüchtern erlebt habe.
Ich habe gesagt, dass Dämonen sie im Griff gehabt haben, aber in Wirklichkeit waren es die Erinnerungen, die ihren von Drogen und Alkohol umnebelten Geist verpesteten. Sie waren verantwortlich dafür, dass sie sich manchmal in ein schreckliches Monster verwandelte. Dann lagen wir in unseren Betten und hörten, wie sie weinend nach ihrem toten Vater rief oder ihn anbrüllte. In diesen Nächten wurde sie dann irgendwann gewalttätig, zerschlug alle möglichen Sachen und verfluchte Gott und uns alle gleich mit.
In einer Familie mit einem suchtkranken Elternteil spielt jedes Kind seine eigene Rolle und findet eigene Wege, um mit der Situation fertigzuwerden. Meine Brüder zogen sich, wenn meine Mutter unter Drogeneinfluss stand und zu einer Gefahr für uns wurde, immer mehr in sich selbst zurück. Meine Aufgabe hingegen war es, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht selbst verletzte. Später musste ich sie dann vom Boden hochheben und ins Bett bringen. Um es in der Sprache der suchttherapeutischen Fachliteratur auszudrücken: Ich bin in die Rolle des Helden und fürsorglichen Retters geschlüpft.
Wie ich so da stand und mir all die Abende wieder einfielen, die ich versucht hatte zu vergessen, da wurde mir überdeutlich, dass ich nicht nur rein körperlich das Geschöpf meiner Mutter war. Von Kindesbeinen an hatte ich mich im Chaos und unter chaotischen Menschen zurechtfinden müssen, und um das zu überleben, hatte ich keine andere Wahl gehabt, als meine Ängste hinunterzuschlucken und mich zu zwingen, den Wahnsinn zu begreifen und irgendwie damit umzugehen. Und diese mühsam erworbene Fähigkeit hatte mich unweigerlich zu meiner wahren Berufung geführt: dem Studium an der Johns Hopkins University mit einem Doktortitel in Psychologie und dann zur Polizeiarbeit. Und genau aus diesen und noch weiteren Gründen wurde mir klar, dass ich meiner Mutter, trotz all des Wahnsinns und all der Enttäuschungen, dankbar war. Dass es ein Segen war, ihr Sohn zu sein.
Ich wischte mir die Tränen aus den Augen, ließ die Küche hinter mir und betrat den Flur, der zu den Schlafzimmern führte. Damals hatten wir überhaupt nur zwei Zimmer gehabt, und dazu ein einziges Badezimmer, das die Bezeichnung beim besten Willen nicht verdient hatte. Aber inzwischen war ein weiteres Badezimmer hinzugekommen, und aus dem großen Zimmer, in dem ich mit meinen Brüdern gehaust hatte, waren zwei geworden. In jedem stand ein Doppelstockbett.
Ich starrte irgendwo in die Ferne, nahm nichts um mich herum wahr und musste an meinen Vater denken, an einen seiner besseren Abende. Nüchtern und witzig war er gewesen, und er hatte mir und meinen Brüdern versprochen, dass er uns zu einem Ausflug nach New Orleans mitnehmen wolle, in die Bourbon Street, wo es wunderbaren Jazz zu hören gab.
Man muss träumen, Jungs, hatte er jedes Mal gesagt, bevor er das Licht ausgemacht hatte. Man muss träumen, und ihr müsst …
»Keine Bewegung!«, unterbrach eine Männerstimme meine Gedanken. »Hände hoch, und zwar so, dass wir sie sehen können!«
Erschrocken hob ich die Hände und blickte vorsichtig über die Schulter zurück und den Flur entlang bis in die Küche. Zwei Männer in Zivilkleidung hatten ihre Pistolen auf mich gerichtet. Beide hatten ein Schlüsselband mit einer Polizeidienstmarke um den Hals hängen.
6 »Auf die Knie«, bellte der größere und jüngere der beiden, ein schlanker, drahtiger Afroamerikaner Anfang dreißig.
Der andere Zivilpolizist war weiß, Mitte fünfzig, blass und pockennarbig. Eine braun gefärbte Haarsträhne hing ihm über das freudlose Gesicht.
»Was ist denn los?«, fragte ich und rührte mich nicht von der Stelle. »Detectives?«
»Sie sind unbefugt in das Haus eines guten Bekannten von mir eingedrungen«, sagte der Afroamerikaner.
»Dieses Haus gehört Connie Lou Parks, meiner Tante. Sie hat mich ins Haus gelassen. Eigentlich ist es vermietet, an meine Cousine Karen und ihren Mann Pete, der vermutlich Ihr Bekannter ist«, sagte ich. »Ich habe als Kind hier gewohnt, und außerdem bin ich auch Polizist.«
»Na klar«, sagte der ältere der beiden.
»Kann ich Ihnen meine Ausweise zeigen?«
»Aber vorsichtig«, erwiderte er.
Ich schob mein Jackett ein Stück zur Seite, sodass das Schulterholster sichtbar wurde.
»Schusswaffe!«, rief der afroamerikanische Beamte, und schon hatten er und sein Partner sich tief geduckt.
Ich war mir sicher, dass sie mich erschießen würden, wenn ich versuchte, meinen Ausweis zu ziehen, darum nahm ich die Hand wieder weg und sagte: »Natürlich habe ich eine Waffe. Ich bin Detective bei der Mordkommission in Washington, D. C. Um genau zu sein, es sind sogar zwei. Abgesehen von der Glock 40 trage ich noch eine kleine Neun-Millimeter Ruger LC9 am rechten Unterschenkel.«
»Name?«, wollte der Ältere wissen.
»Alex Cross. Und Sie?«
»Detective Frost und Detective Carmichael. Ich bin Frost«, sagte er, während er und sein Partner langsam wieder in die Senkrechte kamen. »Also, Alex Cross, Sie machen jetzt Folgendes. Ziehen Sie ihr Jackett aus, und zwar den rechten Ärmel zuerst. Dann werfen Sie es zu mir.«
Es hätte keinen Sinn gehabt, sich zu weigern, darum tat ich, was er verlangte, und warf mein leichtes Sportsakko in den Flur.
»Gib mir Deckung, Carmichael«, sagte der Ältere und ging in die Hocke, sodass sein Partner mich genau im Visier behalten konnte.
Sie gingen genau nach Vorschrift vor. Sie kannten mich nicht und machten darum genau das, was jeder altgediente Polizeibeamte in Washington auch gemacht hätte. Mich eingeschlossen.
Als Frost mein Jackett in der Hand hielt, sagte ich: »Linke Brusttasche.«
Er wich mit zusammengekniffenen Augen ein paar Schritte zurück, immer noch in der Hocke, und holte die Brieftasche mit meiner Dienstmarke und dem Ausweis heraus.
»Du kannst die Waffe runternehmen, Lou«, sagte Frost. »Die Angaben stimmen. Dr. Alex Cross, Mordkommission Washington, D. C.«
Carmichael zögerte zunächst, dann ließ er seine Pistole ein wenig sinken und sagte: »Besitzen Sie eine Genehmigung zum Tragen einer versteckten Waffe in North Carolina, Herr Dr. Cross?«
»Ich habe sogar eine landesweit gültige Genehmigung«, erwiderte ich. »Sie steckt auch da drin, hinter dem Ausweis. Ich war früher mal für das FBI tätig.«
Frost zog die Genehmigung heraus und nickte seinem Partner zu.
Carmichael wirkte verärgert, steckte seine Waffe aber wieder ein. Frost machte es ihm nach, dann hob er mein Jackett auf, klopfte den Staub ab und gab es mir wieder, zusammen mit meinen Dokumenten.
»Würden Sie uns vielleicht erzählen, weshalb Sie hier sind?«, erkundigte sich Carmichael.
»Ich möchte den Prozess gegen Stefan Tate begleiten. Er ist mein Cousin.«
Carmichael versteinerte. Frost sah so aus, als sei ihm plötzlich ein bitterer Geschmack die Kehle emporgekrochen. Er sagte: »Starksville ist vielleicht nicht gerade eine Großstadt, Detective Cross, aber wir sind alle gut ausgebildete Profis. Ihr Cousin, Stefan Tate? Dieses Dreckschwein ist so schuldig, wie man nur schuldig sein kann.«
7 Ich überquerte das hintere Ende der Loupe Street, um zu dem dritten Bungalow zu gelangen. Während der zivile Streifenwagen hinter mir losfuhr, fragte ich mich, wie die Chancen für meinen jungen Cousin wohl stehen mochten. Ich musste Naomi um die Akten bitten und …
Tante Connies lebhafte Stimme tönte durch die Fliegengittertür, gefolgt von gackernden Frauen und prustenden Männern. Sie hatte wohl etwas ziemlich Witziges gesagt. Der Wind drehte sich und trug geheimnisvolle, herrliche Düfte aus der Küche meiner Tante, Hattie Parks Tate, zu mir herüber. Sie war die jüngere Schwester meiner Mutter. Seit fünfunddreißig Jahren hatte ich so etwas nicht mehr gerochen, und doch lockten sie sofort Kindheitserinnerungen ans Tageslicht: an genau diese Eingangstreppe und diese Düfte, wie ich genau diese Fliegengittertür geöffnet hatte und es kaum erwarten konnte, nach drinnen zu kommen.
Dieses Haus war damals einer meiner Zufluchtsorte gewesen. Ich weiß noch, wie friedlich und geordnet es dort im Vergleich zu dem ständigen Chaos auf der anderen Straßenseite zugegangen war. Und daran hatte sich auch nichts geändert, wie ich mit einem Blick durch die Fliegengittertür feststellen konnte. Meine Familie saß jedenfalls in Hatties blitzsauberem Wohnzimmer, auf ihren Tellern türmte sich wunderbares Essen, und auf ihren Gesichtern lag tiefe Zufriedenheit.
»Klopf, klopf«, sagte ich und trat ein.
»Dad!«, rief Ali von seinem Platz auf einem Weidensofa aus und winkte mir mit einem Knochen zu. »Du musst unbedingt was von Tante Hatties Hasenbraten probieren!«
»Und von ihrem Kartoffelsalat«, ergänzte Jannie und verdrehte genüsslich die Augen.
Hattie Tate kam aus ihrer Küche gestürzt, wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und strahlte über das ganze Gesicht. »Du meine Güte, Alex, wieso hat das denn so lange gedauert?«
Ich hatte die Schwester meiner Mutter fast zehn Jahre lang nicht gesehen, aber sie schien keinen Tag älter geworden zu sein. Sie war jetzt Anfang sechzig und immer noch schlank und groß. Aus ihrem wunderschönen, ovalen Gesicht sahen mich zwei große mandelförmige Augen an. Ich hatte vergessen, wie sehr sie meiner Mutter ähnlich sah. Längst begrabene Trauer flackerte in mir auf.
»Tut mir leid, Tante Hattie«, sagte ich. »Ich …«
»Ist ja auch egal«, unterbrach sie mich mit Tränen in den Augen. Sie kam zu mir und nahm mich in ihre Arme. »Dass du hier bist, reicht schon, damit ich wieder Hoffnung schöpfen kann.«
»Wir werden für Stefan tun, was wir können«, versprach ich ihr.
Sie strahlte mich mit tränenüberströmten Wangen an. »Ich wusste, dass du kommen würdest. Stefan auch.«
»Wie geht es ihm?«
Noch bevor meine Tante antworten konnte, kam ein Mann mit Gehstock ins Zimmer geschlurft. Er war wohl Mitte siebzig und trug Hausschuhe, eine braune Jogginghose und ein weites weißes T-Shirt. Verwirrt blickte er sich um, dann packte ihn die Aufregung.
»Hattie!«, rief er. »Da sind Fremde im Haus!«
Blitzartig war Hattie bei ihm und redete beruhigend auf ihn ein. »Alles in Ordnung, Cliff. Das sind Verwandte. Alex mit seiner Familie.«
»Alex?«, wiederholte er.
»Ich bin’s, Onkel Cliff«, sagte ich und ging auf ihn zu. »Alex Cross.«
Mein Onkel starrte mich ratlos an, während Hattie ihn am Ellbogen stützte, ihm über den Rücken streichelte und sagte: »Alex, der Junge von Christina und Jason. Du weißt doch noch, oder?«
Onkel Cliff blinzelte, als hätte sich irgendwo in den Tiefen seines versagenden Geistes gerade etwas geregt. »Ach, was«, sagte er dann. »Der Alex ist doch so ein ängstlicher Kleiner.«
Ich lächelte ihn schwach an und sagte: »Der Kleine ist groß geworden.«
Onkel Cliff leckte sich die Lippen und musterte mich noch etwas länger. »Du bist so groß wie sie, aber du hast sein Gesicht. Was macht er denn jetzt, dein Daddy?«
Hattie verzog schmerzlich das Gesicht. »Jason ist doch schon lange tot, Cliff.«
»Ach ja?« Seine Augen wurden feucht.
Hattie lehnte sich mit dem Kopf an seinen Arm und sagte: »Cliff hat deinen Vater sehr geliebt, Alex. Dein Vater war sein bester Freund, stimmt’s, Cliff?«
»Wann ist er gestorben? Jason?«
»Vor fünfunddreißig Jahren«, erwiderte ich.
Mein Onkel legte die Stirn in Falten. »Nein, das ist … oh … Christina liegt gleich neben Brock, aber Jason, der liegt …«
Meine Tante legte den Kopf schief. »Cliff?«
Ihr Mann drehte sich verwirrt zu ihr um. »Mann, Jason … er hat den Blues geliebt.«
»Und den Jazz«, sagte Nana Mama.
»Aber den Blues noch mehr«, beharrte Cliff. »Soll ich’s dir zeigen?«
Hatties Züge wurden weicher. »Soll ich dir die Gitarre holen, Liebling?«
»Die sechssaitige«, sagte er und schlurfte zu einem Stuhl. Er benahm sich, als sei außer ihm niemand hier.
Tante Hattie verschwand und kam gleich darauf mit einer sechssaitigen Steel Guitar wieder. Sie kam mir irgendwie bekannt vor. Mein Onkel nahm die Gitarre, verschmolz mit ihr und spielte eine alte Bluesmelodie, so voller Inbrunst, dass ich das Gefühl hatte, in die Vergangenheit katapultiert zu werden. Ich sah mich als Fünf- oder Sechsjährigen auf dem Schoß meines Vaters sitzen, während Clifford genau dieses Stück spielte.
Meine Mutter kam in dieser Erinnerung auch vor. Sie hatte ein Glas in der Hand und saß neben meinen Brüdern, juchzte und feuerte Clifford an. So lebendig war diese Erinnerung, dass ich für einen Moment hätte schwören können, dass ich meine Eltern tatsächlich gerochen habe.
Mein Onkel spielte den ganzen Song und endete mit einem kleinen Schnörkel, der uns allen deutlich machte, wie gut er früher gewesen war. Alle klatschten, und er fing an zu strahlen und sagte: »Wenn es euch gefallen hat, dann kommt heute Abend zum Konzert, okay?«
»Was denn für ein Konzert?«, wollte Ali wissen.
»Cliff and the Midnights«, sagte mein Onkel in einem Tonfall, als hätte Ali das eigentlich wissen müssen. »Wir spielen drunten im …«
Seine Stimme versagte, und der verwirrte Gesichtsausdruck war wieder da. Er sah sich nach seiner Frau um. »Hattie? Wo ist der Auftritt heute Abend? Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen.«
»Keine Sorge«, sagte sie und nahm ihm die Gitarre ab. »Ich pass schon auf.«
Mein Onkel schien kurz darüber nachzudenken, dann sagte er: »Alles einsteigen, Hattie.«
»Alles einsteigen, Cliff«, erwiderte sie und stellte die Gitarre weg. »Das Mittagessen wird im Speisewagen serviert. Hast du Hunger?«
»Ist meine Schicht schon zu Ende?« Er klang überrascht.
Meine Tante warf mir einen schnellen Blick zu und erwiderte: »Du hast bald Pause, Schatz. Ich bring dir einen Teller in den Speisewagen. Connie? Kannst du ihn begleiten?«
»Wo ist denn Pinkie?«, wollte Cliff wissen, während Connie Lou auf ihn zutrat.
»Drunten in Florida, das weißt du doch«, sagte sie. »Nun komm schon. Und nimm deinen Stock. Im Zug zu stürzen, ist immer besonders unangenehm.«
»Pffff«, machte Cliff beim Aufstehen. »Seit fünfundzwanzig Jahren arbeite ich in diesem Zug, und ich bin noch kein einziges Mal hingefallen.«
»Trotzdem«, sagte Tante Connie und folgte ihm den Flur entlang.
Hattie drehte sich zu uns um. »Ihr müsst entschuldigen.«
»Da gibt es doch nichts zu entschuldigen«, erwiderte Nana Mama.
Tante Hattie rang die Hände und nickte bewegt, dann drehte sie sich um und ging zurück in die Küche. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich sie nicht schon früher einmal besucht hatte, als es meinem Onkel noch nicht so schlecht gegangen war.
»Alex, besorg dir mal was zu essen, damit Ali und ich uns endlich einen Nachschlag genehmigen können«, sagte Bree.
»Und lass mir was übrig«, rief Jannie.
Ich ging zu Tante Hattie in die Küche. Sie stand an der Spüle, hatte die Hand vor den Mund geschlagen und machte den Eindruck, als müsste sie alle Kraft aufbieten, um nicht an Ort und Stelle zusammenzubrechen.
Aber als sie mich sah, lächelte sie tapfer. »Bedien dich, Alex.«
Ich nahm mir einen Teller vom Küchentisch, schaufelte mir Hasenbraten, Kartoffelsalat und grüne Bohnen mit Pilzen darauf und nahm mir ein paar dicke Scheiben selbst gebackenes Brot. Das war einer der wunderbaren Düfte, die mich vorhin empfangen hatten.
»Seit wann weißt du es?«, wollte ich wissen.
»Dass Cliff an Demenz leidet? Die Diagnose haben wir seit fünf Jahren, aber angefangen hat es schon vor neun Jahren.«
»Bist du die Einzige, die sich um ihm kümmert?«
»Connie Lou hilft mir«, sagte sie. »Und Stefan auch, seit er wieder zu Hause war.«
»Wie kommt ihr finanziell zurecht?«
»Cliffs Eisenbahner-Pension und Sozialhilfe.«
»Reicht das?«
»Wir kriegen es irgendwie hin.«
»Aber es ist schwer …«
»Sehr«, sagte sie und strich sich ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. »Und jetzt diese Geschichte mit Stefan …« Hattie hielt inne, warf die Hände in die Luft und sagte mit erstickter Stimme: »Er ist doch mein Wunderbaby. Wie könnte denn mein Wunderbaby …«
Nana Mama hatte mir erzählt, dass die Ärzte Cliff und Hattie keinerlei Hoffnung auf ein eigenes Kind gemacht hatten. Aber dann war sie mit Mitte dreißig doch schwanger geworden und hatte Stefan zur Welt gebracht.
Ich stellte meinen Teller ab und wollte sie gerade tröstend in den Arm nehmen, da kam Ali hereingestürmt und rief: »Dad! Da draußen, da sind eine Zillion Glühwürmchen, ganz ehrlich, ich schwöre!«
8 Als ich auf die Eingangsveranda trat, war es schon längst dunkel geworden. Draußen vor dem Fliegengitter schwebten Glühwürmchen durch die Luft. Es mussten Tausende sein. Das hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt. Ich musste daran denken, wie Onkel Clifford mir und meinen Brüdern beigebracht hatte, sie mit Gläsern einzufangen, und wie verblüfft ich war, dass zwei oder drei dieser winzigen Geschöpfe so viel Licht abgeben konnten.
Tante Hattie schien meine Gedanken gelesen zu haben. »Soll ich ihm ein Glas holen, Alex?«
»Das wäre sehr nett.«
»Ich hab noch ein großes Erdnussbutterglas unter der Spüle.« Sie ging nach drinnen, um es zu holen.
Dann stellten wir uns alle gemeinsam in Tante Hatties Garten und beobachteten die Glühwürmchen, wie sie durch die Luft tanzten und blinkten wie unzählige, weit entfernte Sterne. Mir wurde warm ums Herz, als ich sah, wie Ali langsam lernte, sie einzufangen. Ein längst verloren geglaubtes Gefühl ergriff mich und hielt mich fest.
Bree hängte sich bei mir ein. »Du lächelst ja. Wieso denn das?«
»Schöne Erinnerungen«, erwiderte ich und deutete auf die Glühwürmchen. »Die waren jeden Sommer hier. Das ist … ich weiß auch nicht.«
»Tröstlich?«, schlug Nana Mama vor.
»Eher so was wie ewig«, meinte ich.
Bevor meine Frau etwas sagen konnte, ertönte auf der Straße lautes Gebrüll.
»Ihr wollt uns verarschen? Das habt ihr jetzt davon!«
Ich drehte mich um und erstarrte.
Ein ganzes Stück entfernt, am anderen Ende des Blocks, taumelten zwei afroamerikanische Teenager mit gefesselten Händen über die Straße. Ihre Fesseln waren mit einem Seil verknüpft, das zu drei älteren Jungen in Hip-Hop-Klamotten führte. Allen dreien schien es sadistisches Vergnügen zu bereiten, die beiden Jüngeren durch die Gegend zu zerren, sie zu verhöhnen und sie immer wieder anzubrüllen, dass sie sich gefälligst bewegen sollten, wenn ihnen ihr Leben lieb war. Das Ganze sah verdächtig nach Sklaventreiberei aus, und das ärgerte mich maßlos.
Ich blickte Bree an, die genauso wütend aussah wie ich.
»Lass dich da bloß nicht reinziehen, Alex«, warnte mich Tante Connie. »Das ist ein Hornissennest und nichts anderes. Frag Stefan.«
Mein Instinkt sagte mir, diese Warnung zu ignorieren, die Straße entlangzulaufen und dieser Barbarei ein schnelles Ende zu bereiten.
»Sie hat recht«, meinte jetzt auch Tante Hattie. »Das ist eine Straßengang hier aus der Gegend, und das, was sie da machen, ist das Aufnahmeritual für die Jüngeren.«
Mittlerweile war das Grüppchen nach links in die Dogwood Road abgebogen und nicht mehr zu sehen.
»Aber die haben die beiden anderen Jungen gefesselt, Dad«, beschwerte sich Jannie. »Das ist doch verboten, oder nicht?«
Genau so sah ich das auch. Diese Jugendlichen waren garantiert noch nicht alt genug, um so etwas mit einem angeblichen gegenseitigen Einverständnis zu rechtfertigen. Aber ich schluckte die bittere Galle hinunter und zwang mich, im Vorgarten meiner Tante stehen zu bleiben, umgeben von Glühwürmchen und den nächtlichen Lauten North Carolinas – Baumfrösche, Zikaden und Eulen. Es klang alles seltsam vertraut und bedrohlich zugleich.
»Wie hast du das denn gemeint, dass Alex sich bei Stefan nach dieser Straßengang erkundigen soll«, wandte Bree sich an Connie.
Tante Connie warf Tante Hattie einen Blick zu, und diese sagte: »Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber ich glaube, er hatte an der Schule ein paar Schwierigkeiten mit denen. Genau wie Patty auch.«
»Wer ist Patty?«, erkundigte sich Bree.
»Stefans Verlobte«, erwiderte Tante Hattie. »Sie ist auch Sportlehrerin.«
»Was hatte Stefan denn für Schwierigkeiten?«, fragte ich Naomi.
Meine Nichte gähnte. »Das soll er dir am besten selbst erzählen. Gleich morgen früh.«
Jetzt fing auch Ali an zu gähnen. Und Nana Mama wirkte ebenfalls bettreif.