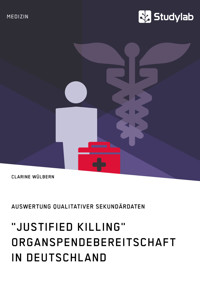
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nach Aussagen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Aber nur knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung besitzt einen Organspendeausweis. Dabei stellt sich die Frage, warum die Werbekampagnen durch die DSO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nicht in dem Maße greifen, wie es gewünscht wird.Die Organspende bleibt ein Tabu, auch wegen verschiedener Manipulationsfälle. Eine wachsende Ablehnung bzgl. der Organspende ist die Folge. Auch aus diesem Grund ist es notwendig, die bisherigen Offensiven von DSO und BZgA neu zu überdenken, um das Vertrauen und die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung wiederzuerlangen. Warum spenden Menschen ihre Organe nicht? Für dieses Buch hat die Autorin fünf Experteninterviews nach qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, um dieser Frage nachzugehen. Dabei hat sie neben der einseitigen Aufklärung über Organspende noch zwei weitere wesentliche und entscheidende Aspekte für die Beantwortung herausgearbeitet.Aus dem Inhalt:- Hirntod;- Hirntodkritik;- Organspendebereitschaft;- Organtransplantation;- Transplantationsgesetz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Danksagung
Zuerst möchte ich an dieser Stelle allen danken, die diese Bachelorarbeit fachlich und persönlich unterstützt und zu ihrem Gelingen beigetragen haben.
Hierbei wird Prof. Dr. phil. David Rester besonderen Dank ausgesprochen, der mich von Beginn an, bei der Wahl des Themas, bis zum Abschluss dieser Bachelorarbeit sehr unterstützt hat. Er übernahm die umfangreiche Erstbetreuung. Danke für die zahlreichen Ratschläge, Hinweise und Denkanstöße, die wesentlich zum Gelingen beigetragen haben. Zudem gilt mein Dank auch Frau Antje Jager (M. Sc.), die mir als Zweitkorrektorin bei dieser Bachelorarbeit und schon während meines Praxissemester bestärkend zur Seite stand.
Die Anfertigung dieser Bachelorarbeit wäre außerdem nicht möglich gewesen ohne die vielen Diskussionen über unterschiedlichste Sichtweisen und Problemstellungen. Danken möchte ich in diesem Zusammenhang insbesondere Stefan Unger, Sebastian Vetter und meinen Eltern Catrin und Thomas Schubert.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
Vorwort
Nachfragen statt vorgeben
1 Einleitung
2 Theoretische Hintergründe
2.1 Organspende
2.2 Transplantationen
2.3 Organspende-Bereitschaft und Skandalisierung
2.4 Hirntod
2.5 Forschungsstand
2.6 Zusammenfassung
3 Methode
3.1 Sozialforschung
3.2 Datengrundlage
3.3 Qualitative Inhaltsanalyse
3.4 Datenauswertung
3.5 Induktive und deduktive Kategorienbildung
4 Ergebnisse
4.1 Kategoriensystem
4.2 Organspende
4.3 Hirntodkonzept
4.4 Organspendeskandale
4.5 Dilemma Organspende
4.6 Philosophische und theologische Betrachtung
4.7 Entwicklungsperspektiven
4.8 Umsetzung Transplantationsgesetz
4.9 Zusammenfassung
5 Diskussion
5.1 Beantwortung der Forschungsfrage
5.2 Methodenkritik
5.3 Hirntodkritik
5.4 Ergebniskritik
6 Ausblick
7 Literaturverzeichnis
8 Anlagen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Werbeplakat „ORGANPATE werden“ (BZGA, 2013c)
Abbildung 2: Organspendeausweis – Vorderseite (BZGA 2013b)
Abbildung 3: Organspendeausweis – Rückseite (BZGA 2013b)
Abbildung 4: Hirntoddiagnose (KALITZKUS, 2009, S.112)
Abbildung 5: Liste der Codings (eigene Darstellung)
Abbildung 6: Memo als Ankerbeispiel (eigene Darstellung)
Abbildung 7: Kategoriensystem nach erster vollständiger Kodierung
(eigene Darstellung)
Abbildung 8: Kategoriensystem nach Revision (eigene Darstellung)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Organtransplantationen (DSO 2012b)
Tabelle 2: Datengrundlage
Tabelle 3: Datenmaterial
Zusammenfassung
Die zu Grunde liegende Bachelorarbeit trägt den Titel „justified killing“ – Organspendebereitschaft in Deutschland. Nach Aussagen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Dementgegen besitzt nur eine Minderheit von knapp einem Viertel der deutschen Bevölkerung einen Organspendeausweis. Dabei stellt sich die Frage, warum die Werbekampagnen durch die DSO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nicht in dem Maße greifen, wie es gewünscht wird? Eine denkbare Antwort ist die hinterfragungswürdige Form der Überzeugungsarbeit beider Institutionen. Die Organspende bleibt tabuisiert, bisweilen noch mehr durch die öffentlich bekanntgewordenen Manipulationsfälle. Ein Resultat ist die sich ausdehnende Ablehnung bezüglich der Bereitschaft zur Organspende in der deutschen Bevölkerung. Auch aus diesem Grund ist es notwendig die bisherigen Offensiven von DSO und BZgA neu zu überdenken, um das Vertrauen und die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung wieder zu erlangen. Mit dem Ziel die Spende-Bereitschaft in Deutschland zu erhöhen, wurde das Transplantationsgesetz (TPG) 2012 novelliert und die Entscheidungslösung eingeführt. Bisher wurden keine Erfolge dieser Zielsetzung verzeichnet. Wiederum ist diese Erscheinung maßgeblich auf die fragliche Umsetzung des Gesetzes zurück zu führen. Die Maßnahme Transplantationsbeauftragte einzusetzen, um das System transparenter und effektiver zu gestalten, scheitert größtenteils an der Kostendeckung des zusätzlichen Personalaufwandes. Für die Bachelorarbeit wurden fünf Experteninterviews nach qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, um der Frage nachzugehen: Warum spenden Menschen ihre Organe nicht? Dabei zeigten sich drei wesentliche und entscheidende Aspekte für die Beantwortung: Der wichtigste Punkt besteht in der manipulierenden und falschen Art der Beeinflussung durch die DSO und BZgA, bezüglich der einseitigen Aufklärung über Organspende. Um die Bereitschaft wieder zu erhöhen, muss versucht werden durch spezielle Anreizsysteme das Interesse der deutschen Bevölkerung wieder zu erlangen. Dabei sollte auf eine objektivere Aufklärungsweise Wert gelegt werden, wodurch dem Menschen die Freiheit gegeben wird, sich wissentlich und wohl Bedacht zu positionieren.
Schlüsselwörter:Organspende, Organspende-Bereitschaft, Hirntod, Organtransplantation, Beeinflussung
Keywords:
Vorwort
Die Autorin nennt folgend ihre Beweggründe für die Bachelorarbeit. Dafür wird sich der Dialektik von Nähe und Distanz bei Organspende und Transplantationsmedizin bedient. So werden Zitate und Statements von Befürwortern und Kritikern einbezogen um eine möglichst umfassende Erklärung zu erhalten. Dabei gilt zu beachten, dass die Bachelorarbeit bewusst gewählt in neutraler Sicht- und Schreibweise verfasst wurde. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bevorzugt die männliche Schreibweise verwendet, sodass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint ist.
Ein Vortrag mit der Überschrift ‚Organspende – im christlichen Sinne‘ weckte 2008 erstmalig Sympathien. Nach Gruppendiskussion und Abwägung von pro und kontra wurde der Organspendeausweis (OSA) uneingeschränkt ausgefüllt und unterschrieben. Vier Jahre später, vor der Auseinandersetzung mit der Bachelorarbeit, wurde bisweilen noch die positive Einstellung gegenüber Organspende vertreten. So auch auf Grund des persönlichen christlichen Glaubens war und galt die damalige Zusage für eine Organentnahme nach dem Ableben als unbedenklich und stellte einen Akt der Nächstenliebe dar. Im Verlauf der Bachelorbearbeitung und kritischen Auseinandersetzung mit der Transplantationsmedizin – Organspende wankte das Verhalten zu den Vorgängen. Durch die spezifische Auseinandersetzung in der Bachelorarbeit hat die Organspende an persönlicher Bedeutung für die Autorin gleichzeitig gewonnen und verloren. Besonders die öffentliche Kritik am Hirntodkonzept lassen Zweifel am genauen Todeszeitpunkt des Menschen aufkommen. Auch wenn durch den persönlichen Glauben an ein Leben nach dem Tod, die Sorge geringer sein sollte, so spielt die Angst fälschlicherweise als Hirntod diagnostiziert zu werden, hierbei eine wesentlichere Rolle. Es wird weiter als negativ beurteilt, dass durch Organtransplantation Ärzte auf eine Gottgleiche Stufe erhoben werden, da sie beinahe uneingeschränkt in der Lage sind, über Leben und Tod zu urteilen, weil sie über Hirntodkonzept und notwendige Technik verfügen dürfen. Hinzu kommt ein weiterer bedenkenswerter Aspekt auf menschlicher Zwischenebene, dass bei postmortaler Spende Menschen mit Organen eines Fremden weiterleben. Dahingehend sollte auch die Lebensdauer eines Menschen nicht vom Ableben, beziehungsweise (bzw.) den Organen eines anderen bestimmt werden.
Nachfragen statt vorgeben
1 Einleitung
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2010)
“Organspende schenkt Leben”
Im Jahre 1967 ist es dem südafrikanischen Chirurgen Christiaan Banard erstmalig gelungen ein Herz erfolgreich zu transplantieren. Dieser Erfolg begünstigte die weltweite Durchsetzung und Weiterentwicklung der Transplantationsmedizin. (MEINECKE 2012, 13) Diesem brisanten Verlauf stehen moralische, ethische und juristische Bedenken gegenüber. Bereits 1968 ermittelten Staatsanwälte wegen vorsätzlicher Tötung gegen Transplantationschirurgen. So dass die Havard Ad-hoc Kommission daraufhin den Tod des Menschen neu definierte, zeitlich vorverlegte und somit erweiterte in seinem bisherigen Rahmen. (MEINECKE 2012, 13) Der wissenschaftliche und medizinische Fortschritt wird futuristisch in der Kulturkritik mit verschiedenen Szenarien von dem Film ‚Koma‘ 1973 bis hin zum 2005 veröffentlichten Film ‚Die Insel‘ abgebildet. Diese Kritik mündet jetzt in der Realität bzw. schon bald in naher Zukunft. So berichtet die ‚Süddeutsche Zeitung‘, dass es amerikanischen Wissenschaftlern erstmals gelungen ist, menschliche Stammzellen aus einem eigens hierfür geklonten Embryo zu gewinnen (ILLINGER 2013).
Im November 2012 wurde in Deutschland das neue TPG verabschiedet. Die deutsche Bundesregierung hat sich mit der Novellierung des TPG zum Ziel gesetzt, jeden Bürger zur Meinungsäußerung seiner Organspende-Bereitschaft zu befragen. Durch die Krankenkassen sollen Aufklärung und Befragung erfolgen. Es wird dadurch eine Erhöhung der Organspenderanzahl und eine Reduzierung der psychischen Belastung für die Angehörigen erwartet. (BMG 2012a) In Deutschland warten knapp 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Diese Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren kaum verändert. Ein Drittel der Wartelistenpatienten stirbt jedes Jahr. Diesen hohen Anteil führt die DSO darauf zurück, dass lediglich ein Viertel der deutschen Bevölkerung überhaupt über einen OSA verfügt. (DSO 2012a) Organspende ist skandalisiert. Transplantationsmediziner manipulierten im letzten Jahrzehnt mehrfach Patientenakten. Die mediale Dokumentation dieser Vorfälle begünstigte die gleichsam abnehmende Organspende-Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung. (HIBBELER 2013) Um diesem Trend entgegen zu wirken, wirbt die deutsche Bundesregierung mit dem Slogan, dass es sich bei Organspende-Bereitschaft um einen Akt der Nächstenliebe handle, wodurch das Leben eines Menschen gerettet bzw. verlängert werden kann (BMG 2012b). Fraglich bleibt im Umkehrschluss, ob die gewählte Weise, bewusst in Appellform einer moralischen Pflicht, jemals Erfolg haben wird.
2 Theoretische Hintergründe
(Anna Bergmann 2011)
“Organspende, denn die Hoffnung stirbt zuletzt.”
Die Definition und Erläuterung zentraler Begriffe steht im Vordergrund des theoretischen Kapitels. Die historische Entwicklung wird mit Hilfe einer tabellarischen Darstellung aufgezeigt. Weiter sollen die wichtigsten Organisationen und Institutionen mit ihren jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen vorgestellt werden. Die Organspende-Skandale und der weltweite Organhandel werden mit der Beleuchtung des Hirntodes am Ende des Kapitels näher beleuchtet. Der Forschungsstand schließt das theoretische Kapitel ab.
2.1 Organspende
Nach § 1a Nr.1 TPG bestehen alle Organe, mit Ausnahme der Haut, aus verschiedenen Geweben. Sie sind Teile des menschlichen Körpers, die in Bezug auf Struktur, Blutgefäßversorgung und Fähigkeit zum Vollzug physiologischer Funktionen eine funktionale Einheit bilden (BMJ 2012).
Postmortale Organspende
Unter einer postmortalen Organspende wird die Organentnahme von toten Organspendern verstanden. Die DSO definiert Organspender wie folgt: „Als potenzielle Organspender werden Verstorbene bezeichnet, bei denen der Hirntod nach den Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellt worden ist und keine medizinischen Ausschlussgründe zur Organspende bezüglich der Organfunktion oder der Gefährdung des Empfängers durch übertragbare Krankheiten vorliegen.“ (DSO 2010a) Weiterhin definiert die DSO (2010b)
Bedingungen für die Organentnahme: „Damit bei einem Verstorbenen Organe entnommen werden dürfen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Der Verstorbene oder – stellvertretend – seine Angehörigen müssen in die Organentnahme eingewilligt haben. Der Hirntod muss nach den Richtlinien der BÄK eindeutig festgestellt worden sein.“
Lebendspende
Die Lebendspende bezeichnet die Transplantation von doppelt vorhandenen Organen, wie Niere oder Organteile, wie Leber, oder Gewebe von einem lebenden Organspender auf einen kranken Empfänger. Das TPG schreibt eine Bedingung vor, dass die Transplantation von Organen lebender Spender nur zulässig ist, wenn kein postmortal gespendetes Organ für den Empfänger zur Verfügung steht. Außerdem beschränkt das TPG die Lebendspende mit speziellen Voraussetzungen. Darunter erfolgt die Lebendspende, das heißt Spende und Empfang, nur zwischen Ehegatten, Verwandten ersten oder zweiten Grades, Verlobten oder andere sich in persönlicher Weise nahestehender Personen. (DSO 2010c)
2.2 Transplantationen
Organtransplantation bezeichnen eine Operation bei denen Zellen, Körpergewebe oder Organe zum Ersatz für geschädigte oder funktionsuntüchtige Gewebe oder Organe von einem gesunden oder hirntoten Spender auf einen schwerkranken Menschen übertragen werden (DSO 2011). Unterschieden werden dabei drei Formen der Transplantation (Robert-Koch-Institut 2003):
allogene/ homologe Transplantation
Die Übertragung von Gewebe und Organen von einem Menschen auf einen Anderen.
autogene/ autologe Transplantation
Die Übertragung von körpereigenem Gewebe, von einem Körperteil auf einen Anderen
xenogene/ heterologe Transplantation
Die Übertragung von Organen zwischen Individuen verschiedener Art, z.B. zwischen Mensch und Tier
Um einen Überblick zu den historisch wichtigsten Organtransplantationen zu geben, werden in Tabelle 1 die weltweit ersten erfolgreichen Organtransplantationen abgebildet. Auf die Entwicklung von Gewebetransplantationen wird hierfür nicht weiter eingegangen.
Tabelle 1: Organtransplantationen (DSO 2012b)
DSO





























