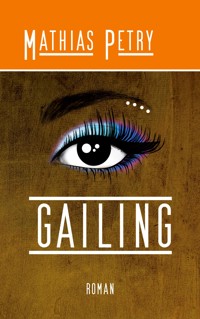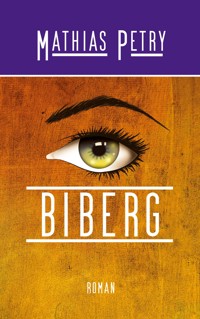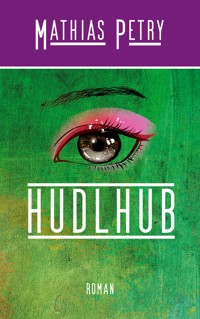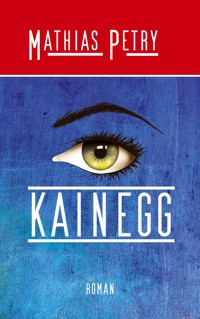
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: edition KB8
- Sprache: Deutsch
Die einen stehen auf Zaphod Beeblebrox, andere haben noch nie von ihm gehört, aber das ist ganz normal. Weil die Welt bekanntlich aus unzähligen Paralleluniversen besteht: Fußballfans- und Fußballhasser, Star-Wars- und Star-Trek-Devotees, Fake-News-Opfer und Hinterfragende, Frühaufsteher und Langschläfer. Gläubige und Gottlose. Die Gegenwart ist schon derart kompliziert, dass man sich fragen muss, ob es wirklich schlau ist, auch noch in der Vergangenheit herumzuwühlen. Die Schriftstellerin Bettina Hinkel macht sich jedenfalls keine Freunde, als sie die Geschichte eines bis heute unaufgeklärten Sechsfachmordes neu aufrollt, der sich dereinst auf einem Einödhof in Kainegg ereignete. Nicht jeder im benachbarten Dorf namens Hudlhub will, dass sich die Schatten der Vergangenheit über den Alltag der Gegenwart legen. Die Ereignisse überstürzen sich, als in der Gemeindekirche ein Brand ausbricht. Die zerstörerische Kraft des Feuers bringt mindestens ebenso viel durcheinander wie Bettinas Hinkels Neugier, zumal der Landtagsabgeordnete Ludwig Haderlein, der sein eigenes Süppchen kocht, alles noch viel schlimmer macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 | FRÖSTELND
2 | DER HIMMEL IST NASS
3 | DER HIMMEL WEINT
4 | EINE WÄRMENDE MAHLZEIT
5 | DER HIMMEL BRENNT
6 | EIN PROSIT DER GEMÜTLICHKEIT
7 | TEE TRINKEN
8 | LOCHFRASS
9 | ALARM
10 | WER LANGE FACKELT
11 | NACKERT, ODER?
12 | EINE TOURISTIN
13 | ABGEORDNETER IM EINSATZ
14 | SPITZ AUF KNOPF
15 | KONTAKTSUCHE
16 | DER MOND TANZT
17 | GUTEN MORGEN
18 | DIE TIPPGEMEINSCHAFT
19 | DER HUBERBAUER
20 | WAS GEHT AB
21 | WAS DER HUBERBAUER SAGT
22 | EINE ART ÜBERRASCHUNG
23 | VERZWEIFELND
24 | WAS DER HUBERBAUER DENKT
25 | DER STEIN DES WEISEN
26 | WER ZU SPÄT KOMMT
27 | ABLASS
28 | JETZT ABER ZACKIG
29 | DORFPHILOSOPHIE
30 | DER BOMMEL HÄNGT
31 | AUF DREI
32 | BEKNACKTE NAMEN
33 | RENNEND
34 | BLICK INS ARCHIV
35 | ZWEIFELND
36 | HOFFEN UND BANGEN
37 | KEINE EXTRAWURST
38 | DER KERN IM APFELHAUS
39 | EINER WACHT AUF
40 | EIN RADLER ZUR RECHTEN ZEIT
41 | VERGELTEND
42 | LUFT
43 | WAIDMANNSHEIL
44 | EIN WIEDERSEHEN
45 | MILITÄRGEHEIMNISSE
46 | NICHT EINFACH ZUSCHAUEN
47 | BAMBI, LIEBES BAMBI
48 | PAUSENSNACK
49 | WELTBESTER APFELKUCHEN
50 | ZWEIUNDVIERZIG BREZEN
51 | FLOCKI UND SYLVIE
52 | AUFFE MUASS I
53 | WEIL JEDER WEN KENNT
54 | INZESTUÖS
55 | KASPRESSKNÖDEL
56 | KICKEN, ABER SO RICHTIG
57 | HALLO FRAU BICHLER
58 | KIRCHGANG
59 | HÖR MAL, WER DA ATMET
60 | MITFIEBERND
61 | DEIN FREUND UND HELFER
62 | NICHT GUT KIRSCHEN ESSEN
63 | DÜSTERE GESTALTEN
64 | FRUCHTRAVIOLI
65 | HERR, ICH HABE GESÜNDIGT
66 | ANDERE WELTEN
67 | ITALIAN STALLION
68 | DIE AUFTRAGGEBERIN
69 | REHBRATEN
70 | EINE FRAGE DER FANTASIE
71 | MERKEL, HILF
72 | VERSTECKEND
73 | GESTÄNDNIS
74 | DER GEMEINDERAT TAGT
75: NA DANN: GUTE NACHT
76 | BETTINA UND STEFFI
77 | UND JETZT: ALLE ZUSAMMEN
NACHSPIEL
1 | AM MARTERL
2 | GOTTESDIENST
3 | SAMOS
4 | DER HUBERBAUER KAUFT EIN
5 | POST VON HADERLEIN
6 | HUDLHUBBER KOCHKUNST
1 | FRÖSTELND
Kalt, es ist kalt.
Mir ist kalt.
In mir ist es kalt.
Was habe ich getan? Sie sind tot. Alle erschlagen. Eben schrie der Bub noch, auch ihn hat meine Haue erwischt. Sie fuhr durch das Dach seines Bettchens, sie traf. Vorhin, da hatte er noch mit der Katze im Hof gespielt. Er wird nie wieder spielen. Was habe ich nur getan? Und was ist mit dem Mädel? Sie ging beim Kampf dazwischen, dann traf sie die Haue am Kinn. Sie wimmert, sie schreit. Seit bald einer halben Stunde schon. Hör doch auf zu schreien, Kind. Der Todesstoß, er fehlt. Ich kann sie nicht erlösen, ich ertrage ihre Qualen nicht.
Kalt. So kalt.
Ich habe Hunger. Großen Hunger. In der Küche, da muss es etwas zu essen geben. Ja, Brotsuppe für die Kinder. Ich kann nicht ihr Essen essen, es war nicht für mich, es war für sie.
So großer Hunger. Die Kälte.
Da liegt ein Laib Brot, der wird mir guttun, ich schneide eine Scheibe ab, gleich mit der Haue. Aber, nein, es ist Blut an der Schneide. Und Haare. Hirn.
Ich muss die Haue loswerden, die zur Waffe geworden ist. Wohin damit? Was soll ich tun? Alle sind sie hinüber. Ausgelöscht.
Oder nicht? Das arme Mädel, es wimmert immer noch, hör auf! Gib doch endlich Ruh, Kind! Ich kann das nicht ertragen, muss noch einmal hin, muss beenden, was ich begonnen habe. Mir ist übel.
Ich habe Hunger.
Ich muss etwas essen.
Ich muss die Waffe loswerden. Und Ruhe schaffen. Ich muss für Ruhe sorgen, damit die Nachbarn uns nicht hören.
Ich brauche Zeit. Das Vieh. Das Vieh muss gefüttert werden.
Da steht die Wiege des Buben. Der brave Bub. Warum ist er tot? Was ist überhaupt passiert?
Brot essen. Eine Scheibe abschneiden, da liegt ein Messer. Das Messer ist keine Waffe, es ist nur ein Messer. Meine Hände zittern, warum zittern sie so? Das Kind. Wann hört es endlich auf zu wimmern?
Was klirrt da? Das Messer, es gleitet mir aus der Hand. Jetzt liegt es am Küchenboden, neben der Haue mit dem Blut, den Haaren, dem Hirn.
Ich kann nichts essen, so übel ist mir. Das Vieh. Das Brot. Ich brauche Zeit. So müde bin ich. Ich muss schlafen.
Schlafen. Schlafen.
2 | DER HIMMEL IST NASS
»So ein Mist!«
»So ein Bockmist!«
»So was Blödes!«
»So ein Dreck!«
Selten waren sich die Herren Ministranten einmal so einig.
»So eine Sauerei!«
»Ja, leck fett.«
»Kruzinesn.«
»Ja spinnst!
Da standen sie in der Sakristei der Hudlhubber Dorfkirche Zur Heiligen Mutter Gottes Verkündigung und vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Denn der Himmel war pitschpatschnass. Das konnte so nicht bleiben.
»Du kannst dich heutzutage aber auch auf gar nichts mehr verlassen«, schimpfte Leon, »nicht einmal auf den Wetterbericht.«
»Der im Fernsehen stimmt ja eh nie, seit der Kachelmann ihn nicht mehr macht.« Jan-Eric äffte seinen Papa nach, was niemand außer ihm selbst wusste. Wobei Jan-Eric nicht den Hauch eines Schimmers hatte, wer genau denn dieser Kachelmann war, und genau genommen war ihm das auch total egal. Er hätte den Namen googeln können. Hat er aber nicht.
»Wie, Fernsehen? Gehst du schon in Rente?«, sagte Ferdinand, der sich, wenn er nicht gerade schlief, im Minutentakt im Internet bewegte, und mit diesem vorsintflutlichen Teil an der Wohnzimmerwand genauso wenig zu tun haben wollte wie die meisten seiner Altersgenossen, außer er hatte sich mit seinem Smartphone in den gecurvten Flatscreen eingeloggt.
»Hab im Netz geschaut«, meldete sich jetzt Leon, der Profi, zu Wort, »alle Portale waren sich einig: Es bleibt trocken.«
»Von wegen!« Das war Tim, der Oberministrant. »Jedenfalls müssen wir jetzt was unternehmen, sonst ist der Himmel bis zur nächsten Fronleichnamsprozession verschimmelt.«
»Igitt, dann mag ich den aber nicht mehr anfassen«, sagte Leon.
»Ich auch nicht.« Ferdinand schüttelte es regelrecht bei dem Gedanken.
»Und der Herr Pfarrer wär’ da auch nicht glücklich, immerhin war der Himmel gerade erst bei Regens Wagner in Hohenwart zum Ausbessern, und dafür sind gewiss einige Kollekten draufgegangen«, sagte Tim.
»Aber schön ham’s es gemacht.«
»Ja, schon schön.«
»Und jetzt ist er schön nass.«
Tim versuchte eine Ecke auszuwringen. »Sinnlos.«
Die Tür zum Kirchenschiff ging auf, der Pfarrer steckte den Kopf durch die Tür.
»Alles klar, Männer?«, fragte er. Er sah aus wie ein begossener Pudel, seine Fröhlichkeit ließ er sich von einem kleinen Wolkenbruch sicherlich nicht vermiesen. Auch nicht, wenn er pitschpatschnass war, inklusive Unterhose. Ein klein wenig hatte er sich ja schon darüber geärgert, dass alle Hudlhubber einfach nach Hause gestürmt waren, mitten in der Prozession. Bloß, weil sich da ein paar dunkle Wolken am Himmel über dem Himmel aufgetürmt hatten. Der Bürgermeister war nach zehn Minuten schon weg gewesen, aber das kannte man ja, dafür bedurfte es keines Regenschauers.
»Passt schon, Herr Pfarrer, wir gehen gleich, wir räumen nur noch kurz auf«, sagte Oberministrant Tim.
»Dass ihr euch nur nicht erkältet!«
»Keine Sorge, Herr Pfarrer, schaun S’ eher, dass Sie sich keinen Schnupfen holen. Am Sonntag haben Sie volles Haus, da müssen Sie schließlich abliefern.«
Der Pfarrer überlegte kurz, ob er darauf reagieren sollte, entschied sich dann aber, es lieber zu lassen. »Danke, Männer!«, sagte er nur, dann schloss er die Tür.
Bis eben noch hatte sich Ferdinand zusammengerissen, jetzt begann er aber doch, zu zittern.
»Wisst Ihr was, mir ist das hier jetzt völlig wurscht. Mir ist kalt, und ich will erstmal aus den nassen Sachen raus. Der Himmel kann warten.« Ferdinand bestand allerdings nur aus Haut und Knochen, er hatte gerade einen krassen Wachstumsschub hinter sich, zwölf Zentimeter in acht Monaten.
»Finde ich auch«, sagte Jan-Eric und wischte sich das Wasser von der Stirn, das von den Haaren herunterlief. Er war der Sohn des Feuerwehrkommandanten. Seine Eltern hatten sich gerade getrennt, die Mutter war in die lebenswerteste Stadt des Universums gezogen, und er pendelte jetzt zwischen Pfaffenhofen und Hudlhub, jener zauberhaften, kleinen Gemeinde im hügeligen Herzen Bayerns, wo der Himmel noch weiß-blau, die Welt noch in Ordnung und er bei Papa Franz an den Wochenenden daheim war.
»Mein Dad hat einen Heizlüfter, einen echten Fakir, der macht saumäßig heiß. Wenn ihr wollt, bring ich den nachher mit, und dann heizen wir dem Himmel dermaßen ein, dass ihm das Wassern vergeht.«
»Gute Idee«, sagte Ferdinand, »meine Oma hat so was auch, den bring ich auch mit.«
So zogen sie los, die vier Himmelspfleger, um sich abzutrocknen, sich umzuziehen und sich dann den Himmel vorzunehmen.
Sie wussten: Die Hudlhubber zählten auf sie. Und das konnten sie auch.
Obwohl die Dorfkirche Zur Heiligen Mutter Gottes Verkündigung ziemlich abgelegen ein gutes Stück außerhalb des Dorfes stand, waren sie keine halbe Stunde später alle wieder da. Abgetrocknet, umgezogen, und jeder hatte mindestens einen Fakir dabei, Jan-Eric sogar drei.
»So, dann wollen wir mal!«, sagte er und steckte die Fakire der Reihe nach in eine Mehrfachsteckdose. Die anderen taten es ihm gleich, Ferdinand hatte zum Glück noch eine zweite Steckerleiste mitgebracht, sicher ist sicher. Ein Gerät nach dem anderen wurde zugeschaltet, schnell wurde es kuschelig warm, in der Sakristei.
»Vielleicht sollte man hier in Zukunft immer ein paar Heizlüfter aufstellen«, sagte Tim, »da wird sogar die Sakristei richtig gemütlich!« Das fanden die anderen gut.
»So, jetzt aber nix wie heim, Mittagessen!«, sagte Ferdinand, und die anderen nickten. Ein paar Kalorien auf den Knochen würden ihm sicher guttun. Alles andere überließen sie den Fakiren. Bis zum Abend, da waren sie alle ganz sicher, würde der Himmel wieder trocken sein.
Sie hatten ihm jetzt genug eingeheizt.
3 | DER HIMMEL WEINT
Weil Feiertag war, hatte sich Fanny richtig rausgeputzt, sie trug ihr zweitschönstes Dirndl, das sie bei einer Trachtenschneiderin ganz in der Nähe hatte anfertigen lassen, die neue Schrobenhausener Tracht. Vor ein paar Jahren war sie, basierend auf der original Paartaler Tracht, entworfen worden. Und die brachte Fannys erstaunliche Auslage prächtig zur Geltung. Sie mochte durchaus, wenn sie Blicke ihrer männlichen Gäste auf sich zog.
Heute klappte das nicht.
Ludwig, Max, Meik und Charlie schafkopften, und sie waren viel zu sehr mit dem Spiel beschäftigt, als dass sie bewundert hätten, was Fanny zu bieten hatte. Außerdem war die Fanny ja eh immer da. Der Feuerwehrtrupp von Hudlhub hatte wie üblich an Fronleichnam während der Prozession die Straßen abgesichert, aber als die Kameraden merkten, wie sich alle wegen des drohenden Unwetters aus dem Staub machten, hatten auch sie sich nach und nach abgemeldet. Sie kamen gerade in Adelheid Kirchmairs Wirtshaus an, da ging es auch schon los. Gewaltige, fast weintraubengroße Regentropfen wurden vom Himmel zu Boden geschleudert. Durchs Wirtshausfenster sahen sie, wie nun auch Hochwürden und seine vier Ministranten unter dem heiligen Himmel das Weite suchten, sie würden es schon finden.
»Ich spiel mit der Blauen!«, sagte Meik.
»Die Genaue«, ergänzte Max.
»Die mit der Mannschaftsaufstellung!«, wusste Ludwig. Charlie sagte dazu nichts, er nickte nur und ließ seine schönen Männerhände mit den sich leicht über der feinporigen Haut erhebenden Venen am Tisch ruhen. Die Jungs sagten das mit der Blauen, der Genauen, immer, wenn einer mit der Gras-Sau spielte. Irgendeiner hatte das einmal begonnen, und die Generation früherer Hudlhubber Schafkopfer wie der Reiß Sepp oder der Hausknecht Valentin hätten gewiss noch gewusst, dass sich der Spruch auf die einstige Stadionzeitung des TSV 1860 München bezog, die Blaue, die Genaue, die mit der Mannschaftsaufstellung.
Die Feuerwehrmänner von Hudlhub hatten davon keine Ahnung. Keinen Schimmer.
Nicht den geringsten.
Der Meik hatte zwar mal gefragt, woher das kam, aber da hatte sein Smartphone gerade keinen Empfang, so dass er Siri nicht fragen konnte, und dann war es auch schon wieder rum ums Eck.
»Sie schon wieder. Die Blaue. Natürlich«, sagte Ludwig. »Das ist grad deine Lieblings-Sau, oder?« Er hatte ihn, den Gras-Ober, damit war er in diesem Spiel der Partner von Meik. Jetzt, wo noch keine Karte gezogen war, wusste das nur er allein. Das würde sich aber gleich ändern. Ludwig zog den Oidn, also den Eichel-Ober, ballerte ihn auf den Tisch und sorgte für klare Verhältnisse.
»So!«, sagte Ludwig.
»Wer sö socht, hat noch nüscht gedön!«, erwiderte Meik und schmierte seinen Herz-Zehner. Den Spruch sagte er immer auf, wenn jemand im Raum »so« sagte.
»Na, da haben sich ja zwei gefunden«, sagte Max.
Charlie trank einen Schluck Weizen und spatzte sich ab. So nennt man das, wenn man eine Karte spielt, die garantiert keinen Stich macht, dem Gegner auch keine Punkte bringt.
»Warum trink ich eigentlich als einziger ein Bier?«, fragte er dabei in die Runde.
»Meine Frau lässt mich nicht«, sagte Ludwig, und die anderen nickten verständnisvoll. Ludwig war schließlich jung verheiratet. Trotzdem: Alle vier winkten, ohne aufzusehen, nach Fanny.
Vier Halbe, bitteschön.
Hätten sie die Frau beobachtet, die zwei Tische weiter saß, wäre ihnen das kurze Lächeln nicht entgangen, das über ihr Gesicht zuckte. Sie war der einzige weitere Gast an diesem Tag. Fanny allerdings war die kurze Regung nicht entgangen. »Wieder mal typisch, oder?«, fragte sie, und die Frau wandte sich ihr zu. Sie war Ende 20, vielleicht Anfang 30, hatte eine kaum zu bändigende schwarze Mähne, die sie erfolglos hinter die Ohren zu klemmen versuchte.
»Ja mei!«, sagte die Frau. »Männer halt. Was will man da schon erwarten.« Sie sagte das zwar auf eine Weise von oben herab, wie man so etwas nun mal in solchen Small-Talk-Situationen sagt, aber es schwang eine gewisse Traurigkeit dabei mit, die Fanny, mit ihren im jahrelangen gastronomischen Dienst geschulten feinen Antennen, nicht entging.
Da hatte wohl jemand Ärger mit einem Mann.
Um ihr nicht zu nahe zu treten, wechselte Fanny unvermittelt das Thema.
»Was schreibst’n da?«
Tatsächlich kritzelte die Frau mit der Mähne etwas in eine Art Notizbuch. Sie musterte Fanny kurz, nicht unhöflich, und doch genau genug, um zu wissen, dass bei dieser Bedienung das Herz am rechten Fleck saß. Sie mochte sie sofort.
»Tagebuch«, sagte sie deshalb und lächelte kurz.
Und Fanny legte den Kopf in den Nacken, was soviel bedeutete wie Ahjetztja und verzog sich diskret. Die Schwarzhaarige sah ihr kurz nach und lächelte weiter. Hatte sie sie also richtig eingeschätzt.
Fanny war schwer in Ordnung.
»Die junge Liebe!«, sagte Max drüben am Schafkopftisch zu Ludwig. »Musst heut noch Leistung bringen.«
»Du bist doch nur neidisch!«, sagte Ludwig, und alle am Tisch wussten, dass das stimmte. Und Fanny wusste das auch, und die Schwarzhaarige auch.
»Vielleicht suchst dir auch einmal eine, Max«, schlug Charlie vor, »so wie der Huberbauer.«
»Und wie hat’s der Huberbauer gemacht?«, stieg Max drauf ein.
»Der hat zum Viehhändler gesagt: Weißt nicht eine Frau für mich? Und dann hat der gesagt: Für ein Kalb bring ich dir eine. Und das hat er dann auch gemacht. Was der Viehhändler ihm nicht sagte, ist, dass die gute Dame auf ihren ersten Mann mit einem Schürhaken losgegangen war.«
»Ja, und der ist dann an seinem Auge hängen geblieben«, ergänzte Ludwig, er kannte die Geschichte schon.
»Aua!«, sagte Meik.
»Ja, das hat er auch gesagt, der gute Mann«, grinste Charlie. »Und der Huberbauer ist sein Kalb losgeworden.«
»Und wie lang ist das schon her?«, fragte Max.
»Oh, sicher 18, 20 Jahre. Er hat Glück gehabt, er hat auch noch beide Augen, allerdings ...«
»Allerdings was?«, wollte Max wissen.
»Naja, schau halt mal genau hin, wenn du ihn nach der nächsten vhs-Seniorengymnastik beim Duschen siehst.«
»Seit wann duschen die sich denn nach der Seniorengymnastik? Und seit wann gehe ich da überhaupt hin?«
»Auch wieder wahr. Er ja auch nicht. Es ergibt sich schon mal eine Gelegenheit.«
»Bestimmt. Und wie ich da hinschauen werde.«
»Und bis dahin suchst dir endlich eine Frau, Max, ob mit oder ohne Viehhändler.«
»Ist schon recht, Charlie.«
Fünf Karten waren gespielt, da legte Meik sein restliches Blatt auf den Tisch. Die beiden höchsten verbliebenen Trümpfe und die Herz-Sau. Ganz klar: In diesem Spiel würde keiner mehr einen Stich machen. Sie warfen die Karten zusammen.
»Sö!«, sagte Meik, und alle mussten lachen.
Max drehte sich rüber zu der Frau am Nachbartisch.
Sie war so sehr in ihr Tagebuch vertieft, dass sie Max nicht gleich wahrnahm. Wobei er ihr optisch durchaus aufgefallen war. Max hatte zuletzt viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, bei ihm war einiges hingewachsen.
»Wie bitte?«
»Ich sagte: Bei uns in Hudlhub ist immer etwas geboten, gell?
»Ist das so?«, erwiderte sie und meinte es etwas weniger unfreundlich als es vielleicht klang.
»Sie sind neu hier, oder?«
»Schon, ja.«
»Ich bin der Max«, sagte der Max und kippelte mit dem Stuhl etwas nach hinten, um die Schwarzhaarige etwas genauer mustern zu können.
»Bettina«, sagte Bettina, die plötzlich nicht anders konnte als loszuprusten. Ludwig, der lustige Kamerad, war nämlich mit einem Fuß unter Max’ schon schwebendes vorderes Stuhlbein gefahren und hatte ihm den entscheidenden Kick gegeben. Max spürte, wie er nach hinten kippte, versuchte sich vergeblich irgendwo festzuhalten, er verlor das Gleichgewicht und wunderte sich noch viel mehr, warum er nicht auf den Boden krachte. Als er die Augen öffnete, war ihm alles klar: Er starrte von unten auf Fannys gewaltigen Vorbau. Sie war manuelneuermäßig genau richtig gestanden und fing Max mit dem Bauch auf, Kraft genug hatte sie eh, als oktoberfestgestählte Kellnerin.
»Und, Max, gefällt dir, was du siehst?«, fragte Fanny belustigt und atmete mal eben tief ein.
»Mei, Fanny, du bist die Beste!«, stammelte der Max nur, und er hatte es gerade überhaupt nicht eilig, aus seiner Position herauszukommen.
Ludwig wollte seinen Spezl nicht blamieren und wechselte das Thema. »Du bist sicher wegen des Mordes hier«, wandte er sich an Bettina. Das gab Max Zeit, sich wieder zu sammeln. Du blöder Hund, das waren die Worte, zu denen er den Mund stimmlos und grinsend formte, Ludwig zwinkerte ihm mit dem von Bettina abgewandten Auge kurz zu.
»Wegen des Mordes? Was für ein Mord?«, fragte Bettina.
»Na, Kainegg, halt.«
»Kainegg? Ist das hier?«
»Ja freilich, keine drei Kilometer entfernt.«
»Von Kainegg habe ich schon gehört. Aber eigentlich besuche ich nur meine Nichte Steffi!«
Da schaute Charlie auf. Ach, DIE Bettina. Alles klar. Steffi hatte was gesagt, dass sie kommt.
»Hallo Bettina«, sagte er, »ich bin Charlie. Ich und die Steffi ...«
»Wie schön!«, sagte Bettina und lächelte ihn an. »Ich war bloß etwas früh dran, und weil ich mich bei der Prozession nicht nass regnen lassen wollte, bin ich hier noch eben eingekehrt.«
»Wir haben ja auch ganz viele andere Sachen zu bieten, in Hudlhub«, sagte Ludwig und schaute zu Max, alles klar, er war wieder dabei.
»So? Wirklich?«, fragte Bettina, offensichtlich amüsiert.
»Na, bei uns ist eigentlich immer was los«, sagte Max.
»Also, man kann bei uns in Hudlhub ganz wunderbar dem Gras beim Wachsen zuschauen!«, sprang Meik ein. Er war mal wieder keine große Hilfe.
»Und der Hudlhoop-Reifen ...«. Das war Ludwig.
»Der ... Hudlhub-Reifen?
»Hudlhoop, ja richtig. Mit zwei ,o’ und einem ,p’ hinten«, sagte Max, »der Hudlhoop-Reifen ist hier bei uns erfunden worden.«
»Der – was?«
»Na, du kennst doch den Reifen, den man um den Bauch schleudern lässt ... ja ich weiß schon, die Leute glauben immer, der wäre aus Amerika, aber das stimmt gar nicht. Unser Dorfphilosoph ...«
»... Matthias Kronleichter ...«, ergänzte Ludwig.
»... 1726 bis 1754 ...«, warf Meik ein.
»... hat ihn 1753 höchstpersönlich erfunden, als er gerade sein Alterswerk ,Vom Kreuchen und Fleuchen« schrieb.«
»Dann würde mich mal interessieren, wie alt er war, als er sein Jugendwerk schrieb«, erwiderte Bettina trocken.
»Ja«, sagte Fanny von hinten hinter der Theke, wo sie gerade ihren BH richtete, wobei ihr alle im Raum interessiert zusahen, »das habe ich mich auch schon gefragt.«
»Aufpassen«, sagte Max und deutete ohne eine Miene zu verziehen mit Zeigeund Mittelfinger eine Bewegung an, wie wenn man jemandem mit einem Messer die Gurgel durchschneidet. »Niemand lästert über unseren Matthias Kronleichter, dass das klar ist. Wir alle kennen seine Philosophie: ,Eyn jeder trynke seine Biere im Stehen, auf daß er nycht so schnell einen sytzen habe!’«
»Genau«, sagte Meik, »oder: ,Eyn jeder Mensch spreche nur noch solches, was seyn Verstand auch erfasset habe, auf daß es sehr leyse werde auf Erden.’«
»Der ist ja fast gut!«, sagte Bettina und nickte so überzogen respektvoll, dass es ihr angemessen respektlos erschien.
»Stecke er nicht den Kopf in den Sande, auf dass er nicht an seynem Hinterteyl erkannt werde«, schlug Charlie im Sinne Kronleichters vor.
»Ganz genau«, sagte Meik, und Bettina zog es vor, lieber nichts mehr zu sagen. Dieser Philosoph mit seiner tollen Erfindung, er war ihr nicht so ganz geheuer. Vermutlich kein Wunder, dass Kronleichter seinen Platz zwischen Kierkegaard, Schopenhauer und Heidegger noch nicht gefunden hat, dachte sie. Noch vermochte sie seinen Stellenwert nicht so ganz einzuschätzen.
»Du siehst«, wandte sich Max am Ende dieses Schauspiels an Bettina, »bei uns ist immer was los.«
Bettina bestellte einen weiteren Tee.
»Den Eindruck habe ich auch.«
4 | EINE WÄRMENDE MAHLZEIT
Theresia hatte endlich die richtige Kassette gefunden.
Die moderne Musik, die neuerdings auf Bayern 1 lief, wollte sie ganz bestimmt nicht hören. Sie wollte etwas Heimatliches fürs Herz, und wenn der Bayerische Rundfunk ihr das nicht geben wollte, weil der schlaue Bayerische Rundfunkrat beschlossen hatte, dass bayerische Musik im Bayerischen Rundfunk nur noch eine Nebenrolle spielen soll, dann hörte sie eben eine Musikkassette an und nicht mehr den nicht mehr so bayerischen Rundfunk.
Theresia war eine ganz besonders nette alte Dame, sie hatte ein überaus gütiges Gesicht und eine unglaublich hohe, fast piepsige und wahrscheinlich genau deshalb so zauberhaft klingende Sprechstimme.
Theresia war eine sehr, sehr nette Frau. Früher, da hatte sie ein anderes Wort für diese moderne Musik, aber das mochte sie nicht mehr sagen, sie hatte es sich abgewöhnt. Und hätte sie früher schon gewusst, dass »Negermusik« Menschen herabwürdigt, dann hätte sie das schon viel früher nicht mehr so genannt. Allein schon wegen der kenianischen Kapläne, die hier in Hudlhub immer wieder mal zu Gast waren. Sehr nette Menschen waren das nämlich. Ihnen brachte sie selbstverständlich aus tiefstem Herzen genau denselben Respekt entgegen wie dem Herrn Pfarrer. Aber diese Musik im Bayerischen Rundfunk – dafür hatte sie trotzdem kein Verständnis.
Seit ihr Mann tot war, lebte sie allein, das heißt, ihre Katze, die war natürlich immer da. Schnurri war inzwischen auch schon 23 Jahre alt, aber Theresia war sicher, dass Schnurri es noch mindestens genauso lang machen würde wie sie selbst. Also noch eine ganze Weile, sie war ja nicht einmal 100.
Dass sie mit dieser Einschätzung ziemlich falsch lag, das wusste Theresia trotz aller Weisheit des Alters nicht. Wie hätte sie auch damit rechnen können, dass sie ausgerechnet diesen Fronleichnamstag nicht überleben würde?
Gerade rührte Theresia eine Suppe zusammen, ein feines Essen würde das werden. Für Theresia, aber auch für Schnurri – und natürlich für den Herrn Pfarrer. Seit vielen Jahren war Theresia die Hudlhubber Pfarrersköchin.
»Ist ja schon recht, Schnurri«, sagte Theresia mit ihrer niedlichen Piepsstimme, »du bekommst auch was ab. Oh mei, wenn das der Vater wüsste.«
Und in ihrer Erinnerung erwachte der Vater, der auf einem allmählich vergilbenden Schwarzweiß-Foto im Herrgottswinkel hing, zum Leben. Er stapfte durch den Schnee zu einem riesigen Scheunentor, es war ein kalter Tag im November 1927.
»Hallo, ist da wer?«, rief jemand. Er war nicht allein, der Vater, sie waren mehrere, die den Hof unter die Lupe nahmen. Es war ja schon merkwürdig, dass sich hier seit Tagen nichts mehr rührte. In diesen Zeiten ließ doch niemand seinen Hof allein. Und er öffnete das Scheunentor und ging hinein, denn die Haustür war verschlossen. Vielleicht war ja der Zugang durch den Stall ins Haus möglich.
Es war schon recht dämmrig, und bei dem nasskalten, grauen Spätherbstwetter war es den ganzen Tag eh noch nicht so richtig hell geworden. Mühsam tastete er sich vor, dann blieb er an etwas hängen.
»Was ist das?«, schrie er.
Und als einer der anderen mit einer Laterne hinleuchtete, sah er einen nackten, toten Fuß.
»Weißt, Schnurri, die Leute glauben ja, der Vater wär der Mörder gewesen, weil er die Leichen gefunden hat. Und weil er ein paar Mal mit der Katharina, dem Zeiserl von Kainegg, im Heu zusammengekommen ist. So hat man sie genannt, weil sie hat ja so schön gesungen, im Kirchenchor. Und eine fesche Frau war sie ja schon, Schnurri? Weißt, heute, da würde man sagen: ein steiler Zahn, gell, Schnurri?« Und Theresia kicherte wie ein Schulmädchen.
»Aber er war’s nicht, Schnurri, du weißt es, und ich weiß es auch, gell?«
Die Katze streckte und reckte und räkelte sich, dann kuschelte sie sich an Theresias Bein.
»Es war ja alles ganz anders.«
Das war der Moment, als die Tür aufging. Der Pfarrer kam von draußen rein.
Er schlotterte, denn er war patschnass.
»Regnet’s?«, piepste Theresia keck und stellte dem Pfarrer erneut kichernd einen dampfenden Teller hin.
»Sehr witzig, Theresia«, knurrte der Pfarrer und stürzte die ersten Löffel gierig herunter, die Wärme von innen tat gut. »Eigentlich wollte ich mich erst einmal umziehen.«
»Ach gehen S’, Herr Pfarrer, jetzt ist’s eh schon wurscht – und das Essen soll ja nicht kalt werden.«
»Eigentlich haben S’ recht, Theresia, und ich habe so einen Hunger.«
Theresia hörte gar nicht mehr hin. Sie war in Gedanken noch bei ihrem Vater, einem feinen Mann. Sie hatte ihn sehr gemocht, und er hatte sie sehr liebevoll beruhigt, damals. Auch sie, Theresia, hatte damals die Leichen gesehen, nach dem Mord in Kainegg – und das hatte sie sehr verstört. Wie gut, dass ihr liebevoller Vater immer für sie da war.
Nach dem Pfarrer bekam nun auch Schnurri etwas Suppe, dann nahm sie einen Schöpfer für sich.
5 | DER HIMMEL BRENNT
Der Hudlhubber Himmel war ein ganz besonders gelungenes Exemplar handwerklicher Stickkunst, ein wahres Meisterwerk. Der frühere Dorfpfarrer Godehard Wagner hatte ihn vor über 300 Jahren in Auftrag gegeben, er mochte es pompös, er mochte es üppig. Von allem etwas zu viel, war ihm gerade recht.
Pfarrer Godehard Wagner hatte einige Klosterschwestern, die ihm nicht nur bei der gestickten Ausschmückung der Hudlhubber Kirche gefällig waren, gebeten, sich doch bitteschön beim Himmel ganz besonders viel Mühe zu geben. Und so zierten diesen Baldachin nicht nur der Leib Christi, sondern auch eine ganze Reihe Hudlhubber Himbeeren sowie mehrere versteckte Symbole, die sich allerdings nur den Klosterschwestern und dem ehemaligen Pfarrer erschlossen. Niemand hatte den Himmel jemals so unter die Lupe genommen, dass er nachhaltig verewigte, unzulässige Anzüglichkeiten darauf als solche erkannt hätte. Und auch die Fachleute der Hohenwarter Regens-Wagner-Fahnenstickerei wären nicht in der Lage gewesen, diese Botschaften zu entschlüsseln, als sie das gute Stück restaurierten.
Die Gurke im rechten oberen Eck fing jedenfalls als erstes Feuer. Dazu muss man wissen, dass das Stromleitungssystem der Hudlhubber Dorfkirche Zur Heiligen Mutter Gottes Verkündigung zuletzt in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts generalsaniert und seither nur noch geflickt worden war. Wo es nötig wurde, war tatsächlich schon das eine oder andere dreiadrige Kabel eingezogen worden, aber sonst hatte es in der Regel Wichtigeres in der Gemeinde gegeben, wofür Geld ausgegeben wurde.
Die Fakire, die nun also diensteifrigst ihre Pflicht vollführten, konnten jedenfalls nichts dafür.
Sie strengten sich an, sie heizten, was das Zeug hielt, die glühten fieberhaft vor sich hin, und tatsächlich gelang es ihnen ob ihrer gekoppelten, gemeinschaftlichen Kraft, die sonst eher klamme Sakristei auf stolze 42 Grad aufzuheizen, für solche angenehme Temperaturen hätten sich auch die Ministranten erwärmt.
Die betagten Stromleitungen der Sakristei eher nicht.
Die ungewohnte Leistungsanforderung brachte nicht nur die unschuldigen Heizeinheiten der Heizlüfter-Fakire zum Glühen, sondern auch die alten, zweiadrigen Stromkabel.
So kam, was kommen musste: Eine Stichflamme schoss aus der Steckdose, und der historische Hudlhubber Himmel war längst trocken genug, um sie dankbar entgegenzunehmen und sich final von der unzüchtigen, schamlosen Gurke zu trennen, mit der er dereinst bei seiner Schöpfung schon verunreinigt worden war.
Langsam arbeiteten sich die Flammen vor, fraßen sich durch den Baldachin, der alle Hudlhubber Ortsgeistlichen seit den Tagen von Pfarrer Godehard Wagner beschirmt hatte, ohne dass auch nur ein Nachfolger des Auftraggebers etwas von den amourösen Erinnerungen geahnt hätte. Die Gurke neben den Hudlhubber Himbeeren war noch die harmloseste, alle anderen wurden in diesem Augenblick, den die vier einfallsreichen Ministranten vor ihren Tablets oder an ihren Smartphones in irgendwelchen sozialen Netzwerken verbrachten, zum Raub der Flammen.
Deren Hunger war damit aber noch nicht gezügelt.
Sie fraßen sich gierig weiter vor, die Tragestangen hinab, dann weiter zum Teppich, der in der Sakristei ausgelegt war. Der leitete sie in mehrere Richtungen weiter: nach links zu den wunderbar brennbaren Messgewändern, die die Pfarrersköchin gerade einmal nicht zum Behufe des Aufbügelns ins Pfarrhaus mitgenommen hatte, sowie nach rechts zur schweren, über die Jahrhunderte nachgedunkelten Eichentür, der einzigen Trennung zwischen der Sakristei und dem Kirchenschiff.
Bald stand die ganze Sakristei in Flammen, und die beiden einzigen, die das hätten bemerken können, waren Hochwürden und Theresia. Der Pfarrer aber erholte sich eben bei einem ausgiebigen Bad in der Badewanne von den Folgen des prozessionsbegleitenden Wolkenbruchs, und die Pfarrersköchin gönnte sich einen ausgedehnten Mittagsschlaf. So viel Aufregung heute, und sie war ja auch keine 90 mehr.
Die Flammen in der Sakristei aber nagten hungrig und gierig an der schweren Eichentür.
6 | EIN PROSIT DER GEMÜTLICHKEIT
»Prost, Toni!« sagte der Hudlhubber Landtagsabgeordnete Ludwig Haderlein, hob den Humpen und drosch ihn derb auf den seines Gegenübers ein. Der Landwirt Anton Entleitner, der unter anderem hervorragende Hudlhubber Himbeeren anbaute, was ihm den Spitznamen Himbeer-Toni eingebracht hatte, sagte nichts. Er konnte Haderlein nach wie vor nicht sonderlich leiden, aber er fühlte sich ihm ein Stück weit verpflichtet.
Denn Entleitners Reichtum beruhte nicht auf dem Anbau von Himbeeren allein, sondern hatte sich über die Jahre auch ob seiner vorzüglichen Kenntnisse im illegalen Hanfanbau gemehrt. Als er polizeirelevant aufflog, hatte der Landtagsabgeordnete das Kunststück vollbracht, die Drogendelikte zwei Profikillerinnen in die Schuhe zu schieben, die es vor einer Weile dank einer für den Himbeer-Toni höchst glücklichen Fügung in die kleine Gemeinde verschlagen hatte. Und Entleitner kam vergleichsweise glimpflich mit einer Bewährungsstrafe davon, weil das Gericht ihn als Opfer einer Erpressung, nicht aber als Drogenbaron wahrgenommen hatte.
Wobei sich die Bayerische Justiz sonst ja nie irrt, schon gar nicht, wenn Politiker im Spiel sind. Insofern war dieser unglückliche Einzelfall in der Gesamtbilanz der Bayerischen Justiz völlig zu vernachlässigen.
Die beiden Profikillerinnen hatten zwar versucht, den Justizirrtum aufzuklären, aber von Leuten wie ihnen ließ sich die Justiz von Haus aus nicht gern aufklären.
Und der Himbeer-Toni sowie der Landtagsabgeordnete Haderlein hatten in diesem Fall an der Aufklärung von vornherein kein Interesse. So war aus einem Justizirrtum die reine Wahrheit geworden.
Haderlein hatte all das selbstverständlich nicht uneigennützig eingefädelt.
Er hatte einen Plan, bei dem ihm der Himbeer-Toni helfen sollte: Er wollte als der beste Bierbrauer aller Zeiten in die Geschichte eingehen, und er brauchte den Entleitner, um seinen »Luckivator« – das Bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516, wie er sich ausdrückte, »zeitgemäß maßvoll erweiternd« – zu vollenden.
Sein Plan sah so aus: Er würde dem Bier sogenannte Flavonoide beimengen, das sind die besonders gesunden Himbeerbestandteile. Und zwar so, dass sie ihre Wirkung im Brauprozess behielten. Ja, ganz sicher würde er in die Geschichte eingehen. Und wenn es schon mit der großen politischen Karriere nichts geworden war ...
Was das justizielle Risiko anging – einmal ist keinmal, fand Haderlein, und wo heutzutage Autobauer millionenfach jahrelang unentdeckt bei ihren Abgaswerten schummeln konnten, was war dagegen eine kleine Bierpanscherei?
Haderlein war Realist genug, seine Chancen richtig einzuschätzen: Er war Anfang 40, die dritte Wiederwahl hatte er zwar geschafft, war jedoch Hinterbänkler geblieben – er würde im Maximilianeum für immer ein kleines Licht bleiben.
Was für ein Gedanke: ein Bier, das nicht nur süffig ist, sondern vor allem lebensverlängernd! Gesund war Bier ja eh. Das wussten schon die erfahrenen bayerischen Mönche. Die Andechser. Die Franziskaner. Und all die anderen auch.
Haderlein sah sein Konterfei schon als Büste in der ewigen Walhalla in Donaustauf, jener bayerischen Gedenkstätte für die großen deutschen Persönlichkeiten. Er, der Landtagsabgeordnete aus Biberg, Seit’ an Seit’ mit Max von Pettenkofer, Jean Paul, Johannes Brahms, Heinrich Heine, Albert Einstein und Gregor Mendel.
Seine Familie würde stolz auf ihn sein.
Auch wenn es in seiner Familie nicht mehr sehr viele gab, die stolz auf ihn sein könnten, genau genommen war der Großvater der einzige noch lebende Verwandte, und der hatte inzwischen Jopi Heesters überlebt.
Egal.
Du kannst nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein – so hatte es schon der gute Roy Black selig singen müssen, und so war es ja auch, aber ein bisschen Glück, ein bisschen Sonnenschein, warum sollte ihm das nicht vergönnt sein?
Haderlein musste an einen Satz des Hudlhubber Ortsphilosophen Matthias Kronleichter (1726–1754) denken: »Mögest du auch einen Schritt zurück thun – auf dass es dennoch eyner auf dem Weg zum Ziele sey!« Eben.
Und dass die Idee eigentlich nicht die seine war, sondern dass es ausgerechnet eine rote Socke war, die ihn darauf gebracht hatte, der Landtagskollege Knapp-Meier, oder genauer gesagt, dessen Gattin, war ein weiterer Wermutstropfen, mit dem er sehr gut leben konnte.
Er hatte also allen Grund, mit dem Himbeer-Toni kräftig anzustoßen, nachdem die erste Maische nach dem neuen Verfahren eben im Läuterbottich gelandet war.
Jetzt hieß es: Abwarten und Bier trinken.
Haderlein hatte vor einigen Jahren auf dem Anwesen der Familie in Biberg eine ziemlich, genau genommen: eine vollkommen illegale Brauerei gebaut, er dachte gar nicht daran, seine Brautätigkeit jedes Mal im Hauptzollamt zu melden.
Viel zu viel behördliches Gschiss.
Und damit kannte er sich ob seines Hauptberufs nun wirklich aus – all die viel zu hohen Kosten während des Entstehungsprozesses, so üppig war sein Abgeordnetensalär nun auch nicht, dass er sich die ganz großen Sprünge leisten könnte. Zumal allein schon sein Bentley den einen oder anderen Extra-Euro verschlang, aber der gehörte ebenso zum Image wie die beiden – in den Kotflügeln versenkten – ausklappbaren Standarten: die bayerische und die europäische Flagge. Dazwischen gab es für ihn sowieso nichts. Wenn jemand »Berlin« sagte, dann zitierte er immer abgewandelt »Asterix und der Arvernerschild«: »Berlin? Wo ist dieses Berlin?«
Nicht ganz so teuer war das LED-Laufband in der Heckscheibe des Bentley gewesen, auf dem er Nachfahrenden (vor ihm Fahrende waren nie lange vor ihm Fahrende) signalisieren konnte, wer gerade Vorfahrt hat, weil er wirklich richtig wichtig ist: er nämlich, der »Abgeordnete im Einsatz«.
Deshalb hatte Haderlein auch kein Problem damit gehabt, die Hudlhubber Wasserversorgung illegal anzuzapfen, um ausgiebig mit seinem Bier experimentieren zu können. Was waren schon ein paar hundert Hektoliter im Vergleich zur daraus eines Tages erwachsenden kollektiven Volksgesundheit durch den »Luckivator«!
Und dass aus diesen Kanälen ab und an auch ein paar zehntausend Liter reinsten Hudlhubber Gemeinschaftswassers in seiner Landwirtschaft landeten, nahm er billigend in Kauf – schließlich würde ja am Ende der große Gewinn für die Menschheit stehen.
Und ein bisschen was konnte die Menschheit schließlich auch dazutun.
Haderlein musterte das Testgebräu, das auch schon mit Hudlhubber Brauwasser hergestellt worden war. Nicht schlecht, aber noch nicht reiner Wahnsinn, wusste er, und mit weniger als der perfekten Perfektion wollte er sich nicht zufrieden geben.
Sie würden schon noch ein bisserl experimentieren müssen.
Aber eines Tages, da würde er sie alle fertig machen, mit seinem
»Luckivator«, und niemand würde wissen, wie er das schaffte. Außer ihm, dem Himbeer-Toni und ein, zwei eingeweihten Brauern.
Er würde es noch allen zeigen.
Und das genau in dem Jahr, wo alle feierten, dass im benachbarten Ingolstadt anno 1516 das Bayerische Reinheitsgebot ausgerufen worden war.
Ha!
Und: Pah!
7 | TEE TRINKEN
Bettina reiste mit leichtem Gepäck.
Sie wollte nur für ein paar Tage raus, da fiel ihr ihre Nichte Steffi ein. Die beiden mochten sich schon immer, auch wenn sie sich nicht allzu oft trafen. Ab und zu telefonierten sie, und meistens endeten die Gespräche damit, dass Steffi ihre Tante zu sich einlud.
»Schau halt mal raus zu uns, wenn du die Nase voll hast von der Stadt«, pflegte sie gebetsmühlenartig zu wiederholen. Und doch war die Hudlhubber Postlerin einigermaßen überrascht, als jetzt das Telefon geklingelt hatte und Bettina die Einladung mir nichts dir nichts einfach so annahm.
»Ja freilich passt es mir, komm einfach!«, rief sie in den Hörer, und Bettina war sicher, dass diese Freude echt war. Dass Fronleichnam war, das hatte Bettina nicht auf dem Schirm, wohl aber Steffi, und sie bat um Verständnis, dass sie sich erst nach der Prozession mit ihr treffen konnte, manche Dinge sind in Hudlhub nicht verhandelbar.
Tradition, zum Beispiel.
Jetzt aber holte sie ihre Tante in der Wirtschaft ab.
Steffi war dem Regenschauer nicht entkommen, und sie wollte Bettina nicht ungeföhnt begegnen, drum hatte es ein paar Minuten länger gedauert.
Alles kein Problem.
Auch wenn Bettina inzwischen allein im Wirtshaus wartete; die Jungs vom Feuerwehrtrupp hatten sich schon verzupft, samt Charlie und Max. Charlie hatte ihr noch angeboten, sie eben zu Steffi zu begleiten, aber sie hatte es nicht eilig.
Bettina fühlte, dass Steffi sich über ihren Besuch freute. Die Umarmung war lang und fest, dann hängte sich Steffi die Tasche der Tante um, keine Widerrede. »Pack mers!« Fanny winkte ihnen von der Theke aus nach.
Steffi nutzte die Gelegenheit, der Tante aus der Stadt ihre Heimat zu zeigen, und sie ließ keine Gelegenheit aus, Hudlhub so nah an der Gegenwart wie nur möglich zu präsentieren.
»Hier wohnt unser Feuerwehrkommandant, der Franz«, sagte sie beispielsweise, »der hat sich gerade von seiner Frau getrennt, weil sie eine Affäre hatte. Und da vorne, in dem Haus mit den Säulen, da wohnt der Bürgermeister, er hat die allerbesten Drähte in alle bayerische Behörden, wenn man irgendwas braucht, kennt er immer jemanden, der jemanden kennt. Ach ja, und hier, das ist das Haus vom Meierbauern, eine tragische Geschichte, vom eigenen Bulldog überrollt, da kannst nichts machen. Und die Frau vom Huberbauern, die hat der ...«
»...Viehhändler gebracht ...«, fiel Bettina ihr ins Wort, »weiß ich doch längst.«
Steffi stutzte, dann lachte sie – ein einziger Besuch in Adelheid Kirchmairs Dorfwirtschaft, und schon war Bettina mittendrin. Sie war gerade nicht ganz bei der Sache, weil ihnen eine überaus anmutige blonde Frau mit auffallend heller Haut entgegenkam, die viel zu städtisch für Hudlhub wirkte.
»Servus, Steffi!«, sagte die Blonde und zeigte beim Lächeln zwei perfekte Zahnreihen, die schon so manchen »Bild«-Leser kirre gemacht hatten, als sie noch Spielerfrau im Bundesligazirkus war. Ehe sie sich in den Himbeer-Toni verliebt hatte, war sie einige Male freizügig abgelichtet worden, und die »Bild«-Zeitung hatte ihr den Spitznamen »Elfenbeinprinzessin« verliehen.
Jetzt aber lebte die Elfenbeinprinzessin hier, in Hudlhub, wo alles ein paar Nummern geerdeter und authentischer war als in der Glamourwelt da draußen. Deswegen musste man ja seine Klasse nicht aufgeben, fand die Elfenbeinprinzessin.
Steffi lächelte ihr freundlich zu, BFFs würden sie beide nicht werden, nachdem sich Charlie die Blonde – wenn auch nur aus der Ferne – anfangs doch etwas zu genau angesehen hatte.
»Wer war das denn?«, fragte Bettina, als die Elfenbeinerne außer Hörweite war, und Steffi erklärte es ihr.
Schließlich kamen sie bei ihr zu Hause an, und es dauerte nicht lange, bis Bettina sagte, was Sache ist. »Frank und ich, wir haben Streit. Wir streiten schon lang! Jetzt ist das Maß voll! Alles, was er will, ist zu viel!«
»Das kenne ich«, sagte Steffi und machte Chai-Tee. »Wie lang seid ihr inzwischen zusammen, acht Jahre?«
»Neun. Eine halbe Ewigkeit. Wir lieben uns, aber irgendwie ist ... in letzter Zeit ... ich weiß nicht ...«
Steffi sagte erstmal nichts, sie ließ die Worte im Raum stehen, brachte Bettina Tee, beide lümmelten sich in die bequemen Sitzkissen, die Steffi in ihrem Wohnzimmer ausgebreitet hatte.
»Jetzt lass dir mal Zeit, komm erstmal an, fühl dich wohl bei uns, dann sehen wir weiter«, sagte sie.
»In Ordnung«, erwiderte Bettina, »du hast recht.«
Die beiden nahmen einen tiefen Schluck und genossen die Wärme, die durch den Körper lief, sich zügig ausbreitete, und schließlich alles vereinnahmte, was sie zu fassen bekam. Dann lehnten sich beide entspannt zurück, schlugen die Beine übereinander, und als sie merkten, dass sie beide dasselbe taten, mussten sie lachen.
Bettina spürte, wie es ihr schon viel besser ging.
8 | LOCHFRASS
Auch die Sakristei der Kirche Zur Heiligen Mutter Gottes Verkündigung erwärmte sich zusehends.
Genau genommen stand hier alles in Flammen, und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Flammen durch die alte, schwere Eichentür, die sie noch vom Kirchenschiff trennten, hindurchgearbeitet hatten.
Der Lochfraß schritt unweigerlich voran.
Hochwürden hatte im Pfarrhaus gegenüber sein erwärmendes Bad beendet, und er war gerade dabei, seinen tiefenentspannten, müden, hochgeschossenen, blassen, asketischen Körper abzutrocknen, da fiel sein Blick hinaus aus dem Fenster. Sofort erkannte er die Lage, rannte, wie der Herr ihn geschaffen hatte, hinaus in den Gang, wo das Telefon stand, nicht ohne mit der linken Schulter den Türstock zu rammen, aber für Schmerzen war jetzt keine Zeit, er wählte die 112.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis jemand ranging. Das sechste Freizeichen.
Das siebte Freizeichen. Das achte Freizeichen. Das neunte Freizeichen.
Vor den hochwürdigen Füßen bildete sich eine kleine Wasserlache. Das zehnte Freizeichen.
Das elfte Freizeichen.
Ich weiß ja, dass die Kirche in Jahrhunderten denkt, und das ist irgendwie auch gut so, aber bitte nicht auch die Feuerwehr, dachte er.
Dann hob jemand ab. Endlich.
»Leitstelle, was kann ich für Sie tun?«, fragte eine mürrische Männerstimme.
»Feuer!«, sagte der Pfarrer.
»ZEFIX«, brüllte der Mann in der Leitstelle. Das verwirrte den Pfarrer.
»Wieso, Zefix’?«, fragte er erschrocken.
»Weil ich mir gerade meinen frischen, heißen Kaffee über die Tastatur geschüttet habe, UND JETZT«, brüllte der verdiente und sehr langjährige Leitstellenmitarbeiter Walter Nieder-Rühmlich wieder,
»LÄUFT MIR DER SABBER ÜBER DIE HOSE! ZEFIX TUT DAS WEH!«
Weil er ein Profi war, versuchte er sich flugs zu sammeln.
»... aber das tut jetzt nichts zur Sache«, murmelte er in sein Headset. »Entschuldigung! Sie sagten gerade etwas von einem Feuer ...?«
»Ja, es brennt, hier bei mir, in der Sakristei!«
»Sie wollen damit sagen, dass eine Kirche brennt? In Bayern? IST DAS ÜBERHAUPT ERLAUBT?«
»Das weiß ich doch nicht!«, erwiderte der Pfarrer, und er spürte, wie sich der Schmerz in der linken Schulter ausbreitete und er auch deswegen zunehmend ungehalten war, zumal er endlich nachsehen wollte, was da drüben in seiner Kirche los war. Zu allem Überfluss kam jetzt auch noch die Haushälterin auf den Gang getrottet, einigermaßen überrascht, den Pfarrer einmal von dieser Seite zu sehen. Theresia war zwar alt, aber sie war nicht so weltfremd, dass sie nicht gewusst hätte, dass derartige Anblicke im Leben vieler Haushälterinnenkolleginnen etwas sehr Normales waren. Bei diesem Exemplar hier allerdings nicht.