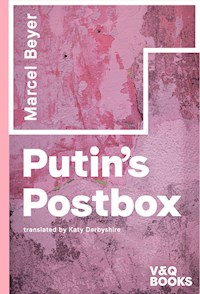Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer ist Kaltenburg? Ein Ornithologe und Verhaltensforscher, der nach dem Krieg in Dresden ein Forschungsinstitut aufbaut. Ein Exzentriker, der den Dienstwagen samt Stasi-Chauffeur stehen lässt und Motorrad fährt. Für Hermann Funk, der seine Eltern in der Dresdner Bombennacht verlor, wird er zum Ziehvater. Als alter Mann erinnert sich Funk: an die Gründung des Institutes und der DDR, an Kaltenburgs plötzliches Verschwinden nach dem Mauerbau, an ein möglicherweise dunkles Kapitel in dessen Vergangenheit. Vor dem Hintergrund von einem halben Jahrhundert DDR-Geschichte erzählt Marcel Beyer in seinem hochgelobten Roman meisterlich von menschlichen Lebensläufen. Joseph-Breitbach-Preis 2008
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer ist Kaltenburg? Ein Ornithologe und Verhaltensforscher, der nach dem Krieg in Dresden ein Forschungsinstitut aufbaut. Ein Exzentriker, der den Dienstwagen samt Stasi-Chauffeur stehenläßt und Motorrad fährt. Für Hermann Funk, der seine Eltern in der Dresdner Bombennacht verlor, wird er zum Ziehvater. Als alter Mann erinnert sich Funk: an die Gründung des Institutes und der DDR, an Kaltenburgs plötzliches Verschwinden nach dem Mauerbau, an ein möglicherweise dunkles Kapitel in dessen Vergangenheit. Vor dem Hintergrund von einem halben Jahrhundert DDR-Geschichte erzählt Marcel Beyer in seinem hochgelobten Roman meisterlich von menschlichen Lebensläufen.
Marcel Beyer, geboren 1965, lebt seit 1996 in Dresden. 2008 wurde er mit dem Joseph-Breitbach-Preis und 2016 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Von ihm erschienen die Romane Das Menschenfleisch (1991, st 2703), Flughunde (1995, st 2626), Spione (2010, st 4207), die Gedichtbände Falsches Futter (1997, es 2005), Erdkunde (2002) und Graphit (2014) sowie die Essaybände Nonfiction (2003) und Putins Briefkasten. Acht Recherchen (2012, st 4324) und die Erzählung Vergeßt mich (2006).
Marcel Beyer
Kaltenburg
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 3. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4103.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Daniel Pilar
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75069-8
www.suhrkamp.de
»Ach, bloß ein kleiner Vogel –
der hat keinen besonderen Namen.«
Vladimir Nabokov: Erinnerung, sprich
I
1
Ludwig Kaltenburg wartet bis zu seinem Tod im Februar 1989 auf die Rückkehr der Dohlen. Besuchern gegenüber äußert er sich noch in seinem letzten Winter zuversichtlich, eines Tages werde ein Paar dieser von ihm geliebten, von ihm bewunderten weißäugigen Krähenvögel den Kamin im Arbeitszimmer als Nistplatz wählen und mit seiner Brut eine neue Dohlenkolonie ins Leben rufen. »Ich weiß, sie werden erst in einigen Monaten mit dem Nestbau beginnen«, erklärt er Weggefährten, Schülern oder Journalisten, die von Wien eine knappe Autostunde durch die niederösterreichische Schneelandschaft gefahren sind. Ihm stehe die Zukunft vor Augen. In eine Wolldecke gehüllt, sitzt der große Zoologe Ludwig Kaltenburg am Fenster, das Karomuster und das volle weiße Haar, er hört nur noch sehr schlecht, seine Geistesgegenwart aber hat nicht gelitten.
»Die Vögel fliehen den Rauch«, sagt er, darum halte er es nicht für ratsam, den Ofen in dem kleinen Anbau vom frühen Morgen bis in die Abendstunden brennen zu lassen. Der späte Kaltenburg wird von mehreren elektrischen Heizöfchen eingerahmt. Er ist gelöster Stimmung. »Die jungen Dohlen werden ohne mich zurechtkommen müssen, dessen bin ich mir durchaus bewußt.«
Ehe die Gäste höflich protestieren können, der hochverehrte Herr Professor werde sie am Ende alle überleben, schildert Kaltenburg den Abstieg einer sogenannten Kamindohle zu ihrem in völliger Dunkelheit liegenden Nest. Der Vogel springt nach einigem Zögern und Herumlaufen mit dem Schnabel voran in den Eingang der künstlichen Höhle, vollführt eine Drehung, findet mit abgespreizten Flügeln am rauhen Kamingemäuer Halt, streckt die Beine aus und stützt sich mit den Krallen ab. Dann geht es vorsichtig, man könnte sagen: Schritt für Schritt, hinunter in die Tiefe, zwei Meter oder mehr. Das laute Poltern, Rasseln, Schleifen. Momentaufnahmen dieser viele Male am Tag wiederholten Prozedur vermitteln den Eindruck, die Dohle stürze hilflos aus großer Höhe herab, aber das Gegenteil ist der Fall, jede Bewegung zeugt von überlegtem Vorgehen und äußerster Geschicklichkeit.
Niemand wagt es, dem Professor zu widersprechen. Seine letzte Kolonie ist vor vielen Jahren zerfallen, doch noch immer kennt kein Mensch die Dohlen so gut wie Ludwig Kaltenburg. Im eisigen Januar malt er sich und seinen Gästen das Treiben kommender Dohlengenerationen aus, und wenn er mit dem Rollstuhl auf der Stelle wendet, wird mancher Besucher unsicher, ob er tatsächlich die Gummireifen auf dem Parkett hört, oder ob er bereits den leisen Ruf einer Dohle vernimmt, die das Reifenquietschen täuschend echt zu imitieren weiß. Kaltenburg neigt den Kopf, als horche er. Die Radiatoren summen. Im Rauchfang streicht ein Dohlenflügel über den verrußten Stein.
2
Die Vögel fliehen den Rauch. Kaltenburg ist achtzig, als er damit beginnt, sich von alten Unterlagen zu trennen, die er zunehmend als Ballast empfindet. Anstatt die Tagesnotizen und Vorlesungsmanuskripte, die Taschenkalender und Aufsatzentwürfe sowie Teile seiner Korrespondenz zu verfeuern, macht er sich ein Vergnügen daraus, die Papiere nach und nach seinen Schützlingen anzuvertrauen. Auch sämtliche Vorarbeiten zu der 1964 veröffentlichten Studie mit dem Titel URFORMEN DER ANGST finden so neue Verwendung, nachdem sie mehr als zwei Jahrzehnte unbeachtet in einem verschlossenen Maria-Theresien-Kasten gelegen haben.
Im Verlauf einiger schöner Frühlingstage verteilt Ludwig Kaltenburg die Manuskriptblätter der Rohfassung als Nistmaterial unter den in seinem Haushalt lebenden Nagern und Entenvögeln. Ein halbes Dutzend Stichwortlisten überläßt er einem jungen Hermelin, dem er sich freundschaftlich verbunden fühlt. Im Sommer dann sitzt Kaltenburg hinter dem Haus auf der Terrasse, hält den weitläufigen Garten im Blick, den Teich, die Wiese, nimmt schließlich eine Handvoll Notizzettel aus dem Schuhkarton auf seinen Knien. Wenn die Entenküken bei Sonnenuntergang mit ihren Eltern heimkehren, nehmen sie das holzhaltige Papier dankbar anstelle von Beschäftigungsfutter an.
Er hat URFORMEN DER ANGST immer als Zäsur in seinem Lebenswerk betrachtet. Das erste nach zwölfjähriger Abwesenheit wieder in seinem Herkunftsland, in Österreich, entstandene Buch. Das erste, in dem Kaltenburg offen auf Beobachtungen während seines Dresdenaufenthalts zurückgreift, selbst wenn er in der Einleitung hervorhebt, die Idee sei ihm beim Schnorcheln vor der Küste Floridas gekommen. Seine erste umfangreiche Untersuchung seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die nicht umgehend ins Russische übersetzt wird, sieht man von einer lückenhaften, im Samisdat kursierenden Zusammenfassung ab. Erst 1995, anläßlich seines sechsten Todestages, erscheint in einem kleinen Petersburger Fachverlag eine vollständige Ausgabe ohne sinnentstellende Übersetzungsfehler, leider unter einem mißverständlichen Titel, der auf Deutsch ungefähr ICH – LUDWIG KALTENBURG UND DIE ANGST lauten würde. Die Sowjetunion ist von den Landkarten verschwunden und bei den russischen Lesern keinerlei Interesse mehr an den Schriften eines Tierkundlers namens Kaltenburg vorhanden.
Die bloße Existenz des Buches wurde geleugnet. Man hat seinen Verfasser totgeschwiegen. Hat ihn lautstark verdammt. Scharfe Attacken gegen ihn geführt. Auf Konferenzen demonstrativ gemieden. Kollegen in den USA haben ihm Weltfremdheit vorgeworfen. Kollegen in Europa eine unsaubere Vorgehensweise. Gegen die Formulierung, Angst sei insofern eine geradezu wunderbare Einrichtung der Natur, als daß sie lebenserhaltend wirken könne, laufen Erziehungswissenschaftler wie Konfliktforscher bis in die achtziger Jahre Sturm. Bei einer Fernsehdiskussion soll einmal ein Jugendfreund die Kamera gesucht und Kaltenburg – »Ludwig, ich weiß, du schaust uns jetzt am Bildschirm zu« – eindringlich dazu aufgefordert haben, sich auf sein Fachgebiet zu besinnen und Spekulationen über die Beschaffenheit des Menschen für alle Zukunft hinter sich zu lassen. Mit URFORMEN DER ANGST ist Ludwig Kaltenburg zu einer weltweit beachteten Figur geworden.
3
Binnen weniger Monate erreicht die Auflage eine Höhe, wie man sie angesichts der Arbeit eines Zoologen nicht für möglich gehalten hätte, und es heißt, Kaltenburg habe sich von seinem Honorar einen Mercedes mit aufklappbarem Verdeck zugelegt.
Dem einen oder anderen fachfremden Leser mag bereits bei der Lektüre der ersten Kapitel gelegentlich unwohl zumute werden, in denen Kaltenburg zunächst nichts weiter vorschwebt, als ein Panorama möglicher Angstreaktionen zu entfalten, die jedem aufmerksamen Beobachter der Tierwelt geläufig sind. So weiß man, daß junge Singvögel – der Autor bezieht sich hier auf Tannenmeisen – nach dem Schlüpfen trotz ausreichender Wärme- und Nahrungszufuhr rasch verenden können, sofern ihr Nest auf Dauer groben, unregelmäßig erfolgenden Erschütterungen ausgesetzt wird. Wie man beobachtet hat, zucken die blinden und gefiederlosen Wesen bereits im Ei zusammen, wenn etwa ein herabfallender Zweig das Nest berührt.
Eine längere Passage befaßt sich mit dem Phänomen der Schreckmauser, dem plötzlichen Abstoßen einzelner oder mehrerer Federn unter Schock. Kennzeichnend ist das Fehlen von Gewalteinwirkung, wie das Beispiel der Turteltaube augenfällig macht, die beim Überfliegen eines offenen Geländes einen in ihrer Nähe abgegebenen Schuß vernimmt: Sie bleibt in der Luft stehen, läßt einen Teil ihres Gefieders zu Boden regnen, als habe der Schuß ihr gegolten, ja, als hätten sich die Schrotkugeln in ihren Leib gebohrt – doch im nächsten Moment setzt sie ihren Flug fort, wenn auch offenbar verwirrt und durch den Federverlust geschwächt. Kaltenburg zufolge stellt die Schreckmauser in gewisser Weise ein Fortleben der kindlichen Erschütterungsangst beim erwachsenen Vogel dar, mit dem entscheidenden Unterschied, daß lediglich einzelne Individuen dieses Verhalten zeigen. Kaltenburg führt einen Züchter an, in dessen Buchfinkenvoliere sich ein außerordentlich anfälliges Weibchen befand. Er habe stets darauf geachtet, seine Vögel so vorsichtig wie möglich zu umgreifen, und trotzdem blieben, als der Züchter zum erstenmal den schlafenden Buchfinken aus dem Lockvogelkäfig nehmen wollte, an seiner Handfläche bestürzend viele Bauchfedern zurück. Nach diesem Erlebnis schreckmauserte das Weibchen nahezu zwangsläufig beim Anblick eines Habichts oder einer Katze.
Das Gegenstück zur Schreckmauserdarstellung bildet der Abschnitt über die Hyänen. Diese Tiere zeigen dem Menschen gegenüber keinerlei Fluchtverhalten, Furcht kennen sie nicht, und die einzelne Hyäne wagt sich selbst in der freien Wildbahn so nah an den Menschen heran, daß es kaum Mühe bereitet, sie mit einem Knüppel zu erschlagen. Der Rest des Jagdverbandes, sagt man, verfolgt derartige Vorfälle mit äußerster Gleichgültigkeit.
Im Mittelteil grenzt Kaltenburg anhand eigener Beobachtungen aus fünfzig Jahren unterschiedliche Angsterfahrungen begrifflich ein, um sich anschließend im Kapitel DIE TODESANGST einer aufsehenerregenden Photoserie von Pavianporträts zuzuwenden, die unter widrigsten Umständen im natürlichen Lebensraum der Affen entstanden und dem Autor von einem befreundeten Tierfilmregisseur zur Verfügung gestellt worden sind: Der Gesichtsausdruck im allerletzten Lebensaugenblick, da der Pavian blitzartig erfaßt, diesmal wird er dem Angreifer nicht entrinnen, unterscheidet sich laut Kaltenburg in nichts von dem eines Menschen, der seinem Todfeind rettungslos ausgeliefert ist.
Bis zu diesem Punkt, schreibt er, beschränke sich die Studie im wesentlichen auf eine nüchterne Bilanz zoologischer Erkenntnisse seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Und tatsächlich nehmen Fachkollegen wie Vertreter anderer Disziplinen insbesondere an einem Kapitel Anstoß, das AUSBLICK: DIE NAMENLOSE ANGST überschrieben ist und sich dem Verhältnis zwischen Tier und Mensch unter Extrembedingungen widmet. Hier überschreite der Autor eine Grenze, heißt es in ersten Reaktionen. Ein früherer Mitarbeiter empört sich, anscheinend habe Ludwig Kaltenburg vergessen, wo er hingehöre.
4
Kaltenburg spricht von einem Häftling, der Jahre in der Isolationszelle verbringt und seine Verlorenheitserfahrung dadurch zu mildern weiß, daß er Freundschaft mit den sich jeden Tag vor seinem Zellenfenster einfindenden Krähen schließt. Spricht von der gängigen Praxis, Diensthunde während der Ausbildung mit Stromstößen zu traktieren, um sie enger an ihren Herrn zu binden. Spricht von der Ratte. Von Vogelbeobachtungen vor Stalingrad ebenso wie in Leningrad, und fragt sich, ob die alle Glieder lähmende Todesnähe dem Menschen wie dem Tier einen besonders klaren Blick verleiht. Woher allerdings Ludwig Kaltenburg das Material seiner Fallbeispiele bezieht, läßt er offen, nennt weder schriftliche noch mündliche Quellen. So setzt er sich dem Vorwurf aus, kaum nachprüfbare Angaben zu verwenden und seine Thesen anhand von Phänomenen zu entwickeln, die ihm nicht aus eigener Anschauung bekannt sind.
Das gilt auch für eine Dresdner Episode aus den Februartagen des Jahres 1945, als ein »guter Bekannter« oder, wie es an anderer Stelle heißt, ein »Schüler« Kaltenburgs über mehrere Stunden hinweg an einer aus dem zerstörten Zoo entlaufenen Horde Affen ein für Tiere äußerst ungewöhnliches Verhalten beobachtet haben will. Der Zeuge – damals noch ein Kind – sei während der Nacht, als Dresden zu Schutt und Asche zerfiel, auf der Suche nach seinen Eltern in der größten Parkanlage der Stadt herumgeirrt und habe sich am folgenden Morgen nach wie vor in buchstäblich aufgelöstem Zustand befunden, nämlich jeglicher Vorstellung von sich selbst beraubt. Am Rand des Großen Gartens sei er bei einer Gruppe verstörter Menschen stehengeblieben, unter die sich ein halbes Dutzend Schimpansen oder Orang-Utans oder Rhesusaffen gemischt hatte – an die genaue Zusammensetzung der Horde vermag sich Kaltenburgs Zeuge nicht zu erinnern.
Mit gesenktem Blick forschen die Überlebenden nach bekannten Gesichtern. Irgendwann beginnen auch die Schimpansen, die Züge der reglos am Boden liegenden Gestalten zu betrachten, man könnte glauben, sie sähen abwechselnd den Toten und den Lebenden ratsuchend in die Augen. Tatsächlich meint der Beobachter so etwas wie Erleichterung unter den Tieren zu bemerken, als die Menschen aus ihrer Apathie erwachen, die überall verstreuten Leichname zusammensammeln und sie auf einem unversehrten Rasenstreifen in eine Ordnung bringen. Nichts wissen die Schimpansen von der Identifizierung verstorbener Angehöriger, nichts von den Toten, die man in einer Reihe im Gras bettet, und nichts davon, wie man einen Leichnam an Schultern und Füßen greift, um ihn zu seinesgleichen zu tragen. Und dennoch schließt sich ein Affe nach dem anderen dieser Arbeit an, wie Kaltenburg berichtet, ohne zu sagen, wer ihm diese Szene beschrieben hat. Ich.
II
1
Wo bleiben sie, die Regungen eines alten Mannes, die mich doch eigentlich überkommen sollten, wo bleibt der Anflug einer Hitzewallung, wo, frage ich mich, die schiere Kopflosigkeit, gepaart mit dem taxierenden Blick. Und wo das greisenhafte Imponiergehabe, das ich in Gegenwart einer Frau an den Tag legen müßte, die kaum halb so alt ist wie ich, aber trotzdem Interesse an mir zeigt, und sei es nur an meinen Worten, während wir miteinander reden und ich insgeheim verwundert bin, daß sich an meinem Verhalten keine Anzeichen des lächerlichen Tänzelns, Krächzens oder Plusterns ablesen lassen, nicht die leiseste Spur jenes Balzverhaltens, das ich von einem ergrauten Herrn wie mir erwartet hätte, als ich selbst noch jünger war.
Mitunter sehne ich mich fast danach, ich wäre einer dieser oft von mir beobachteten Männer, die tun, was man in ihrem Alter von ihnen verlangen kann. Ich würde umständlich an meiner Hosentasche herumnesteln und ein frisches weißes Taschentuch zum Vorschein bringen, mit dem ich mir unablässig über Stirn und Schläfen streichen könnte, und diese junge Frau vor meinen Augen käme nicht auf die Idee, sich weiter darüber zu wundern, auch wenn es erst Ende März und überhaupt nicht heiß ist. Höchstens, daß sie mitfühlend fragte, ob sie mir vielleicht ein Glas Leitungswasser holen könne, ob wir eine kleine Verschnaufpause einlegen sollten, was nichts anderes hieße, als daß sie mir Einblicke in ihr Leben gewähren würde, die Männern gleichen Alters niemals erlaubt sind. Ich könnte mit gesenktem Kopf andeuten, etwas in der von ihr vorgeschlagenen Art sei mir sehr recht, während ich mit dem feuchten Taschentuch über meinen Nacken striche und mir vorstellte, nicht meine eigenen, sondern ihre jungen Frauenfinger tupften die Schweißperlen von meiner Haut.
Wie ich früher Altersgenossen bedauert habe, die immerzu mit ihren Latein- und Griechischkenntnissen prahlten, sogar ein Wort wie »Omnibus« haben sie noch geraunt, als gäben sie damit der Dame an ihrer Seite geheimes Wissen preis. Doch während die damals altklugen jungen Männer zu weisen Herren geworden sein mögen und tagaus, tagein schweigend ein paar Grashalme betrachten oder in fröhlicher Vertrottelung ihre anzüglichen antiken Witze falsch erzählen, komme ich dieser jungen Dolmetscherin heute mit meinem Latein, ich sage: Carduelis carduelis, langsam, daß sie mitschreiben kann, ich sage: Carduelis chloris, nach und nach füllt sich ihre Tabelle, ich habe: Carduelis spinus gesagt.
Die Vogelnamen. Stieglitz, Grünling und Erlenzeisig. »Warum in aller Welt wollen Sie denn Vogelnamen lernen?« hatte ich am Telefon gefragt, als sie mich anrief und erklärte, in Kürze stehe ihr ein Termin bevor, zu dem hoher Besuch aus dem englischsprachigen Raum erwartet werde, der sich nicht nur, wie es das Protokoll verlangt, hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung seit 1990 informieren, sondern, als ausgewiesener Naturfreund, mit seinen Gastgebern im kleinen Kreis auch über die hiesige Flora und Fauna sprechen wolle. Die bloßen Namen seien allerdings nicht das Problem, die könne sie mühelos auswendig lernen, doch fehle ihr dabei die Anschauung des jeweiligen Tieres, und so bat sie mich, ihr ein, zwei Stunden meiner Zeit zu schenken und die englischen, deutschen, lateinischen Bezeichnungen zur Sicherheit mit den entsprechenden Standpräparaten vor Augen durchzugehen.
Wir haben uns in der Sammlung verabredet, meiner ehemaligen Arbeitsstelle, die sich seinerzeit unten in der Stadt befand. Der Blick hinüber in die Schloßruine. Touristengruppen bewunderten den Fürstenzug, an Sommertagen drangen die Stimmen von der Gasse in mein Zimmer, das russische Gemurmel, das schwedische Gemurmel, dazu der immer gleiche harte Fremdenführerton. Und abends habe ich am Elbufer gestanden, um zuzuschauen, wie die Möwen sich über der Hofkirche sammelten. Hier im neuen Gebäude hat man mir auf dem Flur mit den Arbeitszimmern einen kleinen Raum überlassen, noch immer komme ich fast jede Woche einmal her, es zieht mich zu den Bälgen. Jemand von den Kollegen hatte Frau Fischer an mich verwiesen, »Und denken Sie daran«, rief ich noch in den Hörer, »Sie müssen hinaus bis nach Klotzsche fahren, die Tierkundlichen Sammlungen im früheren Ständehaus gibt es nicht mehr«, dann hatte sie schon wieder aufgelegt.
Ich holte Katharina Fischer oben an der Treppe ab, vom offenen Korridor sind wir in den Sammlungstrakt eingebogen, vom Tageslicht ins Kunstlicht durch die Glastür, am Schild BITTE KEINE LEBENSMITTEL IN DER SAMMLUNG vorbei. Die Stille. Gleichmäßig beleuchteten die Neonröhren die gekalkten weißen Wände, die schweren gelben Eisentüren, den Fließestrich unter unseren Füßen. Zitronengelb, kanariengelb die Flügeltür neben der Aufschrift WIRBELTIERE TROCKEN, breit genug, um die Dermoplastik eines ausgewachsenen Elefanten ohne Schwierigkeiten in die Sammlung zu bugsieren, auch wenn sich im Raum dahinter heute überwiegend Tiere finden, die man problemlos in der Jackentasche transportieren kann. Ich werde mich an dieses Gebäude nicht gewöhnen, nicht mehr gewöhnen müssen, der Umzug Ende 1998 war zugleich mein Abschied von der Ornithologischen Sammlung.
Die mit der Zeit bedrückende Enge im Ständehaus, der einmal süßliche, dann wieder stechende Geruch von Aas und Alkohol und Gift, der je nach Wetterlage von den Präparatorenwerkstätten in unsere Räume zog, die Feuchtigkeit, das muffige Gemäuer, auf dem ein Notdach saß, die Wassereinbrüche bei anhaltend starkem Regen. Gefahren, die unsere Präparate und auf Dauer auch unsere Gesundheit zu zerstören drohten, ja, selbst das DDT, das wir so viele Jahre eigenhändig über den offenen Schubfächern versprühten: All dies hängt für mich so eng mit meiner Arbeit in der Sammlung zusammen, daß es mir schwerfällt, hier in den neuen Räumlichkeiten etwas wiederzuerkennen, mich selber eingeschlossen, wenn nicht die lange vertrauten Tiere wären.
»Sie sind kein gebürtiger Dresdner, oder?« hat Frau Fischer bald nach unserer Begrüßung vorsichtig gefragt. Normalerweise höre sie die Herkunft eines Menschen spätestens beim dritten Satz aus seinem Tonfall heraus, aber bei mir schwanke sie immer noch. »Nicht einmal die Himmelsrichtung könnte ich angeben«, meinte sie, als sie Stifte und Notizheft aus dem Rucksack nahm und einen ersten Blick auf die von mir bereitgestellten Vögel warf.
Es ist richtig, ich stamme nicht von hier, und daß ich Anfang 1945 mit elf Jahren nach Dresden gekommen bin, ist eher einem Zufall zu verdanken, das heißt: den Zeitumständen, weil meine Eltern entschieden hatten, die Stadt Posen in Richtung Westen zu verlassen. Auch vorher müssen wir schon mehrmals umgezogen sein, aus dem Elternhaus habe ich keinen regionalen Einschlag, geschweige denn einen Dialekt mitbekommen. Ich glaube fast, sie legten sogar bei der Wahl meines Kindermädchens Wert darauf, daß sie ein klares Hochdeutsch sprach.
In einem Erinnerungsbild sehe ich mich im Sonntagshemd auf unserer Küchenbank sitzen, und mein Kindermädchen streicht mir mit einem feuchten Lappen über die nackten Beine. Ob die Eltern damals im Februar mein Kindermädchen mit auf die Reise nach Dresden genommen hatten?
Das Langzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis. Die Dolmetscherin hat darum gebeten, eine Pause zu machen, eine halbe Stunde, in der sie abgelenkt sein will, um zu prüfen, ob alle Namen, die ihr nun im Kurzzeitgedächtnis präsent sind, auch tatsächlich ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden. Das will sie herausfinden, indem sie sich nachher von mir abfragen läßt, aber in dieser halben Stunde möchte sie die präparierten Tiere nicht vor Augen haben, sei es, daß nun Gestalt und Wort allein in der Imagination zusammenfinden müssen, sei es, daß ihr in Gegenwart der Vögel auf die Dauer unbehaglich zumute geworden ist: Sie hocken auf ihren Zweigen, als seien sie eben erst gelandet, als flögen sie im nächsten Augenblick schon wieder weiter, und mancher, der an ihren Anblick nicht gewöhnt ist, fürchtet, er werde sie mit einer unruhigen Bewegung verjagen. So haben wir uns aus dem fensterlosen Raum mit der Gelegesammlung und den Standpräparaten in mein Zimmer zurückgezogen, was mir erlaubt, eine Zigarette zu rauchen und Katharina Fischer einen Kaffee anzubieten.
Sie läßt den Blick über das Hängeregal schweifen, dort liegen ein paar Bände aus unserer Bibliothek, die ich in den letzten Wochen gebraucht habe, daneben steht meine kleine Handbibliothek, die Dolmetscherin nimmt flüchtig das JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE zur Kenntnis, DIE VOGELWARTE neben GRZIMEKS TIERLEBEN und den WASSMANN. Die gebundenen Wörterbücher im obersten Fach wirken bei diesem Licht um einiges älter, als sie es sind, Deutsch-Russisch-Deutsch, Deutsch-Englisch-Deutsch, Vor- und Nachwendeausgaben, leicht angestoßen, nachgedunkelt, als hätte ich sie seit Jahren nicht mehr zur Hand genommen. URFORMEN DER ANGST steht hier nicht im Regal.
Nein, in der Nacht nach unserer Ankunft in dieser Stadt, die eben im Begriff war, sich in ein Schuttfeld zu verwandeln, das die Bezeichnung »Stadt« nicht mehr verdiente, war mein Kindermädchen nicht bei mir, während ich, in eine Decke eingehüllt, im Großen Garten auf der Wiese lag. Menschen um mich herum, der ganze Park voller Menschen, man hockte im Dunkeln, man lief auf und ab, man unterhielt sich leise, man sah wortlos in den Himmel hinauf, und alle diese Leute waren Fremde. In meiner Nähe kauerte ein altes Paar, im hellen Widerschein war es, als spielte Kerzenlicht auf dem Gesicht des Mannes. Die Augenränder, die Furchen um den Mund und Bartstoppeln mal rot, dann gelblich, weiß, und wieder tiefgrau, wenn Wolken über die Wipfel zogen. Die Frau trug einen guten, wenn auch nicht mehr neuen Mantel, ein breiter Schal verdeckte ihren Oberkörper, ich weiß nicht, trug sie eine Mütze, einen Hut, ihr Kopf lag an der Schulter des Mannes. Erschöpft, unter freiem Himmel, in einer Februarnacht, sie waren eingenickt. Ein nie zuvor gehörter Lärm lenkte mich von den beiden ab.
Drüben haben wir eine ganze Weile vor den aufgereihten Vögeln gesessen, das heißt, sie saß, ich bin bald wieder aufgestanden und hinter den Tisch getreten, um ihr die maßgeblichen Unterschiede aufzuzeigen, die Finken, von links nach rechts, aus ihrer Perspektive: der Buchfink, der Bergfink, der Bluthänfling, der Berghänfling, der Birkenzeisig, den Polarbirkenzeisig lassen wir beiseite, er würde uns hier nur irritieren, weil er nicht immer sicher zu bestimmen ist, weiter mit Girlitz, Gimpel oder Dompfaff und Kernbeißer, die vier Wüstengimpel bleiben trotz ihrer schönen rosafarbenen Federpartien wiederum ausgespart, dann Karmin- und Berggimpel und der im Verhältnis zu den anderen riesige Hakengimpel, Fichtenkreuzschnabel, Schottenkreuzschnabel, Kiefernkreuzschnabel, und schließlich hier die Carduelis-Finken, der Erlenzeisig, der Grünfink und der Stieglitz, auch Distelfink genannt.
Während ich die Reihe abschritt, begann sie in ihrem aufgeschlagenen Notizheft eine Tabelle zu zeichnen, zunächst kamen die englischen Entsprechungen, sie hatte sich ein englisches Bestimmungsbuch besorgt, blätterte in ihrem PETERSON, die Finkenabteilung: Chaffinch, Brambling, Linnet, Twite, Redpoll, Serin, Bullfinch, Hawfinch und so weiter, bis hin zu Siskin, Greenfinch und Goldfinch für Stieglitz. Also, unterbrach ich sie, auf keinen Fall den Stieglitz als Goldfinken ausgeben und ihn am Ende noch in eine Reihe mit dem Schneefinken, dem Snowfinch, stellen, der gar kein Fink, sondern ein Sperling ist, so wie sie auch den Scarlet Rosefinch nicht als Rosenfink übersetzen dürfe, das sei im Deutschen der Karmingimpel, und Rosenfink heiße er nur in Schweden.
Kann sein, ich überfordere sie für den Anfang ein wenig, aber eine Dolmetscherin, das habe ich gleich gewußt, die sich mit einer derart bewundernswerten Gewissenhaftigkeit auf ein Gespräch vorbereitet, das möglicherweise, nein, in der vorbereiteten Form sogar aller Wahrscheinlichkeit nach nie zustande kommen wird, darf auf keinen Fall unterfordert werden. Frau Fischer benutzt mit dem PETERSON ein Werk, das ich nicht eben häufig zu Rate ziehe, denn auch wenn sein Aufbau durchaus den Gepflogenheiten entspricht, habe ich es immer als ein wenig unübersichtlich empfunden, weil die Schautafeln, die Beschreibungen und die Karten jeweils eigene Kapitel bilden. Ich legte ihr den SVENSSON / MULLARNEY / ZETTERSTRÖM daneben, links die Beschreibungen, rechts Vögel im Gegenlicht, Silhouetten im Bodennebel, und Katharina Fischer erkannte auf den ersten Blick, es geht darum, die Vögel nicht im Zimmer, sondern in ihrer natürlichen Umgebung zu bestimmen.
Um nun die Sache vollends kompliziert werden zu lassen – so begann ich einen Satz, als sie mir einen Moment zu lange in die Bestimmungsbücher versunken war: Hüten Sie sich davor, Sparrow und Sparrow miteinander zu verwechseln. Denn je nachdem, ob Sie es mit einem Engländer oder einem Amerikaner zu tun haben, meint er entweder die echten Sperlinge oder die Ammern der neuen Welt, welche hier allerdings höchstens einmal als über den Atlantik verdriftete Irrgäste anzutreffen sind. Der Engländer nennt die Ammer, schlicht und einfach zu behalten: Bunting.
Ich fürchtete, meine Bemerkungen könnten die Dolmetscherin an dieser Stelle bereits so weit verwirrt haben, daß sie sich wünschte, sie hätte ihren Auftrag niemals angenommen. Ich wollte die Angelegenheit Schritt für Schritt vereinfachen, indem ich zunächst einige Finken aussortierte, die in unserer Gegend gar nicht anzutreffen sind, von denen also hoffentlich auch keine Rede sein wird, wenn Frau Fischer bei ihrem Termin die Vögel zwischen den Sprachen wandern lassen will. Ich nahm einige Exemplare wieder vom Tisch: Der Bindenkreuzschnabel, der Einödgimpel, der Abend- und der Wacholderkernbeißer, der Rotstirn-, Zedern-, Korsen- und Zitronengirlitz, der Berghänfling und auch der schöne graue Teydefink verschwanden aus unserem Blick, und schon wirkte das Arrangement viel übersichtlicher, wie Katharina Fischer fand.
Ich sehe mich im weißen Hemd da sitzen, der Lichtkegel der Küchenlampe erreicht mich nicht, mein Kindermädchen schirmt mich ab, das Hemd ist ganz zerknittert, und vielleicht könnte man, wenn ich beleuchtet wäre, dunkle Flecken im Stoff erkennen, Lehm, Farbstifte, geronnenes Blut. Maria. Sie kann keine zwanzig gewesen sein.
2
Einen Augenblick lang nur gingen mir in der Nacht im Großen Garten meine Eltern durch den Kopf, dann waren sie merkwürdigerweise aus meinen Gedanken verschwunden, so wie sie später auch verschwunden geblieben sind, man hat sie nie gefunden. Sie müssen umgekommen sein, doch wider alle Vernunft habe ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sie hätten überlebt, hingegen mich unter den Toten geglaubt, und man habe ihnen, die keine Ruhe gaben, sich nicht abschütteln ließen, möglicherweise irgendwann in einer Anwandlung äußerster Roheit sogar die von den Flammen entstellte Leiche eines Jungen vorgeführt, so daß sie, da sie nichts tun konnten und niemand ihnen helfen wollte, nach einigen Wochen weitergezogen sind. Ich weiß, an diese Vorstellung habe ich mich immer dann geklammert, wenn mir der ältere Mann und die Frau vor Augen standen, die auf der Wiese ganz in meiner Nähe gehockt hatten. Das könnten meine Eltern gewesen sein. Und ich habe sie in der Nacht einfach nicht erkannt. Zwei Figuren, vom einen auf den anderen Moment gealtert, mit Verbrennungen im Gesicht: Derartiges hatte ich zuvor noch nie gesehen, wie hätte ich von den Toten auf meine lebendigen Eltern schließen sollen. Denn immerhin hatte, als ich mich das erste Mal wieder im Spiegel erblickte, dieses Gesicht auch keinerlei Ähnlichkeit mit dem, das ich von Photos und in der Erinnerung kannte.
Was haben Sie sich da nur aufgehalst, Sie Arme, entfährt es mir einmal, und kaum sind diese Worte ausgesprochen, möchte ich mir auf die Zunge beißen – was hat die Dolmetscherin sich da für eine Arbeit aufgehalst, mitten im März die hiesige Vogelwelt auswendig zu lernen. Hätte der Gast seine Dresdenreise doch in den Winter oder meinetwegen in den Hochsommer gelegt, nur ein paar Wochen noch hätte er warten können, doch so muß sie sich nun sämtliche Wintergäste und neben den Brutvögeln auch die Sommergäste merken, weil ja die einen noch nicht alle fort, die anderen noch nicht alle wieder hier sind.
»Und dann sind Sie in Dresden hängengeblieben?«
So könnte man es ausdrücken, ich bin hier hängengeblieben, obwohl wir nach dem Abschied von Posen nur auf der Durchreise in Dresden haltgemacht hatten. Mein Vater, der Botaniker war, traf, soweit ich mich erinnere, Kollegen, und meine Mutter zeigte mir die Stadt, in der sie vor meiner Geburt einige Zeit verbracht hatte, vielleicht die glücklichste in ihrem kurzen Leben. Das meinte ich zu spüren, als wir gemeinsam durch die Altstadt spazierten, sofern dieses Gespür einem Elfjährigen zuzutrauen ist. Ich glaube, wir gingen Wege, die sie als Mädchen schon einmal gegangen war, und nie benutzte sie die neuen Namen, sie hielt an Theaterplatz, Augustus-Straße und Jüdenhof und Frauenstraße fest, wenn wir stehenblieben und sie mir etwas erzählen wollte, bei hellem, mildem Wetter, nahezu Scheinfrühling, der uns mitten im Februar umgab. Nachmittags saßen wir lange in einem Café und betrachteten das Geschehen draußen, Wilsdruffer Straße, Scheffelstraße, Webergasse, das gab es alles noch in diesen Stunden, die Stadt war voller Menschen, und ich suchte den Blick des einen oder anderen Flüchtlingsmädchens, eines älteren, hinkenden Mannes, auch wenn ich mich strikt daran hielt, was meine Eltern mir, obwohl für unsere Familie gar nichts zu befürchten war, einmal in einer unbeobachteten Stunde eingetrichtert hatten: Sieh niemals einem SS-Mann direkt ins Gesicht.
Für mich war es – ich weiß, wie merkwürdig das klingt – ein richtiger Ferientag, obwohl es einen kleinen Zwischenfall gab, für den ich mich schämte und, wenn ich ehrlich bin, noch als Erwachsener lange geschämt habe. Wir kamen vom Theaterplatz, es muß am Vormittag gewesen sein, und liefen, am Ständehaus entlang, die Treppe zur Brühlschen Terrasse hinauf, als ich ein Schild entdeckte: JUDEN ZUTRITT VERBOTEN. Und ja, Kinder können Anwandlungen von Grausamkeit schwer unterdrücken, Kinder benehmen sich mitunter wie Wahnsinnige, trotzdem gibt es keine Entschuldigung, ich weiß nicht, was mich packte: Ich blieb stehen und war von einem Triumphgefühl erfaßt, ich schaute, schon auf halber Höhe, die Treppe hinauf, wieder auf dieses Schild, und schritt – ich ging nicht mehr, ich schritt – die folgenden Stufen empor, wir dürfen auf die Brühlsche Terrasse, wir sind keine Juden. Oben drehte ich mich um, sah Hofkirche, Augustusbrücke, Italienisches Dörfchen unter mir, und hier auch wieder meine Mutter, die den Absatz erreicht. Auch sie bleibt stehen. Ich weiß es noch wie heute, ich sehe in ihre plötzlich schmal gewordenen Augen, und ich spüre, wie ihre Hand am Ende des schweren Wintermantelärmels zuckt: Meine Mutter, die mich im Leben nie geschlagen hat, hätte mir beinahe auf offener Straße eine Ohrfeige gegeben.
Also ist mein Kindermädchen tatsächlich nicht mit uns gereist, ein weißes Sonntagshemd mit dunklen Flecken, und der Junge völlig benommen auf der Küchenbank. Vielleicht haben die Eltern sie noch in derselben Nacht entlassen.
Meine Mutter führte mich an diesem Faschingsdienstag sogar zum Tierkundemuseum, das sie wohl oft besucht hatte in ihrer Dresdner Zeit, als es noch Zoologisches Museum hieß, doch als wir vom Postplatz in die Ostra-Allee einbogen, sahen wir bereits, das Haus gab es nicht mehr, es war beim Fliegerangriff im vorangegangenen Oktober ausgebrannt. Davon hatte meine Mutter offenbar nichts gewußt, so wie ich an diesem Tag nicht wissen konnte, daß ich vor der Ruine einer Einrichtung stand, in der ich viele Jahre später selber einmal arbeiten sollte.
Zum Mittagessen war mein Vater noch bei uns. Wir saßen irgendwo im ersten Stock am Fenster und sahen hinunter auf einen großen Platz, also sind wir vermutlich am Altmarkt eingekehrt, die Sonne schien herein, blendete fast, und wir, zu dritt, an einem Fenstertisch für uns allein. Ein ganz besonderes, fahles Licht, auf meinem Teller dampfte der Kartoffelbrei, als ob die Sonnenstrahlen ihn erwärmten. Daneben Erbsen und ein vermutlich mit viel Paniermehl gestrecktes Deutsches Beefsteak, das ich angebissen liegenließ. Beefsteak: dieses Wort hatte ich eben erst gelernt, bei uns zu Hause sagte man Frikadelle, ein neues, fremdartiges Wort, das mir, als ich es auf der Speisekarte entdeckte, zugleich verheißungsvoll und abstoßend vorkam, und als ich mich bei der Bestellung entschied, das Wagnis einzugehen, geschah dies weniger, weil ich Appetit auf eine Frikadelle gehabt hätte, als daß ich sehen, schmecken wollte, ob die Erklärung meines Vater stimmte oder ob sich, entgegen dem verwandten Aussehen und dem ähnlichen Geschmack, dahinter nicht doch etwas ganz anderes verbarg. Nein, es war nicht dasselbe, auch wenn die Eltern fast ein wenig verzweifelt darauf bestanden, es handele sich nur um ein anderes Wort.
Bis das Essen serviert wurde, ließ meine Mutter ihre herrliche dunkle Otterkappe auf dem weißen Tischtuch liegen. Wie immer erschien meine Mutter mir sehr elegant, sie zog die Blicke auf sich, an diesem Tag aber, in diesem Restaurant kamen auch böse Blicke von den Nachbartischen, mein Vater merkte es.
»Nun leg doch bitte deine Otterkappe mal beiseite.«
Sie aber tat, als hätte sie davon nichts gesehen, nichts gehört, und zupfte an seiner immer schief gebundenen Krawatte herum, machte den Knoten schön, betrachtete den Kragen, sah meinem Vater ins Gesicht: Er wand sich und verzog den Mund, sie aber wußte, daß es ihm gefällt, genauso wie es ihm gefiel, daß sie ihren Schmuck angelegt hatte, die Perlenohrringe, das Armband und die kleine Kette, wir waren ja nicht auf der Flucht, wir waren auf Ausgang in der Großstadt, und diese Frau ihm gegenüber war seine Frau, egal, was andere Restaurantgäste von ihrem Aufzug halten mochten. Sie, in einem schlichten Kleid, mit ihrem fein frisierten halblangen Haar, und er, in seiner Kleidung unentschieden zwischen Großstadtbesuch und Wandertag, mit seinen groben Fäustlingen, die mir ein wenig peinlich waren, wenn ich anderen Herren zusah, wie sie ihre hirschledernen Fingerhandschuhe sauber auf die Tischkante legten. Meine Mutter fuhr meinem Vater durch seinen immer ungekämmten Schopf, das waren ihre Spiele in meiner Gegenwart. Ich schaute hinunter auf den Platz, ich schaute in die Sonne, das Essen kam, ich legte die Otterkappe auf die Fensterbank.
Mein Vater aß seine Kohlroulade, die hier Krautwickel hieß, mit großem Appetit. Ich weiß nicht, was er am Vormittag erledigt hatte, sein Treffen mit Botanikerkollegen jedenfalls stand erst am Nachmittag an, ich achtete erst wieder auf das Gespräch der Eltern, als meine Mutter mit einem Mal die Stimme senkte. Jetzt, dachte ich, erzählt sie, was an der Brühlschen Terrasse passiert ist, aber jenen Vorfall hat sie mit keinem Wort erwähnt, sie sprach vom Tierkundemuseum.
»Ich habe ihm leider nichts zeigen können, keinen Riesenalken und keine Käferwelt. Das Museum ist geschlossen. Nein, kein Schließtag. Das Museum steht nicht mehr.«
Mein Vater schüttelte den Kopf, der Luftangriff im letzten Herbst, äußerst bedauerlich, aber meine Mutter ließ es dabei nicht bewenden.
»Da sieht man, zu was sie fähig sind, so hat es mit dem ausgefallenen Museumsbesuch auch etwas Gutes.«
Kein Wort darüber, wer mit dem »sie« gemeint war, ob meine Mutter nun den Alliierten Schuld an der Zerstörung gab oder nicht doch jenen, die sich einer vorsorglichen Evakuierung der Ausstellungsstücke verweigert hatten, weil sie glauben wollten, einer Stadt wie Dresden drohe keinerlei Gefahr.
Meine Mutter wandte sich an mich, schien fast ein wenig Genugtuung zu empfinden: »Siehst du, die Menschen sind zu allem fähig, an diesen Tag wirst du dich später erinnern, dein Leben lang.«
Sie sollte recht behalten. In den auf Stalins Tod folgenden Jahren sind mir ihre Worte wieder in den Sinn gekommen, ich hatte die Zwanzig längst überschritten und erfuhr, die Sammlung sei damals keineswegs vollständig vernichtet worden, die wertvollsten Stücke lagerten nach wie vor in einem Geheimarchiv. Ich mußte an meine Eltern denken, ich ertappte mich bei dem Gedanken: »Deine Eltern waren ahnungslos«, während es mir vorkam, als sei ich nun alt genug, als seien wir alle endlich alt genug, um wenigstens die halbe Wahrheit zu erfahren, und sei es auch nur hinter vorgehaltener Hand. Der Riesenalk: Der letzte britische Vertreter dieser Vogelart wurde um 1840 erbeutet, das allerletzte isländische Brutpaar am dritten Juni 1844 – wie ein Schüler konnte ich die Daten hersagen, als ich schon auf die Fünfzig zuging und das erste Mal unseren Dresdner Riesenalk zu Gesicht bekam. Ich hatte das Lebensalter meines Vaters, meiner Mutter weit überschritten, aber ich hörte ihre Worte noch, und bis heute ist der Riesenalk untrennbar mit der Erinnerung an unser letztes gemeinsames Familienmittagessen verbunden.
»Willst du die Frikadelle wirklich nicht mehr haben?«
Ich schüttelte den Kopf, ich hatte mit Kartoffelbrei und Erbsen längst genug, und so stürzte mein Vater sich, er hatte meinen Teller die ganze Zeit fixiert, auf das Deutsche Beefsteak. Beim Zahlen dann begannen meine Eltern zu tuscheln, wir zogen uns schon an, da hatten sie die Frage noch immer nicht gelöst: Er, der in der Öffentlichkeit angebissene Frikadellen von fremden Tellern aß, und sie, die ihre Otterkappe vor aller Augen auf dem feinen Tischtuch liegenließ, ohne sich um die Meinung der anderen zu scheren – diese beiden Erwachsenen, die meine Eltern waren, Leute von Welt nach meiner Auffassung, die mich durch eine Weltstadt führten, waren sich unsicher, wieviel Trinkgeld sie geben sollten, ob es sich überhaupt schicke, in diesem guten Restaurant, in Dresden. Nie vorher hatte ich meine Eltern wie in diesem Moment erlebt, schüchtern geradezu, und erst, als wir wieder unten auf dem Altmarkt standen, gewannen sie ihre Selbstsicherheit zurück.
Mein Vater, der den Botanischen Garten am nördlichen Rand des Großen Gartens mit seinen Beeten und Pflanzungen und säuberlich geschwungenen kleinen Pfaden am frühen Nachmittag des dreizehnten Februar in bestem Zustand gesehen haben wird. Mein Vater, der allem Anschein nach Kollegen dort besuchen wollte, der erwartet wurde. Mein Vater inmitten einer Gruppe von Botanikern, alle leben, alle sind soweit gesund, womöglich zeigt sich auf den Gesichtern bereits Zuversicht, während leise über den kommenden Sommer gesprochen wird. Am Abend dieses Tages würde sich mein Vater, nun mit seiner Familie, ein zweites Mal im Großen Garten einfinden, im weitläufigen Park, alsbald mit Kratern übersät, mit entwurzelten Sträuchern, mit geborstenen Bäumen und mit Toten, zu denen auch er selbst gehören sollte.
Mein Vater, der Botaniker, den es an seinem unvorhersehbaren Lebensende noch einmal in die Botanik zog. Sei es, daß er uns in den Großen Garten führte, weil ihm der Weg vom Vormittag bekannt war, sei es, daß er den Schutz der Bäume und Wiesen und Blumen suchte, die auf ihn immer eine beruhigende Wirkung ausgeübt hatten, sei es, daß er der Menschenmenge auf ihrer Flucht aus dem Feuer der inneren Stadt folgte, in der Hoffnung, seine Familie dem sicheren Tod auf wunderbare Weise zu entreißen.
Bis heute bin ich, der Sohn, der überlebt hat, denn auch kein einziges Mal hinauf zum Heidefriedhof gefahren, um dort an einem der Massengräber das Bild meiner Eltern heraufzubeschwören. Statt dessen gehe ich in den Großen Garten, überquere die Wiese am Westrand und stelle mich vor eine Stieleiche, die von den Dresdnern einen eigenen Namen erhalten hat: die Splittereiche. Es muß um die dreihundert Jahre her sein, daß jemand sie an dieser Stelle gesetzt hat, als Grenzbaum, heißt es, von einer Parkanlage war damals noch keine Rede. Nähert man sich vom Zoo her, merkt man nichts weiter: ein hoher, knorriger Baum mit schön gefurchter Rinde. Doch geht man um den Stamm herum, scheint die Baumhaut unvermittelt aufzuplatzen, zeigt sich, umrahmt von dicken, schlecht verwachsenen Wülsten, das blanke, offene, helle Holz. Man blickt nach oben, schiefe Äste, als wären sie gegen einen quälenden, massiven Luftwiderstand angewachsen, die Bruchstellen, und unterhalb der dicht belaubten Krone ein aufgerissener Bereich, Gesplittertes, Herausgebrochenes, die Schrunden. Erst mit der Zeit erkennt man, daß die über den gesamten Stamm verteilten Ritzungen ein gleichmäßiges Muster bilden: Hier stecken die Bombensplitter in der Rinde, sie stecken immer noch. Auf der Seite hat das Holz eine ungewöhnliche, leuchtend braune Färbung angenommen. Auf dem Boden liegt Totholz, man kann es mit der Fußspitze zerbröseln, morsch: Seit vielen Jahren breitet sich ein Pilz im Inneren des angegriffenen Baumes aus, eine Spätfolge der Bombardierung. Jene Nacht hat sie überstanden, irgendwann aber wird der Schwefelsporling sie zugrunde richten. An der Splittereiche habe ich die Erinnerung, habe ich meine Eltern vor mir.
3
Für jemanden, der einen Botaniker zum Vater hat, liege es wohl nicht allzu fern, sich der Vogelkunde zuzuwenden, hat die Dolmetscherin hinzugefügt, als sie wissen wollte, wie ich zur Ornithologie gekommen sei. Gewiß hat mich von früh an eine bestimmte Vorstellung von der Natur begleitet, es kann ja gar nicht ausbleiben, daß sich die selbstverständliche Aufmerksamkeit der Eltern für die Welt der Lebewesen auch auf das Kind auswirkt. Aber ich wollte nicht behaupten, mit einem solchen Elternhaus hätte ich irgendwann nahezu zwangsläufig bei der Biologie landen müssen, geschweige denn alles daran gesetzt, Zoologe, gar Vogelkundler zu werden. In meiner Kindheit gab es eine Phase, in der ich diese Tiere überhaupt nicht mochte. Lange Zeit war mir die Katze, die den Vogel bringt, lieber als ihr Geschenk, das sie mir aufgeregt und stolz vor die Füße legte, um sich meiner Freundschaft zu versichern.
Vater und Mutter vermuteten, meine Aversion gehe auf ein Erlebnis zurück, an das ich mich kaum erinnern konnte, während meine Eltern oft davon erzählten. Demnach muß sich einmal ein junger Vogel in unseren Salon verflogen haben, als ich allein im Haus war, und die Panik des Jungtiers, dem es aus unerfindlichen Gründen nicht gelang, so, wie es auch hereingekommen war, durch die offenen Türflügel wieder in den Garten zurückzufliegen, hat sich auf mich übertragen. Ich wollte vor diesem unruhig flatternden und dabei fürchterliche Laute ausstoßenden Etwas fliehen, drückte mich aber genau wie der zerzauste Vogel nur in eine Ecke, anstatt selbst in den Garten hinauszulaufen oder auch nur die Tür zur Diele öffnen zu können, wo ich in Sicherheit gewesen wäre. Ich muß einen ungeheuer verwirrten Eindruck gemacht haben, als ich am Ende zwischen Anrichte und Ofen gefunden wurde, ich erinnere mich nicht mehr, aber meine Eltern haben es mir so geschildert.
Ich habe bloß noch dieses unberechenbare Wesen vor Augen, wie es sich in den dunklen Vorhängen verfängt, ich starre auf den dunklen Streifen am Rand des gleißenden Rechtecks, der sich in der lauen Mittagsluft träge zu wiegen scheint, dabei ist nur das Gewebe zu schwer, als daß die heftigen Bewegungen des Vogels den Stoff ebenso heftig erzittern ließen. Er krallt sich fest, er klettert weiter hoch, und im nächsten Moment ist er in einer Falte verschwunden, aber ich weiß, er hängt noch da, der Saum des Vorhangs streicht lautlos über das Parkett. Ist er tatsächlich aus eigener Kraft in den Salon gekommen, oder hat die Katze ihn gebracht? In der Erinnerung nimmt der Vogel nach und nach die Form eines Mauerseglers an – auch wenn der Ornithologe in mir sagt, ein Mauersegler wird niemals durch eine offene Tür ins Haus fliegen, wird sich, bei seiner Fluggeschwindigkeit, den Kopf an einer Wand einschlagen und kann, falls er tatsächlich überleben sollte, sich keinesfalls wieder vom Boden lösen, um in den Vorhängen zu verschwinden.
Im nächsten Moment sitze ich völlig benommen auf der Küchenbank und höre kaum, wie die Mutter mit meinem Kindermädchen schimpft, das sich am Nachmittag mit einem Verehrer in den Feldern vergnügt hat, während es mich allein im Haus zurückließ, und mir nun die nackten Beine mit einem nassen Lappen wischt. Dabei ist alles meine Schuld. Ich habe gebettelt, sie solle mich nach dem Essen im Salon spielen lassen und allein spazierengehen, ich werde den Eltern nachher sicher nichts verraten, ich habe auch an früheren Sonntagen den Mund gehalten. Später bin ich störrisch geworden, habe mit den Armen um mich geschlagen, immer aber darauf bedacht, meinem Kindermädchen mit den Fäusten nicht zu nahe zu kommen, vielleicht habe ich sogar geschrien. Nein, ehe mir eingefallen wäre, jähzornig zu heulen, gab sie jedesmal nach, erleichtert einerseits, andererseits voller Sorge, wenn sie schließlich allein spazierenging, wobei wir beide, ohne es je auszusprechen, wußten, was dieses Wort am Sonntagnachmittag bedeutete: allein.
Ich hatte meine Ruhe, im kühlen Zimmer mit halb zugezogenen Vorhängen ging ich meinen einsamen Spielen nach, während sie gezwungen war, sich in Gedanken mit mir zu beschäftigen, ob mir auch nichts zustieße, ob ich allein auch keinen Unfug anstellte, sie wußte nicht, was ich in ihrer Abwesenheit machte, wohingegen ich zumindest eine Ahnung hatte, was ihr Verehrer irgendwo da draußen auf einer fernen Wiese mit ihr tat. Und so kam, ist mir später klar geworden, als ich selbst erwachsen war, zur Sorge beim Zusammensein mit ihrem Liebhaber stets die andere, um das vernachlässigte Kind, hinzu.
Ich habe Gänsehaut, der Lappen, eben noch angenehm warm vom Wasser und der warmen Hand, die ihn über meine Beine gleiten läßt, wird in der ungeheizten Küche, in der kühlen Abendluft vom einen auf den nächsten Augenblick kalt. Als mein Kindermädchen von seinem Ausflug zurückkam, habe ich nichts gesagt, keine der Fragen beantwortet, warum ich mich im Dämmerlicht zwischen Ofen und Anrichte verkrieche, warum ich meine Arme so verkrampft vor meiner Brust verschränke, warum ich nicht wie sonst, wie ein normaler Junge, einen Schritt vor den anderen setze. Sie hat den dunklen Fleck auf meiner Hose nicht bemerkt, sie hat den Mauersegler nicht bemerkt, der immer noch auf dem Teppich lag, mit wild schlagendem Herzen, wie gelähmt, als ich ihn zuletzt sah. Vor meinem Kindermädchen habe ich alles verbergen können, nicht jedoch vor den Eltern, die rechtzeitig zum Abendessen von einem Besuch zurückgekehrt sind, und jetzt sitze ich bloß mit meinem Sonntagshemd bekleidet auf der Küchenbank, ich habe mir, mit wild schlagendem Herzen, in die Hosen gemacht, ich habe vor lauter Angst das Wasser nicht halten können.
Zwar höre ich den Lärm, verstehe aber keinen Ton, so laut dröhnt mir das Blut in den Ohren. Mein Kindermädchen läßt die Vorwürfe, die ungewöhnlich groben Worte meiner Mutter still über sich ergehen, sie hält, während sie vor mir hockt, ihre Lider gesenkt, sieht mich nicht an, so wie auch ich jetzt um nichts in der Welt ihrem Blick begegnen wollte, ohne daß ich es aber wagte, die Augen zu schließen und mich aus diesem Raum fort zu wünschen, aus der gefliesten Küche mit ihrem grauenerregenden Widerhall in mein stilles Zimmer. Der Mund ist trocken, nicht einmal schlucken kann ich, geschweige denn meine Schuld eingestehen, rufen: »Ich bin an allem schuld, laß sie bitte in Ruhe, sie hat nichts getan.« Vielleicht habe ich nie wieder eine solch große Ungerechtigkeit und Pein erfahren, der junge Mauersegler, die nasse Hose, und mein Kindermädchen, das ich mochte.
Eine blasse Erinnerung habe ich, wie meine Mutter, als ich längst im Bett liege und schlafen soll, vor meinem Vater die immergleichen Formulierungen wiederholt, Satzfetzen, die aus dem Schlafzimmer zu mir herüberdrangen, ohne daß ich ihren Zusammenhang begriffen hätte, etwas wie: »Das arme Ding«, und: »Mit bloßen Händen«, und: »Unser eigener Sohn«, später dann nur noch, wenn ich durch die angelehnte Tür richtig verstanden habe, immer wieder, nun flüsternd fast, sei es, daß sie keine Kraft mehr hatte, sei es, daß sie dermaßen angewidert war: »Die Augen.«
Was mit dem Mauersegler seinerzeit weiter geschah, kann ich heute nicht mehr sagen. Möglich, er hat nicht überlebt, ging ein, nachdem mein Vater ihn sanft aus seiner Hölle befreit und in den Garten gelenkt hatte, ohne ihn aber mit bloßen Händen zu berühren. Oder er war, am Ende seiner Kräfte, schon zum Abend hin auf dem gemusterten, weichen Teppich gestorben. Genauso ist es möglich, wenn auch unwahrscheinlich, daß er trotz der Ereignisse ein langes Leben vor sich hatte, ein Leben in der Luft, die ihn jedes Jahr nur für wenige Wochen in unsere Breiten trieb, in die Nähe dunkler Vorhänge, kühler Salons und grausamer Kinder, die er, als hätte er an jenem Sonntagnachmittag seine Lektion gelernt, fortan nur noch aus großer Höhe, aus sicherer Distanz zur Kenntnis nahm.
Auch ich habe meine Lektion gelernt, ohne daß mir dies sofort aufgegangen wäre. Es brauchte bis zum nächsten Morgen, als ich aus unruhigem Schlaf und der Benommenheit zurückkehrte, auf demselben Weg, den ich am Tag zuvor gelaufen war: von meinem Zimmer auf die Galerie, dann die breite Treppe hinunter, in die Küche, wo ich Milch bekam, und endlich in den Salon, an den Ort, wie mir erst jetzt wieder zu Bewußtsein kam, meiner gestrigen Niederlage. Alle Spuren des Kampfes, sofern es welche gegeben haben sollte, waren getilgt, nirgendwo ein Fleck auf dem Boden, der Vorhang fiel wieder so akkurat, als hätte nie ein Mauersegler sich darin verfangen. Man kann in der Entdeckung, die ich an diesem Morgen machte, die ich, um es genauer zu sagen, zwar längst gemacht hatte, doch erst begriff, als ich den Blick über das nunmehr leere Schlachtfeld schweifen ließ, vielleicht schon einen Hinweis darauf erkennen, daß ich mich später einmal der Ornithologie zuwenden würde: Ich hatte die Beine des Mauerseglers gesehen.
Schließlich ist bis heute die Vorstellung weit verbreitet, dieser Vogel besitze weder Beine noch Krallen, er, der den größten Teil seines Lebens in der Luft verbringt, verfüge über nichts dergleichen. Ein Tier, das man kaum jemals aus der Nähe zu Gesicht bekommt, das den Beobachter auf der Erde mit seinem geschickten Flügelschlag und schnellem Flug beeindruckt, niedrig genug mitunter, daß man sich unwillkürlich duckt, um kurz darauf weit oben am Himmel zu verharren, ein kaum wahrnehmbarer Punkt, der nach und nach ins All zu entgleiten scheint. Nie sieht man einen Mauersegler auf einem Ast hocken, nie bewegt er sich auf dem Boden. Kein Wunder, daß angesichts eines solchen Wesens die Unkenntnis in Aberglauben übergeht. Der Mauersegler, davon waren die Menschen früher überzeugt, sei ein Vogel, der direkt vom Mond kommt.
Sosehr mir nun der junge Mauersegler zuwider war, verband mich doch auch etwas mit ihm, mit meinem Feind und Schreckensgenossen an einem langen Sonntagnachmittag im Salon: Ich hatte ihm das Wissen um etwas abgetrotzt, das er vor dem Menschen zu verbergen sucht. Denn wenn es dem Vogel möglich gewesen war, sich im Stoff des Vorhangs festzukrallen, so mußte er folglich auch die dazu nötigen Krallen haben. Und als er rücklings auf dem Teppich lag, mit ausgestreckten, hilflos zuckenden Flügeln, dem Tode nah, sah ich sie mit eigenen Augen, sah sie aus nächster Nähe: die kurzen, zwar ein wenig verkrüppelt wirkenden, aber doch existierenden Beine des Mauerseglers. Beine, wie sie jeder Vogel hat. Und damit war er alles andere als ein geheimnisvolles, mit wunderbaren Kräften versehenes Fabelwesen.
Ich rannte aus dem Salon hinüber in die Küche, wo für mich das Frühstück bereitet war, und rief, rief immer wieder: »Der Mauersegler hat Beine«, ich wollte, außer Atem, alles ganz genau erklären, doch mein Kindermädchen, das mir den Teller mit dem aufgeschnittenen Brötchen hinschob, als ich mich endlich auf der Küchenbank an meinen Platz gesetzt hatte, schüttelte nur traurig den Kopf.
Es war etwas entzweigebrochen. Dieses dumpfe Gefühl habe ich noch heute, auch wenn mir nie ganz klar geworden ist, was geschehen war. Der Blick meines Kindermädchens, der sachte von einer Seite zur anderen gedrehte Kopf, das helle, offene Haar im Gegenlicht, wie es um Kinn und Wangen streicht. Hatte Maria mir soeben das letzte Mal mein Frühstück vorgesetzt? Sie saß mir gegenüber, als wisse sie um etwas, das mein schlichtes Mauerseglerwissen bei weitem überstieg, eine furchtbare Erkenntnis, die schon ein Erwachsener kaum erträgt. Wie dann ein Kind.
Ob ich Maria angehimmelt habe? Als kleiner Junge, ja, bestimmt. Und ihr Kopfschütteln, kam mir erst Jahre danach in den Sinn, hatte womöglich weniger mit einer möglichen Kündigung als mit ihrem Liebhaber zu tun. Seinerzeit aber wirkte es auf mich, muß so auf mich gewirkt haben, als sei das geheime Wissen meines Kindermädchens mit dem Mauersegler vom Vortag verknüpft.
Zum einen, dachte ich, müsse ich den Mauersegler, dieses Wesen nur mit aller mir zur Verfügung stehenden Macht ergründen, dann käme ich, der ich die Schuld an ihrer Verzweiflung trug, dahinter, warum mein Kindermädchen an diesem Morgen so niedergeschlagen war, zum anderen aber wehrte ich die Vorstellung ab, jemals in meinem Leben einen verirrten Jungvogel wieder von nahem zu betrachten, denn ohne den Mauersegler wäre es nicht zu jener bedrückenden Frühstücksszene gekommen, hätte ich meinem Kindermädchen nicht hilflos gegenübersitzen müssen, unsicher, hin und her gerissen, betrübt und zugleich auch ein wenig enttäuscht, weil die zugegeben kümmerlichen Mauerseglerbeine sie so gar nicht interessierten.
Ich kaute stumm. Mein Kindermädchen schwieg. Als hätte ich zum Aussterben des Mauerseglers beigetragen. Als hätte ich am Tag zuvor den entscheidenden, unwiderruflichen Schritt getan, um diese Vogelart endgültig von der Erde verschwinden zu lassen. Als hätte ich das letzte lebende Exemplar auf dem Gewissen.
4
Merkwürdig, daß Sie gerade diese Frage stellen, meine ich zu Frau Fischer, denn auch ich habe mich später immer wieder gefragt, ob es denn keine gleichaltrigen Spielkameraden gab, mit denen ich nach der Schule in die Felder ziehen und die langen Sonntagnachmittage hätte verbringen können. Die frühe Schulzeit, Kinderfreunde? Davon ist mir nichts geblieben.
Am Waldrand drüben ein Sprung Rehe, deren Umrisse sich auf dem Feld nach Sonnenuntergang nur nach und nach vor dem dunklen Hintergrund abzeichnen: Manchmal nahm mich mein Vater auf seine Exkursionen mit. Im Sommer, wenn es abends viel zu lange hell war, als daß ich hätte schlafen können, kam er in mein Zimmer, schaute, ob ich wach war, und erlaubte mir, noch einmal aufzustehen und mich anzuziehen. Ein guter Schläfer war ich nie.
Vermutlich, weil mir diese Spaziergänge bei Nachteinbruch wie eine außerordentliche Belohnung vorkamen, auch wenn ich nie begriff wofür, weil sie mir stets aus heiterem Himmel, wohl aus einer Laune meines Vaters heraus zuteil wurde, war ich auf unseren Exkursionen besonders folgsam und gelehrig. Von meinem Vater lernte ich, wie man sich lautlos durch das Unterholz bewegt und wie man, statt in einem fort zu reden, auch auf entfernteste Geräusche horcht. Wollte er einfach nicht allein gehen? War es ein Trick von ihm, gehörte es zu seiner Vorstellung von Erziehung? Wenn wir am späteren Abend loszogen, gab es natürlich nicht mehr allzuviel zu sehen, so lernte ich, mich auf die schwachen Eindrücke zu konzentrieren, den nebensächlich wirkenden Phänomenen meine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Wir sprachen nicht. Er ging voraus. Mit der Hand wies er auf eine Suhle oder den frischen Verbiß an einer Birke. Wir schlichen bis an den Waldrand und warteten. Irgendwann tauchten, wie er es mir zu Hause beim hastigen Anziehen vorausgesagt hatte, hinten tatsächlich Rehe auf. Die Tiere, lernte ich bei solchen Ausflügen, sprechen fast unablässig miteinander, sie sprechen häufig auch mit uns, wir aber nehmen ihre Äußerungen nur selten wahr, begreifen nicht, daß wir gemeint sind. Die Tiere wenden sich uns zu, von ferne, über unseren Köpfen im Laub verborgen, aus dem Dickicht am Wegrand heraus, sie stellen Fragen, oder sie beschimpfen uns, sie geben zu erkennen: »Ich habe dich bemerkt.« Um aber als Mensch überhaupt in die Gegenwart bestimmter Tiere zu geraten, sie auch zu entdecken, muß man still sein können. Um sie, die Sprechenden, zu Gesicht zu bekommen, darf man vor allem eines nicht: mit ihnen sprechen.
Jetzt kommt mir doch ein Schatten wieder in den Sinn, wenn auch nicht das dazugehörige Gesicht: Ich hatte einen gleichaltrigen Freund in Posen, es gab da einen Nachbarsjungen, den ich manchmal auf der Straße traf. Besonders eng befreundet waren wir wohl nicht. Kann sein, Neugier und Abstoßung hielten sich bei mir die Waage, ein wenig Mitleid spielte auch hinein, wenn ich mich mit diesem Jungen abgab. War er geistig zurückgeblieben? Recht tolpatschig kam er mir vor, viel war mit ihm nicht anzufangen. Er redete kaum, doch wenn er sprach, dann nicht sehr deutlich, dafür überlaut. Gedehnte Laute, die er mit Anstrengung hervorpreßte, aus denen er vollständige Wörter zu formen suchte. In seiner Gegenwart hatte ich ein bißchen Angst. Aber zu Hause machte ich ihn nach.
Er wußte von den Streifzügen nach Sonnenuntergang. Er wollte mit. Er hat bei seinen Eltern gebettelt, bis sie ihn endlich ließen. Ich weiß noch, mein Vater wurde zu den Nachbarn bestellt, mit denen wir kaum etwas zu tun hatten: Ja, abends nehme er mich gelegentlich mit in die Felder. Und ja, der Nachbarsjunge dürfe einmal mit. Wer weiß, vielleicht hatten seine Eltern gemeint, er lüge sich etwas zusammen, oder sie wollten meinem Vater erst dann Glauben schenken, sobald ihr eigener Sohn von einem dieser Ausflüge Bericht erstatten würde.
Am verabredeten Abend kam der Junge zu uns herüber, doch ins Haus wollte er nicht, er blieb verlegen an der Tür stehen. Und aufgeregt war er, wie ich ihn nie gesehen hatte. Dieses arme Geschöpf, das sonst kaum je ein Wort herausbrachte, konnte den Mund nicht halten. Ein ärgerlicher Abend, da war mein Vater sich hinterher mit mir einig. Wir hatten nicht ein einziges Tier beobachtet. Beim Nahen des plappernden Nachbarsjungen müssen sie sich alle still zurückgezogen haben.
Sonst aber: Nichts. Als habe jene erste Nacht in Dresden eine ganze Reihe älterer Bilder gelöscht, als habe mir der Ansturm jener hart zwischen Hell und Dunkel wechselnden Eindrücke frühere, in der Beleuchtung feiner abgestimmte Erinnerungen einfach aus dem Kopf getrieben.
»Ihre Großeltern vielleicht?«
Ich schüttele den Kopf.
»Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins?«
Auch nicht. Vermutlich lag meinen Eltern nicht viel an engerem Kontakt mit den Verwandten. Wer weiß, ob sie nicht sogar froh waren, ihrem Familienhintergrund zu entkommen, als es nach Posen ging.
»Erinnern Sie sich denn an Freunde Ihrer Eltern, an Bekannte?«
Nur an diejenigen, denen ich später als Erwachsener wiederbegegnet bin. Es hätte etwas Unwirkliches haben können – die Befürchtung, man werde an einem Menschen nichts wiedererkennen, sosehr man sich auch anstrengen mag, mit einem Abstand von zehn, fünfzehn Jahren. Ich erlebte einen Augenblick der Orientierungs-, der Hilflosigkeit, doch ehe ich das Gleichgewicht hätte verlieren können, kehrten mit den neuen Gesichtern auch die Jugendzüge, Stimmen und Bewegungen dieser Menschen in mein Bewußtsein zurück, die mir als Kind vertraut gewesen waren.
»In einem früheren Leben«, wie die Dolmetscherin meint.
In einem früheren Leben, das könnte man vielleicht so sagen. Aber indem ich, der Erwachsene, mich von diesen Figuren umgeben wußte, blieb für mich etwas von jenem Leben erhalten.
5
Zwei Uniformierte sind im Haus. Ich klammere mich an die Handgelenke, die Unterarme meines Kindermädchens, wenn auch nur mit den Augen, weil ich sie jetzt nicht anfassen darf, weil sie mit einer Hand die Fleischplatte balanciert, während sie in der anderen Gabel und Löffel hält, um nacheinander je zwei Scheiben Braten auf die fünf großen, elfenbeinfarbenen Teller aus dem Sonntagsservice zu verteilen, die Teller mit dem umlaufenden lindgrünen Band, ein Halm, der nirgendwo beginnt, nirgendwo endet, und trotzdem suche ich den Anfang jedesmal. Dann gibt Maria, ohne die Gabel aus der Hand zu legen, jedem noch ein wenig Saft dazu, ohne zu kleckern, ruhig, doch zügig, immer von links sich über die Schulter beugend. Mit den Gästen hat sie begonnen, danach den Eltern Fleisch serviert, der dampfende Rinderbraten hängt einen Moment lang neben dem Gesicht, dem Ohr, fast vor den Augen in der Luft, doch niemand bemerkt das, keiner läßt sich davon stören, alle am festlich eingedeckten Tisch unterhalten sich weiter, außer mir, zu dem mein Kindermädchen als letztes kommt. Ich hoffe, sie hat, wie sonst immer, eine besonders schöne Scheibe Braten für mich reserviert, ganz ohne Sehnen, auf denen ich vergeblich herumkaue, die ich nicht schlucken, vor Gästen aber auch nicht auf meinen Tellerrand legen kann, so daß sie, bis die Tafel aufgehoben wird und ich zur Toilette darf, in der Backentasche bleiben. Dann hebt Maria schon den Deckel von der Kartoffelschüssel, und in die aufstiebende Wolke hinein spricht mein Vater: »Bitte, bedienen Sie sich, meine Herren.«
Zwei Uniformierte sind im Haus, und ich darf sie mit »Du« anreden. Vorhin, als sie eingetroffen sind, hörte ich von oben zuerst, wie sie meine Eltern an der Tür begrüßten, ich saß in meinem Zimmer auf dem Teppich, wollte noch zu Ende spielen, hell, freundlich drangen Stimmen zu mir herauf, und dann rief meine Mutter schon nach mir, ich solle kommen, um Herrn Spengler und Herrn Sieverding »Guten Tag« zu sagen. Als ich die beiden in der Halle sah, es wurde über unser Haus gesprochen, meine Mutter strich mir über den Kopf, ich reichte dem Besuch die Hand, fielen mir zuerst ihre Stiefel auf, das Klacken auf dem Steinboden, wie es bei uns noch nie zu hören war. Ich weiß noch immer nicht, was ich davon halten soll, zwei uniformierte Männer, deren Stimmen gar nicht zu den Stiefeln passen, bis unter die Knie reichen sie, so ordentlich gewichst, daß man sich fast in ihnen spiegeln kann. Ich starrte diese Stiefel an, auch die Erwachsenen lenkten ihren Blick jetzt auf die schwarzglänzenden weichen Schäfte, und der eine Mann begann zu lachen: »Das ist nicht mein Verdienst, das habe nicht ich vollbracht, da mußt du Martin hier gratulieren, der hat die Gabe, sich einen ganzen Nachmittag ins Stiefelputzen zu vertiefen.«
»Na lauf«, mein Vater wußte nicht, was sagen, »und geh dir deine Hände waschen.«
Martin Spengler, das ist der Jüngere von beiden, er wird kaum älter als mein Kindermädchen sein, der andere heißt Knut Sieverding, ich drehte die Seife unter dem Wasserhahn, dieser Name ist schwieriger zu behalten,